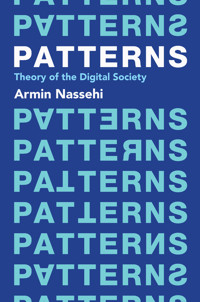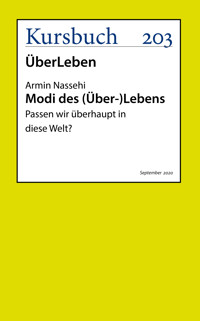Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: kursbuch.edition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keine neue Nacherzählung, sondern eine Frage, nämlich die, ob es "1968" gegeben hat, ist Gegenstand dieses Essays. Natürlich hat es das Jahr 1968 gegeben. So wie auch die damit verknüpfte Studentenbewegung stattgefunden hat. Aber war "1968" wirklich der Umschlagpunkt, der eine verkrustete, unbewegliche Welt in eine offene Zukunft geführt hat? Jedenfalls ist der Mythos "1968" ein Erzählanlass, dem auf den Grund gegangen werden muss. Denn was für individuelle Biografien gilt – dass sie sich eingängiger erzählen lassen anhand eines kritischen, alles ändernden Ereignisses –, gilt auch für die Nacherzählung von gesellschaftlichen Entwicklungen: Wenn es einen Kairos gibt, den entscheidenden Moment, durch den das chronologische Nacheinander beeinflussbar ist, lässt sich – im Nachhinein – alles erklären. Da aber auch solche vermeintlichen Plötzlichkeiten nicht einfach vom Himmel fallen, sind auch sie erklärungsbedürftig. Zu klären ist, welche gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen und Veränderungen "1968" möglich gemacht haben. Ob "1968" Ursache oder Effekt von Veränderungen war. Und was davon geblieben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armin Nassehi
GAB ES 1968?
Eine Spurensuche
kursbuch.edition
Inhalt
Vorwort
Einstieg
Warum 1968?
Eine linke Bewegung?
Dauerreflexion
Dauermoralisierung
Exkurs: Entdeckung und Unterschätzung der »Gesellschaft«
Dauerberieselung
Dauerpose – nach 68
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Dieses Buch ist der Versuch eines Soziologen, sich einen soziologischen Reim auf »1968« zu machen – keinen politischen, auch keinen historisch akribischen, sondern einen, der die Frage stellt und beantwortet: Was können wir mit dem Blick durch die Brille der Erinnerung auf das, was mit dem schönen Erinnerungsmarker »1968« belegt wird, über die heutige Gesellschaft erfahren?
Zu danken habe ich nicht zum ersten Mal dem außerordentlich produktiven Arbeitsumfeld meines Münchner Lehrstuhls, dessen Kolleginnen und Kollegen genau das intellektuelle Umfeld bilden, das gegenseitige Inspiration ermöglicht. Viele der hier vorgetragenen Thesen verdanke ich der seit vielen Jahren währenden Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Irmhild Saake. Eine der Erbschaften von »1968« nenne ich in diesem Buch »Dauerreflexion«. Wenn die These stimmt, sind wir beide echte 68er! Julian Müller hat den gesamten Schreibprozess mitverfolgt und mir sehr wertvolle Hinweise gegeben, auch im Hinblick auf die Gesamtkomposition des Buches. Magdalena Göbl hat ebenfalls sehr akribisch mitgelesen und mich auf viele Aspekte hingewiesen, die den Text besser gemacht haben. Teile des Buches hat Gina Atzeni mitgelesen. Till Ernstsohn danke ich für wertvolle Recherchen.
Dass für etwaige Eseleien und Fehler ich selbst verantwortlich bin, lässt sich nicht vermeiden. Ich schließe in meinen Dank die Lektorin Evelin Schultheiß ein, von der meine Texte sehr profitieren, sowie die Mitherausgeber der kursbuch.edition Sven Murmann und Peter Felixberger.
Schließlich danke ich der Leiterin meines Büros Gisela Döring, die den Laden auch dann zusammenhält, wenn ich mich schlicht weigere, aus den Tiefen des Schreibens an der Oberfläche zu erscheinen.
München, im März 2018
Einstieg
Am besten, ich sage es gleich am Anfang: Was wir mit der Chiffre »1968« verbinden, steht für eine Liberalisierung der Kultur und Pluralisierung sozialmoralischer Orientierungen, für eine stärkere Beteiligung zuvor marginalisierter Gruppen und sozialen Aufstieg, für Demokratisierungserfahrungen und optimistische Entwürfe der Gestaltbarkeit der Gesellschaft, für Individualisierung und Befreiung aus allzu starken Bindungen, für Inklusionsoptimismus. All das stimmt und all das hat es gegeben, und auch als Narrativ funktioniert es hervorragend, übrigens auch in modo negativo, also durch diejenigen, die all das eher beklagen würden. Auch das Beklagen ist eine Form der Anerkennung. Ich will hier also nicht über Unstrittiges verhandeln – und ich will vor allem weder Partei dafür noch dagegen ergreifen – aus zwei Gründen. Man wird erstens kaum gute Gründe nennen können, die gegen die angedeuteten Entwicklungen sprechen. Und zweitens wissen wir alle, dass all diese Entwicklungen neben Nutzen auch Kosten verursacht haben. Also noch mal: Es soll nicht über Unstrittiges gestritten werden.
Worum dann? Nun, die Streitigkeiten fangen schon an, wenn wir uns fragen, worüber wir eigentlich reden, wenn von »1968« die Rede ist. Gemeint sein kann mindestens zweierlei: entweder die Ereignisse der sogenannten Studentenrevolte, die in Deutschland ungefähr von Mitte 1967 bis Mitte 1969 gedauert hat; oder eine Generationslage, die ihren Namen von diesen Ereignissen bekam und bis heute andauert, weil Teile der Kohorte noch am Leben sind. Es wird hier um beides auch in seiner Verbindung gehen, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Generationslage samt ihren erheblichen Auswirkungen auf die kulturelle und gesellschaftliche Lage in der Bundesrepublik liegen wird. Dabei wird sich meine Argumentation in erster Linie auf Deutschland beziehen, auch wenn es Ende der 1960er-Jahre genauso in den USA, in Frankreich, in afrikanischen und südamerikanischen Ländern, in Polen und der Tschechoslowakei oder in Japan zu Protestbewegungen gekommen ist.1
Was mich im Folgenden interessiert, ist, die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen nachzuzeichnen, die »1968« hervorgebracht und ermöglicht haben, und den Folgen auf den Grund zu gehen, die diese Veränderungen nach sich gezogen haben. Weder werde ich es also historisch detailgetreu nachzeichnen noch eine schlüssige Erzählung des Geschehenen abliefern, sondern der Frage nachgehen, was »1968« für die gesellschaftliche Selbstbeschreibung bedeutet und worauf sich diese bezieht. Es ist also keine politische Bewertung von »1968« zu erwarten, viel weniger noch eine Entscheidung darüber, welche Teile der Erbschaften von »1968« wir annehmen, welche aber lieber ablehnen sollen.
Im ersten Kapitel »Warum 1968?« werde ich zunächst in Beantwortung der Frage, worüber wir sprechen, wenn wir von »1968« sprechen, »1968« zunächst als einen Erinnerungsgenerator darstellen, der die Geschichte der Bundesrepublik erzählbar macht. Dass dies Kritiker wie Anhänger von »1968« einschließt, weist schon darauf hin, dass »1968« nur als ein Generationszusammenhang zu begreifen ist, wie ich mit Karl Mannheim darstellen werde. Auf der Suche nach den Bedingungen, die zu »1968« geführt haben, stoße ich auf Inklusionsschübe als einen wichtigen gesellschaftlichen Trend, der immer mehr Menschen in Bildungskarrieren, zu sozialem Aufstieg und zur Teilhabe an öffentlichen Diskursen bringt und politisiert. Diese Inklusionsschübe sind sowohl Auslöser wie Folge des Syndroms »1968«.
Im zweiten Kapitel »Eine linke Bewegung?« werde ich für die Beantwortung der scheinbar redundanten Frage eine Unterscheidung zwischen einer explizit und einer implizit linken Form vornehmen. Das explizit Linke an 1968 betrifft die sichtbare Seite der 68er, die revoltenhafte, revolutionäre, tatsächlich extrem linke, antibürgerliche, zum Teil auch antidemokratische Bewegungsform der relativ kleinen, aber lauten studentischen Bewegung, die spätestens mit dem Ende der Großen Koalition schon wieder zu Ende war. Wäre allein das »1968«, würde man es heute allenfalls als Fußnote der bundesdeutschen Geschichte betrachten. Entscheidender ist das implizit Linke, das die gesellschaftliche Realität radikal umgekrempelt hat. Die erheblichen Inklusionsschübe haben eher linke Ziele gewissermaßen mit der Gesellschaft versöhnt und die institutionelle Ordnung der Gesellschaft stark verändert. Implizit links handelten bisweilen sogar die, die sich selbst niemals als »links« bezeichnen würden. Das ist ein bleibendes Erbe dessen, was mit »1968« assoziiert wird.
Im dritten Kapitel »Dauerreflexion« behandle ich die vielleicht entscheidende Bezugsgröße von »1968« und widme mich dazu der religionssoziologischen Abhandlung Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar? von Helmut Schelsky – ohne Zweifel also kein 68er. An dem Text von 1957 lässt sich aber die Antezedenzbedingung der gesellschaftlichen Umwälzungen der 1960er- und 1970er-Jahre sehr deutlich zeigen. Weil man, so Schelsky, nicht mehr auf stabile Institutionen, also feste Strukturen setzen könne, werde, wie er am Beispiel der Veränderung des Religiösen demonstriert, Reflexion, Dauerreflexion unvermeidlich und dadurch das Gespräch das Medium, durch das die Menschen nun sozialisiert werden, nicht mehr einfach durch Zugehörigkeit zu Schichten, Milieus oder Konfessionen. Jürgen Habermas hat das später kommunikative Verflüssigung genannt. Dauerreflexion als Kommunikationsexplosion war wohl das Signum der Generationslage der 1960er- und 1970er-Jahre.
Im vierten Kapitel »Dauermoralisierung« beschäftige ich mich mit der Frage, die sich von heute aus – auch damaligen Protagonisten – immer wieder stellt, nämlich der starken Moralisierung des Tons. Moralisierung meint hier die Etablierung geradezu unbedingter Standpunkte, aus Binnensicht zurückführbar auf das von mir so genannte »Sympathieparadox der Linken«, aus einer analytischen Perspektive auf das »Technologiedefizit« der Inklusionsstrategien der 1970er-Jahre. Die starke Pädagogisierung und Politisierung der Inklusionsstrategien und der öffentlichen Diskussion entlastet sich gewissermaßen in stark idealisierten Selbstbildern vom eigenen Technologiedefizit.
Das fünfte Kapitel »Entdeckung und Unterschätzung der ›Gesellschaft‹« ist ein Exkurs zu einer gegenläufigen Entwicklung, die einerseits die Gesellschaft als einen gestaltbaren Raum entdeckte, darin andererseits auf die Widerständigkeit der Gesellschaft stieß, die sich den inklusionspolitischen Maßnahmen auch entzogen hat.
Das sechste Kapitel »Dauerberieselung« nimmt die dritte bleibende Erbschaft von »1968« auf, nämlich die Popkultur, insbesondere in Form der Popmusik, ohne die eine Interpretation der Generationslage von »1968« unvollständig bliebe – eingedenk der ästhetischen Funktion und Bedeutung von Popkultur für diese Generation: Auch hier geht es um Entlastung von der Dauerreflexion und der Dauermoralisierung, gleichzeitig auch um Ermöglichung von Gegenwartsorientierung. Konsequenzfreies Popkulturelles kann dabei als Gegenentwurf und Protest auftreten, durch seine serielle Struktur aber auch mit dem Kapitalismus und seiner Konsumkultur versöhnen.
Im abschließenden siebten Kapitel »Dauerpose – nach 68« untersuche ich die Frage, was von »1968« geblieben ist. Die These lautet, dass sich in der heutigen Alltagskultur, Kritikform und den akademisierten Debatten die Erbschaften amalgamieren: Dauerreflexion und Dauermoralisierung gehen in einer Form auf, die sich vor allem der popkulturellen Pose verdankt. Inzwischen geht es nicht mehr um die befreienden Perspektiven der Reflexion und der Inklusionsschübe, sondern um Anerkennungsgerechtigkeit bis hin zur Pose des Authentischen – übrigens sowohl in kulturlinken als auch in neorechten Szenen. Womit nicht gesagt ist, dass nun alle Rechte seien, sondern dass der Grundkonflikt sich nicht mehr wie in den 1970ern an den implizit linken Fragen universalistischer Inklusion und pluralistischer Liberalität entzündet, sondern an den implizit rechten Fragen der Zugehörigkeit, der Anerkennungsgerechtigkeit und der Wiederentdeckung des Eigenen als letzter Bedeutung.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis auf Anführungsstriche. Im Text ist sowohl 1968 als auch »1968« zu lesen. Die Jahreszahl ohne Anführung nennt schlicht ein Datum, die in Anführung zwar auch, aber kein zeitliches, sondern ein systematisches. Mit »1968« erscheint also das Symbol für das, was mit dieser Jahreszahl assoziiert wird. Dass es mitunter an Eindeutigkeit in der Unterscheidung zwischen 1968 oder »1968« fehlt, ist ein Hinweis darauf, worum es in diesem Buch geht.
Anmerkung
1 Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. Aktualisierte und um ein Postskriptum erweiterte Neuausgabe, München 2017, S. 151 ff.; Carole Fink, Philipp Gassert, Detlef Junker (Hrsg.): 1968. The World Transformed. Cambridge 1998; Martin Klimke: »1968 als transnationales Ereignis«, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/68er-bewegung/51984/68-transnational?p=all#footnodeid3-3
Warum 1968?
»Bei vielen Menschen ist es bereitseine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen.«
Theodor W. Adorno, 1951
»Wozu noch Ich sagen?«
Botho Strauß, 2013
Die Frage »Gab es 1968?« dürfte vielleicht schon jetzt weniger naiv klingen, als sie auf den ersten Blick erscheint. Dass es das Jahr 1968 gab, ist einsichtig. Es ist schlicht das Ergebnis einer Zählung. In der Geschichtswissenschaft ist man sich inzwischen ziemlich einig über eine notwendige Entmythologisierung des Geschehens 2 – nur hilft das auch nicht recht weiter, ist es doch nur ein Indiz dafür, dass es zu Mythologisierungen kam und kommt. Tatsächlich ist »1968« ein Mythologem, eine Chiffre, ein Symbol für ein Ereignis, in dessen Folge nichts mehr war wie zuvor, eine Chiffre dafür, Erinnerung strukturieren zu können. »1968« ist ein Erinnerungs- und damit auch ein Erzählanlass. Dass es sich gerade jetzt als Erzähl- und Erinnerungsanlass anbietet, liegt selbstverständlich daran, dass das Geschehen sich zum 50. Mal jährt und sein »rundes« Jubiläum in die Erinnerungsökonomie einfließt, die sich auf dem Markt um Aufmerksamkeit und Interesse wiederfindet.
Erinnern und Vergessen
Erinnern ist eine Funktion der Gegenwart. Das Vergessen auch. Wie alles andere findet Erinnern in einer Gegenwart statt, deren Vergangenes nur als gegenwärtige Vergangenheit existiert, nicht als vergangene Gegenwart. Man nennt das die Modalität der Zeit. Vergangenheiten und Zukünfte sind stets aus der Gegenwart herausscheinende Vergangenheiten und Zukünfte. Noch niemand hat etwas in der Vergangenheit – und niemals etwas in der Zukunft bewerkstelligt. Wir sind operativ an die operativen Gegenwarten unseres Tuns und Lassens gebunden.3 Diese Zeitmodalität ist konstitutiv für die Geschichtswissenschaften, für alle historischen Perspektiven, aber auch für unsere je individuellen Formen der Selbstbeschreibung. Wir kennen das von uns selbst: Wie wir unsere eigene Vergangenheit beschreiben, wie und was wir geworden sind, hängt prinzipiell ab vom Anlass der Beschreibung und vom Adressaten. Das Bezugsproblem einer historischen Beschreibung liegt also zeitlich gesehen in der Gegenwart, sozial gesehen im Anlass und Adressaten und sachlich gesehen in der Auswahl der Erinnerungsstücke.
Wer etwa in einer Liebesbeziehung lebt, wird im Status der Zufriedenheit anders und anderes erinnern als im Horizont des Scheiterns der Beziehung. An solchen Beispielen kann man übrigens auch lernen, dass Erinnern vom Vergessen abhängt. Man kann nur konsistent erinnern, wenn man das meiste vergisst, also für nicht relevant hält, und zwar für so irrelevant, dass es nicht einmal als irrelevant thematisiert wird.4 Dabei können aus der Erinnerung über ein und dasselbe faktische Geschehen von ein und demselben Beobachter sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden, von denen keine wirklich falsch sein muss, selbst wenn sie sich widersprechen. Die Vergangenheit ist nicht nur in ihrer Vollständigkeit unerreichbar, sondern auch in ihrem inneren Sinn, in ihrem inneren Zugzwang. Womöglich, nein, wahrscheinlich haben Erzählungen über die Vergangenheit mehr Zugzwang als das Geschehen selbst, das ja immer auch gleichzeitig mitbeobachtet wird.
Biografische Erzählungen sind deshalb niemals buchhalterische Berichte und Protokolle des Geschehenen, sondern immer selektive Zugriffe auf – ja worauf eigentlich? Auf den ersten Blick hört es sich so an, als sei es ein selektiver Zugriff auf die vergangenen Ereignisse, es ist aber eher ein selektiver Zugriff auf das, was man über das Vergangene auch hätte erzählen können. Da die vergangenen Ereignisse immer schon vermittelt sind durch die Erinnerung, kann die Erinnerung gar nicht genau prüfen, ob sie richtig erinnert, weil sie zugleich vergessen muss, besser: immer schon vergessen haben muss. Nicht dass wir beliebig erinnern, Vergangenheiten vollständig erfinden und uns frei vorstellen können oder Erinnern sich nicht auf die Vergangenheit bezieht, worum es geht, ist, dass Erinnern und Erinnertes miteinander verwoben sind, dialektisch könnte man sagen, unhintergehbar und nur analytisch trennbar.5
Im Alltag erinnern wir zumeist wenig reflexiv. Wir gewöhnen uns an unsere eigenen Geschichten über das Vergangene und glauben das, was wir uns darüber erzählen. Je öfter wir Geschichten unseres eigenen Lebens zum Besten gegeben haben, desto mehr wird die grundlegende Differenz zwischen Geschehen und Erinnerung beziehungsweise Geschehen und Beschreibung unsichtbar. Das ist keine Täuschung, sondern eher eine Habitualisierung. Um die Erinnerung kommunikabel zu machen, braucht es eine konsistente Geschichte, man könnte auch sagen: Die erzählte Geschichte muss aufgehen.
Die Sentenz Die Geschichte muss aufgehen enthält bereits die Doppelbedeutung dessen, was das Erinnern zu einem so komplexen Geschehen macht: Die Geschichte im Sinne des Historiografischen, also des erzählten Beschriebenen muss aufgehen, womit dann auch die Geschichte im Sinne des Geschehenen aufgeht. Wer je eine Geschichte erzählt hat, wird feststellen, dass ihr kommunikativer Sinn nur dann erfüllt wird, wenn sie einen Zugzwang der Konsistenz erzeugt, wenn sie in sich anschlussfähig wird. Sie kann Brüche enthalten, auch Widersprüche und Disparates, aber auch dies muss innerhalb der Struktur sichtbar werden. Es muss einen Clou geben, eine innere Logik, einen Sinn.
1968 als Erinnerungsgenerator
»1968« ist ein, vielleicht der Erinnerungsmarker in der Geschichte der Bundesrepublik. Was ich oben über das biografische Erinnern gesagt habe, gilt für erinnernde Einheiten generell: für Gruppen, für Staaten, für soziale Systeme. Auch solche Einheiten greifen selektiv auf die eigene Geschichte beziehungsweise auf die vielen Möglichkeiten der Bezugnahme auf die eigene Vergangenheit zu – und sie tun es stets in einer Gegenwart. Wer oder was solche Einheiten sind, lässt sich nicht immer genau sagen – aber der proof of the pudding ist die Anschlussfähigkeit, will heißen: Klingt die Geschichte plausibel, fühlt sich jemand/etwas angesprochen, ist sie ein Erzählanlass?
Von dem Soziologen Alois Hahn stammt der schöne Ausdruck Biografiegeneratoren.6 Gemeint sind damit Anlässe und Konstellationen, die erinnernden Selbstbeschreibungen wie – im religiösen Bereich – die Beichte oder auch das Tagebuchschreiben, Krisen, Krankheiten, freudige Ereignisse, Katastrophen usw. wirken als Biografiegeneratoren, sind damit Anlässe, verzeitlichte Geschichten über sich selbst anzufertigen, anlass- und adressatenbezogen. »1968« ist im weitesten Sinne ein solcher Biografiegenerator und eignet sich hervorragend zu einer verzeitlichten Selbstbeschreibung. Übliche Aussagen sind etwa: 1968 habe die Bundesrepublik von der bleiernen Schwere der Adenauerzeit befreit. 1968 sei eine Kulturrevolution gewesen, die das Leben freier, pluralistischer und kosmopolitischer gemacht habe. Zugleich ist »1968« auch eine Chiffre für die Selbstverortung von Konservativen. Der Spitzenkandidat der AfD hat noch am Abend der Bundestagswahl 2017 in die Mikrofone getönt, seine Partei sei angetreten, sich das Land zurückzuholen, jenes Land, das man spätestens 1968 verloren habe. Er musste nicht einmal 1968 sagen, um »1968« hörbar zu machen.
»1968« ist ein multipler Erzählanlass. Ehemalige Protagonisten wie etwa Götz Aly 7 oder Matthias Matussek 8 haben dazu Renegatengeschichten geschrieben und sich von ihrer Generationslage distanziert. Wieder andere stellen sich in die Tradition von 1968, etwa Daniel Cohn-Bendit.9 Und das Verständnis der »Neuen Rechten«, insbesondere ihres aktionistischen Zweiges, kommt kaum mehr ohne den Rekurs auf »1968« aus.
So schreibt Thomas Wagner in seiner vorzüglichen Studie Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten: »Die politische Rechte greift auf Sprüche und Aktionsformen zurück, die man seit den Tagen der Achtundsechziger-Studentenrevolte vor allem mit der Linken in Verbindung bringt. Besonders beliebt sind gezielte Provokationen. Sie gehörten zur Strategie der Antiautoritären. Das dahintersteckende Kalkül: Der verunsicherte Staat reagiert über und entlarvt sich dadurch selbst als ein repressives Regime.« 10 Diese Interpretation zeigt vor allem, wie stark sich das Ereignis »1968« in die deutsche Erinnerungskultur eingeprägt hat. Wagner schreibt weiter: »Die Selbstinszenierung als Bürgerschreck gehörte für Rudi Dutschke und die Akteure der Außerparlamentarischen Opposition (APO) dazu. Heute sind es rechte Gruppierungen, wie die Identitäre Bewegung, die sich in ihren Fußstapfen bewegen. Ob sie den Zugang zur CDU-Bundeszentrale vorübergehend mit einer Sitzblockade versperren, das Brandenburger Tor erklimmen oder Veranstaltungen in renommierten Theatern stören: Die Aktionen der Identitären schockieren viele Zeitgenossen. Und wieder kommt es zu den erwünschten Überreaktionen der etablierten Institutionen. Es ist wie ein Déjà-vu.« 11
Ein Déjà-vu kann nur durch eine echte Präsenz ausgelöst werden beziehungsweise – wie hier – durch einen privilegierten Erzählanlass. Ein Déjà-vu übrigens, das auch in der Selbstbeschreibung der Neuen Rechten vorkommt, so etwa bei Götz Kubitschek, dessen Essay »Provokation« 12 explizit auf die Strategie der Situationistischen Internationale Bezug nimmt, einer Künstlergruppe, die im Umfeld des Pariser Mai 1968 Strategien einer Kommunikationsguerilla entwickelte. Thomas Wagner nennt die 68er gar Lehrmeister der Neuen Rechten.13
Diese wenigen Andeutungen zeigen schon, wie stabil der Rekurs auf das Mythologem »1968« funktioniert – in positiver Aneignung, in affirmativer Erinnerung und in (selbst)kritischer Distanzierung. Wenn es stimmt, dass die Erinnerung beziehungsweise der Rekurs auf Vergangenes eine Funktion der Gegenwart ist, müsste nun genauer bestimmt werden, welches Problem überhaupt mit dem Rekurs auf »1968« gelöst werden soll, wie erklärt werden kann, was »1968« zu jenem »Biografiegenerator« gemacht hat, von dem her sich Gegenwarten so gut beschreiben lassen.
Noch einmal: Gab es 1968? Heinz Bude hat bereits vor mehr als 20 Jahren in einer porträtistischen Studie versucht, die Generation der 68er genauer zu qualifizieren, und Interviews mit Protagonisten der Jahrgänge 1938 bis 1948 ausgewertet. Ein Ergebnis der Studie formuliert Bude so: »Es bleibt die Erkenntnis, daß 1968 eine Generation von Kriegskindern auf eine günstige Opportunitätsstruktur des sozialen Wandels traf. Ein diffuses Unbehagen fand die Bedingungen einer wirkungsvollen Artikulation. Die Motive des Protests erklären daher nicht den Erfolg der sozialen Bewegung.« 14
Bude unterscheidet Bewegung und Generation. Die Revolte selbst war kurz, und die Zahl der handelnden Personen überschaubar. Wolfgang Kraushaar datiert die konkrete Protestbewegung in Deutschland vom Tod von Benno Ohnesorg im Juni 1967 bis zum Sommer 1969.15 Norbert Frei bezeichnet das Jahr 1967 als »das unwahrscheinliche Jahr«, dem eine 18 Monate dauernde Form des Dauerprotestes folgte.16 Und Rudi Dutschke räumt in einem Fernsehinterview mit Günter Gaus 1967 ein, dass die Bewegung in Westberlin letztlich aus nur 15 bis 20 aktiven Personen besteht, unterstützt von einigen Hundert Personen. Zu Protestdemonstrationen könne man in Westberlin ein paar Tausend Menschen auf die Straße bringen.17 Es hat denn auch lange gedauert, bis aus der Bewegung, der Studentenbewegung oder den Studentenprotesten eine »Generation« wurde, also eine Adresse für kollektive Zurechnung.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die »68er« eine Kursbuch-Erfindung sind. Zehn Jahre danach, im Kursbuch 54 aus dem Jahre 1978, hat der damals 38-Jährige eine geradezu melancholische Reflexion vorgelegt, die im Scheitern des »linken Gettos« eine Generationslage ausruft. Die Bewegung selbst, so schreibt auch Hartung, ist letztlich 1970 zu Ende gewesen, die Protagonisten haben sich in esoterischen K-Gruppen aufgerieben, andere empfanden vor allem den sogenannten »Radikalenerlass« von 1972 als Reaktion des Staates auf den angekündigten »Marsch durch die Institutionen«, insbesondere die Institutionen eines in den 1970er-Jahren exorbitant wachsenden öffentlichen Dienstes, als Ende der Bewegung. Diese habe sich, so Hartungs implizite Botschaft, gewissermaßen von innen wie von außen selbst zerlegt. Und erst im Moment dieser Historisierung »erfindet« Hartung diese Generationslage und mit ihr den Begriff »68er Generation«.18
Diese Selbstcharakterisierung und -historisierung ist ohne Zweifel eine Binnensicht. Erstaunlicherweise ruft sie zwar eine Generationslage aus, unterschätzt aber deren Reichweite erheblich – eine Reichweite, die man schon daran erkennen kann, dass bis heute der politische Kulturkampf sich immer wieder an jenen 68ern abgearbeitet hat, die für die einen der Garant einer freieren Gesellschaft waren, für die anderen das Ende jener geordneten Verhältnisse, die man per geistig-moralischer Wende in den 1980ern oder als »konservative Revolution« 2018 wiederherstellen möchte. Der Begriff der »konservativen Revolution« stammt von dem rechten Theoretiker Armin Mohler und wurde zu Beginn des Jahres 2018 von dem CSU-Politiker Alexander Dobrindt in einem Beitrag für die Tageszeitung Welt publikumswirksam eingesetzt, um auf die »linke Revolution der 68er und die Dominanz der Eliten … eine konservative Revolution der Bürger folgen« 19 zu lassen. Ob die Provokation mit dem Mohler-Titel überhaupt gewollt war, steht dahin. Aber deutlich wird an solchen Texten – deren Zahl Legion ist – schon, wie problemlos der Rekurs auf die Chiffre 68 funktioniert. Das verweist darauf, dass trotz des »kurzen« 1968 als Bewegung die Adressierbarkeit als »1968« durchaus im Sinne einer Generationsgestalt funktioniert, ganz unabhängig, wie man sich dazu positioniert.
Die Binnensicht von Klaus Hartung in seinem Kursbuch-Beitrag war noch so sehr auf sich selbst bezogen, dass er wohl kaum antizipieren konnte, dass 40 Jahre später immer noch jene 68er adressierbar sind, die er in der logischen Sekunde ihrer semantischen Erfindung bereits ad acta gelegt hatte. Hartung beginnt seinen Text mit einem Bericht über ein Bob-Dylan-Konzert im Sommer 1978. Er war enttäuscht davon, dass Dylan »seinen Mythos zersungen« habe, schlimmer noch aber, er tat es vor einem Publikum, das selbst amorph war, und doch als Generation ansprechbar sein sollte. »In Berlin war es ein Publikum der Dreißigjährigen. … Diese Dreißigjährigen in der Berliner Deutschlandhalle, was stellten sie dar? Die Linke als Generation – unendlich getrennt von ihren Altersgenossen, nicht nur durch den politischen Zusammenhang, sondern durch das Alter selbst. … Doch: es waren Lehrer, Architekten, Buchdrucker, Mediziner, Taxifahrer, Arbeitslose, künftige und vergangene Exempel des Berufsverbotes usw. und waren es auch wieder nicht. Denn wenn ich mich betrachte und mich in meinem Freundeskreis umschaue (der zum großen Teil die Konzerte besuchte), dann muß ich sagen, daß wir unsere Existenz als vorläufig ansehen, vorläufiger denn je, und sind doch dabei und vielfach zum ersten Mal, uns ernsthaft zu entscheiden und das Gewicht unseres Lebens anzuerkennen.« 20 Worauf Hartung hier, womöglich eher implizit als explizit, hinweist, ist das, was man mit Karl Mannheim eine Generationslagerung nennen kann. Hartung beschreibt seine eigene Situation, frustriert von dem Verrat einer Ikone: »Bob Dylans letzte Zugabe … war ›The times they are a-changing‹ – dieses heilige Protestlied hatte er übermütig verrockt, präsentiert in einem fröhlichen Artistentum, das besagte: ›diese Zeiten sind vorbei‹.« 21 Er kontextualisiert diese Enttäuschung deutlich in einem über die eigene Gruppe hinausweisenden Zusammenhang, indem er die eigene Position als »linkes Getto« beschreibt. Ich zitiere nochmals ausführlich: »Das linke Getto, ein kollektiver, schwer entwirrbarer Stoßseufzer der Stagnation, der gelebten Vorläufigkeit; der Ort, an dem wir alle unsere zukünftigen Ideen aufbewahren, an den wir selbstverständlich zurückkehren, weil wir hier, ohne Selbstachtung zu verlieren, überleben können, und von dem wir alle wissen, fraglos, daß wir da raus müssen. Obwohl das linke Getto auch ein erarbeiteter Zusammenhang von Kinderläden, Buchläden, Verlagen, Werkstätten, Wohngemeinschaften, Selbsthilfeorganisationen, Frauenhäusern, Mediengemeinschaften, Galerien, Zeitungen, Kneipen ist, scheinen wir, wenn ich mich nicht täusche, nicht allzu stolz darauf zu sein.« 22
Es fällt Hartung durchaus auf, dass er damit auch eine Erfolgsgeschichte erzählt, also zumindest eine Geschichte, die Spuren hinterlassen hat und die mehr Aufmerksamkeit erzeugt hat, als die Binnen- und Innensicht des »linken Gettos« zugibt. Weit über seine Bezeichnung der Generation der 68er hinaus ist sein namengebender Text selbst Ausdruck einer Generationslage, die die Frage, ob es 1968 gegeben hat, erst zu einer intellektuell anspruchsvollen Frage machen könnte. Diese Frage stellt Hartung nicht, dafür ist er zu sehr auf sich fixiert, aber der Text stellt die Frage und impliziert eine Antwort.
Ein Generationszusammenhang?
Ich habe Karl Mannheim schon erwähnt. Von diesem Begründer der Wissenssoziologie stammt der für die Soziologie bis heute kanonische Text zur Theorie der Generation, zuerst 1928 erschienen. Mannheim fragt sich, was eine Generation ausmache. Er wendet sich zunächst gegen die (eher französische) rationalistische Idee der schlichten Kohortenbildung, aber auch gegen die (eher deutsche) romantische Idee der Generation als einer geistigen Größe, wobei er durchaus von beiden Seiten beeinflusst ist. Das rationalistische Denken ist auf die Idee des Fortschritts geeicht, der sich durch die sich ablösenden Generationenkohorten Bahn bricht; das romantische Denken dagegen orientiert sich an einer qualitativen Zeitlichkeit, die nicht bloß die äußere Gleichzeitigkeit zum Maßstab einer Generation erklärt. Rekurrierend auf den Kunsthistoriker Wilhelm Pinder macht Mannheim auf die romantische Idee des inneren Zusammenhangs einer Generation aufmerksam, auf die einer Generation inhärente Entelechie.23
Den geisteswissenschaftlichen Fokus des Entelechie-Gedankens erweiternd weist Mannheim darauf hin, dass »auch die gesellschaftlichen Beziehungen, in denen Menschen sich zunächst treffen, in ihren Gruppierungen, wo sie sich gegenseitig entzünden und wo ihre realen Kämpfe Entelechien schaffen« 24, berücksichtigt werden müssten, um das Phänomen der Generation zu verstehen. Das ermöglicht es ihm, Generationen nicht für eine gewissermaßen einheitliche Gruppenform, für eine nach innen homogene oder gar sich selbst bewusste Einheit zu fassen. Er führt dafür den Begriff der sozialen Lagerung ein.
Die Generation ist für Mannheim keine »konkrete Gruppe« im Sinne der »Gemeinschaft« 25, sondern eher vergleichbar dem, was man eine Lagerung nennt. Mannheim vergleicht es mit der Klassenlage: »In einer Klassenlage befindet man sich; und es ist auch sekundär, ob man davon weiß oder nicht, ob man sich ihr zurechnet oder diese Zurechenbarkeit vor sich verhüllt.« 26 Analog dazu beschreibt Mannheim, dass jede Lagerung die »Weisen des Erlebens, Denkens, Fühlens und Handelns« 27 auf bestimmte Art strukturiert und damit zugleich Bestimmtes ermöglicht, Unbestimmtes ausschließt. Er nennt das die einer Lagerung inhärierende Tendenz.
Eine solche Generationslagerung ist die Grundlage für einen spezifischen Generationszusammenhang. Mannheim zeigt das am Beispiel der preußischen Jugend von 1800 auf, deren Generationszusammenhang keineswegs durch die Lagerung allein gestiftet wird, sondern durch eine registrierbare »Partizipation an den gemeinsamen Schicksalen dieser historisch-sozialen Einheit«.28 Anders als die Pinder’sche Entelechie heißt das freilich nicht, dass hier eine Gemeinschaft gestiftet würde, die allen einen gemeinsamen inneren Sinn verleiht. Ganz im Gegenteil gehört zu diesem Zusammenhang auch das Konfliktuöse, das Trennende, das Unvermittelbare. Der einheitliche Generationszusammenhang der preußischen Jugend um 1800, so Mannheim, ist vor allem durch Distanz und Konflikt einer romantisch-konservativen und einer liberal-rationalistischen Jugend gekennzeichnet – unschwer lassen sich darin die politischen Lager der Französischen Revolution wiederfinden. Aber, und dies ist nun das Entscheidende: »Sowohl die romantisch-konservative, als auch die liberal-rationalistische Jugend gehört demselben Generationszusammenhang an; denn romantischer Konservatismus und liberaler Rationalismus waren damals nur zwei polare Formen der geistigen und sozialen Auseinandersetzung mit demselben, sie alle betreffenden historisch-aktuellen Schicksal.« 29 In Mannheims Sprachgebrauch stehen sich hier zwei Generationseinheiten in einem Generationszusammenhang gegenüber.
Das soziologische Problem der Generation wird von Mannheim also, modern gesprochen, im Sinne einer Praxis gelöst, die durchaus widersprüchlich und konfliktuös sein kann. Wenn es stimmt, dass sich innerhalb eines Generationszusammenhangs mehrere polar sich bekämpfende Generationseinheiten bilden können, wenn also die Generation, und das ist eben das Soziologische an diesem Gedanken, sich durch die sozialen Beziehungen innerhalb einer zeitlichen, sachlichen, sozialen und räumlichen Lagerung auszeichnet, so müsste das eine Bedeutung für die Frage haben, was denn die 68er nun sind und was es bedeutet, sie als Generation zu beschreiben. Jedenfalls sollte deutlich geworden sein, dass die bloße Tatsache, einer bestimmten Geburtskohorte anzugehören, noch keine Generation ausmacht. Die 68er sind nicht wegen ihres Geburtsjahrs 68er, sondern aufgrund ähnlicher typischer Praktiken und Erfahrungen, die durchaus unterschiedlich verarbeitet werden können, aber irgendwie erzählbar sein müssen.
Vor dem Hintergrund meiner Mannheim-Lektüre lässt sich schon erahnen, was der Generationszusammenhang der 68er sein könnte. Es ist tatsächlich ein Konflikt zwischen Generationseinheiten, die aufeinander bezogen sind. Hartung schreibt 1978: »Cohn-Bendit sagt: ›Für uns alle ist der Prozeß des Zusammenlebens nicht mehr rückgängig zu machen. Man kann nicht mehr sagen: Ihr werdet sehen, in fünf Jahren, wenn Ihr älter seid, werdet Ihr anders leben.‹ Es wäre wahrlich ein Grabspruch. Ich hoffe jedenfalls, daß die Genossen nicht anders leben wollen. … Nicht weil ich die Vorläufigkeit unseres Lebens begrüße, sondern weil ich die subjektive Unsicherheit unserer Lebensorganisation entschieden verteidige, bestehe ich auf der objektiven Möglichkeit, wieder bürgerlich zu werden.« 30 Das bedeutet, dass sich Hartung nicht nur der Vorläufigkeit seiner Lage bewusst ist, sondern auch der gesellschaftlichen Konfliktlage, in der er sich hier beschreibt. Sein nächster Satz heißt nämlich: »Die Linke hatte sich angesichts der herrschenden Repression darauf versteift, sich als kollektives Opfer propagandistisch darzustellen.« Ich lese diese Sätze nicht inhaltlich, sondern im Hinblick auf ihre generationsstiftende Funktion. Was Hartung hier schreibt, ist eine Positionierung im Generationszusammenhang, insbesondere der letzte Satz ist eine Positionierung, die die (wohl multiplen) Polaritäten in der angemessenen gesellschaftlichen Selbstbeschreibung ausdrückt.
Wenn also von »1968« die Rede ist, dann hat man die Wahl, im Namen einer der Generationsgestalten zu sprechen und eine Pro-Haltung oder Kontra-Haltung einzunehmen. Oder man kann das Antipodische, das Dialektische, das in der Differenz Verbindende beobachten und zeigen, wie sehr die unterschiedlichen Seiten voneinander leben, wie sehr sie nicht einfach Positionen sind, sondern Unterscheidungen, zwei Seiten desselben, in ihrer Selbigkeit je auf ihren Unterschied fixiert. Womöglich klug seinen eigenen Lebenslauf als späterer Zeit-Korrespondent und damit Protagonist von Bürgerlichkeit schlechthin vorwegnehmend besteht Hartung darauf, wieder bürgerlich werden zu können, dies wenigstens als Möglichkeit einzuräumen. Der Generationszusammenhang, der mit dem Mythologem oder der Chiffre »1968« bezeichnet wird, ist also intern differenziert, polemogen und darin einheitlich. Die Botschaft lautet: Die gegenwärtigen Kritiker, die wie Alexander Dobrindt Anfang 2018 eine bürgerlich-konservative Revolution fordern und dies mit explizitem Rekurs eben auf 1968 tun, betreiben das 68er-Geschäft. Ich rekurriere absichtlich auf diesen Zeitungsartikel, nicht weil er besonders intelligent wäre, sondern weil er, politisch situiert im Rahmen damals bevorstehender Koalitionsgespräche mit der SPD und sich abgrenzend gegen die AfD, einen Phänotyp von Text abbildet, der den Generationszusammenhang 1968 in den Fokus rückt und von dorther jenen einheitlichen Zusammenhang stiftet, der kommunikativ hervorragend funktioniert. Ganz ähnlich argumentiert auch ein Text des FDP-Politikers Marco Buschmann, übrigens auch in der Tageszeitung Welt.31Endlich das Denken der 68er zu überwinden