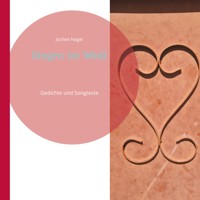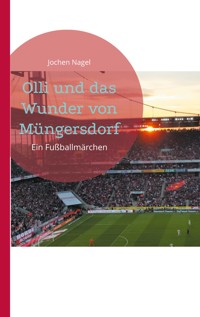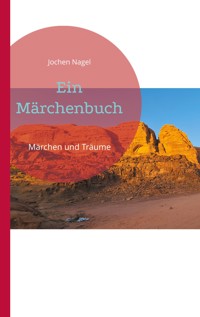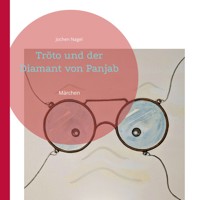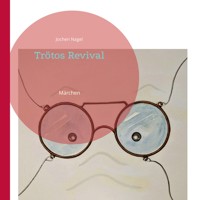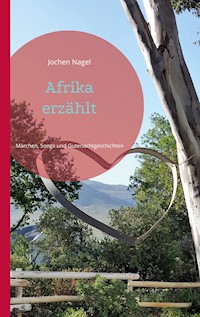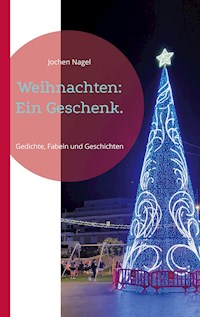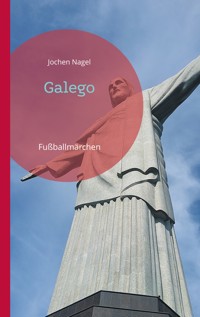
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Märchenhaft
- Sprache: Deutsch
Galego ist ein unbekannter Held. Er träumt davon, die Welt zu retten. Oder zumindest sein Umfeld in der Favela. Wenn er nur seinen grünen Umhang trägt und laut Brasil ruft, wird alles gut werden. Aber selbst Helden brauchen Hilfe. Wo wird er sie finden? Wer wird ihm zur Seite stehen? Seine Freunde? Seine Mutter? Oder doch der kleine Held aus dem Tijuca Wald? Und vor allem, wer ist diese junge Frau, von der er unentwegt träumt. Das Mädchen von Ipanema. Eine Geschichte von Mut und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nikolas
„Geht´s raus und spielt´s Fußball.“ Franz Beckenbauer
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Danke
Prolog
„Meine Seele hat es eilig“
von Mario de Andrade (San Paolo, 1893 - 1945), Dichter, Schriftsteller, Essayist und Musikwissenschaftler; einer der Gründer der brasilianischen Moderne
„Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich bisher gelebt habe.
Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat: die ersten isst es mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten. Mich stören Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich ihrer Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile.
Ohne viele Süßigkeiten in der Packung.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind.
Menschen, die über Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich durch nichts berufen fühlen und die nicht von ihrer Verantwortung fliehen.
Die die menschliche Würde verteidigen und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten.
Es ist das, was das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig. Ich habe es eilig mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann. Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden.
Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.“
1
Galego stand am Strand. An seinem Strand. An dem Strand schlechthin. Seine Füße spürten den noch kühlen Sand. Einzelne Körnchen rannen zwischen seinen Zehen. Langsam kroch die Sonne aus dem wippenden Meer. Die leichten Wellen spülten die Sorgen der Nacht hinfort. Ihre ewige Melodie sang leise und sanft das Lied des Vergessens und der Hoffnung. Hoffnung auf einen neuen Tag. Eine einsame Möwe zog ihre Runde und hielt Ausschau nach einem ersten Fisch.
Galego spürte den leichten Wind, der seinen grünen Umhang flattern ließ, und die wärmenden Strahlen der Sonne. Er wusste, was jetzt zu tun war. Genüsslich sog er die frische Luft des frühen Morgens ein, blinzelte in die Sonnenstrahlen und ging tänzelnd weg vom Strand von Copacabana. Von dem Strand schlechthin. Von seinem Strand. Ein verträumter Blick hinauf zur Christus-Statue bestärkte ihn in seinem Plan. Galego war gefragt. Galego musste helfen.
Strand von Copacabana - Rio de Janeiro (Jochen Nagel)
2
João war echt noch müde. Der Tag kam zu früh. Viel zu früh. Die letzte Nacht war viel zu kurz und er hatte zu wenig, viel zu wenig geschlafen. Traumlos hatte er sich in seinem Bett hin und her gewälzt, eine gute Position gesucht, um endlich schlafen zu können. Aber es blieb bei einem Nickerchen. Zu sehr sorgte er sich um seine Mutter. Die Ärzte konnten die Krankheit nicht ergründen. Dabei ging es ihr wirklich nicht gut. Das sah João. Und er spürte es.
Er musste unbedingt Arbeit finden, aber das wollten viele Menschen in Rio de Janeiro. Für die Drogenbarone mochte er partout nicht tätig werden. Obwohl sie ordentlich bezahlten und für eine gewisse Sicherheit in seinem Viertel sorgten. Tja, und dann war da noch sein Projekt im Tijuca-Wald. Und nicht zuletzt dachte João an sein Mädchen, das hoffentlich seine Freundin werden würde. Joana. Das Girl von Ipanema. Zu viele Gedanken und zu wenig Schlaf. João war müde.
Eigentlich hieß João nicht nur João. Sein voller Name war João Nicolas Pinto da Luna. Seinen ersten Vornamen bekam er von seinem Großvater, einem begnadeten Fußballspieler. Er war damals bei der großen Trauer dabei gewesen. Maracanaço. Alle hatten sich den Coup Jule Rimet so sehr gewünscht. Mehr als zweihunderttausend Menschen mögen im Estadio Maracana dicht an dicht gestanden haben. Alles war bereitet. Nur verlieren war verboten. Und doch geschah das Unfassbare. Uruguay, ausgerechnet Uruguay siegte 2:1. Eine lähmende Stille breitete sich im Stadion, der Stadt und über das ganze Land aus.
Beschämt schlichen die Spieler vom Rasen, auf dem sie eben noch das schöne Spiel zelebriert hatten. Noch im hohen Alter konnte und wollte sein Großvater nicht darüber sprechen. Zu sehr nagte das Versagen der Seleção an ihm. Besonders bitter empfand er, dass er aufgrund seiner Verletzung nicht mehr an den folgenden Triumphen mitwirken und die Schmach von Maracana vergessen machen konnte.
João eiferte ihm nach. Leidenschaftlich gerne lief er dem Ball, wirklich jedem Ball, hinterher. Egal wo, egal wann und egal bei welchem Wetter. Allerdings spürte er trotz aller Faszination und Freude für das Spiel, dass er nicht so gut würde spielen können, wie sein Großvater.
Auf seinen zweiten Vornamen hatte seine Mutter bestanden. Nicolas. Weltoffen, den schönen Künsten zugetan und voller Charme und Lebensfreude. Ein großer Geist. Es erfüllte Nicolas mit Stolz, auch wenn er sich nicht, vielleicht noch nicht, mit den Künsten anfreunden mochte. Ja, die Musik, den Rhythmus der Melodien, das hatte er wie wohl alle Brasilianer im Blut. Aber die Malerei oder die Dichtkunst, das war nicht seine Welt. Doch er gab sich in der Schule die allergrößte Mühe, auch um seine Mutter zu erfreuen.
Doch im Blut, wie sollte es auch anders sein, lag ihm das schöne Spiel. „O Jogo Bonito“ erzählt von der Romantik des brasilianischen Fußballs und vom Stolz des Rekordweltmeisters. Fußball ist mehr als ein Spiel. Mehr als Sport. Er gehört zu Brasilien. Er ist Teil der Kultur, der Identität - des Lebens. Doch es erzählt auch vom Trauma. Maracanaço und Mineiraço. „Sete a um“; 7:1 als Fußballresultat und als ein in den Sprachgebrauch eingezogenes, geflügeltes Wort für Versagen.
Maracana als ein Stadion des Volkes mit Stehplätzen, soweit das Auge reicht. Und es bleiben immer diese Bilder. Von tanzenden und hoffenden, von verzweifelten und weinenden Menschen. Von den größten Spielern aller Zeiten. Von verwegenen Bolzplätzen. Von der Schönheit des Spiels. Egal, wie es ausgeht. Vom Leben, dem pulsierenden und schönen Leben mit all seinen liebenswerten Facetten. „O Jogo Bonito“ - wie schön ist das Spiel.
Auch João träumte davon. Eines Tages würde seine Stunde kommen. Heute Abend wollten sie sich wieder am Strand treffen. Spielen. Das schöne Spiel. Der Ball war immer dabei. Damit sie spielen konnten. Egal wo. Am Strand. Im Wasser. Auf der Straße. Zwischen Hochhausschluchten. Auf Wiesen. Morgens. Mittags. Abends. Wie João hofften auch seine Freunde, dass eines Tages ein Spielerbeobachter sie entdecken würde. Von Corinthians. Oder Palmeiras, Flamengo, Botafogo oder Cruzeiro aus Belo Horizonte? Oder vom FC Santos, dem Pelé Club? Wer wusste das schon?
Jetzt musste er sich aber erst einmal beeilen. Zur Schule gehen und einen Job finden. Das war wichtig. Er war es sich und seiner geliebten Mutter schuldig. Obwohl er als großer Star genug Geld verdienen würde.
3
Vom Norden in der Karibik nach Süden in Patagonien sind es rund siebentausendfünfhundert Kilometer Luftlinie. Über die Straßen sogar weit mehr als zehntausend. Wer den Subkontinent bereist, bekommt ein Gefühl für seine ungeheure Weite. Das Gesicht Südamerikas prägen Regenwald, Wüsten und hohe Berge.
Brasilien hat über zweihundert Millionen Einwohner und ist das größte Land Südamerikas. Es bildet von der Fläche her fast die Hälfte des Subkontinents und ist damit auch das fünftgrößte Land der Erde. Seine weiteste Ausdehnung übertrifft sogar den Abstand Südamerikas zu Afrika. Brasilien hat mit allen südamerikanischen Staaten außer Chile und Ecuador eine gemeinsame Grenze. Die Geografie ist unglaublich vielfältig, aber oft ein Hindernis für die Entwicklung.
Und wenn Ordnung und Fortschritt, wie es in dem weißen Spruchband der brasilianischen Flagge heißt, endlich Raum greifen und Aufschwung, Fortschritt und Entwicklung vorangetrieben werden sollen, geschieht dies häufig mit brutalem Raubbau an der Natur oder rücksichtslosen Bauvorhaben. Vergessen sind rasch die wilde Schönheit des Amazonas-Regenwaldes. Verdrängt die zauberhafte Wildheit des Tijuca-Nationalparks. Mahnerinnen und Mahner für den Naturschutz und die Erhabenheit der Schöpfung mit all ihren Protesten und Appellen dringen nicht durch. Der unüberhörbare, drängend laute Ruf des Geldes übertönt alles.
So wie der Natur ging es auch zahlreichen Menschen. Afrikanische Sklaven wurden im 16. Jahrhundert als billige Arbeitskräfte entführt und entrechtet. Sie wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Minen oder auf den Zuckerrohrplantagen eingesetzt. Sie sollten die hier ursprünglich lebenden Indigenen, von denen viele an den von den spanischen Konquistadoren eingeschleppten, bis dato unbekannten Krankheiten gestorben waren, ersetzen. Doch obwohl sie rechtlos waren, behielten sie ihren Stolz. Und sie übten heimlich das Kämpfen. Für den Tag der Befreiung. Selbstredend war ihnen dies von der Obrigkeit streng untersagt. Daher ließen sie es wie Tanz aussehen. Mit rhythmischen Schritten, Überschlägen, Tritten und Ausweichbewegungen. Trickreich und akrobatisch. Stolz und schön. Die heutige Capoeira.
Noch bis in die Mitte der 1930er-Jahre war sie verboten. Danach breitete sich die afro-brasilianische Kunst, die Kampfkunst, die Musik und Tanz mit Kampf vereint, in ganz Brasilien aus. Meist läuft es so: Zwei Capoeirista stehen sich in einem Zuschauerkreis gegenüber. Um sie herum wird geklatscht, gesungen und musiziert. Ihre Bewegungen sind improvisiert, obwohl es so aussieht, als würden sie einer geheimen, traditionellen Choreografie folgen.
Ob Spiel oder Kampf. Es geht nicht ums gewinnen, sondern um das Gefühl von Gemeinschaft und den Ausdruck von purer Lebensfreude. Pura Vida. Auch sind die Capoeira-Moves gut für den ganzen Körper. Der brasilianischen Capoeira ist die Ginga entsprungen - eine lebensbejahende Philosophie.
Ja, Ginga, dieses mystische Wort hinter dem schönen Spiel. Ein Fußballtraum vom perfekten Rhythmus, vom vollendeten Miteinander und dem Zauber des „O Jogo Bonito.“
So eiferten João und seine Freunde nicht nur der uralten Tradition nach, sondern strebten auf ein besseres Leben hin, um dem Müll, der Armut und der Gewalt in den Favelas von Rio de Janeiro entkommen zu können. Ein Traum, dies für immer schaffen zu können. Eine Hoffnung, die in den Stunden eines nie enden wollenden Fußballmatches keimte, wuchs und sie auch durch die tristen Tage trug. Erst recht beflügelte die Spielphilosophie sie natürlich zu guten Zeiten.
Ginga. Das war ihr Streben. Ihr Spiel. Ihre Tradition. Ihr Erbe. Ihre Geschichte. Ginga.
Aus diesem Geist erwuchsen etliche erfolgreiche Fußballer. Sucht man nach den Gründen für den Erfolg, wird oft angemerkt, dass die kräftigen, ehemaligen Sklaven so athletisch sind. Oder es liege an der Ernährung mit einer besonders proteinreichen Hülsenfrucht, wodurch sie so robust und laufstark sind.
Vermutlich liegt die Wahrheit in viel einfacheren Ursachen. Ihr Antrieb, aus der Armut auszubrechen und als Mensch wahrgenommen zu werden. „Wir müssen erfolgreich sein, damit wir anerkannt werden.“
Das wussten auch João und seine Freunde. Fußball schweißte sie zusammen. Das Spiel ließ sie für Minuten oder Stunden die Probleme vergessen. Möglicherweise konnte der eine oder andere von ihnen das Ziel, Profisportler zu werden, auch erreichen. Doch ebenso wichtig wie Freundschaft, Gemeinsinn und Zusammenhalt waren Bildung und Arbeit.
4
Wieder einmal saßen João und seine Mutter im Wartezimmer des Arztes. Abermals eine der zahlreichen Untersuchungen. Eigentlich hatte João keine Lust mehr darauf, denn es gab die immergleichen Sorgenfalten im Gesicht des Mediziners. Daran an schlossen sich Behandlungen, die nur für kurze Zeit Linderung brachten. Und danach begann alles von vorne.
Seine Mutter Rosa war unglaublich tapfer. Sie hielt die Schmerzen aus. Sie ertrug die Bluttransfusionen, obwohl die Schwestern kaum mehr gute Wege fanden, um die Nadeln in die Adern zu bringen. Neulich hatten sie es am Fuß versucht; das klappte gut. Und seine Mutter war geduldig. João nicht. Irgendjemand musste seiner geliebten Mama doch helfen. Und nicht immer wieder diese wehleidigen Blicke oder diese nichtssagenden medizinischen Begriffe.
João verzweifelte.
Rosa kämpfte.
Um ihr Leben. Um ihren Sohn. Um ihre Liebe.
Rosa. Sie hatte ihren Namen nach der heiligen Rosa de Lima bekommen. Sie wird in der Kirche als Heilige verehrt. Mit bürgerlichem Namen hieß sie Isabel Flores de Oliva und hatte schon als Kind den Wunsch, ein gottgeweihtes Leben zu führen. Sie wirkte an der Gründung des ersten kontemplativen Klosters in Südamerika mit. Im Jahre 1671 sprach Papst Clemens X sie heilig. Sie ist die Patronin von Südamerika und wird bei Verletzungen und Familienstreitigkeiten angerufen.
Rosa würde helfen. Daran glaubte sie fest und versuchte, auch ihren ungeduldigen Sohn, der neben ihr zappelte, zu überzeugen.
Rosa Isabel Pinto da Luna. Sie würde kämpfen.
Dann, nach scheinbar endloser Wartezeit, öffnete sich die Tür zum Behandlungszimmer und Dr. Cristiano trat persönlich heraus. „Rosa,“ sprach er Joãos Mutter direkt an, „wollen wir?“
Beide erhoben sich mit schwerem Gemüt und noch schwererem Herzen in der Erwartung oder Befürchtung, was denn heute so kommen möge.
Nachdem alle Platz genommen hatten, eröffnete Dr. Cristiano die Sprechstunde.
„Rosa, ich habe mir ihre Blutwerte noch einmal sehr genau angesehen. Eigentlich sind sie gegenüber ihren letzten Besuchen besser geworden.“
„Eigentlich,“ wollte João wissen, „was bedeutet denn eigentlich?“ Da war er wieder. Dieser rastlose Junge, der seiner Mutter und der ganzen Welt helfen wollte. Manchmal träumte er davon, ein Superheld zu sein.
Dann lief er mit seinem grünen Umhang umher und rief, so laut er konnte „Brasil“ und alles wurde gut. Rastlos. Ruhelos. Hilfe und Hoffnung.
Seine Mutter legte beruhigend ihre Hand auf seine, atmete ruhig durch und sagte: „João, jetzt lass den Herrn Doktor doch bitte ausreden.“
Dr. Cristiano räusperte sich und fuhr fort. „Du hast ja recht,“ räumte der Mediziner besänftigend ein, „entweder sind die Werte besser oder nicht. Und nicht eigentlich. Was ich damit sagen wollte, sagen will, ist Folgendes: Die Blutwerte an sich haben sich gebessert. Insgesamt zeigen sie, dass die Behandlung