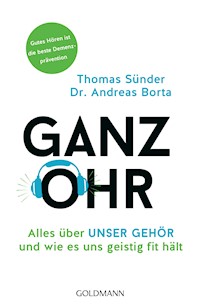
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer besser hört, bleibt länger fit im Kopf!
DJ Thomas Sünder legte auf mehr als 500 Hochzeiten auf – bis ein Hörsturz sein Ohr schädigte und er schließlich aufgrund von Schwindelattacken seinen Beruf an den Nagel hängen musste. Diese existenzielle Erfahrung nahm Sünder zum Anlass, sich zusammen mit dem Wissenschaftler Dr. Andreas Borta auf eine spannende Reise in unser Gehör zu begeben. Wussten Sie, dass Schwerhörigkeit eine der verbreitetsten Zivilisationskrankheiten ist? Bereits heute ist jeder Dritte über 50 betroffen! Aber auch junge Menschen sind durch pausenlose Beschallung gefährdet. Hörgeräte werden meist schamhaft belächelt, dabei sind sie ein unverzichtbares Hilfsmittel: Die neueste Forschung bestätigt, dass eine Hörminderung ohne den Ausgleich durch ein Hörgerät das Risiko, an Demenz zu erkranken, um bis zu vierhundert Prozent erhöht! Eins ist daher klar: Nichts ist wirksamer gegen Demenz, als das Gehör zu pflegen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Wie funktioniert Hören eigentlich, und wie ist so ein Ohr aufgebaut? Ist es normal, dass wir im Alter schwerhörig werden? Oder können wir etwas dagegen tun?
Alles über unser Gehör: informativ, spannend und anschaulich.
Thomas Sünder & Dr. Andreas Borta
Ganz Ohr
Alles über unser Gehör und wie es uns geistig fit hält
Mit Illustrationen von Amely zur Brügge
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Alle in diesem Buch präsentierten Informationen wurden von den Autoren und dem Verlag sorgfältig recherchiert und geprüft. Sie sind allerdings kein Ersatz für eine professionelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Sämtliche Inhalte dienen allein der allgemeinen Information. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen ohne Gewährleistung oder Garantie seitens der Autoren oder des Verlags. Eine Haftung der Autoren oder des Verlags für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten wurden teilweise Namen und Beschreibungen von Personen oder Orten verändert. Die Inhalte stellen die Sicht der Autoren dar, und diese muss sich nicht mit der Wahrnehmung oder Meinung anderer Beteiligter decken.
1. Auflage
Originalausgabe März 2019
Copyright © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
unter Verwendung eines Motivs von
© FinePic®, München
Alle Illustrationen im Innenteil: © Amely zur Brügge
Lektorat: Doreen Fröhlich
DF • Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22747-0V002
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Inhaltsverzeichnis
Intro: So ein Schwindel!
TEIL I: DAS WUNDER DES HÖRENS
Am Anfang war die Stille: Eine akustische Reise zur Entstehung des Lebens
Oben und unten im Urzeitmeer und wie Flusskrebse den Kopfstand lernen
Das Haar in der Suppe und wie Bewegung zu Information wird
Ein Telefonat auf Ohrenhöhe
Schall la la la la
Schallkonzert, Erster Akt: Von Wellen, die eigentlich Kugeln sind
Schallkonzert, Zweiter Akt: Von Wellen, die eigentlich Zwiebeln sind
Schallkonzert, Dritter Akt: Von Wellen, die einfach nur Chaos sind
Wasserbewohner erobern das Land: Atmen durch die Ohren
Die letzte Spritztour
Die Reise ins Ohr
Ohrmuschel
Äußerer Gehörgang
Trommelfell
Mittelohr
Der Mix in unserem Mittelohr: Ein bisschen Fisch und ein bisschen Reptil
Sehr schön zu sehen
Das Hertz der Klänge:Über Höhen und Tiefen
Das Labyrinth: Fantastische Windungen
Nobelpreis für ein Plastikrohr mit Gummiband
Vierzig Klaviere in unserem Kopf
Ein Hydrops ist kein Lutschbonbon
Die Batterie im Kopf
Ein Wackelpudding mit Kalkstreuseln hält uns aufrecht
Vier Ohren hören mehr als zwei
TEIL II: DAS WUNDER DES VERSTEHENS
Die Ohren gehen VOR
Zwischen den Zeilen hören
Vom Verschlucken zum Sprechen
Wie Steinwerkzeuge die Gehirne unserer Vorfahren formten
Kommt Zeit, kommt Rad
Aus eins mach zwei: Warum unsere Ohren ein perfektes Paar sind
Die Kirsche im Sprachcocktail finden
Hörumfang für Millionäre
Wie laut ist eigentlich laut?
Ein guter Plan
Lachende Ratten im dunklen Keller
Unerhört! Supertief und ultrahoch – was unseren Ohren entgeht
Lautlose Töne hinter Masken
Hits in Endlosschleife
Steinzeit-Blues auf der Knochenflöte
Was Sprechen und Singen gemeinsam haben
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern
Rudelgeheul im Fußballstadion
La, Le, Lu, mein Kind bist du
Wenn Hören durch den Magen geht
Zug um Zug gegen den Wind
Raum für Klänge
Akustische Gemütlichkeit für Wohnzimmer und Restaurants
Das Flüstern des Eiffelturms
Unwissen auf dem neuesten Stand
Astronauten im Supermarkt
Das digitale Gehirn
TEIL III: DAS WUNDER BEWAHREN
Eine kurze Geschichte des Lärms
Höralter vor Schönheit
Hey Alter, was heißt hier eigentlich Alter?
Wie und warum altern unsere Ohren?
Krach macht wach – und krank
Gut geschützt: Filter für die Ohren
Vier, drei, zwei, eins
Rundgang durch die Wahrnehmungsfabrik in unserem Kopf
Den Denkmuskel trainieren
In geheimer Mission: der versteckte Hörverlust
Was ein Augenblick verraten kann
Wie Hörverlust das Gehirn schrumpfen lässt
Gesund leben, gesund essen, gesund altern
Wie im Fluge
Lärm ist nicht gleich Lärm
Sauber und leise: Elektromobilität
Schallwellen unter Wasser: Gefahr für Meeresbewohner
Like a Rolling Stone
Droge Musik
Der Kater nach dem Musikrausch: Ohrenklingeln und Co.
Tinnitus: Das Ende der Stille
Auf der Jagd nach dem Phantom
Studien mit Klangtechnologie (zum Beispiel Hörgeräte):
Studien mit Medikamenten:
Studien mit psychologischer Behandlung:
Was tun bei Tinnitus?
Psychotherapeutische Behandlung
Behandlung mit Klangtechnologie
Medikamente und andere Verfahren zur Behandlung von Tinnitus
Tür zu, Ohren auf
Gehör im freien Fall
TEIL IV: DAS WUNDER ERNEUERN
Hightech: Balsam für die Ohren
Die Legende vom pfeifenden Ohrenkolben und wo die Hörgerätetechnik heute tatsächlich steht
Die Zukunftsmusik spielt bereits jetzt
Wie Hörgeräte das Gehirn jung halten und warum sie trotzdem zu wenig getragen werden
Die fünf häufigsten Argumente gegen das Tragen von Hörgeräten und warum sie schlichtweg falsch sind
Mit Geduld zum Ziel: Dem Gehirn mindestens ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit gönnen
Wie teuer sind Hörgeräte, und wer bezahlt das?
Im Ohr oder hinter dem Ohr: Welches Hörgerät passt besser?
Elektronische Ohren für Gehörlose
Wer gut hört, hat gut reden: Tipps im Umgang mit Schwerhörigen
Der Lohn für einen guten Plan
Outro: Ein neues Ziel
Nachwort – (nicht nur) für Menschen mit Morbus Menière
Danksagung
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Intro: So ein Schwindel!
Gegen ein Uhr früh ist die Party am Kochen. Zweihundert Menschen feiern, tanzen und lachen vor den Lichtern eines gigantischen Weihnachtsbaums, der in dem zwei Stockwerke hohen Festsaal im Herzen Hamburgs erstrahlt. An Bars auf zwei Etagen werden die Gäste mit Weihnachtspunsch und reichlich Longdrinks versorgt. Entsprechend enthemmt ist die Meute.
Ich dagegen bin gar nicht angeheitert, sondern wie immer nüchtern und hoch konzentriert. Das hier ist mein Job, und es geht allein um das Vergnügen der Gäste. Ich bin DJ und stehe seit Stunden direkt neben zwei meiner sechs Lautsprecher, über die ich einen Hit nach dem anderen auf die Tanzfläche im Erdgeschoss abfeuere.
Zwar trage ich einen maßangefertigten Gehörschutz, doch trotz der beiden Stöpsel in meinen Gehörgängen dröhnen die Bässe durch meinen Körper, meine Knochen und mein pulsierendes Blut. Dieses dumpfe Wummern begleitet mich nun schon seit zwölf Jahren bei meinem Beruf als DJ, und ich bin daran gewöhnt. Jetzt allerdings nehme ich noch ein ungesundes Knarzen in meinem linken Ohr wahr. Das erinnert mich an mein erdrückendes Berufsgeheimnis: Ich bin einseitig schwerhörig. Seit einem Hörsturz vor drei Jahren nehme ich auf der linken Seite nur noch dreißig Prozent aller Töne wahr. Im Alltag trage ich auf dieser Seite stets ein winziges Hörgerät, tief in meinem Gehörgang verborgen, das noch nie jemandem aufgefallen ist.
Leider ist vor Kurzem noch ein weiteres Problem dazugekommen, das laut meiner Ärztin von diesem Ohr ausgeht: Schwindelattacken. Ich hatte seit dem Sommer drei Anfälle erlebt, die mich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen haben. Ich hatte weder stehen noch laufen können und mich übergeben. Erst Stunden später hatte sich meine Wahrnehmung wieder beruhigt. Ich darf gar nicht daran denken, dass mir so etwas jemals während eines Auftritts passieren könnte.
Ich darf nicht daran denken, nicht hier und jetzt, auf dieser Weihnachtsfeier, denke ich, und folglich denke ich ja doch daran. Da passiert es. Zunächst ist es eine leichte Bewegung des gesamten Gesichtsfeldes. Für einen Moment hoffe ich, dass es nur eine kleine Kreislaufschwäche ist. Doch dann wird aus der flüchtigen Bewegung ein Hüpfen. Der Bildschirm meines Rechners, über den ich Musik auflege, springt vor meinen Augen in schnellem Takt nach oben, allerdings ohne wieder herunterzufallen. Stattdessen fängt er direkt wieder von unten an. Wie eine Schleife in einem Film, die immer wieder von vorne abgespielt wird. Und das im Schnellvorlauf. Es hüpft, hüpft, hüpft.
Jetzt weiß ich, dass es ein Anfall ist. Kein Zweifel. Panik schnürt meine Brust zu. Was soll ich tun? Obwohl ich von hunderten Menschen umgeben bin, bin ich ganz allein auf meiner kleinen Bühne. Ich kann hier nicht weg! The Show Must Go On.
Ich klammere mich am Rand meines weißen DJ-Pults fest wie an der Reling eines Schiffs auf hoher See. Dabei versuche ich, mit meinen Augen einen festen Punkt zu finden und das Hüpfen der blinkenden Lichter an meinem Mischpult allein durch Willenskraft aufzuhalten. Vergeblich. Stattdessen wird aus dem Hüpfen ein Kreisen gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt habe ich einen handfesten Schwindel. Weihnachtsgans und Rotkraut rotieren ebenfalls in meinem Magen. Mir wird schlecht.
Ich muss mich zusammenreißen, denke ich. Meine Hände bewegen sich auf der Tastatur meines Rechners, ohne dass ich sie sehen kann. Ich denke an Last Christmas von Wham, und meine Finger finden jeden einzelnen Buchstaben von alleine. Ich ertaste den Regler an meinem Mischpult und starte wie in Trance die Weihnachtshymne. Wie ich dem Gejohle von der Tanzfläche entnehme, die ich mittlerweile gar nicht mehr erkennen kann, kommt es gut an. Das wird mir etwas Zeit verschaffen, doch ich brauche dringend professionelle Hilfe. Jetzt sofort.
In meiner Verzweiflung greife ich nach meinem Smartphone. In dem bunten Wirbel vor meinen Augen versuche ich, auf dem Touchscreen drei kleine Zahlen zu finden. Irgendwie schaffe ich es, die Notrufnummer 112 zu wählen. Die kompetente Stimme am anderen Ende ist trotz des Lärms erstaunlich gut zu verstehen. Ich beschreibe über die laute Musik hinweg meine Symptome. Man verspricht mir, jemanden zu schicken. Bis dahin heißt es durchalten!
Ich schaffe es, einen weiteren Song abzuspielen. Ein betrunkener Gast taucht aus dem Nichts auf und brüllt mir mit einer Gin-Tonic-Fahne in mein krankes Ohr, ich solle jetzt endlich Helene Fischer spielen. Ich muss würgen und schlucke kräftig, um die Weihnachtsgans bei mir zu behalten. Da ich mit zusammengepresstem Kiefer nicht reden kann, nicke ich zur Antwort einfach nur. Diese kleine Kopfbewegung verwandelt den ganzen Saal vor meinen Augen in ein Erdbebengebiet der Stufe zehn: globale Katastrophe.
Die nächsten Minuten sind die Hölle. Eine unsichtbare Kraft will mich unbarmherzig zu Boden reißen, der Lärm aus den Lautsprechern ist unerträglich, und die Feier wirbelt um mich herum wie ein Tornado. Endlich kämpfen sich zwei Menschen in Uniform durch die Menge, wie ich aus meinem Karussell heraus vage erkennen kann. Meine Retter sind da! Ein junger Mann und eine Frau treten hinter das DJ-Pult und stützen mich von beiden Seiten. Er sagt: »Wir müssen jetzt mal wohin, wo es ruhiger ist. Können Sie irgendeine Musik laufen lassen?«
Ich wähle eine Playlist, die immerhin ein paar flotte Titel enthält. Abendfüllend wird das zwar nicht, aber egal, Hauptsache erst mal raus hier! Die beiden rettenden Engel führen mich mit strammem Griff an beiden Armen in Richtung Ausgang. Das bleibt nicht unbemerkt: Aus den Augenwinkeln erkenne ich schemenhaft, wie sich eine Horde Weihnachtskobolde aus der Gästeschar löst und hinter meinem DJ-Altar sammelt. Gleich werden diese vom Alkohol entfesselten Dämonen versuchen, selbst DJ zu spielen und meine heiligen Geräte entweihen. Das ist gar nicht gut: Da kann man eine Menge kaputt machen. Doch ich kann nichts dagegen tun. Die Sanitäter führen mich durch die Tür hinaus, und ich lasse meine Musikanlage im Wert von zehntausend Euro zurück bei den Kreaturen der Nacht.
Man setzt mich in einem ruhigen Treppenhaus auf eine Stufe. Irgendjemand reicht mir einen Plastikeimer, und endlich muss ich nichts mehr zurückhalten. Würgend fülle ich den rettenden Bottich bis zur Hälfte mit meinem Mageninhalt. Mein Hemd wird geöffnet, Elektroden befestigt, mein Blutdruck gemessen. Schließlich kommt das Urteil des Sanitäters: »So, Herr Sünder, da gibt es nur eins: Wir bringen Sie ins Krankenhaus.«
Ich stammele, dass ich noch etwas Wichtiges vom DJ-Pult holen möchte. Der Sanitäter sieht das anders: »Sie gehen da nicht mehr rein. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir holen es.«
Man bringt mir meine Umhängetasche mit meinen wichtigsten Wertgegenständen und einem meiner Laptops. Wenig später sitze ich im rückwärtigen Teil eines Krankenwagens, der mit Blaulicht durch das Bahnhofsviertel düst, und kotze in einen röhrenförmigen Plastikbeutel. Die stürmische Fahrt ist zum Glück nur kurz, und wir landen in irgendeinem Krankenhaus, ich habe keine Ahnung, wo genau. Ich werde auf einen Rollstuhl gesetzt (an Laufen ist mittlerweile nicht mehr zu denken) und reingekarrt. Dann liege ich plötzlich ausgestreckt auf einer Matratze und starre an die Decke eines Flurs. Zunächst denke ich, dass ich weiterbewegt werde, doch in Wirklichkeit sind es die Gipsplatten und die Neonröhren über mir, die sich zu bewegen scheinen.
Schließlich werde ich tatsächlich weitergerollt, und eine sympathische Ärztin hängt mich an einen Tropf, während sie mir Fragen stellt. Sie hat den Verdacht, es könnte eine Krankheit sein, Morbus irgendwas. Das erste Wort kommt mir bekannt vor, das zweite klingt Französisch und sagt mir nichts. Während wir reden, werde ich müde. Die Ärztin sagt, in dem Tropf sei ein Medikament gegen den Schwindel. Ihre Stimme entfernt sich. Ich werde samt Tropf auf ein Zimmer gerollt, und dann ist es endlich still. Bis auf ein schrilles Pfeifen. Das ist aber nur in meinem Kopf, und ich kenne es allzu gut. Seit Besuchen von Diskotheken als Teenager habe ich auf beiden Seiten Ohrgeräusche, sogenannten Tinnitus, und wirklich still ist es für mich daher nie.
Ich und meine Ohren. Wir haben viel zusammen durchgemacht. In den letzten zwölf Jahren haben sie mich als Musiker und DJ ernährt, während ich sie zum Dank Tag und Nacht überfordert habe. Nun scheinen sie mich endgültig im Stich gelassen zu haben. Wie soll das nun weitergehen mit mir und der Musik? Kann ich noch auflegen? Wenn nein, wovon soll ich dann leben? Ich denke darüber nach, dass ich mich mein ganzes Leben lang mit größter Selbstverständlichkeit auf meine Ohren verlassen habe. Doch was weiß ich wirklich über sie? So gut wie nichts!
Um mich von meiner unangenehmen Situation abzulenken, lasse ich meine Gedanken kreisen. Obwohl ich hundemüde bin, tauchen viele Fragen in meinem Kopf auf. Wie funktioniert Hören eigentlich, und wie ist es entstanden? Wie merken wir, ob ein Klang von vorne oder hinten kommt? Ist es normal, dass wir im Alter schwerhörig werden, oder lässt sich das vermeiden? Warum haben so viele Menschen Tinnitus, wie ich, und warum nehmen wir Geräusche wahr, die gar nicht existieren? Verarbeiten wir Sprache eigentlich anders als Musik? Und was mich als DJ brennend interessiert: Warum wollen die Leute auf Partys und im Radio immer wieder dieselben alten Hits hören?
In dieser Nacht, während ich einsam am Tropf hänge, beschließe ich, die Geheimnisse des Hörens zu ergründen. Ich möchte wissen, wie meine Ohren funktionieren. Doch wen kann ich dazu befragen? Da fällt mir ein, dass mein langjähriger Freund Andreas nicht nur Medizin und Psychologie studiert hat, sondern auch in einem großen Pharmaunternehmen arbeitet, das seit Kurzem auch Hörprobleme erforscht. Wenn das kein Wink des Schicksals ist! Bestimmt kann er mir etwas zu dieser Krankheit sagen, diesem Morbus Dingsbums, den die Ärztin vorhin erwähnt hatte. Gleich morgen werde ich ihn anrufen. In acht Tagen ist Heiligabend. Vielleicht erlebe ich ja mein persönliches Weihnachtswunder, und er sagt mir, dass sie gerade ein neues Medikament entwickelt haben, mit dem meine Ohren bald wieder fit sind. Bei diesen tröstlichen Gedanken versinkt mein Bewusstsein endlich in tiefschwarzer Stille.
TEIL I: DAS WUNDER DES HÖRENS
Am Anfang war die Stille: Eine akustische Reise zur Entstehung des Lebens
»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« So heißt es in der Bibel (Johannes 1,1). Wissenschaftler vermuten den Anfang aller Dinge im berühmten Urknall. Doch beide Varianten haben einen entscheidenden Schönheitsfehler: Weder ein Wort noch ein Knall waren bei der Entstehung des Universums hörbar. Denn es gab weder Luft, in der sie sich hätten ausbreiten können, noch irgendwelche Zuhörer. Beide sollten erst Milliarden Jahre später in der Atmosphäre des Planeten Erde entstehen. Insofern können wir sagen: Am Anfang war die Stille.
Vor rund 13,8 Milliarden Jahren geschah das Großereignis, das fälschlicherweise als Urknall bezeichnet wird: Völlig lautlos entstanden Materie, Raum und Zeit aus unendlich hoch verdichteter Energie. Seither dehnt sich unser Universum munter aus. Die ersten rund neun Milliarden Jahre können wir getrost überspringen: Für uns Erdenbewohner wird die Story erst interessant, als vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren jene heiße Kugel aus geschmolzenem Gestein entstand, auf der wir heute leben. Während unser Planet langsam abkühlte, wurde er immer wieder von gewaltigen Gesteinsbrocken bombardiert, die mit verheerender Wirkung einschlugen. Etwa 100 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde wurde durch den Zusammenprall mit einem etwa marsgroßen Planeten so viel Materie in den Orbit geschleudert, dass daraus unser Mond entstand. Auch das erzeugte keinerlei Geräusch, da es noch immer keine Atmosphäre und damit auch keine Luft gab. Erst durch die Aktivität von Vulkanen entstand in Millionen von Jahren eine Hülle aus Gasen um unseren Planeten. Würde ein heutiger Mensch mit einer Zeitmaschine dorthin zurückreisen, könnte er mangels Sauerstoff in der heißen Luft zwar nicht atmen, würde aber zumindest etwas hören: nämlich die gewaltigen Eruptionen der Vulkane. Bloß gab es damals keine Zuhörer.
Nachdem die Erde ausreichend abgekühlt war, wurde die Geräuschkulisse deutlich beruhigender. Für Schlechtwettermuffel wie mich vielleicht etwas zu beruhigend, um nicht zu sagen, deprimierend – es regnete nämlich nonstop. Und zwar nicht nur einen trüben Nachmittag lang: Das weltweite Prasseln von Regentropfen dauerte über vierzigtausend Jahre!
Diese – im kosmischen Maßstab betrachtet, kleine – Regenperiode reichte aus, um Ozeane auf unserem Planeten zu bilden. Doch auch das Rauschen der Meere blieb anfangs ungehört, da noch keine Lebewesen mit Ohren existierten. In den Ozeanen entwickelten sich Einzeller und schließlich Blaualgen. Für die nächsten knapp drei Milliarden Jahre waren die stummen Wasserbewohner damit beschäftigt, durch Photosynthese Sauerstoff zu erzeugen. Dieser wurde schließlich in die Atmosphäre freigesetzt, und eine schützende Ozonschicht entwickelte sich rund um den Planeten.
Unter diesen Umweltbedingungen sollte vor rund 540 Millionen Jahren ein weiteres Großereignis mit einem explosiven Namen erfolgen, das unser Leben bis heute bestimmt: die sogenannte kambrische Explosion. Diesmal explodierte nicht wirklich etwas, dieser Begriff bezeichnet vielmehr einen gigantischen Evolutionsschub. Binnen weniger Millionen Jahre entwickelten sich Vertreter fast aller heutigen Tierstämme – also auch unsere entfernten Vorfahren. Die Gründe für diesen plötzlichen Sprung in der Evolution sind unter Wissenschaftlern umstritten. Fakt ist: Nach über dreizehn Milliarden Jahren seit Entstehung des Universums, in denen kein einziger Klang gehört wurde, bevölkerten plötzlich die ersten Lebewesen unseren Planeten, die Schall wahrnehmen konnten. Doch wie kam es zur Entwicklung des Gehörs?
Voraus ging die Entstehung eines anderen lebenswichtigen Wahrnehmungsapparates, der sich heute ebenfalls in unseren Ohren befindet, und über den ich mir bis zum Ausbruch meiner schwindelerregenden Krankheit nie wirklich Gedanken gemacht hatte: das Gleichgewichtsorgan.
Oben und unten im Urzeitmeer und wie Flusskrebse den Kopfstand lernen
Bereits Millionen von Jahren vor der kambrischen Explosion schwammen Hohltiere im archaischen Ozean. Zwar besaßen diese Urzeitquallen weder Knochen, Augen oder Ohren, aber sie hatten dennoch etwas Wichtiges mit uns Menschen gemeinsam: Sie konnten zwischen oben und unten unterscheiden. Die Hohltiere besaßen ein primitives Gleichgewichtsorgan, wie es in ähnlicher Form auch heute noch bei Quallen und Krebsen vorkommt. Es handelte sich um eine kleine, flüssigkeitsgefüllte Blase. Darin befand sich ein winziges Steinchen aus Kalk. Das Kalksteinchen war schwerer als die umgebende Flüssigkeit und folgte daher stets der Erdanziehungskraft, sank also grundsätzlich nach unten. An der Unterseite des Bläschens waren feine Sinneshärchen angeordnet. Wenn der Kalkstein auf diese Härchen traf, wurden sie abgeknickt, ähnlich wie Kippschalter. Sie erzeugten dann einen elektrischen Reiz, der an das Nervensystem weitergegeben wurde. Dieses primitive Netz aus Nervenbahnen war im ganzen Körper der Hohltiere verzweigt und funktionierte so gut, dass sie kein Gehirn benötigten und folglich keines besaßen. Da das Steinchen je nach Lage des Hohltiers auf unterschiedliche Sinneshärchen traf, konnte sich das Wesen räumlich orientieren. Über den konkreten Nutzen dieser Wahrnehmung lässt sich nur spekulieren. Wahrscheinlich verhinderte sie, dass die Hohltiere zu tief tauchten, wo der zunehmende Druck der Wassermassen sie zerquetscht hätte.
Bei heutigen Quallen und anderen wirbellosen Tieren ist die gesamte Innenwand der Gleichgewichtsbläschen rundum mit Sinneshärchen besetzt. Stellen Sie sich das vor wie einen Ball, in dessen Innerem sich überall kleine Kippschalter befinden. Eingeschlossen in diesen Ball ist zudem eine kleine, schwere Kugel. Wenn Sie den Ball über den Boden rollen, anheben oder schütteln, aktiviert die Kugel mit ihrem Gewicht immer wieder unterschiedliche Schalter. Bewegt sich die Kugel von einem Schalter weg, springt dieser zurück in seine Ausgangsposition.
Dieses System gerät übrigens gründlich durcheinander, wenn man die Erdanziehungskraft überlistet. Das gelang Forschern bei einem Experiment mit Flusskrebsen.
Um wachsen zu können, müssen die Tiere ihren Panzer abwerfen. Zwar bilden sie danach einen neuen Panzer, allerdings keine Kalksteinchen mehr. Stattdessen schließen sie in ihre Gleichgewichtsbläschen Sandkörner aus der Umgebung ein. Diese ersetzte man durch Metallkörnchen, die von den Tieren für Sand gehalten und ahnungslos einverleibt wurden. Hielt man nun einen Magneten über einen solchen Krebs, schwamm er mit dem Bauch nach oben – weil das Metallkörnchen in diese Richtung gezogen wurde und das Tier nun glaubte, dort sei unten. So verwirrt diese Krebse beim unfreiwilligen Rückenschwimmen auch gewesen sein mochten, über Eisenmangel konnten sie jedenfalls bestimmt nicht klagen …
Halten wir hier abschließend fest, dass der Gleichgewichtssinn einer unserer evolutionär ältesten Sinne ist – lange bevor Ohren das Hören oder Augen das Sehen ermöglichten. Das ist insofern logisch, als die Notwendigkeit für weitere Sinne erst bei einem Organismus besteht, der sich bewegen kann. Denn was nützt die Bewegung, wenn man keine Ahnung hat, wohin sie führt? Zur Orientierung ist die Wahrnehmung der eigenen Körperhaltung und Bewegungsrichtung unumgänglich. Und damit kommen wir zum nächsten Schritt in der Evolution des Ohrs.
Das Haar in der Suppe und wie Bewegung zu Information wird
Die ersten Lebewesen, die hören konnten, waren Fische. Wir müssen uns also zunächst eine Welt unter Wasser vorstellen, in der Geräusche wahrgenommen wurden. Doch was heißt eigentlich »Wahrnehmung«? Der Ursprung aller Wahrnehmung ist bei jedem Lebewesen die Verwandlung äußerer Reize in elektrische Signale, die dann im Nervensystem weiterverarbeitet werden. Ohne Strom nix los, könnte man als übereinstimmendes Gesetz von Biologie und Technologie festhalten.
Doch was genau wird beim Hören in eine elektrische Mahlzeit für informationshungrige Nervenzellen verwandelt? Die Antwort lautet: Bewegung. Wir haben bereits bei den Hohltieren und Krebsen gesehen, wie ein kleines Kalkkörnchen durch Berührung Sinneshärchen zur Erzeugung von elektrischen Impulsen anregt. Diese sitzen auf der Oberfläche von Zellen, die ihnen ihren Namen verdanken: den Haarzellen. Dank der sensiblen Härchen sind sie in der Lage, feinste Bewegungen in elektrische Impulse zu verwandeln und an das Nervensystem weiterzugeben.
Das gibt den Tieren allerdings lediglich Aufschluss über die Lage des eigenen Körpers und teilt ihnen überhaupt nichts von der äußeren Umgebung mit. Für das Hören ist damit die Bewegung der gesamtenUmgebung entscheidend – egal ob diese flüssig ist, wie das Wasser des Urzeitmeeres, oder gasförmig, wie die Luft um uns herum.
Der erste Schritt in der Entstehung des Hörens musste zwangsläufig die Entstehung einer Sinneszelle sein, die Bewegung übersetzen konnte in elektrische Signale, also ein Vorläufer der Haarzellen. Man geht davon aus, dass die erste dieser Zellen lange vor der kambrischen Explosion als zufällige Mutation in der Haut eines unbekannten Lebewesens entstand. Sie hatte zunächst keinen konkreten Nutzen, schadete dem Träger aber auch nicht. So wurde sie über Generationen hinweg weitergegeben und weiter vermehrt. Durch zusätzliche Mutationen und Umweltanpassungen fand sie einen Platz als Haarzelle in den Hohltieren. Von diesen überlebten schließlich nur noch diejenigen, die dank ihrer Gleichgewichtsbläschen nicht in den Tiefen des Meeres zerdrückt wurden. Haarzellen erwiesen sich somit als nützlich für den Erhalt der Art und wurden weitergegeben. Erst sehr viel später fanden sie ihren Platz in den Hör- und Gleichgewichtsorganen von weiterentwickelten Tieren und Menschen. Unser Gefühl für Gleichgewicht und unsere Hörfähigkeit hat also entwicklungsgeschichtlich dieselbe uralte Wurzel.
Nun also Butter bei die Fische, beziehungsweise Fische in die Ursuppe: Unsere flossenbesetzten Vorfahren waren zunächst taubstumm, besaßen aber ein primitives Gleichgewichtsorgan, das wahrscheinlich dem der Hohltiere ähnelte. Später entwickelte sich daraus das sogenannte Seitenlinienorgan, das bis heute in Fischen zu finden ist. Das Organ verläuft entlang beider Flanken über die gesamte Länge der Tiere und ist ein flüssigkeitsgefüllter Kanal, in dem sich Haarzellen befinden. Diese werden nun nicht mehr durch das Gewicht von Kalksteinchen angeregt, sondern durch die Bewegung des Wassers in unmittelbarer Umgebung. Diese überträgt sich auf die Flüssigkeit in dem Kanal und lässt die Härchen hin und her bewegen, etwa so, wie Algen auf dem Grund des Meeres durch die Strömung bewegt werden. Damit sind Fische in der Lage, Beutetiere zu registrieren oder auch gefährliche Räuber, die es auf sie selbst abgesehen haben. Auch Wasserströmungen werden wahrgenommen, um das ungewollte Abdriften zu vermeiden, ebenso um unbewegte Objekte zu orten, welche die Strömung beeinflussen. Das erhöht die Überlebenschancen der Spezies enorm, wie man an dem Erfolg dieses Prinzips sehen kann: Bereits 470 Millionen Jahre alte Fossilien eines primitiven Fischs namens Astraspis weisen Seitenlinienorgane auf. Dieser Wasserbewohner besaß übrigens auch schon Augen. Der Sehsinn alleine reichte aber offenbar nicht aus, um das Überleben der Art zu sichern – die Tiere benötigten zusätzliche Unterstützung durch das Seitenlinienorgan, um sich zu behaupten. Was konnte dieses Organ also, was die Augen nicht konnten? Es war im Grunde schon sehr nahe dran am Hören: Das Seitenlinienorgan machte für die Tiere unsichtbare Bewegung ihrer Umgebung spürbar, also die von Wasser. Allerdings konnten sie nur grobe Bewegungen wahrnehmen – die viel komplexeren und feineren Bewegungen, die durch Schall verursacht werden, ließen sich damit noch nicht erfassen.
Lange gingen Forscher davon aus, das menschliche Innenohr habe sich aus dem Seitenlinienorgan der Urzeitfische entwickelt. Neuerdings nimmt man jedoch an, dass sich das Innenohr unabhängig davon entwickelt hat, wobei sich beide Organe für ihre Entstehung wohl dieselbe Grundlage zunutze gemacht haben: nämlich Haarzellen. Die Suche nach dem Ursprung des Hörens hat uns also zum Haar in der Suppe geführt, besser gesagt zur Haarzelle in der Ursuppe.
Fünf Übersetzungen von Deutsch auf Fachchinesisch für Ärzte, Wissenschaftler und sonstige Fremdwortjunkies, die keine Alltagssprache beherrschen
Gleichgewichtsbläschen bei Hohltieren und Krebsen – Statozyste
Kalksteinchen im Gleichgewichtsorgan – Statolith, Otolith
Sinneshärchen einer Haarzelle – Sterozilie, Stereovilli
Flüssigkeiten in den häutigen und knöchernen Teilen des Innenohrs –Endo- und Perilymphe
Gespanntes Häutchen in der Gehörschnecke, auf dem Haarzellen sitzen – Basilarmembran
Ein Telefonat auf Ohrenhöhe
»Sagte der Arzt vielleicht Morbus Menière?« Das zweite Wort hört sich durch mein Smartphone an wie Menieer.
Ich denke kurz nach. »Ja, genau das ist es!«
Am anderen Ende der Leitung herrscht Stille. »Andreas, bist du noch da?« Die mobile Verbindung hier im Krankenhaus ist alles andere als stabil, vielleicht ist sie abgebrochen.
»Ja, ja, ich bin noch da«, höre ich die Stimme meines Freundes und erfahrenen Mediziners. Ich habe Andreas gleich nach einer verwirrenden Visite des Stationsarztes am frühen Vormittag angerufen. Ich hatte bei der sogenannten »Aufklärung« durch den Krankenhausarzt nur Bahnhof verstanden und hoffe nun, dass mein Freund mir erklären kann, was los ist. Mein Schwindel ist mittlerweile fast weg, aber ich fühle mich nach der furchtbaren Nacht in dieser fremden Umgebung erschöpft, und der Boden scheint leicht zu wanken, sobald ich mich aus dem Bett erhebe.
»Ist das gut oder schlecht, wenn es wirklich diese Krankheit ist?«, will ich wissen.
»Man muss mit solchen vorschnellen Diagnosen vorsichtig sein«, erwidert Andreas. »Was genau hat er denn gesagt, wie er darauf kommt?«
Ich schließe die Augen und versuche mich zu erinnern. Es war alles so schnell gegangen. Ein recht junger Mann im weißen Kittel war hereingerauscht, hatte mir ein merkwürdiges Gerät mit eingebauten Vergrößerungsgläsern vor die Augen gehalten und mich dadurch angestarrt. Das Licht aus diesem Ding hatte mich derart geblendet, dass mir die Tränen über die Wangen gelaufen waren. Was hatte er da noch gesagt?
»Er sprach von einem … wie hieß das … Nüstern … Nüsta …«
Andreas hilft: »Nystagmus?«
»Genau! Was ist das, und was meinte er damit?«
»Das heißt, dass sich deine Augen unkontrolliert bewegen. Deshalb war dir auch schwindelig. Ok, der Nystagmus war also noch vorhanden?«
»Ja, er war wohl noch leicht da. Dann stellte der Arzt mir einige Fragen und sagte, dass es wohl Morbus Menière sei und dass man da operativ was machen kann.«
»Um Gottes willen!«, dröhnt es aus dem Hörer.
Ich zucke erschrocken zusammen. »Steht es so schlimm um mich?«
»Nein, nein, sorry, das bezog sich nicht auf dich, sondern auf den Arzt! Es ist total überstürzt, was der da abgelassen hat. Kannst du mir sagen, welche Fragen er dir gestellt hat?«
»Er fragte, ob mein Gehör beeinträchtigt ist. Du weißt ja, dass ich links ein Hörgerät trage, und das sagte ich auch. Dann wollte er noch wissen, ob ich Tinnitus habe und wie viele Schwindelattacken ich vorher hatte. Ich sagte drei und wollte erzählen, dass ich als DJ seit Jahren Lärm und Nachtarbeit ausgesetzt bin. Kann ja sein, dass das etwas damit zu tun hat. Das hat ihn aber überhaupt nicht interessiert. Er erzählte etwas von, warte, ich glaube Endolymphe und Hydro-noch-irgendwas. Man könnte das aber operieren und den Gleichgewichtsnerv links durchtrennen oder das Gleichgewichtsorgan auf dieser Seite mit irgendwelchen Antibiotika zerstören. Das Gehirn würde sich dann komplett auf die gesunde rechte Seite einstellen, und dann hätte sich das mit dem Schwindel erledigt.«
Ich höre ein Schnauben am anderen Ende der Leitung.
»Unglaublich«, kommentiert Andreas. »Erstens: Anhand der vorliegenden Fakten lässt sich noch keine eindeutige Diagnose aussprechen. Deine Symptome deuten zwar auf Morbus Menière hin, aber es kann auch etwas anderes sein. Zweitens: Selbst wenn es Menière sein sollte, ist so eine Operation das Allerletzte, was man machen sollte, denn dabei kannst du auf der betroffenen Seite komplett taub werden.«
Mir stockt der Atem. Die ganze Welt nur noch in Mono zu hören statt in Stereo ist für mich als Musiker eine Horrorvorstellung!
Andreas fährt fort: »Man macht das höchstens bei ganz, ganz schweren Fällen, bei denen die Betroffenen seit Jahren so häufig Schwindelattacken haben, dass sie kein normales Leben mehr führen können. Nichts deutet darauf hin, dass das bei dir so sein wird. Es gibt Menschen mit dem Befund Morbus Menière, die im ganzen Leben nur zwei, drei Anfälle haben. Man kann das ganz stark über die eigene Lebensführung beeinflussen. Lärm und Stress meiden, Sport, regelmäßiger Schlaf, gesunde Ernährung und so weiter. Und wie gesagt: Zum jetzigen Zeitpunkt ist überhaupt nicht gesagt, dass es bei dir wirklich Morbus Menière ist. Diese Krankheit ist sehr selten. Nur einer von tausend ist davon betroffen.«
Ich bin baff. Davon hatte der Arzt vorhin überhaupt nichts gesagt. Über die schwerwiegende Operation hatte er mit einer solchen Sicherheit und Beiläufigkeit gesprochen, dass ich seine Worte nicht angezweifelt hatte – zumal ich sowieso nur die Hälfte davon verstand. Als ich weitere Fragen stellen wollte, hatte er gehetzt auf seine Armbanduhr geblickt und erklärt, er würde jetzt am Wochenende die gesamte Station alleine betreuen. Daher müsste er nun weiter zu anderen Patienten, aber ich könnte Anfang der Woche mit einem Kollegen sprechen. Dann war er verschwunden und ich ratlos zurückgeblieben. Mit Andreas am anderen Ende meiner persönlichen Hotline sieht das alles plötzlich ganz anders aus!
Im Folgenden besprechen wir ausführlich die Möglichkeiten. Ein Wundermittel für die Ohren hat seine Firma leider noch nicht entwickelt, das Thema sei komplex, und man müsse noch viel forschen. Ob es sich wirklich um Morbus Menière handelt, kann laut Andreas nur sichergestellt werden, wenn eine krankhafte Erweiterung des Innenohrs vorliegt, die sich Endolympathischer Hydrops nennt. Den Begriff lasse ich mir buchstabieren und notiere ihn in einem kleinen Notizbuch, das mir in den kommenden Wochen bestimmt von großem Nutzen sein wird. Andreas fährt fort, man könne das nur mit einem MRT rausfinden, einem technischen Verfahren, das Flüssigkeiten im Körper auf einem Bildschirm sichtbar machen kann. Mir fällt ein, dass der Arzt davon gesprochen hatte, sie würden so etwas hier im Krankenhaus durchführen. Wenn ich das machen wollte, müsste ich allerdings für ein paar Tage hierbleiben, und darauf habe ich eigentlich überhaupt keine Lust.
»Mach das unbedingt«, rät Andreas. »Wenn du den Befund hast, wissen wir mehr. So lange würde ich mir an deiner Stelle jetzt erst mal keine Gedanken machen, ob das Morbus Menière ist oder nicht.«
Okay, ich muss mich also auf einige Zeit im Krankenhaus einstellen und mich demnächst in eine MRT-Röhre legen. Das ist ja erst mal nicht so schlimm, denke ich.
»Da wäre allerdings noch eine Sache, die du wissen solltest«, fährt Andreas zögerlich fort. »Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm.«
Ich hole tief Luft und stelle mich auf schlechte Nachrichten ein. »Schieß los.«
»Man muss dir für dieses Verfahren ein Kontrastmittel spritzen.«
Ich atme auf und verkünde stolz: »Ach so, damit komme ich schon klar. Ich habe keine Angst vor Spritzen.«
»Das ist schon mal gut. In diesem Fall muss man dir allerdings eine Spritze in beide Ohren geben.«
»Wie jetzt, in beide Ohren? Etwa in den Gehörgang?«
»Sie müssen durch das Trommelfell stechen und das Kontrastmittel ins Mittelohr spritzen.«
Mir läuft ein Schauer den Rücken hinunter. Furchtbar! Die Vorstellung einer langen Spritze im Ohr ist für mich schlimmer als eine Zahnwurzelbehandlung bei einem sadistischen Gefängnisarzt!
Andreas ergänzt: »Aber keine Angst, das wird vorher lokal betäubt. Das ist vielleicht etwas unangenehm, wird aber nicht wehtun.«
»Okay. Immerhin. Danke für die Vorwarnung.« Von alledem hatte der Arzt vorhin natürlich auch nichts gesagt. Wir verabschieden uns, und nachdem ich aufgelegt habe, zeigt das Display meines Smartphones, dass wir eine Dreiviertelstunde geredet haben. Das waren ungefähr vierzig Minuten mehr, als der Stationsarzt mit mir verbracht hat. Jetzt fühle ich mich gewappnet für eine weitere Begegnung mit dem deutschen Gesundheitssystem, das für Patienten mit lebensverändernden Diagnosen offensichtlich wenig Zeit hat. Doch nun habe ich zwei Asse im Ärmel: Ich besitze wertvolles Fachwissen und kann Andreas jederzeit anrufen, wenn ich weiteren Rat brauche.
Als Nächstes wähle ich zum wiederholten Mal an diesem verrückten Tag die Nummer meiner Frau, um ihr von meinen neuen Erkenntnissen zu erzählen. Außerdem müssen wir besprechen, ob sie meinen Transporter von der gestrigen Party-Location abholen kann, samt meiner Musikanlage. Ich hoffe, dass meine Technik die Nacht mit der unbeaufsichtigten Meute hinter den Reglern heil überstanden hat und frage mich, wie diese Feier wohl zu Ende ging ohne DJ …
Schall la la la la
Schallkonzert, Erster Akt: Von Wellen, die eigentlich Kugeln sind
Um begreifen zu können, wie sich unser Gehör entwickelt hat und zu welch unglaublichen Leistungen es fähig ist, sollten wir zunächst einem allgegenwärtigen Naturphänomen auf den Grund gehen: dem Schall. Wir hatten festgestellt, dass Urzeitfische über die Haarzellen im Seitenlinienorgan zwar gröbere Bewegungen des Wassers wahrnehmen konnten, aber noch keinen Schall, oder genauer, Schallwellen. Bestimmt haben Sie diesen Begriff schon oft gehört, und vielleicht ging es Ihnen ähnlich wie mir: Ich dachte dabei an Wellen auf der Oberfläche von Wasser, wie sie an einem See oder am Meer vorkommen. So ähnlich, glaubte ich, würde der Schall auf und ab durch die Luft schwingen. Diese Vorstellung ist allerdings falsch: Schallwellen sehen ganz anders aus!
Zunächst einmal sehen sie für uns natürlich wie gar nichts aus – unsere Augen können sie nämlich nicht erfassen. Um eine bildhafte Vorstellung davon zu gewinnen, was Schallwellen sind und wie sie sich ausbreiten, müssen wir die Welt des Sichtbaren verlassen. Nehmen wir an, Sie klatschen in die Hände, und wir würden diese Bewegung mit einem gigantischen Mikroskop vergrößern. Dann könnten wir sehen, dass der Raum zwischen Ihren Händen und darum herum keineswegs leer ist. Dort tummeln sich Abermillionen Luftmoleküle. Der Einfachheit halber stellen wir uns diese für einen Moment wie kleine blaue Kügelchen vor (auch wenn sich der ein oder andere Teilchenphysiker bei dieser Darstellung vermutlich die Haare raufen wird). Ehe sich Ihre Hände in Bewegung setzen, schweben diese Kügelchen gleichmäßig zwischen ihnen verteilt. Durch unser Mikroskop können wir alles in Zeitlupe sehen: Ihre Handflächen bewegen sich langsam aufeinander zu und schieben die Kügelchen immer weiter zusammen. Die blaue Farbe verdichtet sich zwischen Ihren Händen, da immer mehr Luftmoleküle aufeinander zugeschoben werden. Dann treffen Ihre Handflächen aufeinander, und das ist der Moment, in dem das Geräusch des Klatschens entsteht. Wenn sich Ihre Hände berühren, ist dazwischen logischerweise kaum noch Platz für unsere blauen Luftmoleküle. Sie werden schlagartig an den Seiten herausgepresst. Die Moleküle schubsen benachbarte Moleküle an, die an ihre Nachbarn stoßen und diese wiederum in Bewegung setzen. Da sich die Teilchen nicht immer gerade treffen, sondern auch seitlich versetzt, formen die Querschläger eine geschlossene Kugel um Ihre Hände herum. Das ist uns ein Standbild wert. Also Pause!
Wir zoomen in das Innere der Kugel und stellen fest, dass sich hier die Moleküle bereits wieder gleichmäßig verteilt haben, so wie es vor dem Klatschen war. Die verdichtete blaue Wand der Kugel hat also nur eine bestimmte Dicke, und diese Verdichtung wird immer weitergegeben an benachbarte Molekülgruppen. Kügelchen stößt Kügelchen an, wie bei Dominosteinen, die sich gegenseitig umwerfen. Der Unterschied zu Dominosteinen ist, dass die Moleküle anschließend den ursprünglichen Abstand zueinander von alleine wieder einnehmen, während die Steine einfach liegen bleiben. Natürlich landet am Ende kein Molekül wieder genau dort, wo es vorher war, doch der Abstand zwischen den Molekülen ist dann wieder derselbe wie anfangs. Denn die Teilchen stoßen sich im Ruhezustand gegenseitig ab und halten sich von alleine auf Abstand.
Lassen wir den Film nun in Zeitlupe weiterlaufen. Die Kugel dehnt sich aus und wird immer größer, verteilt sich im ganzen Raum, und ein Teil davon dringt in Ihre Gehörgänge ein. Sobald die Luftmoleküle Ihr Trommelfell erreichen, gerät dieses winzige Häutchen in Schwingung. Dadurch können Sie das Klatschen nach einer weiteren Umwandlung im Mittelohr und Innenohr hören. Fassen wir an dieser Stelle zusammen, was wir über die Ausbreitung von Schallwellen bei einem Klatschen gelernt haben:
Schallwellen bestehen aus Luftmolekülen, die sich gegenseitig anschubsen wie Dominosteine. Schallwellen breiten sich kugelförmig um die Schallquelle aus.Die Wand der Schallkugel besteht aus zusammengeschobenen Luftmolekülen, während im Inneren der Kugel wieder die ursprüngliche Luftdichte herrscht.Schallwellen sind letztlich nichts anderes als eine systematische Veränderung des Luftdrucks, die sich räumlich ausbreitet.Schallkonzert, Zweiter Akt: Von Wellen, die eigentlich Zwiebeln sind
Die meisten Geräusche sind komplexer als ein einfaches Klatschen. Dieses ist – im Gegensatz zum anfangs skizzierten Urknall – tatsächlich ein Knall, also eine stoßartige Dichteänderung der Luft. Das ist ein zwar lautes, aber sehr kurzes Geräusch. Wie sieht eine Schallwelle aber bei längeren Tönen aus? Zum Beispiel bei einem Pfiff oder einem laufenden Motor?
Für unser Mikroskop bietet sich das Beispiel eines klingenden Weinglases an. Schlagen wir mit einem Löffel gegen das Glas, wird es in Schwingung versetzt und stößt dabei die umgebenden Luftmoleküle an. Auch hier verbreitet sich die Bewegung wieder kugelförmig, doch statt einer einzigen Kugel entstehen über die Dauer der Schwingung ständig neue. In einem Standbild sieht die Formation der Luftmoleküle um das Glas herum aus wie eine Zwiebel. In Zeitlupe betrachtet bewegen sich die einzelnen Schichten der Zwiebel kontinuierlich von innen nach außen und vergrößern sich dabei.
Schallkonzert, Dritter Akt: Von Wellen, die einfach nur Chaos sind
Was unser Mikroskop sichtbar gemacht hat, ist als Gedankenspiel durchaus brauchbar. Im echten Leben sieht die Sache allerdings wesentlich komplizierter aus. Zunächst einmal passiert alles wahnsinnig schnell: Der Schall breitet sich in der Luft mit einer Geschwindigkeit von rund 343 Metern pro Sekunde aus. Egal ob Sie klatschen oder ein Glas anschlagen: Binnen Sekundenbruchteilen kommt die dominoartige Molekülbewegung bereits an den Wänden, der Decke und dem Boden des Raums an. Von jeder Barriere prallen die Moleküle zurück und werden in unterschiedlichen Winkeln in den Raum zurückgeworfen. Auch Möbel verändern die Bahn.
Hinzu kommt, dass im Alltag so gut wie nie nur ein einziges Geräusch zur selben Zeit zu hören ist. Nehmen wir an, das Glas wurde in einem Restaurant angeschlagen, wo jemand vor einer großen Hochzeitsgesellschaft eine Rede halten möchte. Ringsherum sind Stimmen zu hören, das Klirren von Besteck, das Rascheln von Kleidung, die Schritte der Kellner, leise Hintergrundmusik, Verkehr von der Straße. All diese Schallquellen formen Schallkugeln und Schallzwiebeln, die sich überlagern. Moleküle, die von einer Schallquelle angeschubst wurden, werden in der Luft von anderen bewegten Molekülen getroffen und vom Kurs gebracht. Wände, Kronleuchter, Tische und menschliche Körper lenken die Bewegungen ab. Suchen wir in einem Standbild in diesem Restaurant Kugel- oder Zwiebelformen, werden wir sie nicht finden. Stattdessen herrscht scheinbar ein einziges großes Chaos aus wild durcheinandergewirbelten Luftmolekülen.
Nicht so für unsere Ohren! Sie sind in der Lage, aus diesem Chaos herauszuhören, wo welcher Klang herkommt und was er bedeutet. Musik hört sich an wie Musik, Gläserklirren wie Gläserklirren, Stimmen wie Stimmen. Das Glas erklingt am Tisch in der Mitte, die Schritte des Kellners zur Rechten, das Lachen eines Gastes zur Linken. All das erkennen wir dank unserer Ohren sofort, ohne auch nur einen Moment darüber nachdenken zu müssen. Letztlich verdanken wir alle diese akustischen Eindrücke minimalen Schwingungen eines Häutchens, das nicht größer ist als der Nagel eines kleinen Fingers: dem Trommelfell. Bereits das Auftreffen einzelner Luftmoleküle auf das Trommelfell kann mit dieser hochsensiblen Membran wahrgenommen werden. Ohne das Trommelfell wären wir nahezu taub. Zeit also, uns anzuschauen, wie das kostbare Häutchen im Ohr eigentlich entstanden ist.
Wasserbewohner erobern das Land: Atmen durch die Ohren
Schallwellen breiten sich in Wasser ebenso kugelförmig aus wie in der Luft. Allerdings sind sie im flüssigen Element mit rund 1500 Metern pro Sekunde mehr als viermal schneller. Die Haarzellen im Seitenlinienorgan der Urzeitfische konnten sie nicht wahrnehmen. Wann genau Fische ein Gehör entwickelten, lässt sich nur mutmaßen. Das Wissen über die Bewohner unseres Planeten vor hunderten Millionen Jahren stammt überwiegend von Fossilien – Versteinerungen längst ausgestorbener Tiere. Leider sind innere Strukturen ihrer Körper häufig nicht erhalten geblieben. Dazu gehören auch Teile des Ohrs, wie das Trommelfell. Forscher können jedoch von heute lebenden Tieren Rückschlüsse auf unsere frühen Vorfahren im Wasser ziehen. Vor allem die berühmten Quastenflosser sind hilfreich bei der Suche nach den Ursprüngen des Hörens. Diese Fische gelten als »lebende Fossilien«, weil man bis ins letzte Jahrhundert hinein noch davon ausging, sie seien vor rund 70 Millionen Jahren ausgestorben. So alt sind die jüngsten versteinerten Funde, die ältesten datieren bis über 400 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Tatsächlich existierten die bis zu zwei Meter langen Tiere verborgen in den Tiefen des Meeres weiter, das erste lebende Exemplar wurde 1938 vor der Küste Südafrikas entdeckt. Noch heute können wir diese uralte Gattung dort und vor einer indonesischen Insel beobachten.
Quastenflosser besitzen nicht nur Seitenlinienorgane, sondern auch kleine Hörwarzen mit Haarzellen. Sie sind so empfindlich, dass sie die schnellen Schallwellen wahrnehmen können. Unter Wasser funktioniert das bei Quastenflossern und modernen Fischen wunderbar, da das Gewebe und die Körpersäfte der Tiere eine ähnliche Dichte haben wie ihre flüssige Umgebung. So stoßen die Wassermoleküle mit ihrer Dominobewegung direkt die Körpermoleküle an, und die Schallwellen breiteten sich in den Tieren ungehindert weiter aus. Ein Knochen des Kiefergelenks leitet beim Quastenflosser die Vibration an die eingekapselten Hörwarzen im Schädel weiter. Dadurch konnten bereits seine Vorfahren vor Millionen von Jahren Laute anderer Tiere in ihrer Umgebung wahrnehmen und sich vor Fressfeinden in Sicherheit bringen. Das Hören erwies sich als Überlebensvorteil und wurde weitervererbt.
Schwieriger wurde es, als die ersten Meeresbewohner das Land eroberten. Die Luft dort ist im Vergleich zum Wasser dünn, und ihre Schallwellen haben nicht die Kraft, den Fischkörper zu durchdringen. Dafür bietet die Luft reichlich Sauerstoff zum Atmen. Bei einem Urzeitvorfahren des heutigen Quastenflossers entwickelte sich die Fähigkeit, das Atmen und das Hören unter einen Hut zu bringen. Vor 370 Millionen Jahren hielt er sich an der Oberfläche von flachen Gewässern im Baltikum auf, wo er regelmäßig Luft holte. Dies tat er nicht wie wir durch Mund oder Nase, sondern durch das sogenannte Spritzloch. Sicherlich kennen Sie das von Walen und Delfinen, die durch ein solches Loch im Rücken Wasserfontänen ausspucken. Der Urzeit-Quastenflosser besaß zwei davon, hinter jedem Auge eines. Dadurch spuckte er aber kein Wasser aus, sondern wollte ganz im Gegenteil vermeiden, dass welches hineinfloss – schließlich hatte er es ja auf die Atemluft abgesehen. Vermutlich konnte er das Loch mit einem Kiemendeckel verschließen, wenn er abtauchte.
Forscher vermuten, dass spätere Nachfahren des Quastenflossers Amphibien auf dem Festland waren, bei denen sich aus dem Kiemendeckel das Trommelfell entwickelte. Noch heute haben wir Menschen in beiden Ohren eine Verbindung des Bereichs hinter dem Trommelfell mit unserem Rachen. Dieser schmale Kanal nennt sich Ohrtrompete. Würde nicht das Trommelfell den Gehörgang verschließen, könnten wir durch unsere Ohren Luft in die Lungen saugen. Allerdings ist die Ohrtrompete bei uns derart verengt, dass die Luftmenge sicherlich nicht zum Atmen reichen würde.
Die letzte Spritztour
Ich liege seitlich auf einem unbequemen Behandlungstisch und warte darauf, dass mir die Ärztin einen chemiegetränkten Wattebausch ins Ohr stopft. Das soll mein Trommelfell betäuben, ehe die Spritze mit dem Kontrastmittel hineingestochen wird. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe: vor der Nadel oder vor dem Ergebnis der Untersuchung. Zwar hatte Andreas geraten, ich sollte mir bis zur Diagnose keine Gedanken über Morbus Menière machen, doch die zwei Tage im Krankenhausbett waren lang gewesen. Es gibt hier nichts zu tun, außer nachzudenken. Und dann ist da noch das allgegenwärtige Internet, das auch vor Krankhaustüren nicht haltmacht. Ich hatte nicht widerstehen können, nach der Krankheit zu recherchieren. Was ich zuletzt gelesen hatte, klingt niederschmetternd:
Aktiver Morbus Menière senkt die Lebensqualität auf einen der niedrigsten Werte aller Patienten, die nicht dauerhaft in eine Klinik eingewiesen sind.Menière-Patienten stufen sich selbst als chronisch depressiv ein.




























