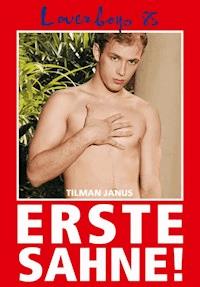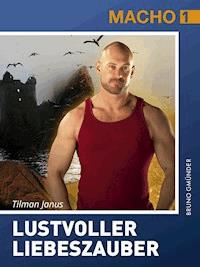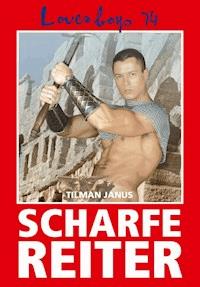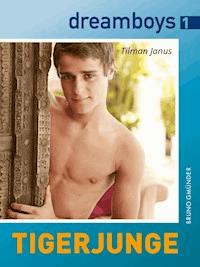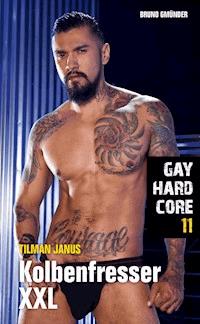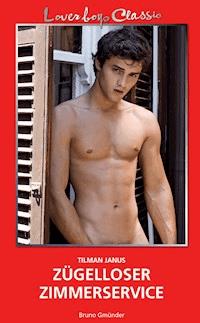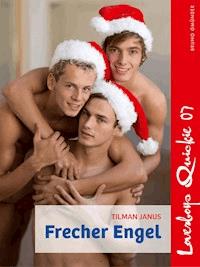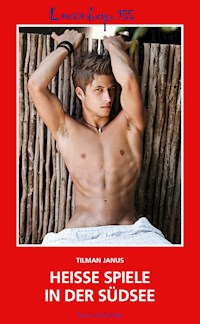Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Gay Hardcore
- Sprache: Deutsch
Der attraktive Geschäftsmann Marc Lenz führt ein Doppelleben als Spezialagent der Regierung und verhandelt mit zwielichtigen Typen im In- und Ausland riskante, streng geheime Deals. Ein bisschen fühlt er sich wie James Bond, nur pflastern keine Leichen seinen Weg. Marcs "Waffe" ist sein durchtrainierter, perfekter Körper. Er hat reichlich Gelegenheit, mit "Härte" vorzugehen, vom Syndikatsboss bis zum Scheich ist alles dabei. Auch bei seinen Informanten revanchiert er sich mit vollem Körpereinsatz. Ein neuer Fall in Hongkong wird für Marc aber besonders heiß und gefährlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GAY HARDCORE 14
Lizenz zumFicken
Tilman Janus
BurnoBooks
Die in diesem Buch geschildertenHandlungen sind fiktiv.
Im verantwortungsbewusstensexuellen Umgang miteinander geltennach wie vor die Safer-Sex-Regeln.
Gay Hardcore 14
© 2019 Bruno Books
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Umschlagabbildung: © Ragingstallion.com
Falcon Studios Group (Model: Sean Duran)
Printed in Germany
ISBN 978-3-95985-387-3
Für J.
Bull Shot
Ein gefährlicher Stecher
Der Verräter
Im Hamam
Heißer Hammer
Dschungelsex
Der Informant und der Stricher
Das Schwanz-Tattoo
Käfighaltung
Silberströme im duftenden Hafen
Bull Shot
Der Kerl, auf den ich es abgesehen hatte, wirkte dynamisch und muskulös. Dass er dunkelhaarig war, merkte ich nur an seinen buschigen Brauen und dem kurzen Vollbart. Sein Schädel glänzte kahl rasiert unter der Festbeleuchtung des Saales. Das Jackett hatte er in der Hitze des Gefechts irgendwo verloren, ich konnte also seine Schwanzbeule in der zu engen Hose deutlich sehen.
Er entsprach nicht meinem Beuteraster, aber darauf kam es wirklich nicht an. Ich hielt mich nicht zum Spaß in Köln auf, auch wenn gerade Fastnacht herrschte. »Herrschte« war das passende Wort. Der Kölner Karneval kam mir vor wie ein buntes, aufgewühltes Meer aus Schweiß, Schnaps und Wahnsinn. Und Schrobski mitten drin.
Ralf Schrobski war Kölner Immobilien-Mogul, einer der wichtigsten. Von der Körpergröße her sah er nicht besonders imponierend aus, er maß nur 1,76 Meter. Ich überragte ihn um neun Zentimeter, außerdem hielt ich mich immer hoffähig aufrecht, im Gegensatz zum angetrunkenen Schrobski, der gerade wie ein wilder Affe übers Parkett fegte. Ich beherrschte das unauffällige Wegzaubern und In-den-Blumenkübel-Gießen von Drinks vollendet, denn ich wollte stets einen klaren Kopf behalten.
Diesmal hatte ich also Schrobski auf dem Schirm, die Immobilien-Kakerlake. Wie üblich hatte ich mir mit einer gefälschten Einladung Zutritt zur Party verschafft. Schrobski hob gerade das Sektglas und prostete seinen Gästen zu. Er umgab sich vor allem mit schönen Frauen. Von meinem Chef hatte ich erfahren, dass Schrobski schwul war, doch das wusste fast niemand. Für mich spielte es keine Rolle, ob er sich outete oder nicht. Ich hatte nur die Aufgabe, ihn weichzuklopfen.
»Wer sind Sie denn?«, rief er, während er auf mich zu tanzte und mich mit glasigen Augen anstarrte.
Sein teures Hemd war von großen Schweißflecken unter den Achseln verunziert. Ich hätte mich niemals so gehen lassen. Vermutlich registrierte er meine gepflegte, perfekte Erscheinung und meinen schlanken, durchtrainierten Körper sehr genau. Außerdem musste er zu mir aufschauen, was mich mit heimlichem Triumph erfüllte. Ich hasste solche neureichen Prolls wie Schrobski.
»Mein Name ist Lenz … Marc Lenz«, gab ich zurück.
Er zog misstrauisch die dunklen Brauen zusammen.
»Sind Sie eingeladen?«
»Nein«, sagte ich seelenruhig.
Schrobski ließ seine Tanzdame stehen wie ein altes Kleidergestell und kam näher.
»Und was wollen Sie hier?«
»Sie erwarten doch nicht, Herr Schrobski, dass ich Ihnen das im Karnevalsgetümmel auseinandersetze.«
Er schnaufte.
»Sie kennen mich?«
»Selbstverständlich, Herr Schrobski. Wer kennt Sie nicht?«
Ein albernes Grinsen erschien auf seinem verschwitzten Gesicht, offenbar fühlte er sich geschmeichelt.
»Kommen Sie morgen in mein Büro, wenn Sie etwas mit mir zu besprechen haben«, meinte er und wollte sich wieder auf die Tanzfläche stürzen.
»Morgen? Am Aschermittwoch? Da kann es schon zu spät sein«, entgegnete ich und blickte ihm tief in die braunen Augen. Dieser Blick hatte sich bereits hundertfach bewährt, denn ich konnte da viel hineinlegen – vor allem das Versprechen, dem anderen die glücklichste Nacht seines Lebens zu schenken. Meine Augen schimmerten bei diesem Blick wie feurige, azurblaue Diamanten. In Kombination mit den langen Wimpern und meinem tiefschwarzen, dichten Haar entfalteten sie eine Wirkung, der kaum jemand widerstehen konnte. Das klingt ziemlich eingebildet, doch die Auswirkungen hatte ich oft getestet, sie waren sozusagen wissenschaftlich bewiesen.
»Wirklich?«, nuschelte Schrobski verunsichert. »Na ja, wenn es so dringend ist … Ich habe hier im Hotel eine Suite. Wenn Sie wollen, können wir dort alles regeln.«
Da ich meine Aufträge immer gut informiert anging, wusste ich natürlich, dass Schrobski in seinem eigenen Kölner Hotelhochhaus, in dem seine Fastnachtsparty stieg, auch ein privates Appartement zur Verfügung hatte.
»Sehr gern, Herr Schrobski.« Der Gedanke, diesem Affen Puderzucker in den Arsch zu blasen, begeisterte mich nicht. Aber es war nun mal mein Job.
Schrobski verließ mit mir den vor Hitze und Lärm überschwappenden Saal. Wir fuhren in einem der silberglänzenden Lifte in die 13. Etage.
»Ich wohne immer im 13. Stock«, erklärte er mir wichtigtuerisch. »In allen meinen Häusern. Die Leute sollen sehen, dass ich nicht abergläubisch bin.«
»Interessant, Ralf«, bemerkte ich. »Ich darf doch ›Ralf‹ sagen?«
Er griente wie ein Honigkuchenpferd. Es war mir nicht entgangen, dass seine Schwanzbeule sich stark vergrößert hatte.
»Aber sicher, äh … Marcus. Oder ist ›Marc‹ richtig?«
Der Alkohol hatte also schon sein Gedächtnis vernebelt.
»Genau, Ralf! ›Marc‹ mit c hinten, wie Marc de Champagne.«
Er kicherte glucksend. Als wir den mit dicken Teppichen ausgelegten, menschenleeren Flur der 13. Etage entlanggingen, blieb er plötzlich stehen.
»Du … bist doch nicht bewaffnet?«, fragte er ängstlich. »Ich soll ohne meinen Bodyguard eigentlich gar nicht den Saal verlassen.«
»Du kannst mich gerne abtasten«, forderte ich ihn auf, grätschte die Beine und breitete die Arme aus. Er machte es mir wirklich leicht.
Sofort befühlte er mich von oben bis unten, knöpfte mein maßgeschneidertes Jackett auf, rieb mir durch den dünnen Hemdstoff die Nippel, fuhr mit den Händen in meine Achselhöhlen, betastete Rücken und Hintern, fühlte meine Schenkel ab und griff zuletzt mit zitternden Fingern nach meiner Schwanzwölbung. Zum Glück reagierte mein Teil – wie immer – sozusagen auf Knopfdruck, ohne Ansehen der Person. Sonst hätte ich diesen Job gar nicht machen können. Sobald ein Kerl mein Rohr nur leicht berührte, egal durch wie viele Lagen Stoff, wurde Blut in diese sensible Region gepumpt. Und da meine Männlichkeit bereits im Ruhezustand ziemlich imposant war, gab es beim Steifwerden auch ordentlich was zu bestaunen.
»Oh, Marc!«, flüsterte Schrobski selig. »Da ist ja doch eine Waffe!«
»Eine ganz heiße«, stimmte ich zu. »Extra für dich.«
Er knetete begeistert meinen Schaft, der sich stramm im linken Hosenbein ausstreckte. Ich dachte schon, Schrobski wollte ihn gleich im Flur auspacken.
»Wolltest du mir nicht deine Fürstensuite zeigen?«, säuselte ich.
»Ja!«, seufzte er, ließ mich schweren Herzens los und kramte in der Hosentasche nach seiner Schlüsselkarte.
Die Suite sah sehr luxuriös aus, war aber total mit kitschigem Dekomüll überladen. Ich dachte an meine schlicht und stilvoll eingerichtete Wohnung in Berlin, um in diesem plüschigen Zeug nicht zu ersticken.
»Gefällt dir meine Suite?«, erkundigte er sich.
»Aber selbstverständlich, wunderschön«, log ich. Was tut man nicht alles fürs Vaterland.
Schrobski griff mir sofort wieder an den Schritt und befühlte nun meinen fetten Sack.
»Ist der echt?«, fragte er. »Oder hast du das mit Socken ausgestopft?«
»Aber Ralf!«, sagte ich tadelnd. »Bei mir ist alles echt. Fass einfach zu!«
Er zerrte an meinem Anzug, es konnte ihm gar nicht schnell genug gehen. Ich zog mich schon selbst aus, damit er mir nicht die Nähte aufriss. Mein Ständer ragte aus dem Beinausschnitt der Unterhose nach oben, und wie üblich ließ er einen dicken Tropfen Vorsaft ab.
»Marc! Dein … dein Schwanz ist göttlich!« Verzückt packte er meinen Kolben und walkte ihn durch. Währenddessen zog ich Ralf aus. Die Krawatte, das verschwitzte Hemd, die zu enge, schlecht geschnittene Hose und die leicht feuchten, mit gelben Pissflecken übersäten Boxershorts landeten auf dem Fußboden. Schuhe und Socken sollte er gefälligst selbst abstreifen.
»Pinkelst du dir etwa in die Unterhose?«, erkundigte ich mich in neckischem Ton.
Er wurde tatsächlich rot wie ein Schuljunge, dieser Parasit, der arme Mieter ungerührt aus ihren Wohnungen verjagte und Immobilienpreise durch gigantische Aufkäufe in die Höhe trieb.
»Ach Marc, du Frecher! Das ist nur, weil es beim Pinkeln immer so schnell gehen muss, und da tropft der Rest eben in die Hose, aber nur ganz wenig.«
»Schade, ich dachte, du machst es absichtlich.«
Jetzt färbte sich sein Gesicht dunkelrot.
»Marc! Bist du immer so ein Ferkel?« Sein passabler Pisser reckte sich hart nach vorn, aber er war lange nicht so groß wie meiner.
»Es gefällt dir doch, wenn ein Schwein dich fickt – oder?« Ich nutzte wieder meinen azurblauen Blick.
Er stöhnte nur und warf sich nackt aufs rüschige Bett. Seinen Arsch, der noch fest und knackig aussah, streckte er mir entgegen. Ich zählte 32 Jahre, Schrobski war bereits 43, aber sein Körper hatte sich gut gehalten. Insofern musste ich mich nicht sehr überwinden, ihm meinen Harten ins Fickloch zu jagen. Loch ist Loch, und wenn ich mir doch mal einen ganz scheußlichen Typen vornehmen musste, schloss ich einfach die Augen, und los ging’s. Ficken war Ficken für mich, ich sollte mich ja nicht verlieben in meine Zielpersonen. Und Ficken war immer gut.
Ich ölte mir die Eichel mit Gel ein, das ich stets dabei hatte, kniete mich hinter Schrobski und drückte sie an seine heiße Rosette, ganz leicht erst mal.
»Willst du meinen Kolben haben, Ralf?«, flüsterte ich sanft.
»Ja!«, keuchte er.
»Ist er dir nicht zu fett und riesig?« Ich rieb mit meiner nassen Kuppe durch seine Spalte.
»Er kann nicht fett genug sein. Fick mich!«
»Ganz tief rein? In deine geile Arschfotze?« Ich spielte weiter mit ihm.
»Ja!« Er schrie fast.
»Und dann darf ich mir auch was wünschen?« Mein Vorsaft machte sein Loch noch glitschiger.
»Was du willst!«
»Ich kann mir was aussuchen?«
»Ja! Ja! Fick mich endlich!«
»Ich hätte so gern deinen Bauplatz in der Kölner Südstadt, du weißt, dieses Filetgrundstück, über das sie in den Zeitungen geschrieben haben.« Ich drückte meine Kuppe etwas fester an sein Einschlupfloch.
»Oh Marc! Fick mich doch endlich!« Er war halb von Sinnen vor Geilheit. Gut!
»Und ich krieg dann das Grundstück? Ich will da ein Bürohaus bauen lassen.«
»Ja doch, was du willst.« Er griff nach seinem eigenen Ständer, begann zu wichsen und hob seinen Arsch noch höher.
»Versprochen?«
»Ja, versprochen! Nun red nicht so viel! Vögle mich, vögle mich! Ganz tief rein!«
Da stieß ich zu. Ich zog seine Backen auseinander und spaltete dabei seinen Schließmuskel mit meiner prallen Eichel auf. Meine Kuppe drückte sich in sein festes Loch und rutschte langsam in seinen Darm. Und es war gut wie immer. Ob Prinz oder Proll, fast alle Löcher waren gut zu ficken. Ich stöhnte leise und sah zu, wie mein langer, dicker Schaft in Schrobskis Arsch verschwand. Dabei genoss ich den heißen Druck in seinem Kanal.
Schrobski jaulte wie ein halb verhungerter Hofhund. Er hechelte und schrie vor Geilheit. Sein Rohr blieb hart, er wichste wie verrückt.
»Ja! Ja! Mach’s mir! Gib’s mir! Fick mich! Mehr! Härter!«, winselte er.
»Da hast du ihn! Nimm ihn!«, sagte ich leise und schob meinen Harten bis zum Anschlag hinein. Meine riesigen Eier drückten sich an Schrobskis Hintern. Der Immobilien-Hai war hart im Nehmen, und er brauchte ganz dringend einen Bolzen in seinem Arsch, das merkte ich. Nach und nach steigerte ich Druck und Geschwindigkeit, hielt kurz still, um Schrobski etwas zappeln zu lassen, und legte wieder zu. Ich verlor nie die Kontrolle beim Ficken. Ich genoss es, aber ich wusste immer, was ich tat und was um mich herum passierte. Ich merkte zum Beispiel, dass jemand ins Zimmer kam, wahrscheinlich Schrobskis Bodyguard, aber ich kümmerte mich nicht darum, und der Typ verschwand wieder. Er hielt mich wohl für harmlos und gönnte seinem Boss den harten Prügel im Hintern.
»Du machst das gut. Ja! Du! Ich komme! Ja! Ich spritze …« Er brüllte los. Ich guckte an seiner Hüfte vorbei und sah, wie ein paar milchige Tropfen auf die Rüschendecke kleckerten. Ich setzte zum Endspurt an, rammelte Schrobski noch ein paar Mal heftig durch und spürte, wie mein Schwanz lospumpte. Ich war ein Orgasmus-Fan. Das Abladen genoss ich immer besonders. Und das zog sich bei mir schön lange hin, ich spritzte länger und mehr ab als alle Kerle, die ich kannte. Ich wühlte mit meinem Steifen noch ein bisschen in Schrobskis Kanal herum, denn mein Ständer brauchte stets eine Weile, bis er sich entspannte. Das nutzte ich zu einem kleinen Nachspiel, was bei den Herren immer gut ankam.
Erst nach ein paar Minuten sanken wir auf die Bettdecke. Mein Schwanz rutschte aus Schrobski Loch, das Sperma lief heraus.
Schrobski verdrehte die Augen vor Glück.
»Marc! Du bist ein super Stecher. Das Grundstück hast du dir verdient. Aber billig ist es nicht.«
»Geld spielt keine Rolle«, seufzte ich zufrieden. »Ich handle mit Diamanten, da kommt es auf eine Million nicht an.«
Schrobski kicherte, wobei sein weich gewordenes Teil leicht hüpfte.
»Weißt du, Marc, diese Liegenschaft wollte der Staat haben, sie haben mir eine Menge Geld geboten. Aber ich will’s denen nicht geben, die haben mich mit ihren Steuerbescheiden zu sehr geärgert. Die Regierung denkt, ich drucke das Geld selbst. Dabei muss ich es sauer verdienen.« Das übliche Gejammer der Reichen. »Aber dir gebe ich das Bauland, Marc! Du sollst es haben!«
»Danke, Ralf«, sagte ich artig. »Können wir einen kleinen Vorvertrag machen?«
»Klar, Marc! Der Staat soll sich schwarz ärgern!«
Er sprang nackt zu einem neubarocken Schreibtisch, kramte nach Stift und Papier, setzte sich auf den mit hellem Damast bezogenen Stuhl und schrieb. Ich sah, dass der Damast von meiner Sahne feucht wurde, die aus Schrobskis Arschspalte lief.
Das war alles buchstäblich gut gelaufen. Nicht immer konnte ich mich darauf verlassen, dass meine Zielpersonen nach dem Orgasmus ihre Versprechen einhielten. Aber das hatte ich nach mehreren Jahren »Berufserfahrung« gut einzuschätzen gelernt. Schrobski war eine meiner leichtesten Übungen.
Am nächsten Tag schlossen wir bei einem Notar den richtigen Kaufvertrag ab. Ich versprach Schrobski, ihn bald wieder zu »besuchen«, was ich natürlich nie tun wollte. Ich überwies ihm das Geld und machte mich aus dem Staub.
Zurück in Berlin, verkaufte ich meinem Chef – das heißt also der Regierung, dem Staat – das Filetgrundstück, das irgendein Minister unbedingt brauchte, denn ich fungierte nur als Strohmann. Damit der Kaufvertrag juristisch gültig war, hatte ich beim Kölner Notar meinen richtigen Namen angegeben, aber nicht meine echte Adresse. Mir standen mehrere Identitäten und Pässe zur Verfügung. So war ich unauffindbar für Schrobski. Im Übrigen befand sich an meiner Wohnung überhaupt kein Name.
Am ersten Märzsonntag erreichte mich abends ein Anruf von Jonas Pfennig, dem Assistenten meines Chefs. Ich saß gerade in meiner Lieblingsbar und genoss es, einen Cocktail nicht immer nur heimlich wegzugießen, sondern auch mal zu trinken.
»Hallo, Marc!«, flötete er. »Der Boss will dich sehen.«
»Ich mache Urlaub. Außerdem ist Sonntag.«
»Sehr witzig! Du weißt doch, dass er keinen Spaß versteht.«
Ich seufzte.
»Okay! Morgen früh?«
»Am liebsten gestern, aber morgen früh wird schon reichen. Bis dann!«
Ich schlürfte meinen »Bull Shot« noch zu Ende. Das war mein bevorzugter Drink – Wodka mit kalter Rinderbrühe, Gewürzen und einem Schuss Zitronensaft. Nicht jedermanns Sache, aber mir schmeckte er, schon wegen des scharfen Namens. Ich »erlegte« meine Opfer schließlich auch oft mit Schüssen aus meinem bulligen Kolben.
Beim Trinken dachte ich daran, dass es wieder Arbeit geben würde. Zwischen den Aufträgen durfte ich immer faul sein, aber wenn K., mein Chef, trommelte, hatte ich anzumarschieren. Ich war gespannt, welchen Kerl ich diesmal mit meinem dauergeilen Schwanz begeistern sollte.
Ein gefährlicher Stecher
Mein Handy zeigte bereits elf Uhr, als ich am Montag K.s Vorzimmer betrat. Wie immer saß Jonas Pfennig an seinem Schreibtisch. Er blickte hoch, als ich mit Schwung die Bürotür aufstieß.
»Marc Lenz, der Mann meiner wildesten Träume!«, rief er. Auf seinem frischrosa Gesicht zeigte sich ein breites Grinsen.
»Das hoffe ich«, gab ich zurück, stellte mich neben ihn und drückte ihm mein Schwanzpaket an den Arm.
Jonas war erst 23 Jahre alt und 1,70 Meter klein. Er hatte mittelblondes Haar, verwaschen blaue Augen und sah nicht besonders hübsch aus. Dafür hatte er den Ruf, enorm tüchtig und fleißig zu sein. Er war also das Gegenteil von mir. Kein Wunder, dass er mich anhimmelte. Der Chef hatte Sex innerhalb der Abteilung verboten, was mich nicht sehr bekümmerte. Jonas wahrscheinlich schon.
»Ich möchte einmal im Leben deinen Riesenbolzen im Hintern haben«, flüsterte er. »Können wir uns nicht mal privat treffen?«
»Verbotenes Terrain, Jonas, weißt du doch.«
»Muss doch keiner erfahren.«
»Alles ist verwanzt, Jonas. Auch unsere Wohnungen. Mini-Videokameras aller Orten«, zog ich ihn auf. »Willst du deinen Job verlieren?«
»Marc, du bist unausstehlich.«
»Dafür werde ich bezahlt.«
In diesem Moment öffnete sich die doppelte, gepolsterte Tür zu K.s Büro. K. erschien, und sein scharf geschnittenes Gesicht mit der großen Adlernase verhieß nichts Gutes.
»Sie kommen zu spät, Marc, wie üblich«, knurrte er.
»Es tut mir leid, Chef«, versetzte ich ohne jedes Bedauern. »Ich konnte gestern nicht einschlafen und kam heute nicht gleich aus dem Bett.«
»Natürlich konnten Sie gestern nicht einschlafen, Marc, weil Sie erst heute früh ins Bett gegangen sind. Ich erwäge ernsthaft, Sie gegen eine zuverlässigere Person auszutauschen.«
Das übliche Geplänkel. Er müsste sich doch inzwischen daran gewöhnt haben, dass ich ein Spätmensch war und kein krähender Frühaufsteher-Hahn wie er.
»Das würde ich bedauern«, bemerkte ich ungerührt. Ich wusste, dass ich gut war und K. keinen besseren Mitarbeiter finden könnte.
»Was stehen Sie herum und halten Herrn Pfennig von der Arbeit ab? Kommen Sie endlich herein!«
Ich zwinkerte Jonas zu und folgte dem Chef in sein spartanisches Büro. Die Wände waren mit Bücherregalen und Aktenschränken zugestellt. Vor dem Fenster sperrte eine Jalousie neugierige Blicke aus, wobei da nur ein schwindelfreier Fensterputzer infrage gekommen wäre, denn K.s Geheimabteilung lag im vierten Stockwerk eines Hauses im Berliner Regierungsviertel. In der Mitte des Raums befand sich ein großer Schreibtisch, der unter Akten und Papieren zusammenzubrechen schien. Auf Beistelltischen flimmerten mehrere Computerbildschirme.
Über K. wusste ich praktisch nichts, außer dass er sich Regierungsrat nannte. Sein Alter schätzte ich auf etwa 50 Jahre. Er war noch größer als ich, vielleicht 1,90 Meter, und dabei ziemlich dürr. Ich kannte aus Sicherheitsgründen nicht einmal seinen Nachnamen, den Vornamen erst recht nicht. Er war einfach »K., der Chef«. Weder seine Wohnadresse und seine Familie, noch sein Wagen oder seine Hobbys waren mir bekannt. Das sollte so sein, und mich störte es nicht.
Ich wurde zwar nicht üppig bezahlt, konnte aber reichlich Spesen abrechnen, wenn ich im In- und Ausland für die Regierung die Kastanien aus dem Feuer holte. Außerdem hatte ich wesentlich mehr Freizeit als normale Arbeitnehmer. Offiziell war ich häufig als Diamantenhändler unterwegs, was ich auch von der Pike auf gelernt hatte. In Wahrheit arbeitete ich als Spezialbeauftragter der Regierung, wenn es irgendwo hakte. Bei Problemen, die legal nicht gelöst werden konnten, regelte ich mit zwielichtigen Geschäftsleuten, Militärs oder ausländischen Machthabern streng geheime Deals. Eben Sachen, die auf keinen Fall der Presse bekannt werden durften. Von solchen Geheimagenten gibt es natürlich mehrere, bei jeder Regierung, doch mein Spezialgebiet war ein ganz besonderes: Ich wurde vom Chef meistens auf schwule Zielpersonen angesetzt.
Die Vorermittlungen erledigten andere Agenten, ich erschien erst auf der Bildfläche, wenn es um die Sache selbst ging. Ich war ziemlich erfolgreich, denn ich arbeitete stets mit vollem Körpereinsatz. Obwohl ich mir manchmal ein bisschen wie James Bond vorkam, pflasterten keine Leichen meinen Weg. Ich trug grundsätzlich keine Waffe, bis auf die eine aus Fleisch und Blut, die auch Schrobski sofort entdeckt hatte. Mir standen zusätzlich größere Geldmittel zur dienstlichen Verfügung, aber den entscheidenden Kick, die hohe Erfolgsrate bewirkte ich so gut wie immer mit meinem zuverlässig funktionierenden Riesenschwanz.
K. setzte sich auf seinen ledernen Chefsessel, rückte etwas zurück und sah mich aus seinen steingrauen Augen auffordernd an.
»Du weißt, Marc, was du zu tun hast, wenn du zu spät kommst.«
Ja, ja, er würde mich nie durch einen anderen ersetzen! Das Sex-Verbot innerhalb der Abteilung galt natürlich nicht für ihn – Chefs verschaffen sich ja gern illegale Vorteile. Ich kniete mich vor seinen Drehsessel und öffnete ihm die Hosenverschlüsse.
»Ich hoffe, du kommst auch weiterhin zu spät, Marc«, flüsterte er.
»Ich komme immer genau richtig, Chef«, gab ich zurück und packte seinen Regierungskolben aus, der bereits Honig abließ. K.s Ständer war nicht zu verachten, sein Alter sah man ihm nicht an. Nur die Eier hingen sehr tief, die stark gedehnte Sackhaut brachte sie auch bei Erregung nicht mehr ganz zur Hochstrecke. K. parfümierte sich immer leicht das Schamhaar mit einem sehr herben Eau de Cologne, wenn er mich erwartete. Diesen bestimmten Duft, gemischt mit dem Aroma nach reifem Mann, würde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Er symbolisierte für mich den Beginn eines neuen Auftrags, also neuer Sexabenteuer.
»Wie lange soll ich noch warten, Marc?«, zischte K. gepresst.
Wortlos leckte ich über seine dicke Eichel, die besonders ausgeprägte Wülste hatte, und schlürfte den Vorsaft ab. K. seufzte glücklich. Langsam schob ich mir das lange Chef-Teil in den Mund. K. rammelte nie wild los, er blieb still sitzen, wie es sich für einen Vorgesetzten gehörte. Ich musste alles allein machen: seine Vorhaut zurückziehen, ihn sanft wichsen, seinen Pinkelschlitz aussaugen, den Bolzen tief in meine Kehle schieben und ihn trotz seines fortgeschrittenen Alters so schnell wie möglich zum Abladen bringen, denn er hatte immer nur wenig Zeit. Noch nie war jemand während unserer kurzen Oralsitzungen ins Zimmer geschneit, aber K. hatte anscheinend Angst, dass genau dies passieren könnte. Er schloss aber auch nicht die Tür ab. Ich hatte den Eindruck, dass diese Angst für ihn dazugehörte und ihm den richtigen Kick gab.
»Gut, Marc! Gut!«, flüsterte er. »Beeil dich!«
Ich steigerte die Geschwindigkeit etwas. Mein Kopf fuhr hoch und runter, K.s Kuppe wurde rhythmisch an meinen Gaumen gedrückt. Nach wenigen Minuten spürte ich schon, wie sich die Chef-Flinte anspannte zum Abschuss. K. stieß einen fast unhörbaren Seufzer aus. Ein dicker Spermaspritzer schoss in meine Kehle, danach zwei kleinere.
Ein paar Sekunden Entspannung, dann schob K. meinen Kopf zurück. Sein halb steifer Schwengel glitschte aus meinem Mund. K. machte seine Hose zu. Ich schluckte seinen Saft, stand auf und wischte mir mit einem Taschentuch die Lippen. K. fuhr sich durchs graublonde Haar, richtete seine Krawatte und setzte sich chefmäßig an den Schreibtisch. Ich stellte mich vor den Tisch und sah meinen Boss erwartungsvoll an. Genau so spielte es sich immer ab – ein nettes Ritual.
»Morgen früh fliegen Sie nach Neapel, Marc«, begann K. Dienstlich blieb er stets beim »Sie«.
»Schöne Jahreszeit für Italien«, bemerkte ich.
Er überging meinen saloppen Einwurf.
»Diesmal werden Sie es mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben.« Er betrachtete mich fast wie ein besorgter Vater. »Ich würde mir wünschen, dass Sie sich von Yvo eine Waffe aushändigen lassen.«
Yvo war ein Experte für Technik, IT und Waffen, der K.s Abteilung unterstützte.
»Sie wissen doch, Chef, dass ich nie eine Waffe trage«, entgegnete ich. »Fast jeder zögert, wenn er auf einen Unbewaffneten schießen soll.«
»Sie sagen es, Marc – fast jeder. Aber in diesem Fall sollten Sie …«
»Keine Sorge, Chef! Ich mache das so wie immer.«
Er seufzte.
»Sie wissen sicher, dass Neapel und die umliegende Provinz Kampanien stark von der Camorra infiltriert ist. Sie ist eher horizontal in viele autonom arbeitende Clans organisiert, nicht so hierarchisch wie zum Beispiel die Cosa Nostra in Sizilien. Auch die Clans der Camorra agieren inzwischen fast weltweit, zum Beispiel in Deutschland. Nun ist eine deutsche Familie mit der Bitte um Hilfe an unsere Regierung herangetreten, deren Sohn sich der Camorra angeschlossen hat und nach Neapel gereist ist.« Er rief ein Foto in seinem Computer auf und zeigte es mir. »Der Sohn, Nico, ist erst 18 Jahre alt, er hatte sich alles anders vorgestellt. Jetzt möchte er zurück nach Deutschland, doch der Clan lässt ihn nicht gehen. Der Junge weiß zu viel. Eher würden sie ihn ermorden.« K. seufzte wieder.
»Und ich soll ihn aus Italien herausschleusen?«
K. nickte.
»Der Sohn wäre inzwischen auch hier in Deutschland gefährdet. Seine Familie – der Vater hat italienische Wurzeln, die Mutter ist Deutsche – will irgendwohin auswandern, weit weg, unter neuem Namen, wenn sie nur ihren einzigen Sohn zurückbekommen.« Er sah mich scharf an. »Wissen Sie, Marc, dass allein in Kampanien jedes Jahr rund 100 Morde begangen werden? Und dass der Norden Neapels schon ein No-go-Area ist?«
»Jetzt weiß ich es«, gab ich cool zurück. »Soll ich mit dem Sohn ins Bett gehen?«
»Selbstverständlich nicht, das wäre wenig sinnvoll. Aber da gibt es das Clan-Oberhaupt, Salvatore Brinone, ein 40jähriger, verheirateter Neapolitaner. Er hat in Oxford Wirtschaft studiert. Von einem seiner früheren Studienfreunde wissen wir, dass Brinone schwul ist. Sein italienisches Umfeld, auch die Familie, ist ahnungslos, wie Sie sich vorstellen können. In diesem katholischen, konservativen Milieu wird Homosexualität nicht toleriert.« Er schwieg.
»Ist das alles?«
»Ja. Wie Sie das Problem lösen, bleibt Ihnen überlassen. Die Adressen und Telefonnummern finden Sie, wie immer, auf Ihrem neu programmierten Smartphone, das bei Yvo liegt. Yvo hat auch noch ein paar andere Dinge vorbereitet. Herr Pfennig hält die Flugtickets für Sie bereit. Es eilt, Marc! Und … treten Sie auf keinen Fall mit Ihrem Klarnamen auf.«
»Ich bin ja kein Anfänger«, knurrte ich. »Bis später, Chef!«
Die frische, milde Märzluft in Neapel umschmeichelte mich angenehm. Vor knapp drei Stunden hatte ich noch auf dem verregneten Flughafen Berlin-Schönefeld gestanden. Ich mochte diese für mich kostenlosen Blitzreisen. Wieder einmal hatte ich allerfeinste Garderobe in mein Köfferchen gepackt.
Als Erstes mietete ich einen teuren Ferrari-Sportwagen. Mein Pass lautete auf den Namen Marc Lawn. Den Vornamen änderte ich nur sehr ungern. Ich empfand es als gefährlich, einen anderen als den gewohnten zu wählen. In Situationen, in denen ich blitzartig reagieren müsste, wäre ich einfach nicht schnell genug, wenn jemand mich mit einem fremden Vornamen rufen würde. Auch im Hinblick auf Bekannte, die ich traf, war der richtige Vorname besser. Denn ich hatte in einigen Städten eigene Informanten und Helfer, die verdeckt für mich arbeiteten und die sich sonst jedes Mal an einen anderen Rufnamen hätten gewöhnen müssen. Das wäre sicher schiefgegangen.
Im roten Ferrari fuhr ich am Baldachin eines Luxushotels in Posillipo vor, dem Stadtteil der Reichen und Eleganten. Hier lagen auf einem vulkanischen Bergrücken die schönsten Villen direkt über dem blau schimmernden Golf von Neapel. In einem dieser pompösen Bauten residierte Salvatore Brinone.
Offiziell war er steinreicher Unternehmer und saß höchst seriös im Gemeinderat der Stadt. Hauptsächlich verdiente er an Bauaufträgen, die ihm mit Hilfe von Korruption und Erpressung vom Staat zugeschanzt wurden. Bereits sein Vater war eine Art »Pate« in Neapel gewesen. All das interessierte mich nur am Rande. Ich sollte ja nicht die Welt verbessern, sondern nur einen grünen Jungen aus den Klauen der Camorra befreien. Wo der verlorene Sohn sich im Moment befand, wusste ich noch nicht.