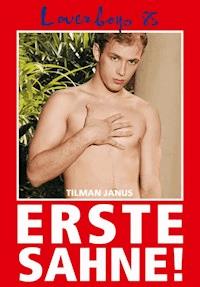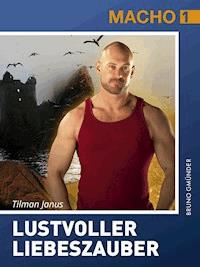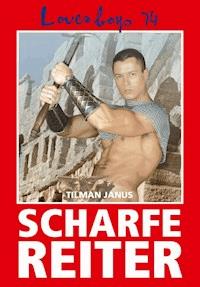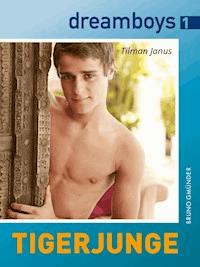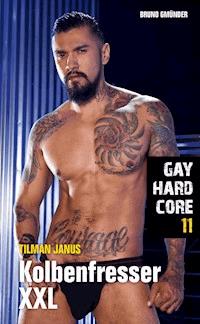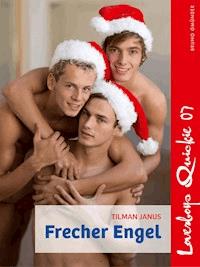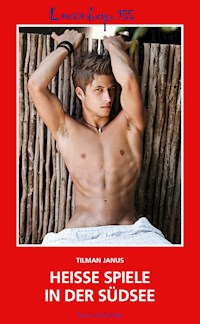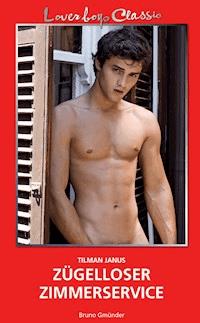
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Loverboys Classic
- Sprache: Deutsch
Von der Hilfskraft in einer kleinen Pension arbeitet sich der 18-jährige Felix zum Liftboy in einem Luxushotel hoch. Dort geht es im Schlafsaal der jungen Hotelangestellten nicht zimperlich zu. Felix versucht, sich auf seine Art durchzusetzen. Noch aufregender sind die Begegnungen mit den gut aussehenden Gästen aus aller Welt. Felix bedient jeden auch wenn es sich um ausgefallene Wünsche handelt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Loverboys Classic 32
ZÜGELLOSER ZIMMERSERVICE
TILMAN JANUS
Die in diesem Buch geschildertenHandlungen sind fiktiv.
Im verantwortungsbewusstensexuellen Umgang miteinander geltennach wie vor die Safer-Sex-Regeln.
Loverboys Classic 32
© 2016 Bruno Gmünder GmbH
Kleiststraße 23-26, 10787 Berlin
Deutsche Erstausgabe: Loverboys 139
Copyright © 2014 Tilman Janus
Coverfoto: © 2016 George Duroy, USA
www.belamionline.com (Model: Andre Boleyn)
Printed in Germany
ISBN 978-3-95985-242-5
eISBN 978-3-959-85-266-1
Mehr über unsere Bücher und Autoren:
www.brunogmuender.com
INHALT
Frühlingssaft
›Bremer Klöten‹
Der Cowboy
Harte Zeiten
Liftboys unter sich
Aufstand im Schlafsaal
Der Marschallstab
Explosionen im Park
Himmel auf Erden
Mein Dylan
Der Sex-Skandal
Torschüsse
Eine feuchtfröhliche Stadt
Minister, Musiker und andere Heten
Adrien
Gefahr und Leidenschaft
Love You
für J.
Frühlingssaft
Seine Augen waren blau. Sie schimmerten wie zwei kleine Aquarien, in denen winzige Fische rasend schnell herumschwimmen. Vielleicht lag das Flimmern seiner Augen an der Maisonne, die in mein Zimmer schien. Oder es war unsere junge, wachsende Geilheit, die uns so heiß machte. Ich hatte noch nie mit einem Jungen Sex gehabt, es war mein erstes Mal.
Axel saß auf meiner Liege und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Die Beine hatte er angewinkelt, die Füße in den schweißigen Socken stemmte er auf das Polster. Seine Schenkel hielt er weit gespreizt. Die Hand spielte am Reißverschluss seiner Jeans. Unter dem blauen Stoff zeichnete sich sein praller Schwanz ab.
»Was ist?«, fragte er mit einer etwas gepresst klingenden Stimme. »Bläst du mir nun einen oder nicht?«
Ich schluckte aufgeregt. »Gleich!«, gab ich leise zurück. Ich war so durcheinander, dass ich meinen eigenen Herzschlag dröhnen hörte. Endlich!, hämmerte mein Herz. Ein Junge sitzt auf deinem Bett! Er hat Lust auf dich! Nun mach was!
Aber ich saß da wie angeklebt. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich das tun würde, einen Schwanz in meinen Mund nehmen. Das Teil, aus dem Axel seine Pisse abließ. Und wenn er dann abspritzen würde … etwa auch in meinen Mund?
Mir wurde noch heißer. Es kam mir so vor, als ob jemand mit einem brennenden Streichholz über meine Wirbelsäule strich. Einen Jungenschwanz … in den Mund nehmen … und wenn der Samen kommt … ihn auf der Zunge schmecken …
Mein Ständer platzte fast aus der Hose, so hart wurde er. Da öffnete Axel seinen Gürtel und die Jeansverschlüsse. Er schob seinen Slip nach unten. Seine Latte sprang aus dem engen Stoffgefängnis in seine Hand. Ich starrte auf die feuchte Eichel, die aus Axels Faust ragte.
»Blas ihn!« Axel schien fast zu gurren. Dabei winkte er mit seinem Teil.
Ich rückte auf der Liege vor, näher zu ihm heran. Mein Ständer tat weh, weil er so fest eingeklemmt war. Aber meine Finger zitterten zu sehr, um ihn zu befreien. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Monate hatte es gedauert, bis Axel zugegeben hatte, dass er auch schwul war. Bis er sich endlich dazu herabgelassen hatte, mich zu besuchen. Alles Mögliche hatte ich ihm versprochen, hatte ihn heiß gemacht. Und jetzt, wo es ernst wurde, wo ich der Erfüllung meiner Wünsche so nah war – jetzt hockte ich vor Aufregung da wie gelähmt.
Langsam streckte ich meine Hand vor. Mein Zeigefinger berührte die fremde Eichel. Sie fühlte sich heiß an. Ich beugte meinen Oberkörper etwas vor. Ein Duft nach ungewaschenem Pisser stieg mir in die Nase. Rings um Axels Schwanzwurzel wucherte dunkelblonder Haarfilz. Das war nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Aber es war die Wirklichkeit. Ein junger Mann, der wirklich da war, nicht nur im Traum.
»Fass ihn richtig an!«, knurrte Axel. Er schien die Geduld zu verlieren. »Und nimm ihn ins Maul!« Er ließ sein Teil los.
Endlich umklammerte ich seinen gebogenen Schaft. Er war fest und glatt, nicht sehr dick, aber warm und lebendig. Er zuckte und bockte vor Geilheit. Ich senkte mein Gesicht noch tiefer. Der Geruch nach alter Pisse wurde stärker.
»Felix! Was ist denn hier los?«, schrie plötzlich jemand.
Ich fuhr so erschrocken zusammen, dass ich meine Fingernägel in Axels Teil krallte. Axel riss mir seinen Schwanz aus der Hand und versuchte hastig, seine Hose zuzumachen.
Meine Pflegemutter Angelika Germer stand an der Zimmertür, hatte beide Hände vor den Mund geschlagen und starrte uns mit schreckgeweiteten Augen an. Dahinter erschien mein Pflegevater Bodo Germer. Seine grauen Augen hätten mich erstochen, wenn das möglich gewesen wäre.
Bestimmt wurde ich knallrot. Jedenfalls schien mein Blut in den Adern überzukochen. Langsam stand ich vom Bett auf. Ich bin nur 1,70 m groß, kleiner als Bodo, aber ich reckte mich etwas, um größer zu erscheinen.
»Du bist doch der Axel aus Felix’ Sportverein?«, fragte Angelika mit schwacher Stimme.
Axel zuckte nur verlegen mit den Schultern, so als ob er es nun mal nicht ändern könnte, dass er tatsächlich der Axel aus dem Sportverein war.
»Schluss jetzt!«, fauchte Bodo. »Axel verlässt sofort das Haus! Und Felix kann sich auf etwas gefasst machen!«
Axel, der seinen Reißverschluss inzwischen zubekommen hatte, rutschte vom Bett, griff seine Turnschuhe, huschte geschickt an meinen Pflegeeltern vorbei in den Flur, preschte vor zur Haustür und verschwand. Ich stand nun allein meinen beiden Erziehern gegenüber. Der erste Schreck war vergangen, ich sammelte meine Kräfte.
»Ich bin achtzehneinhalb!«, sagte ich mit viel Nachdruck.
»Das spielt keine Rolle!«, erwiderte Bodo. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt. »So lange du die Füße unter unseren Tisch stellst, hast du dich anständig zu benehmen! Ich dulde keinen Schweinkram in meinem Haus!«
»Sex ist kein Schweinkram!«, sagte ich.
»Schwuler Schweinkram ist kein Sex!«, giftete er.
»Was dann?« Langsam machte mir die Sache Spaß.
»Das … das ist krank! Einfach krank!«
»Auch Schwule sind Menschen, stell dir vor!«, gab ich zynisch zurück.
»Wir waren doch immer gut zu dir, Felix!«, jammerte Angelika, ehe Bodo Luft holen konnte. »Du verdankst uns so viel! Ohne uns wärst du …« Sie schluchzte.
Natürlich hatte sie recht. Wenn die beiden mich nicht zu sich genommen hätten, damals, als ich noch ein Baby gewesen war, wäre ich für immer in einem rumänischen Waisenhaus verwahrlost. Angelika und Bodo hatten mich großgezogen, ich hatte es gutgehabt bei ihnen. Alles, was ich besaß, verdankte ich ihnen. Ich hatte sogar vor ein paar Wochen mein Abitur geschafft. Aber musste ich deshalb alles unterdrücken, was ich fühlte und dachte? Schon seit Jahren wusste ich, dass ich auf Jungs stand. Ich hatte massig Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ausgerechnet jetzt, an dem Tag, als ich schwulen Sex endlich wirklich ausprobieren wollte – da mussten diese Einfaltspinsel so früh von einer Geburtstagsfeier zurückkommen!
»Ich bin euch sehr dankbar«, sagte ich etwas sanfter und umarmte Angelika. »Aber ich bin nun mal schwul! Ihr könnt das nicht ändern, und ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht ändern.«
Sie sah mich an, als ob ich nicht bei Trost wäre. »Es gibt doch so viele nette Mädchen!«, murmelte sie.
»Sicher! Bloß interessieren die mich nicht!«
»Schluss jetzt damit!«, knirschte Bodo zwischen den Zähnen hervor. »Solange du hier wohnst, hast du dich zu fügen! Ich wünsche keine Besuche dieser Art mehr! Noch so eine Schweinerei, und du fliegst raus!«
Angelika weinte wieder.
Irgendetwas in meinem Inneren zerbrach in diesem Moment. Ich sah meine Pflegeeltern zum ersten Mal anders als sonst, fast wie Fremde. Es war merkwürdig, plötzlich so außerhalb von allem Gewohnten zu stehen. Ich erkannte, dass mein eigenes, selbstständiges Leben eben begonnen hatte. Ich war in zehn Minuten erwachsen geworden.
Einige Zeit später lag ich in meinem Bett, da, wo Axel gesessen und seinen Ständer ausgepackt hatte. Ich hielt meinen harten Schwanz in der Hand und spielte mit meiner Vorhaut. Es war immer wieder schön, die eigene Lust zu spüren. Aber es war auch sehr einsam. Ich stellte mir vor, dass ich zweimal da wäre, einmal im Bett und einmal oben an der Decke schwebend. Ich schaute auf mich selbst hinunter, sah mich auf meiner Liege. Ein schlanker junger Mann lag da, nackt. Er hatte dunkelbraunes, dichtes Haar, das oben mit Gel gestylt und an den Seiten sehr kurz geschoren war. Seine Haut schimmerte hellbraun, die Augen waren dunkelbraun, er hatte hübsch geschwungene Brauen und weiche Lippen. Nur seine Nase gefiel mir nicht, ich fand sie zu spitz, und auf dem Nasenrücken gab es eine kleine Erhebung. Im rechten Ohrläppchen trug er ein Piercing aus Edelstahl, und zwischen dem Nabel und dem kurz getrimmten Schwanzhaar blitzte ein schmales Schlangen-Tattoo auf. Sehr cool, wenn zum Beispiel die Badehose etwas nach unten rutschte. Große, braune Nippel schmückten seine haarfreie Brust, und im Sportverein hatte er sich bereits ein paar Muskeln antrainiert.
Ich seufzte, als ich an den Verein und an Axel dachte. Der würde bestimmt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen! Es war ein sehr warmer Mai, der Frühling machte mich unruhig und heiß. Ich umfasste mit der Linken meine festen Eier, die eng an der Schwanzwurzel lagen, und wichste mit der Rechten kräftiger. Mein Teil fühlte sich gut an, größer und dicker als das von Axel. Meine reichliche Vorhaut flutschte mit etwas Spucke über die pralle Eichel. Hin und her flog meine Hand. Ich streckte mich, mein ganzer Körper versteifte sich. Im Nacken begann ein Kribbeln, lief die Wirbel hinab, raste bis zu den Fußspitzen und kam zurück bis tief in meinen Unterbauch. Meine Spannung löste sich, mein Ständer pumpte in meiner Hand. Warmer Milchsaft spritzte über meine Haut. Ich stöhnte verhalten.
Ruhig lag ich da und genoss die abklingende Erregung. In dieser Nacht fasste ich einen Entschluss, der mein Leben gründlich verändern sollte.
›Bremer Klöten‹
Wir wohnten in einem kleinen Reihenhaus in Lilienthal. Das ist ein Nest nördlich von Bremen. Es gibt ein Gymnasium dort und eine Sporthalle. Mehr eigentlich nicht. Die Nachbarorte heißen zum Beispiel Grasberg, Klostermoor und Moorende. Da war eigentlich schon klar, dass es sehr schwierig sein würde, sich in so einer Umgebung zu outen.
Axel ging mir aus dem Weg. Ich rief ihn an, doch er hatte keine Lust mehr, sich mit mir zu treffen. »Nach dem Schock krieg ich bei dir keinen mehr hoch!«, schnaufte er. Damit war klar, dass ich mit der Planung meiner Entjungferung wieder bei A anfangen musste.
Ich meldete mich für die Universität Bremen an. Da ich was mit Medien und Kommunikation studieren wollte, wusste ich, dass ich bestimmt nicht gleich zum Oktober einen Studienplatz bekommen würde. Meine Zeugnisnoten sahen auch nicht so berauschend aus.
Also suchte ich heimlich nach einem Job. Was es sein würde, war mir egal. Einzige Bedingung war, dass ich in Bremen wohnen könnte, wenigstens ein Stück weit weg von meinen Pflegeeltern. So hatte ich es in dieser besagten Nacht beschlossen, in der mein richtiges Leben beginnen sollte. Ich bewarb mich übers Internet bei gefühlten tausend Firmen, Verlagen und beim Fernsehen, doch niemand wollte mich haben. Ich hätte auch gerne in einer Daily Soap mitgespielt, aber da bekam ich ebenfalls nur Ablehnungen. Ich gab meiner blöden Nase die Schuld, die, wie ich glaubte, mein Gesicht verschandelte.
Schließlich fuhr ich Anfang Juni selbst mit dem Bus nach Bremen hinein. Ich ließ mich im Jobcenter als arbeitssuchend registrieren. Das ging relativ schnell; es war noch vor 12 Uhr mittags, als ich wieder auf der Straße stand. Also streifte ich durch die Stadt, bis ich auf den historischen Marktplatz kam. Dort steht der Roland, ein Ritterstandbild aus dem Mittelalter. Die Statue ist mehr als fünf Meter hoch und das berühmteste Wahrzeichen von Bremen. Ich kannte Bremen und seinen Roland natürlich schon, aber diesen Ritter guckte ich mir immer wieder gerne an. Er hat ein nettes Gesicht. Genau da, wo sein Schwanz sein müsste, trägt er allerdings eine komische, eckige Gürtelschnalle. Ich rechnete aus, wie groß Rolands steinerner Schwengel sein könnte, wenn er richtig steif wäre, und kam auf ungefähr 65 Zentimeter. Nicht schlecht!
Ich grinste noch vor mich hin bei diesen Gedanken, während ich durch eine Seitengasse zurückging zur Bushaltestelle. Da fiel mir ein kleines Schild in einem Fenster auf. »Aushilfe gesucht!«, stand darauf, sonst nichts. Ich schaute an der Fassade hoch. Es schien sich bei dem schmalen Altstadthaus um eine Art Hotel zu handeln. »Pension zum Roland«, las ich in blauer Leuchtschrift über der Haustür. In einem anderen Fenster stand ein Schild mit der Info: »Preiswerte Zimmer. Geöffnet Tag und Nacht.«
Es kam mir so vor, als hätte mich der Ritter Roland, mein alter Freund, direkt hierher geschickt. Einen Moment lang dachte ich noch nach – dann nahm ich die vier Stufen zum Eingang mit zwei raschen Schritten, stieß die Tür auf und ging in das Haus hinein.
Es roch etwas muffig im Flur. Weitere vier Stufen, die mit einem abgewetzten, braunen Kokosläufer belegt waren, führten hinauf zum Empfang. Der Raum wirkte ziemlich eng. Tütenförmige Lampen aus den 50er Jahren warfen trübes Licht auf den Tresen der Rezeption und das schäbige Schlüsselregal dahinter. Links vom Tresen führte eine enge Treppe nach oben, ebenfalls mit Kokosläufern versehen. Daneben erkannte ich die schmale Tür eines uralten Fahrstuhls. Eine staubige Kunstpalme vervollständigte den trostlosen Eindruck. Wollte ich mir das wirklich antun, hier zu arbeiten? Egal, es sollte ja nur vorübergehend sein.
Eine Frau kam aus einem Raum hinter dem Empfangstresen. Sie hatte blond gefärbte Haare und wirkte ähnlich verblüht wie die ganze Pension.
»Guten Tag!«, grüßte ich höflich. »Ich habe Interesse an dem Aushilfsjob. Das Schild im Fenster …«
Sie riss die Augen auf. Die Brille rutschte ihr auf die Nase hinunter. Ihre faltigen Wangen schlabberten hin und her. »Du bist ein bisschen zu jung für den Job!«, sagte sie mit einer überraschend tiefen Stimme.
»Ich werde im November 19!«, erwiderte ich.
»So?« Sie musterte mich von oben bis unten. »Das wird dir zu schwer werden. Die Koffer der Gäste, die Wäschekörbe, die Lebensmittelkisten … Der Lift funktioniert gerade nicht …«
Ich schloss aus ihren Worten, dass der Lift schon seit Ewigkeiten nicht funktionierte und auch keine Reparatur angedacht war. Aber ich hatte mich jetzt hier festgebissen. Die Arbeitslosigkeit in Bremen war hoch – ich wollte diesen Job! »Das schaffe ich schon! Probieren sie es mit mir! Ich heiße Felix Amari.« Ich hielt ihr einfach meine Hand hin.
Sie nahm sie zögernd. »Na gut. Auf Probe, für zwei Wochen. Mein Hausdiener, der Fred, hat sich das Bein gebrochen. Ich brauche dringend Ersatz. 200 Euro die Woche – auf Privatbasis!«
»Okay!« Also Schwarzarbeit! Dann stellte ich die wichtigste Frage: »Wissen Sie von einem billigen Zimmer hier in der Nähe? Ich komme von außerhalb.«
»Du kannst hier wohnen und auch hier frühstücken. Unter dem Dach gibt es eine unbenutzte Kammer. Dann bekommst du aber nur 150 Euro die Woche!«
Ich rechnete schnell aus, dass ich nach dem Abzug immer noch etwa 600 Euro im Monat zur Verfügung haben würde – ein kleines Vermögen für mich! Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Arbeitswoche in der »Pension zum Roland« würde sehr, sehr lang werden!
»Wann soll ich anfangen?«, erkundigte ich mich.
»Sofort!«
Ich nickte. Ein paar Sachen könnte ich später noch aus Lilienthal holen, und Angelika würde ich per Handy Bescheid sagen.
Genau in diesem Augenblick schrillte das altmodische Telefon, das auf dem Tresen stand. »Rezeption, Rusch!«, meldete sich meine neue Arbeitgeberin. »Ja, selbstverständlich, gern. Ich schicke Ihnen meinen Hausdiener hinauf!« Sie legte auf und blickte mich streng an. »Dritter Stock, Zimmer 33. Die Gäste wollen abreisen. Bitte die Koffer abholen und hinuntertragen!«
Ich flitzte los.
Das Treppenhaus ächzte in allen Fugen, während ich die Stufen hinaufeilte. Der Kokosläufer erschien mir dünn wie ein Schleier. Im dritten Stock stand eine Zimmertür halb offen. Klar, dass ich dachte, es wäre das Zimmer 33. Ich lief ohne Anklopfen hinein.
Das Erste, was ich sah, war ein nackter Hintern. Wie vom Donner gerührt blieb ich stehen. Dieser Hintern war sehenswert! Knackig, perfekt geformt, mit einer haarfreien Haut wie Seide und nahtlos gebräunt wurde er mir in dem kleinen Zimmer entgegengestreckt. Die zugehörigen Oberschenkel, genauso atemberaubend, waren leicht gegrätscht. Dazwischen sah ich einen prallen Sack und die Spitze eines ziemlich großen, herabhängenden Schwanzes aufblitzen. Die Beine des jungen Mannes steckten in langen, oben abgeschnittenen Jeans. Nur an den Seiten war je ein breiter Stoffstreifen stehengelassen worden, der das Hosenbein mit dem Jeansbund verband. Die besten Teile des jungen, harmonischen Körpers waren nackt, wurden praktisch wie in einem Schaufensterrahmen präsentiert. Ich schluckte vor Aufregung. Mein leicht erregbarer Schwengel begann, in meiner Hose zu wachsen.
Der Fremde stand vorgebeugt da und wühlte in einem Koffer. Er schien mich gar nicht zu bemerken. War das nun der Gast, der abreisen wollte? In diesem Aufzug? Ich musste irgendetwas tun. Also räusperte ich mich.
Der junge Kerl fuhr mit dem unbekleideten Oberkörper halb herum und sah mich an.
Sein Gesicht wirkte genauso perfekt wie sein Hintern, makellos, harmonisch, maskulin, aber nicht zu sehr. Hübsche Brauen beschatteten die forschend blickenden Augen, sodass ich die Farbe der Iris nicht erkennen konnte. Die Nase gefiel mir sehr, klassisch gerade, und die Lippen … voll, weich, einfach traumhaft! Umrahmt wurde dieses schöne Gesicht von einer wallenden Lockenmähne. Sein Haar war blond, aber nicht einfach blond, sondern mit einem Goldton veredelt, der sogar im spärlichen Licht des schäbigen Zimmers aufleuchtete wie frisch poliertes Messing. Einzelne Strähnen erschienen dunkler, fast kastanienfarben. Dieses außergewöhnliche Haar fiel dem Jungen weit über die Schultern hinab.
»Tschuldigung!« Ich konnte nur dieses eine Wort flüstern.
»Hallo!«, sagte der Schöne und lächelte leicht. »Wo kommst du denn so plötzlich her?« Er hatte eine wunderbare, nicht zu hohe Tenorstimme, die wie Musik klang.
»Ich … sollte … ich wollte … die Koffer … nach unten tragen«, stammelte ich.
Leider nahm der junge Fremde ein Frottierhandtuch, das verknautscht auf dem Bett lag, und schlang es sich um die Hüften. Er wandte sich nun ganz um. »Ich reise aber nicht ab. Da musst du dich mit der Zimmernummer vertan haben!« Er lächelte wieder. Ich hörte einen leichten Nordseeküstentonfall in seiner Sprachmelodie, den ich schon immer gemocht hatte.
»33 …«, brachte ich heraus.
»Das hier ist Zimmer 31.«
»Ich … ich dachte, weil die Tür offen …«
»Ach so!«, unterbrach er mich. »Es ist hier dermaßen stickig in diesem miesen Zimmer, dass ich immer Fenster und Tür aufmache, damit etwas Luft hereinkommt.«
»Dann … Entschuldigung bitte …« Ich ging rückwärts wie ein chinesischer Kuli, der vor seinem Herrn Angst hat.
»Warte!«, sagte der Fremde. »Wer bist du überhaupt?«
»Der neue Hausdiener, Felix.« Jede Sekunde, die ich in diesem Zimmer, neben diesem wunderschönen Mann verbringen durfte, erschien mir wie ein Geschenk.
»Ich bin Robin!«, sagte er. »Ich trete nachts in der Bar ›Bremer Klöten‹ auf, zwei Straßen von hier. Wenn du Lust hast, komm doch heute vorbei!« Er reichte mir eine Visitenkarte, die er von irgendwoher genommen hatte. »Ach! Hier ist ja dieses Teil endlich!« Er zog ein Stück Jeansstoff aus dem Chaos seines Koffers und hielt es hoch. Anscheinend handelte es sich um den herausgeschnittenen Stoff. Ich erkannte, dass ein dünnes Klettband am Rand angenäht war. Wahrscheinlich konnte man dieses Stoffstück in die Hose einsetzen und nach Belieben wieder herausnehmen. Ich stand noch total verwirrt mitten im Zimmer, die Visitenkarte in der Hand, da hörte ich vom Flur her einen Mann sagen: »Wo bleibt denn dieser faule Hausdiener? Sollen wir die Koffer etwa selber runterschleppen?«
Ich erwachte aus meiner Erstarrung und stürzte hinaus. Ein älteres Ehepaar kam mir bereits entgegen. »Die Koffer stehen im Zimmer!«, sagte der Mann barsch. »Aber pass auf, dass du nichts abschrammst!«
Mit halbsteifem Schwanz und klopfendem Herzen schleifte ich die beiden bleischweren Koffer zur Treppe und schleppte sie die Stufen hinunter, erst den einen, dann den anderen. Auf der schmalen Stiege konnte man unmöglich beide Gepäckstücke zugleich tragen. Trinkgeld bekam ich von dem unfreundlichen Ehemann keines, aber das war mir nicht wichtig. Mein Herz jubilierte – ich hatte den schönsten Mann der Welt getroffen!
Nun endlich las ich die Visitenkarte. »Robin Lionel, Country-Sänger, Erotik-Tänzer«, stand da, und eine Handynummer. Ich flüsterte den Namen vor mich hin wie eine Zauberformel. Ob er Amerikaner war? Aber der friesische Sprachklang passte dazu nicht. Egal! Ich wollte noch in dieser Nacht in die Bar ›Bremer Klöten‹ gehen und Robin Lionel sehen!
Der Cowboy
Wie ich es mir bereits gedacht hatte, handelte es sich bei der Bar ›Bremer Klöten‹ um ein Schwulenlokal. Ich hatte es auf meinem Smartphone in einer der wenigen ruhigen Minuten gegoogelt. Klöten sagt man in Norddeutschland für Hoden. Der Name klang also schon ziemlich schwul. Natürlich war es nicht sicher, dass auch der wunderschöne Robin Männer liebte, aber ich hoffte es so sehr, dass ich ihn nur mit der Kraft meiner Gedanken einfach von Ferne umgepolt hätte, wenn er doch eine Hete gewesen wäre. Ich war schwer verknallt in ihn.
Vor das Vergnügen haben irgendwelche blöden Götter die Arbeit gesetzt! Ich musste mächtig schuften an diesem sonnigen Junitag. Es reisten noch weitere Gäste ab. Das Gepäck musste geschleppt werden, dann sollte ich die Zimmer herrichten, Betten beziehen und so weiter. Ich wollte zuerst maulen, denn ich war als Hausdiener angestellt worden, nicht als Zimmermädchen! Doch ich schwieg und erledigte alles, weil ich daran dachte, dass Robin in dieser Pension wohnte und ich ihn jeden Tag sehen konnte!
Am Nachmittag fuhr ich kurz nach Lilienthal und packte das Nötigste zusammen, Klamotten, Schuhe, Waschzeug, Notebook und so weiter. Bodo zeigte sich gar nicht. Angelika weinte, als ich ging. Ich versuchte, sie zu trösten, indem ich ihr versprach, sie häufig zu besuchen. So weit war Bremen nun wirklich nicht entfernt.
Abends hatte ich ebenfalls viel zu tun. Neue Gäste kamen. Also wieder Koffer schleppen, diesmal die Treppen hinauf. Ein paar Leute wünschten Getränke aufs Zimmer. Eine Frau wollte ein zweites Kopfkissen. Ein junger Mann beschwerte sich, dass die Dusche nicht richtig funktionierte. Ich kam mit der Rohrzange und drehte so lange an den Absperrventilen, bis das Wasser ausreichend lief. Zwischendurch zog ich mein Shirt aus, weil ich in dem kleinen, heißen Kabuff schwitzte wie ein Schweinebraten. Der junge Kerl starrte mir ziemlich eindeutig auf die Titten, doch meine Gedanken waren bei Robin. Außerdem gefiel mir dieser Typ überhaupt nicht.
Endlich war alles erledigt. Frau Rusch erklärte sich bereit, den Nachtdienst zu übernehmen, weil es mein erster Arbeitstag war. In der Nacht darauf sollte ich dann Bereitschaftsdienst haben, also mich mit einer Glocke aus dem Schlaf reißen lassen, wenn ein neuer Gast eintraf oder ein anderer nachts saure Gurken oder Sekt wünschte. So konnte ich diese Nacht ins ›Bremer Klöten‹ gehen!
Nach 21 Uhr stieg ich in mein Dachzimmerchen hinauf, duschte und zog mich frisch an. Die Kammer war tatsächlich winzig, aber es war mein Reich, meine erste eigene Wohnung, bezahlt mit meinem eigenen Geld! Ich war sehr stolz darauf.
In dem kleinen Badezimmerspiegel konnte ich mich nicht richtig sehen. Ich hoffte, dass ich gut aussah. Meine dunkelblauen Jeans saßen sehr knackig. Ich musste meinen Schwanz und meine Eier sorgsam packen, weil die Hose wirklich sehr eng war. Dazu trug ich ein blütenweißes T-Shirt, dessen Stoff so fein war, dass sich meine Nippel deutlich abzeichneten. Meine Haare saßen immer von selbst gut, ein bisschen Gel in den oberen, etwa fünf Zentimeter langen Bereich geschmiert, fertig. Gegen 22 Uhr ging ich los.
Ich musste bei der Einlasskontrolle meinen Ausweis zeigen, weil sie mir nicht glaubten, dass ich schon 18 war. Klar, dass mich das ärgerte, aber nur sehr kurz.
Das ›Bremer Klöten‹ war in zwei Bereiche geteilt, eigentlich eine witzige Idee. Die Hälfte des Lokals war ganz in Rot und Schwarz ausgestattet. Als Deko hingen Handschellen, Tittenklammern und Lederpeitschen an den Wänden. Auf einem großen Bildschirm lief ein Bondage-Porno. Die andere Hälfte der Bar schimmerte in Rosa. Künstliche Rosen, Herzen und Fotos von süßen Männerliebespaaren schmückten den Raum. Hier wurde ein Romantikporno mit viel Sperma-Action gezeigt, irgendwas mit Jungs vom Land. Die beiden Bereiche waren nur durch einen Perlenkettenvorhang abgeteilt, man konnte also jederzeit wechseln. Da ich noch Zeit hatte, bis Robin auftreten würde, bestellte ich einen teuren Cocktail – ich verdiente ja nun Geld! – und sah mich überall um. Es war schon lustig, dass zum Beispiel zwei zärtlich knutschende Jungs sich den SM-Porno anguckten oder ein strammer Lederkerl unter rosa Rosen einem anderen an die schwarze Latex-Wäsche ging.
Endlich begann die Bühnenshow. Das kleine Podium war genau zwischen den beiden Bereichen platziert. Der Perlenvorhang wurde zurückgezogen. Zwei Männer in Frauenkleidung traten auf. Das war ganz hübsch, interessierte mich aber nicht sehr. Ich fieberte dem Auftritt von Robin entgegen. Nach einem Akrobaten, dessen eng anliegendes Kostüm wirklich sehr sexy aussah, und einer anregenden Pantomime zum Thema »Schwulsein im Büro« war es schließlich so weit. Der Vorhang – halb rot und halb rosa – schwang auf. Robin betrat die Bühne und hob zur Begrüßung die Arme. Alle klatschten. Seine üppigen Gold-Kastanien-Locken schimmerten metallisch im Scheinwerferlicht, sein schönes Gesicht strahlte. Er trug Westernkleidung – Jeans, verzierte Goldlederstiefel, ein schwarzes Paillettenhemd mit goldfarbener Weste und einen superschicken, schwarzen Cowboyhut. Um die schmalen Hüften hatte er einen vergoldeten Patronengurt mit Revolver geschnallt. In der Hand hielt er eine glänzende Westerngitarre. Ich hatte selbst früher ein bisschen Gitarre gespielt und war deshalb besonders gespannt.
Robin setzte einen Fuß auf einen paillettenbeklebten Stuhl und nahm die Gitarre aufs Knie. Schon als er die ersten Akkorde anschlug, rieselte mir die Erregung den Rücken hinunter. Dann begann er zu singen. Mein Schwanz wurde so hart, wie es in meiner engen Hose überhaupt möglich war. Robin sang ganz schrecklich schmalzige Lieder, zum Beispiel »Cowboy Life«, »Oklahoma My Home« und »Johnny Was A Cowboy«. Aber wie er sie sang! Seine wundervolle Stimme hatte einen Umfang von den höchsten Tenortönen bis zum tiefen Bariton. Mit dieser Stimme konnte er so schnulzig modulieren, schleifen, schmieren oder vibrieren wie er wollte, es klang trotzdem genial. Auch wenn ich selbst kein Instrument mehr spielte, so hatte ich doch ein Ohr dafür. Ich liebe Musik sehr. Und dieser Kerl da vorn, der zwischendurch seine Locken effektvoll über die Schultern warf oder mit der Hand über seine prallvolle Schrittwölbung strich, der konnte es! Der konnte Musik machen! Ich hing mit den Augen an seinen Lippen, an seinem ganzen Körper.