
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mordkommission Dublin
- Sprache: Deutsch
Die Nummer 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste jetzt im Taschenbuch Ein Fall so dicht wie der Nebel über Dublin Die Kollegen in der Dubliner Mordkommission machen der eigenwilligen Antoinette Conway das Leben zur Hölle. Nur ihr Partner Stephen Moran hält noch zu ihr. Als eine junge Frau zu Hause tot aufgefunden wird, sieht alles nach einer schnell aufzuklärenden Beziehungstat aus. Aber warum hat dann jemand aus der Mordkommission ein Interesse, die Ermittlungen zu behindern? Soll Antoinette endgültig aus dem Dezernat fliegen? Weiß außer ihr und Stephen noch jemand, dass sie das Opfer schon einmal gesehen hat? Ermittler, Verdächtige und Zeugen finden sich in einem gefährlichen Vernehmungskreisel wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
TANAFRENCH
Gefrorener Schrei
Roman
Biografie
»Sie ist eine der besten Kriminal-Autorinnen der Welt«, sagt die ›Washington Post‹ über die irische Schriftstellerin Tana French. Ihre tiefgründigen, hochspannenden Romane um verschiedene Ermittler der Dubliner Mordkommission finden sich regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten.Tana French wuchs in Irland, Italien und Malawi auf und lebt seit 1990 in Dublin. Sie absolvierte eine Schauspielausbildung am Trinity College und arbeitete für Theater, Film und Fernsehen. In ihren Kriminalromanen, für die Tana French vielfach ausgezeichnet wurde, schaut sie tief in die Seelen von eng miteinander verstrickten Tätern, Opfern und Ermittlern. Mit ihrer eindrücklichen, präzisen und poetischen Sprache zeichnet die Autorin dabei markante Porträts der modernen irischen Gesellschaft. Tana French lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im nördlichen Teil von Dublin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
›The Trespasser‹ im Verlag Hodder & Stoughton, London
© 2016 Tana French
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de, nach einer Idee von Bridge 3, Kerstin Reitze
Coverabbildung: Fotolia
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403572-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Danksagung
FÜR OONAGH
Prolog
Meine Ma hat mir viele Geschichten über meinen Dad erzählt. In der ersten, an die ich mich erinnere, war er ein ägyptischer Prinz, der sie heiraten und für immer in Irland bleiben wollte, dann aber von seiner Familie gezwungen wurde, nach Hause zu kommen und eine arabische Prinzessin zu heiraten. Sie konnte gut Geschichten erzählen, meine Ma. Amethyst-Ringe an seinen langen Fingern, sie beide tanzend unter kreisenden Lichtern, sein Geruch nach Gewürzen und Kiefer. Ich, ausgestreckt unter der Bettdecke und in Schweiß gebadet – es war Winter, aber die Genossenschaft regulierte die Heizung für das ganze Mietshaus, und die Fenster in den oberen Stockwerken ließen sich nicht öffnen –, ich stopfte die Geschichte so tief in mich hinein, wie ich nur konnte, und verwahrte sie dort. Ich war noch klein. Diese Geschichte machte mich jahrelang stolz, bis ich acht war und sie meiner besten Freundin Lisa erzählte, die sich vor Lachen gar nicht mehr einkriegte.
Ein paar Monate später, als die Kränkung abgeklungen war, marschierte ich eines Nachmittags in die Küche, stemmte die Fäuste auf die Hüften und verlangte die Wahrheit. Meine Ma stutzte nicht mal, griff nach Fairy Ultra und erzählte mir beim Spülen, dass er ein Medizinstudent aus Saudi Arabien gewesen sei. Sie habe ihn kennengelernt, als sie eine Ausbildung zur Krankenschwester machte – an der Stelle kamen viele hübsche Details, die anstrengenden Nachtschichten und das übermüdete Lachen und wie sie beide ein Kind retteten, das von einem Auto überfahren worden war. Er war längst nach Saudi Arabien zurückgekehrt, ohne eine Anschrift zu hinterlassen, als sie merkte, dass ich unterwegs war. Sie brach ihre Ausbildung ab und bekam mich.
Mit der Geschichte konnte ich wieder eine Weile gut leben. Sie gefiel mir. Ich nahm mir sogar insgeheim vor, als Erste von unserer Schule Medizin zu studieren, weil es mir ja schließlich im Blut lag und so. Bis ich zwölf war und wegen irgendwas nachsitzen musste und von meiner Ma einen Anpfiff bekam nach dem Motto, sie würde nicht zulassen, dass ich so endete wie sie, ohne Schulabschluss und ohne Hoffnung auf was Besseres als Putzstellen zum Mindestlohn bis ans Ende ihrer Tage. Ich hatte das alles schon tausendmal gehört, aber an dem Tag fiel mir auf, dass man ohne Schulabschluss keine Krankenschwesterausbildung machen kann.
An meinem dreizehnten Geburtstag sah ich ihr über den Kuchen hinweg in die Augen und erklärte, dass ich es diesmal ernst meinte, ich wolle es wissen. Sie seufzte, sagte, ich sei alt genug, die Wahrheit zu erfahren, und erzählte mir, er sei ein Gitarrist aus Brasilien gewesen, mit dem sie ein paar Monate zusammen gewesen sei, bis er sie eines Abends in seiner Wohnung verprügelte. Als er eingeschlafen war, habe sie sich seinen Autoschlüssel geschnappt und sei nach Hause gefahren, als wäre der Teufel hinter ihr her, über vom Regen leergefegte Straßen und mit einem blauen Auge, das im Takt der Scheibenwischer pochte. Als er schluchzend und Entschuldigungen stammelnd anrief, hätte sie ihn vielleicht sogar zurückgenommen – sie war zwanzig –, aber da habe sie schon von mir gewusst. Sie habe aufgelegt.
Das war der Tag, an dem ich beschloss, nach der Schule Polizistin zu werden. Nicht weil ich vorhatte, mir alle prügelnden Männer da draußen à la Catwoman vorzuknöpfen, sondern weil meine Ma gar nicht Auto fahren kann. Ich wusste, dass die Polizeischule irgendwo in der Pampa war. Es war die schnellste Möglichkeit, die mir einfiel, von meiner Ma wegzukommen, ohne eine miese Putzstelle annehmen zu müssen.
Auf meiner Geburtsurkunde steht Vater unbekannt, aber es gibt Mittel und Wege. Alte Bekannte, DNA-Datenbanken. Und es gibt Mittel und Wege, wie ich meine Ma weiter hätte bedrängen können, den Druck jedes Mal ein bisschen erhöhen, bis ich ihr irgendwas entlockt hätte, was nah genug an der Wahrheit dran war, um damit arbeiten zu können.
Ich habe sie nie wieder gefragt. Damals, mit dreizehn, weil ich sie dafür hasste, dass ich mein Leben so lange um ihre idiotischen Geschichten herum erfunden hatte. Als ich dann älter war, als ich es an die Polizeischule geschafft hatte, weil ich dachte, dass ich möglicherweise verstand, warum sie es getan hatte, und weil ich wusste, dass sie recht gehabt hatte.
1
Der Fall kommt an einem frostigen frühen Morgen im Januar rein oder jedenfalls rein zu uns. Es ist ein Januar, der stillzustehen scheint, so dass du schon glaubst, die Sonne wird sich nie wieder über den Horizont hieven. Mein Partner und ich haben gerade mal wieder eine von diesen Nachtschichten hinter uns, von denen ich dachte, die gäbe es in der Mordkommission nicht: ein Riesenhaufen Langeweile und ein noch größerer Haufen Blödheit gekrönt mit einer ganzen Lawine Papierkram. Zwei Asos haben aus Gründen, die nicht mal ihnen selbst einleuchten, beschlossen, zum Abschluss ihres Samstagabends den Kopf eines anderen Asos als Tanzmatte zu benutzen. Wir haben sechs Zeugen aufgetrieben, von denen jeder Einzelne hackevoll war, von denen jeder Einzelne eine andere Geschichte erzählte als die übrigen fünf, und von denen jeder Einzelne wollte, dass wir den Fall vergessen und stattdessen herausfinden, warum er aus dem Pub geflogen ist/schlechtes Gras angedreht bekommen hat/von seiner Freundin abserviert wurde. Als Zeuge Nummer 6 mich beauftragte herauszufinden, warum man ihm die Stütze gestrichen hat, war ich kurz davor, ihm zu sagen, weil er zu dämlich ist, um von Amts wegen als menschliches Wesen eingestuft zu werden, und die ganze Bagage mit einem Tritt in den Hintern auf die Straße zu befördern, aber mein Partner ist in Sachen Geduld besser als ich, was einer der Hauptgründe ist, warum ich ihn behalte. Wir schafften es tatsächlich, vier Zeugenaussagen nicht nur miteinander in Übereinstimmung zu bringen, sondern auch mit der Beweislage, so dass wir einen dieser Vollpfosten wegen Totschlag und den anderen wegen schwerer Körperverletzung drankriegen können, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir die Welt auf irgendeine Weise, die mir sonstwo vorbeigeht, vor Bösem bewahrt haben.
Wir haben unsere Asos zwecks Überstellung in U-Haft an die Kollegen weitergereicht und tippen unsere Berichte, damit sie auch hübsch ordentlich auf dem Schreibtisch vom Boss liegen, wenn er reinkommt. Mir gegenüber pfeift Steve vor sich hin, was mich bei den meisten Leuten aggressiv machen würde, aber bei ihm klingt es gut: irgendein altes Volkslied, an das ich mich vage vom Singen in der Schule erinnere, leise und gedankenverloren und zufrieden, mit kurzen Pausen, wenn er sich konzentrieren muss, um dann mit lockeren Trillern und frischem Schwung neu einzusetzen, wenn der Bericht ihm wieder flott von der Hand geht.
Er und das säuselnde Summen der Computer und der Winterwind, der sachte um die Fenster streicht: nur das und Stille. Das Morddezernat ist in der Dubliner Burg untergebracht, mitten im Herzen der Stadt, aber unser Gebäude liegt ein paar Ecken entfernt von dem noblen Zeug, das die Touristen anlockt, und unsere Mauern sind dick; sogar der frühmorgendliche Verkehr auf der Dame Street kommt bei uns bloß als unaufdringliches Rauschen an. Die Mengen an Unterlagen und Fotos und handschriftlichen Notizen, die auf den Schreibtischen herumliegen, sehen aus, als würden sie sich aufladen, ungeduldig darauf warten, dass es losgeht. Draußen vor den hohen Schiebefenstern lichtet sich die Nacht zu einem kalten Grau. Der Raum riecht nach Kaffee und warmen Heizkörpern. Wenn ich über alles hinwegsehen könnte, was an der Nachtschicht nervt, könnte ich unser Großraumbüro um diese Tageszeit wirklich lieben.
Steve und ich kennen alle offiziellen Gründe, warum wir so oft Nachtschicht schieben müssen. Wir sind beide solo, keine Ehefrauen oder Ehemänner oder Kinder, die zu Hause warten. Wir sind die Jüngsten im Dezernat, wir können die Müdigkeit besser wegstecken als die Kollegen kurz vor dem Ruhestand. Wir sind die Neuen – sogar ich, obwohl ich schon zwei Jahre dabei bin –, also haltet mal schön die Klappe! Und das tun wir. Wir sind hier nicht bei der Streife, wo du eine Versetzung beantragen kannst, wenn dein Boss ein gemeiner Fiesling ist. Es gibt keine andere Mordkommission, in die du versetzt werden könntest. Das hier ist die einzige. Wenn du hier arbeiten willst, und das wollen wir beide, dann nimmst du alles, was du kriegen kannst.
Manche arbeiten tatsächlich in der Mordkommission, die ich damals angestrebt habe: wo du tagsüber messerscharfe Gedankenspiele mit psychopathischen Genies spielst und weißt, dass ein Blinzeln zu viel den Unterschied ausmachen kann zwischen Sieg oder der nächsten Leiche. Steve und ich dürfen den durchtriebenen Psychopathen nur hinterherschauen, wenn die anderen sie an dem Vernehmungsraum vorbeiführen, in dem uns irgendein Ehemann der Woche aus der Endlos-Serie »Gewalt in der Familie« in den Wahnsinn treibt. Der Boss drückt uns genau diese Fälle aufs Auge, weil er weiß, dass sie mich stinksauer machen. Die kopftanzenden Asos waren wenigstens mal eine Abwechslung.
Steve klickt auf Drucken, und der Drucker in der Ecke erwacht ruckelnd und schnaufend zum Leben. »Fertig?«, fragt er.
»So gut wie.« Ich überfliege meinen Bericht auf der Suche nach Tippfehlern, um dem Boss keinen Vorwand zu liefern, mich runterzuputzen.
Steve verschränkt die Hände über dem Kopf und reckt sich so weit nach hinten, dass sein Sessel quietscht. »Bierchen? Die ersten Pubs machen gleich auf.«
»Soll das ein Witz sein?«
»Um zu feiern.«
Steve, ganz großartig, ist auch in Sachen positives Denken besser als ich. Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, der seinen Versuch schon im Ansatz ersticken dürfte. »Um was zu feiern?«
Er grinst. Steve ist dreiunddreißig, ein Jahr älter als ich, sieht aber jünger aus: Vielleicht liegt das an der Schuljungenstatur, schlaksige Beine und schmale Schultern; vielleicht an dem karottenroten Haar, das in alle Himmelsrichtungen absteht; oder vielleicht an seiner ständigen, gottverdammten guten Laune. »Wir haben sie drangekriegt, schon vergessen?«
»Die beiden hätte sogar deine Oma drangekriegt.«
»Wahrscheinlich. Und dann hätte sie sich hinterher ein Bierchen genehmigt.«
»War wohl Alki, was?«
»Total versoffen. Ich versuche bloß, ihrem Beispiel zu folgen.« Er geht zum Drucker und fängt an, die Seiten zu sortieren. »Komm schon.«
»Nee. Ein anderes Mal.« Ich habe einfach keine Lust. Ich will nach Hause, noch eine Runde joggen, irgendwas in die Mikrowelle schmeißen und mich mit hirnlosem Fernsehen betäuben, und dann will ich ein paar Stunden schlafen, bevor alles wieder von vorne losgeht.
Die Tür fliegt auf, und O’Kelly, unser Superintendent, steckt den Kopf herein. Er ist wie immer zu früh, weil er hofft, irgendwen bei einem Nickerchen zu erwischen. Meistens kommt er frühlingsfrisch an, duftet nach Duschgel und Spiegeleiern mit Speck, jedes einzelne seiner schütteren Haare da, wo es hingehört – ich kann nicht beweisen, dass er damit den müden Hunden, die nach Nachtschicht und pappigen Donuts aus dem Supermarkt riechen, eins auswischen will, aber es würde zu ihm passen. Heute Morgen sieht er zumindest einigermaßen angeschlagen aus – Tränensäcke, Teefleck auf dem Hemd –, aber ich vermute, die kleine Genugtuung, die mir das verschafft, wird für den ganzen Tag reichen müssen.
»Moran. Conway«, sagt er und beäugt uns mürrisch. »Irgendwas Gutes reingekommen?«
»Schlägerei«, sage ich. »Ein Toter.« Dass dein Privatleben drunter leidet, ist nicht das Schlimmste an der Nachtschicht: In Wahrheit wird sie von allen gehasst, weil nie irgendwas Ordentliches reinkommt. Die spektakulären Morde mit komplexen Hintergründen und faszinierenden Motiven mögen ja nachts passieren, manchmal, aber sie werden erst morgens entdeckt. Die einzigen Morde, die schon nachts auffallen, werden von besoffenen Vollpfosten begangen, die nur ein Motiv haben, dass sie nämlich besoffene Vollpfosten sind. »Die Berichte sind gleich fertig.«
»Wenigstens hatten Sie was zu tun. Aufgeklärt?«
»So ziemlich. Den Rest erledigen wir heute Abend.«
»Gut«, sagt O’Kelly. »Dann können Sie ja das hier übernehmen.« Und er hält ein Einsatzformular hoch.
Bloß für eine Sekunde mache ich mir idiotische Hoffnungen. Wenn ein Fall vom Boss zugeteilt statt von der Zentrale direkt zu uns hochgeschickt wird, muss er was Besonderes sein. Einer, der so publicityträchtig oder so brutal oder so heikel ist, dass er nicht einfach an den Erstbesten auf dem Dienstplan gehen kann; so einer braucht die richtigen Leute. Ein Fall, der direkt vom Boss kommt, surrt durchs Dezernat, lässt alle Haltung annehmen und aufhorchen. Ein Fall, der direkt vom Boss kommt, würde bedeuten, dass Steve und ich es endlich, endlich aus der Loser-Ecke des Spielplatzes geschafft haben: Wir sind drin.
Ich muss meine Faust zwingen, nicht nach dem Blatt zu greifen. »Worum geht’s?«
O’Kelly schnaubt. »Gucken Sie nicht, als wäre Fütterungszeit im Zoo, Conway. Ich hab’s mitgenommen, als ich reinkam, hab gesagt, ich bring es hoch, um Bernadette den Weg abzunehmen. Die Streifenkollegen am Tatort sagen, es sieht aus wie eine glasklare Beziehungstat.« Er wirft das Einsatzformular auf meinen Schreibtisch. »Ich hab gesagt, Sie werden denen sagen, wonach es aussieht, besten Dank auch. Man weiß ja nie, vielleicht haben Sie Glück: Könnte auch ein Serienmörder gewesen sein.«
Um Bernadette den Weg abzunehmen, ja klar. O’Kelly hat das Einsatzformular hochgebracht, weil er unbedingt meinen Gesichtsausdruck sehen wollte. Ich lasse es unangetastet liegen. »Die Tagschicht müsste jeden Moment hier sein.«
»Und Sie sind es jetzt schon. Falls Sie heute noch ein heißes Date haben, sollten Sie sich beeilen und den Fall aufklären.«
»Wir sitzen an unseren Berichten.«
»Menschenskind, Conway, Sie müssen hier ja nicht James Joyce spielen. Geben Sie mir einfach, was Sie haben. Und jetzt machen Sie sich auf die Socken. Sie müssen nach Stoneybatter, und da buddeln sie wieder mal die Kais auf.«
Nach kurzem Zögern klicke ich auf Drucken. Steve, der kleine Arschkriecher, wickelt sich schon den Schal um den Hals.
Der Boss ist zu dem Whiteboard mit dem Dienstplan rübergeschlendert und studiert ihn blinzelnd. Er sagt: »Bei der Sache brauchen Sie Verstärkung.«
Ich spüre förmlich, wie Steve mich innerlich anfleht, Ruhe zu bewahren. »Mit einer glasklaren Beziehungstat werden wir auch alleine fertig«, sage ich. »Wir haben weiß Gott schon genug davon bearbeitet.«
»Und jemand mit ein bisschen Erfahrung könnte Ihnen beibringen, wie man’s richtig macht. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie die Sache mit der jungen Rumänin aufgeklärt hatten? Fünf Wochen? Und das, obwohl zwei Zeugen gesehen hatten, wie der Typ sie niedersticht, und obwohl die Presse und die Gutmenschenpatrouille sich aufgeregt haben von wegen Rassismus, und wenn es eine junge Irin gewesen wäre, hätten wir schon längst wen verhaftet –«
»Die Zeugen wollten nicht mit uns reden.« Steves Blick sagt: Halt den Mund, Antoinette, zu spät. Ich hab angebissen, genau wie O’Kelly erwartet hat.
»Richtig. Und falls die Zeugen heute auch nicht mit Ihnen reden wollen, möchte ich, dass ein alter Hase dabei ist, der sie zum Reden bringt.« O’Kelly tippt aufs Whiteboard. »Breslin hat gleich Dienst. Nehmen Sie den. Der kann gut mit Zeugen.«
Ich sage: »Breslin ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich denke mal, der kann mit seiner kostbaren Zeit was Besseres anfangen, als bei unsereins Händchen zu halten.«
»Kann er, ja, aber jetzt hat er Sie am Hals. Also sollten Sie seine kostbare Zeit nicht überstrapazieren.«
Steve nickt übertrieben, denkt, so laut er kann, in meine Richtung, Halt die Klappe, könnte noch viel schlimmer sein. Was auch stimmt. Ich verkneife mir den nächsten Widerspruch. »Ich ruf ihn von unterwegs an«, sage ich, nehme das Einsatzformular und stopfe es in meine Jackentasche. »Er kann dann direkt hinkommen.«
»Ich bitte darum. Bernadette hat schon die Spurensicherung und die Rechtsmedizin verständigt, und ich sage ihr, sie soll Ihnen ein paar Sonderfahnder besorgen. Mehr werden Sie wohl kaum brauchen.« O’Kelly geht zur Tür und schnappt sich auf dem Weg dahin die ausgedruckten Seiten. »Und falls Sie nicht wollen, dass Breslin Sie vorführt, sehen Sie zu, dass Sie sich irgendwo ’n Kaffee besorgen. Sie sehen beide beschissen aus.«
Die Straßenlaternen in der Burganlage sind noch an, aber die Stadt erhellt sich kaum merklich zu so etwas Ähnlichem wie einem Morgen. Es regnet nicht, und das ist gut so: Irgendwo jenseits des Flusses könnte es Schuhabdrücke geben, die auf uns warten, oder Zigarettenkippen mit DNA drauf – aber es ist eiskalt und feucht, mit einem feinen, diesigen Schleier um die Laternen. Es ist die Art von Feuchtigkeit, die tief eindringt und sich festsetzt, bis du das Gefühl hast, deine Knochen sind kälter als die Luft um dich herum. Die ersten Cafés machen gerade auf, es riecht nach brutzelnden Würstchen und Busabgasen. »Müssen wir irgendwo anhalten und dir einen Kaffee besorgen?«, frage ich Steve.
Er wickelt seinen Schal fester um den Hals. »Quatsch. Je schneller wir da sind …«
Er beendet den Satz nicht, muss er auch nicht. Je schneller wir am Tatort sind, desto mehr Zeit haben wir, bevor der Musterschüler auftaucht, um uns armen begriffsstutzigen Trotteln zu zeigen, wie man’s richtig macht. Ich weiß eigentlich nicht, wieso mir das in diesem Moment wichtig ist, aber irgendwie tut es gut zu wissen, dass Steve das genauso sieht. Wir sind beide langbeinig, wir gehen beide schnell, und wir konzentrieren uns aufs Gehen.
Wir sind auf dem Weg zum Fuhrpark. Wir wären schneller, wenn wir meinen oder Steves Wagen nehmen würden, aber das macht man einfach nicht, niemals. Manche Viertel haben was gegen Cops, und wer an meinem Audi TT den Lack zerkratzt, verliert garantiert ein Bein oder einen Arm. Und es gibt Fälle – im Voraus weißt du nicht, welche, jedenfalls nicht mit Sicherheit –, wo du, wenn du mit deinem eigenen Wagen vorfahren würdest, durchgeknallten Schlägertypen praktisch deine Privatadresse auf dem Silbertablett überreichst. Und ehe du weißt, wie dir geschieht, wird deine Katze an einen Ziegelstein gebunden, angezündet und durch dein Fenster geschmissen.
Meistens fahre ich. Ich bin ein besserer Fahrer als Steve und ein weitaus schlechterer Beifahrer. Wenn ich fahre, kommen wir beide sehr viel besser gelaunt am Ziel an. Im Fuhrpark entscheide ich mich für einen verkratzten weißen Opel Kadett. Stoneybatter ist das alte Dublin, Arbeiter und Arbeitslose, durchmischt mit allerlei Yuppies und Künstlern, die sich während des Wirtschaftsbooms dort was gekauft haben, weil das Viertel so herrlich ursprünglich war, will heißen, weil sie sich keine schickere Gegend leisten konnten. Manchmal braucht man einen Wagen, um Eindruck zu schinden. Diesmal nicht.
»Ach, Mist«, sage ich, als ich aus der Garage setze und die Heizung aufdrehe. »Jetzt kann ich Breslin gar nicht anrufen. Muss ja fahren.«
Steve grinst prompt. »So ein Mist. Und ich muss das Einsatzformular lesen. Wir können ja schließlich nicht völlig ahnungslos am Tatort eintrudeln.«
Ich gebe Vollgas, um noch über eine gelbe Ampel zu kommen, ziehe das Formular aus der Tasche und werfe es ihm hin. »Na los. Lass hören.«
Er überfliegt die Seite. »Der Anruf ging um sechs Minuten nach fünf auf der Polizeiwache Stoneybatter ein. Männlicher Anrufer, wollte seinen Namen nicht nennen. Anonyme Nummer.« Also ein Amateur, falls er denkt, das würde ihm was nützen. Der Telefonanbieter kann uns die Nummer innerhalb weniger Stunden liefern. »Er hat gesagt, in Viking Gardens Nummer sechsundzwanzig wäre eine Frau verletzt. Der Kollege hat gefragt, was für eine Art von Verletzung, er hat gesagt, sie wäre gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Der Kollege hat gefragt, ob sie noch atmet; er hat gesagt, das wüsste er nicht, aber es sehe ziemlich schlimm aus. Der Beamte wollte ihm erklären, wie er ihre Vitalfunktionen checken kann, aber er hat gesagt: ›Schicken Sie einen Krankenwagen hin, schnell‹, und hat aufgelegt.«
»Freu mich schon drauf, ihn kennenzulernen«, sage ich. »Ich wette, er ist abgehauen, bevor Hilfe vor Ort war.«
»Ganz genau. Als der Krankenwagen eintraf, war die Tür abgeschlossen, und keiner hat aufgemacht. Eine Polizeistreife hat die Tür aufgebrochen und eine Frau im Wohnzimmer gefunden. Kopfverletzungen. Die Sanitäter haben den Tod festgestellt. Sonst niemand im Haus, keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen, keine Anzeichen für Raub oder Diebstahl.«
»Wenn der Typ einen Krankenwagen bestellt hat, wieso hat er dann in der Stoneybatter-Polizeiwache angerufen? Wieso hat er nicht den Notruf gewählt?«
»Vielleicht hat er gedacht, der Notruf könnte seine Nummer zurückverfolgen, aber eine kleine Polizeiwache wäre technisch nicht so gut ausgestattet.«
»Dann ist er ein verdammter Idiot«, sage ich. »Na toll.« O’Kelly hatte recht mit den Kais: Das Amt für Wahllose Buddelei ist auf einer Spur mit einem Presslufthammer zugange, und auf der anderen kriecht der Verkehr dermaßen zäh dahin, dass ich mir eine Zerstäuberpistole wünsche. »Hol mal das Blaulicht raus.«
Steve fischt die Lampe unter seinem Sitz hervor, lehnt sich aus dem Seitenfenster und knallt sie aufs Dach. Ich schalte die Sirene ein. Viel passiert nicht. Autos bewegen sich hilfsbereit ein paar Zentimeter zur Seite, weiter können sie nicht.
»Himmelherrgott nochmal«, sage ich. So was kann ich jetzt gerade brauchen. »Also wieso denken die Kollegen, es wäre eine Beziehungstat? Wohnt da noch wer? Ehemann, Partner?«
Steve blickt wieder auf das Formular. »Steht hier nicht.« Hoffnungsvoller Seitenblick zu mir: »Vielleicht liegen sie ja falsch, und es ist doch was Gutes.«
»Nein, ist es nicht, verdammt. Es ist bloß eine stinklangweilige Beziehungstat oder sogar nicht mal Mord. Vielleicht ist sie wirklich an einem blöden Sturz gestorben, wie der Anrufer gesagt hat, weil, wenn auch nur der Hauch einer Chance bestünde, dass es was halbwegs Interessantes ist, hätte O’Kelly auf die Tagschicht gewartet und den Fall Breslin und McCann zugeteilt oder zwei anderen Schleimern – Maaaaaaaann!!!« Ich knalle die Faust auf die Hupe. »Muss ich da raus und erst wen verhaften?« Irgendein Idiot an der Spitze des Staus merkt plötzlich, dass er im Auto sitzt, und fährt an. Der Rest macht mir den Weg frei, und ich gebe Gas, biege auf die Brücke und fahre über die Liffey in den Nordteil der Stadt.
Die unverhoffte Halbstille, weg von den Kais und den Bauarbeitern, fühlt sich gewaltig an. Die langen Reihen von hohen Backsteinhäusern und Ladenschildern schrumpfen und teilen sich in einzelne Häusergruppen, geben dem Licht Raum, sich über den Himmel auszudehnen, die tieferen Wolkenschichten grau und blassgelb zu färben. Ich schalte die Sirene aus. Steve greift aus dem Fenster und holt das Blaulicht wieder herein. Er behält es in den Händen, kratzt einen Dreckspritzer vom Glas, dreht es, um sich zu vergewissern, dass es sauber ist. Fängt nicht wieder an zu lesen.
Steve und ich kennen einander seit acht Monaten, sind seit vier Monaten Partner. Wir haben uns bei den Ermittlungen in einem anderen Fall kennengelernt, als er noch im Dezernat für Ungelöste Fälle war. Zuerst konnte ich ihn nicht leiden – alle anderen mochten ihn, und ich traue Leuten nicht, die jeder mag, außerdem lächelte er mir zu viel –, aber das änderte sich schnell. Als wir den Fall schließlich aufgeklärt hatten, konnte ich ihn genug leiden, um meine fünf Minuten in O’Kellys Gunst dafür zu nutzen, ein gutes Wort für Steve einzulegen. Das Timing war günstig – aus eigenem Antrieb hätte ich mir keinen Partner gesucht, ich war gern Einzelkämpferin, aber O’Kelly hatte immer deutlicher gemacht, dass ahnungslose Neulinge in seinem Dezernat keine Alleingänge machten –, und ich bereue es nicht, auch wenn Steve eine fidele kleine Nervbacke ist. Es fühlt sich richtig an, wenn ich von meinem Schreibtisch aufblicke und ihn mir gegenüber sehe, wenn er Schulter an Schulter mit mir an einem Tatort steht, wenn er neben mir am Vernehmungstisch sitzt. Unsere Aufklärungsrate ist top, ganz gleich, was O’Kelly sagt, und wir gehen öfter mal zusammen einen trinken, um zu feiern. Steve fühlt sich an wie ein Freund oder wie etwas, das ganz nah dran ist. Aber wir lernen uns noch immer kennen, haben noch immer keine Garantie.
Ich kenne ihn jedenfalls gut genug, um zu wissen, wenn er was sagen will. Ich sage: »Was?«
»Lass dich vom Boss nicht so nerven.«
Ich schiele zu ihm rüber: Steve sieht mich unverwandt an. »Willst du damit sagen, ich bin überempfindlich? Ernsthaft?«
»Es ist doch kein Weltuntergang, wenn er meint, wir müssen im Umgang mit Zeugen besser werden.«
Ich brettere doppelt so schnell wie erlaubt eine Seitenstraße runter, aber Steve kennt meinen Fahrstil und bleibt entspannt. Ich dagegen beiße die Zähne aufeinander. »Und ob es das ist. Überempfindlich wäre, wenn es mir was ausmachen würde, was Breslin oder sonst wer von unseren Befragungstaktiken hält, und das ist mir wirklich so was von egal. Aber wenn O’Kelly denkt, wir kommen nicht klar, dann werden wir weiterhin diese öden Schwachsinnsfälle kriegen, und irgendein Vollidiot wird uns weiterhin dabei auf die Finger gucken. Geht dir das nicht auf den Zeiger?«
Steve zuckt die Achseln. »Breslin ist bloß Verstärkung. Es bleibt unser Fall.«
»Wir brauchen aber keine Verstärkung. Die sollen uns verdammt nochmal in Ruhe lassen, damit wir unseren Job machen können.«
»Das werden sie. Früher oder später.«
»Ach ja? Und wann?«
Daraufhin schweigt Steve, natürlich. Ich bremse ab – der Kadett fährt sich wie ein Einkaufswagen. Der Sonntagmorgen in Stoneybatter kommt allmählich in Gang: Jogger auf den Bürgersteigen, genervte Teenager, die Hunde hinter sich herziehen und alles total gemein finden, eine junge Frau nach durchgefeierter Nacht in Ausgehklamotten auf dem Nachhauseweg, mit Gänsehaut an den Beinen und ihren Schuhen in der Hand.
Ich sage: »Lange mach ich das nicht mehr mit.«
Burnout kommt vor. Öfter in Dezernaten wie Sitte und Drogen, wo du es Tag für Tag mit demselben widerwärtigen Mist zu tun hast und nichts, was du tust, irgendwas bewirkt. Du strampelst dich ab, um wen zu überführen, und am Ende werden dieselben Mädchen weiter auf die Straße geschickt, nur eben von einem neuen Drecksack; dieselben Junkies kaufen weiter denselben Stoff, nur eben von einem neuen Drogenboss. Wenn du ein Loch gestopft hast, tut sich gleich das nächste auf, und der Mist nimmt einfach kein Ende. Das macht die Leute fertig. Wenn du dagegen im Morddezernat jemanden einbuchtest, bleiben alle, die er noch getötet hätte, am Leben. Meistens hast du es mit einem einzigen Täter zu tun und nicht gleich mit der ganzen dunklen Seite der menschlichen Natur, und einen Einzeltäter kannst du besiegen. Im Morddezernat halten die Leute durch. Ihr ganzes berufliches Leben. In allen Dezernaten halten die Leute sehr viel länger durch als zwei Jahre.
Aber meine zwei Jahre waren anders als bei anderen. Die Fälle sind nicht das Problem – ich könnte ununterbrochen Kannibalen und Kindermörder verkraften, ohne auch nur eine Minute länger wachzuliegen. Wie gesagt, einen Einzeltäter kannst du besiegen. Aber dein eigenes Dezernat besiegen, das ist etwas ganz anderes.
Steve kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht bloß Dampf ablasse. Nach einer Sekunde fragt er: »Was würdest du denn stattdessen machen? Wieder zurück zur Vermisstenstelle wechseln?«
»Nee, niemals.« Ich gehe nicht rückwärts. »Ein alter Schulfreund von mir ist Teilhaber bei einem Sicherheitsdienst. Die machen die ganz großen Sachen, Bodyguards für irgendwelche Stars, international. Da nimmst du keine Ladendiebe beim Discounter hops oder so. Er meinte, falls ich Interesse hätte …«
Ich sehe Steve nicht an, aber ich spüre, dass er mich aufmerksam beobachtet. Ich kann nicht sagen, was in seinem Kopf vorgeht. Steve ist ein anständiger Kerl, aber er möchte auch beliebt sein. Wenn ich weg wäre, würde er sich prima ins Dezernat einfügen, falls er das wollte. Er wäre einer von den Jungs, würde ordentliche Fälle bearbeiten und rumflachsen, ganz einfach.
»Die zahlen super«, sage ich. »Und als Frau hätte ich sogar einen Vorteil. Viele von diesen Typen wollen nämlich weibliche Bodyguards für ihre Ehefrauen und Töchter. Und auch für sich selbst. Ist weniger auffällig.«
Steve sagt: »Und, wirst du ihn anrufen?«
Ich halte am Anfang von Viking Gardens. Die Wolken haben sich so weit aufgelockert, dass Licht hindurchdringt und die Schieferdächer und schrägen Laternenpfähle mit einer dünnen Schicht überzieht. So viel Sonnenschein hatten wir die ganze Woche noch nicht.
Ich sage: »Weiß nicht.«
Ich kenne Viking Gardens. Ich wohne nur zehn Minuten zu Fuß entfernt – weil ich Stoneybatter mag, nicht, weil ich mir nichts Schickeres leisten kann –, und eine meiner Joggingstrecken führt an der Straße vorbei. Der schöne Name verspricht mehr, als er hält: eine etwas heruntergekommene Sackgasse, gesäumt von einstöckigen Altbaureihenhäuschen, die direkt an mehrfach ausgebesserte Bürgersteige grenzen. Niedrige Schieferdächer, Gardinen, buntbemalte Türen. Die Straße ist so schmal, dass die Autos mit zwei Rädern auf dem Bordstein parken müssen.
Viel länger können wir den Anruf bei Breslin nicht hinausschieben, sonst kommt er ins Büro, und der Boss wird wissen wollen, wieso er nicht bei uns ist. Ehe wir aussteigen, rufe ich über eine spezielle Handyfunktion direkt seine Mailbox an – was uns vielleicht ein paar Minuten mehr verschafft, vielleicht auch nicht, aber zumindest erspart es mir, mit ihm quatschen zu müssen – und hinterlasse eine Nachricht. Ich stelle den Fall als stinklangweilig dar, was nicht besonders schwierig ist, aber ich weiß, das wird ihn nicht aufhalten. Breslin bildet sich ein, er wäre Mr Unersetzlich. Für eine schnöde Beziehungstat wird er genauso schnell auftauchen wie für einen menschenhäutenden Serienkiller, weil er meint, das arme Opfer ist verraten und verkauft, bis er dazukommt und die Lage rettet. »Auf geht’s«, sage ich und schwinge meine Tasche über die Schulter.
Nummer 26 ist das Häuschen ziemlich am Ende der Straße, das mit dem Polizeiabsperrband und dem Streifenwagen und dem weißen Van von der Spurensicherung. Ein paar Jugendliche, die sich vor dem Absperrband rumdrücken, hauen ab, als sie uns kommen sehen (»Aaaah! Nix wie weg!« »Hier, Missus, der war’s, der hat im Laden ein Snickers geklaut –« »Halt die Klappe, du Arsch!«), aber wir werden auf dem ganzen Weg die Straße hinunter beobachtet. Hinter den Gardinen spucken die Fenster Fragen aus wie Kirschkerne.
»Ich würde gern winken«, sagt Steve halblaut. »Darf ich winken, bitte?«
»Benimm dich wie ein Erwachsener.« Aber der Adrenalinstoß packt auch mich, sosehr ich mich dagegen wehre. Selbst wenn du weißt, dass dressierte Schimpansen deinen Job an dem Tag machen könnten, packt dich der Gang zum Tatort irgendwie: macht dich zum Gladiator auf dem Weg in die Arena, ein paar Herzschläge entfernt von einem Kampf, bei dem Kaiser deinen Namen skandieren. Und dann wirfst du einen Blick auf den Tatort, und deine Arena und dein Kaiser verpuffen, und du fühlst dich beschissener als vorher.
Der Streifenkollege an der Tür ist praktisch noch ein Kind, langer, wackelig wirkender Hals und große Ohren, die eine zu große Mütze halten. »Detectives«, sagt er, nimmt zackig Haltung an und überlegt, ob er salutieren sollte. »Garda JP Dooley.« Oder so ähnlich. Sein Akzent erfordert Untertitel.
»Detective Conway«, sage ich, während ich Handschuhe und Schuhhüllen aus meiner Tasche hervorhole. »Das ist Detective Moran. Haben Sie irgendwen gesehen, der hier nichts zu suchen hat?«
»Bloß die Kids, eigentlich.« Wir werden mit den Jugendlichen reden müssen und auch mit ihren Eltern. In einem gewachsenen Viertel wie dem hier achten die Leute noch aufeinander. Das ist nicht jedem recht, uns dagegen sehr. »Wir haben die Nachbarn noch nicht befragt. Wir haben gedacht, Sie wollen das vielleicht lieber selbst machen, eigentlich.«
»Gute Entscheidung«, sagt Steve und streift seine Handschuhe über. »Wir werden jemanden drauf ansetzen. Wie war die, als sie hier ankamen?«
Er deutet mit dem Kopf auf die in einem dezenten Blauton gestrichene Haustür, die zersplittert ist, weil die Kollegen sie aufgebrochen haben. »Zu«, sagt der Garda prompt.
»Tja, das war mir klar«, sagt Steve, aber mit einem Grinsen, das es zu einem Scherz zwischen den beiden macht, nicht zu dem Anschiss, den ich ausgepackt hätte. »Zu, aber wie? Verriegelt, abgeschlossen, eingerastet?«
»Ach so, ja, sorry, ich –« Der Garda ist rot angelaufen. »Die Tür hat ein Chubbschloss und ein Sicherheitsschloss. War aber nicht abgeschlossen, bloß eingerastet.«
Das heißt, falls der Täter vorn aus dem Haus ist, hat er die Tür einfach hinter sich zugezogen. Er brauchte also keinen Schlüssel. »Ist der Alarm losgegangen?«
»Nein, eigentlich gibt es eine Alarmanlage, eigentlich«, er zeigt auf einen Kasten an der Wand über uns –, »war aber nicht eingeschaltet. Ist nicht mal losgegangen, als wir rein sind.«
»Danke«, sagt Steve und grinst ihn wieder an. »Gut gemacht.« Der Garda wird dunkelrot. Stevie hat einen neuen Fan.
Die Tür schwenkt auf, und Sophie Miller reckt den Kopf heraus. Sophie hat große braune Augen und die Figur einer Ballerina und lässt einen weißen Schutzanzug mit Kapuze noch irgendwie elegant wirken, weshalb viele Leute versuchen, mit ihr Schlitten zu fahren, aber das versuchen sie auch nur einmal. Sie ist eine der besten Spurensicherer, die wir haben, und außerdem können wir zwei uns gut leiden. Ihr Anblick erleichtert mich mehr, als er sollte.
»Hey«, sagt sie. »Wurde aber auch Zeit.«
»Stau«, sage ich. »Hi. Was haben wir?«
»Sieht ganz nach Beziehungskrach aus. Seid ihr darauf abonniert, oder was?«
»Ist jedenfalls besser als organisiertes Verbrechen«, sage ich. Ich spüre Steves raschen, verblüfften Blick und schaue kühl zu ihm rüber: Er weiß, dass Sophie und ich befreundet sind, aber er sollte auch wissen, dass ich mich nicht an der Schulter meiner Freundin über die Situation im Dezernat ausheulen werde. »Bei Beziehungstaten kriegst du wenigstens auch mal Zeugen, die reden wollen. Lass uns reingehen.«
Das Cottage ist klein: Wir gelangen direkt ins Wohn-Esszimmer. Es gehen drei Türen ab, und ich weiß schon, welche wohin führt: Schlafzimmer linker Hand, Küche geradeaus, Duschbad rechts davon – der Grundriss ist derselbe wie bei mir. Die Einrichtung dagegen könnte unterschiedlicher nicht sein. Lila Teppich auf dem Laminatboden, schwere lila Vorhänge, die teuer auszusehen versuchen, lila Überwurf, kunstvoll auf der weißen Ledercouch arrangiert, belanglose Leinwanddrucke mit lila Blumen: Der Raum sieht aus, als wäre er über eine Home-Deko-App gekauft worden, wo du dein Budget und deine Lieblingsfarben eingibst, und das Ganze wird am nächsten Tag geliefert.
Hier drin ist immer noch gestern Abend. Die Vorhänge sind geschlossen. Das Deckenlicht ist ausgeschaltet, aber in den Ecken brennen Stehlampen. Sophies Kriminaltechniker – einer kniet vor der Couch und sichert mit Klebeband Fasern, einer bestäubt einen Beistelltisch mit Fingerabdruckpulver, einer macht gerade einen langsamen Schwenk mit einer Videokamera – haben ihre Stirnlampen an. Der Raum ist stickig und stinkt nach gebratenem Fleisch und Duftkerzen. Der Techniker vor der Couch zupft ein paarmal an der Vorderseite seines Overalls, um ein bisschen Luft da reinzubekommen.
Das Gasfeuer im Kamin brennt, künstliche Kohlen glühen, Flammen flackern manisch in dem überhitzten Raum. Der Kamin ist aus Naturstein, Rustikalkitsch, passend zu diesem reizenden Puppenhäuschen. Der Kopf der Frau ruht auf einer Ecke der Sockelplatte.
Sie liegt auf dem Rücken, x-beinig, als hätte jemand sie dorthingeschleudert. Ein Arm liegt neben dem Körper, der andere ist über den Kopf gereckt und seltsam abgewinkelt. Sie ist etwa einen Meter siebzig groß, dünn, trägt Stöckelschuhe, jede Menge künstliche Bräune, ein enges kobaltblaues Kleid und eine dicke Falschgoldkette. Über dem Gesicht liegen die blonden Haare, die so resolut geglättet und eingesprüht wurden, dass die Frisur selbst bei Mord gehalten hat. Sie sieht aus wie eine tote Barbie.
»Wissen wir schon, wer sie ist?«, frage ich.
Sophie deutet mit einer Kopfbewegung auf den Tisch neben der Haustür: ein paar Briefe, ein kleiner akkurater Stapel Rechnungen. »Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Aislinn Gwendolyn Murray. Ihr gehört das Haus – bei der Post ist ein Grundsteuerbescheid.«
Steve geht die Rechnungen durch. »Keine anderen Namen«, sagt er zu mir. »Sieht aus, als wäre sie alleinstehend.«
Aber ein Blick auf den Raum genügt, und mir ist klar, warum alle glauben, dass das hier das übliche Liebe-Hiebe-Szenario ist. Auf dem kleinen runden Tisch im Essbereich liegt eine lila Tischdecke. Er ist für zwei Personen gedeckt, weiße, raffiniert gefaltete Stoffservietten, die Gasflammen spiegeln sich auf Porzellan und poliertem Silberbesteck. Geöffnete Flasche Rotwein, zwei Gläser – unbenutzt –, ein hoher Kerzenständer. Die Kerze ist völlig heruntergebrannt, geschmolzene Wachsstalaktiten am Kerzenständer und Tropfen auf der Tischdecke.
Auf der Kaminsockelplatte ist eine breite Blutlache, die sich vom Kopf der Frau ausgebreitet hat, dunkel und klebrig. Ansonsten sehe ich nirgendwo Blut. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sie anzuheben, nachdem sie zu Boden gegangen war, sie zu halten, zu versuchen, sie wachzurütteln. Da hat einer nur gemacht, dass er wegkam.
Gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, hat der Anrufer gesagt. Entweder das stimmt, und Lover-Boy ist in Panik geraten und abgehauen – so was kommt vor, brave kleine Bürger, die vor lauter Schiss, Ärger zu kriegen, so unberechenbar reagieren wie Serienmörder –, oder aber er hat bei dem Sturz nachgeholfen.
»Cooper schon da gewesen?«, frage ich. Cooper ist der Rechtsmediziner. Er mag mich mehr als die meisten Menschen, aber er würde trotzdem nicht auf mich warten: Falls du nicht vor Ort bist, wenn Cooper seine vorläufige Untersuchung durchführt, ist das dein Problem, nicht seins.
»Hast ihn knapp verpasst«, sagt Sophie. Mit einem wachsamen Auge beobachtet sie ihre Mitarbeiter. »Er sagt, sie ist tot, nur für den Fall, dass uns das entgangen ist. Weil sie direkt neben dem Feuer gelegen hat, sind Abkühlen der Körpertemperatur und Einsetzen der Totenstarre schwer einzuschätzen, Todeszeitpunkt somit ziemlich ungenau: irgendwann zwischen sechs und elf gestern Abend.«
Steve deutet mit dem Kopf Richtung Tisch. »Wahrscheinlich vor halb neun, neun. Später hätten sie schon mit dem Essen angefangen.«
»Außer einer von ihnen hat ungewöhnliche Arbeitszeiten«, sage ich. Steve macht sich eine Notiz: Das müssen die Sonderfahnder überprüfen, sobald wir den Gast identifiziert haben. »Der Anrufer hat von Verletzungen durch einen Sturz gesprochen. Hat Cooper gesagt, ob das hinkommt?«
Sophie schnaubt. »Ja, genau. Ein ganz besonderer Sturz. Ihr Hinterkopf ist zertrümmert, und die Verletzung scheint zu der Ecke des Kaminsockels zu passen. Cooper ist praktisch sicher, dass sie daran gestorben ist, aber vor der Obduktion wird er es nicht laut aussprechen, nur für den Fall, dass er peruanisches Pfeilgift findet oder was weiß ich. Aber sie hat auch Hautabschürfungen und ein großes Hämatom links am Unterkiefer und ein paar abgebrochene Zähne – wahrscheinlich ist auch der Kieferknochen gebrochen, aber Cooper will sie erst auf dem Tisch haben, ehe er das bestätigt. Sie ist nicht aus zwei Richtungen gleichzeitig auf den Sockel gefallen.«
Ich sage: »Jemand hat sie ins Gesicht geschlagen. Sie ist nach hinten gekippt und mit dem Kopf auf den Sockel geknallt.«
»Ihr seid hier die Detectives, aber so sieht’s für mich aus.«
Die Fingernägel der Frau sind lang und kobaltblau, passend zum Kleid, und perfekt: Keiner ist abgebrochen, keiner auch nur beschädigt. Die hübschen Fotobände auf dem Couchtisch sind noch immer ordentlich sortiert; das Gleiche gilt für die hübschen Glasdinger und die Vase mit lila Blumen auf dem Kaminsims. Es hat keinen Kampf gegeben. Sie hatte gar keine Chance, sich zu wehren.
»Hat Cooper irgendeine Ahnung, womit er sie geschlagen hat?«, frage ich.
»Dem Muster der Prellung nach zu urteilen«, sagt Sophie, »mit der Faust. Was bedeutet, dass er Rechtshänder ist.«
Was bedeutet, dass es keine Waffe gibt, was bedeutet, dass es nichts gibt, was uns Fingerabdrücke liefern oder mit einem Verdächtigen in Verbindung gebracht werden könnte.
Steve sagt: »Wenn er so fest zugeschlagen hat, dass ihre Zähne abgebrochen sind, muss er sich die Knöchel verletzt haben. Das kann er nicht verbergen. Und mit ein bisschen Glück ist von einem aufgeplatzten Knöchel DNA in ihrem Gesicht haften geblieben.«
»Vorausgesetzt, er hat keine Handschuhe getragen«, sage ich. »Ziemlich unwahrscheinlich an einem so kalten Abend wie gestern.«
»Im Haus?«
Ich deute auf den Tisch. »Sie ist nicht mal dazu gekommen, Wein einzugießen. Er kann nicht lange hier gewesen sein.«
»Hey«, sagt Steve gespielt munter. »Wenigstens ist es Mord. Und du hast schon gedacht, die hätten uns hergeholt, weil irgendeine Oma über ihre Katze gestolpert ist.«
»Na toll«, sage ich. »Mit meinem Freudentänzchen warte ich aber noch ein bisschen. Hat Cooper sonst noch was gesagt?«
»Keine Abwehrverletzungen«, sagt Sophie. »Kleidung unberührt, keine Anzeichen für kürzlich erfolgten Geschlechtsverkehr, und bei den Abstrichen war kein Sperma festzustellen. Vergewaltigung könnt ihr vergessen.«
Steve sagt: »Es sei denn, unser Mann wollte, sie hat nein gesagt, und er hat ihr einen Schlag verpasst, um sie gefügig zu machen. Dann hat er gesehen, was er angerichtet hat, und ist abgehauen.«
»Kann sein. Aber auf jeden Fall könnt ihr vollzogene Vergewaltigung vergessen.« Sophie ist Steve erst einmal begegnet. Sie weiß noch nicht genau, ob sie ihn mag.
Ich sage: »Versuchte kommt auch nicht hin. Wie soll das abgelaufen sein? Er kommt rein und greift ihr sofort unter den Rock? Wartet nicht mal, bis sie ein bisschen Wein getrunken haben und seine Chancen größer sind?«
Steve zuckt die Achseln. »Stimmt auch wieder.« Er ist nicht beleidigt, wie viele Detectives das wären, wenn ihr Partner ihnen widerspricht, vor allem im Beisein von jemandem, der so aussieht wie Sophie. Das soll nicht heißen, dass Steve ein schwaches Ego hat – dann wäre er nicht Detective geworden –, nur dass sein Ego nicht darauf beruht, ständig einen auf dicke Hose zu machen. Es beruht darauf, Erfolg zu haben, was gut ist, und von anderen gemocht zu werden, was ganz nützlich ist und worauf ich achte wie ein Luchs.
»Ist ihr Handy hier irgendwo?«, frage ich.
»Ja. Da drüben auf dem Beistelltisch.« Sophie zeigt mit ihrem Stift. »Fingerabdrücke haben wir schon genommen. Wenn ihr damit rumspielen wollt, nur zu.«
Ehe wir uns den Rest des Häuschens ansehen, gehe ich neben der Leiche in die Hocke und hebe vorsichtig, mit einem Finger, die Haare vom Gesicht. Steve kommt dazu.
Bei Mordermittlungen macht das jeder Detective, den ich kenne: Er nimmt sich einen Augenblick Zeit, um dem Opfer ins Gesicht zu schauen. Es ergibt keinen Sinn, nicht für Außenstehende. Wenn wir bloß eine genaue Vorstellung vom Opfer haben wollten, um uns daran zu erinnern, für wen wir arbeiten, wäre jedes Selfie besser geeignet. Wenn wir einen Schuss Empörung bräuchten, um uns richtig in Rage zu bringen, würden die Verletzungen den eher liefern als das Gesicht. Aber wir tun es, selbst bei den ganz üblen Fällen, die kaum noch ein Gesicht haben, das man sich anschauen könnte; eine Woche im Sommer unter freiem Himmel, eine Wasserleiche, wir sehen sie uns dennoch an. Die größten Spacken im Dezernat, die Typen, die die Titten dieser Frau taxieren würden, während sie vor ihnen liegt und erkaltet, selbst die würden ihr diesen Respekt erweisen.
Sie ist irgendwas unter dreißig. Sie war hübsch, ehe jemand beschloss, die linke Seite ihrer Kinnpartie in einen blutigen blauroten Klumpen zu verwandeln; keine absolute Schönheit, aber gutaussehend, und sie hat viel dafür getan. Sie trägt eine Wagenladung Make-up, das volle Programm und gekonnt aufgetragen. Nase und Kinn könnten kleinmädchenhaft niedlich sein, wenn sie nicht so ausgezehrt aussähen, als hätte sie lange und ausdauernd gehungert. Der Mund – offen, so dass kleine, gebleachte Zähne und geronnenes Blut zu sehen sind – ist gut: weich und voll, mit einer leicht hängenden Unterlippe, die jetzt einfältig wirkt, aber gestern wahrscheinlich noch reizvoll war. Unter den drei ineinander übergehenden Schattierungen Lidschatten sind ihre Augen einen schmalen Spalt geöffnet und starren nach oben in eine Ecke der Zimmerdecke.
Ich sage: »Ich hab sie schon mal gesehen.«
Steves Kopf schnellt hoch. »Ja? Wo?«
»Weiß nicht genau.« Ich habe ein gutes Gedächtnis. Steve nennt es fotografisch. Ich nicht, weil das großkotzig klingen würde, aber ich weiß, wenn ich jemanden schon mal gesehen habe, und diese Frau habe ich schon mal gesehen.
Sie sah anders aus. Jünger, aber das könnte daran liegen, dass sie fülliger war – nicht richtig dick, aber mollig – und viel weniger Make-up trug: dezente Grundierung, eine Nuance dunkler als ihr Teint, dünne Wimperntusche, mehr nicht. Ihr Haar war braun und wellig, zu einem leicht missglückten Zopf geflochten. Dunkelblaues Kostüm, einen Tick zu eng, High Heels, auf denen ihre Knöchel wackelten: Erwachsenenkleidung für irgendeinen wichtigen Anlass. Aber das Gesicht, die zarte Stupsnase und die leicht hängende Unterlippe, die waren dieselben.
Sie stand im Sonnenlicht, kam auf mich zugewankt, Hände vorgestreckt. Helle zittrige Stimme: Aber bitte, ich muss wirklich … Ich, ausdruckslose Miene, Beine vor Ungeduld wippend, dachte: Jämmerlich.
Sie wollte irgendetwas von mir. Hilfe, Geld, Mitfahrgelegenheit, einen Rat? Ich wollte, dass sie mich in Ruhe ließ.
Steve sagt. »Arbeit?«
»Könnte sein.« Die ausdruckslose Miene kostete Willenskraft; wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich ihr gesagt, sie soll verschwinden.
»Wir lassen sie durch den Computer laufen, sobald wir wieder im Präsidium sind. Falls sie eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet hat …«
»Ich war nie im Dezernat für Häusliche Gewalt. Es muss früher gewesen sein, als ich noch bei der Schutzpolizei war. Und ich kann mich …« Ich schüttele den Kopf. Die Suchscheinwerferschwenks der Techniker mit ihren Stirnlampen lassen den Raum unförmig und bedrohlich wirken, machen uns zu hockenden Zielscheiben. »Ich kann mich an nichts in der Art erinnern.« Ich hätte sie nicht möglichst schnell loswerden wollen, nicht, wenn sie verprügelt worden war.
Die einen schmalen Spalt offenen Augen geben dem Gesicht einen durchtriebenen Ausdruck, wie ein Kind, das beim Versteckenspielen schummelt.
Steve richtet sich auf, lässt mir alle Zeit, die ich brauche. Er sieht Sophie fragend an und deutet auf das Lichtrechteck, das aus der Küchentür dringt. »Kann ich …?«
»Von mir aus. Wir haben alles da drin gefilmt, aber noch keine Fingerabdrücke genommen, also fang nicht an, irgendwas zu wienern.«
Steve geht zwischen den Technikern hindurch zur Küche. Die Decken sind so niedrig, dass er praktisch den Kopf einziehen muss, als er durch die Tür geht. »Wie läuft’s mit ihm?«, fragt Sophie, die mit dem Kopf hinter ihm herdeutet.
»Ganz gut. Er ist das kleinste meiner Probleme.« Ich lasse die Haare des Opfers wieder über das Gesicht fallen und stehe auf. Ich möchte mich bewegen. Wenn ich schnell und weit genug laufen würde, könnte ich die Erinnerung vielleicht einholen. Aber wenn ich anfange, an ihrem Tatort auf und ab zu tigern, schmeißt Sophie mich raus, Ermittlungsleitung hin oder her.
»Klingt ja super«, sagt Sophie. »Jetzt habt ihr alles so gesehen, wie wir es vorgefunden haben. Können wir nun endlich das Licht anmachen und aufhören, im Dunkeln rumzuhampeln?«
»Klar«, sage ich. Einer der Techniker schaltet die Deckenbeleuchtung ein, wodurch der Raum noch deprimierender wirkt. Die Stirnlampen hatten ihm einen unheimlichen Charakter verliehen, aber immerhin einen Charakter. Ich suche mir vorsichtig einen Weg zwischen gelben Nummerntafeln hindurch ins Schlafzimmer.
Es ist klein und blitzsauber. Auf dem Frisiertisch – ein verschnörkeltes weiß-goldenes Teil mit Rüschenüberwurf, als hätte ihn sich eine Achtjährige für ihr Prinzessinnenzimmer ausgesucht – liegen keine Schminkutensilien herum. Ich sehe bloß eine weitere Duftkerze und zwei Parfümflakons, eher dekorativ als zweckmäßig. Keine anprobierten und verworfenen Outfits auf dem Bett verteilt; die Bettdecke mit Gänseblümchenmuster ist symmetrisch glattgezogen, akkurat mit vier von diesen Zierkissen garniert, die ich nie kapieren werde. Aislinn hat aufgeräumt, nachdem sie sich fertig aufgebrezelt hatte: Hat jedes kleine Beweisstück versteckt, damit Lover-Boy auch ja nicht auf die Idee kommt, dass sie nicht von Natur aus so aussah wie etwas, was er sich im Katalog bestellt hatte. Er ist nicht bis hierher gekommen, aber sie hatte damit gerechnet.
Ich werfe einen Blick in den Einbauschrank. Jede Menge Klamotten, hauptsächlich Kostüme und Ausgehkleider, alle im mittleren Preissegment und unifarben mit einem glitzernden Detail, die Art Klamotten, die in morgendlichen Talkshows präsentiert werden, zusammen mit Blutgruppendiäten und Hautglättungsbehandlungen. Werfe einen Blick auf das verschnörkelte weiß-goldene Bücherregal: jede Menge Liebesromane, jede Menge alte Kinderbücher, jede Menge von diesen bescheuerten Geschichten von irgendwelchen Slum-Kindern, die fliegen lernen, und der Leser soll dadurch den Sinn des Lebens erkennen, ein paar Bücher über Verbrechen in Irland – Vermisste, Bandenkriminalität, Mord; ironischerweise ein paar Urban-Fantasy-Romane, die tatsächlich einen ganz guten Eindruck machen. Ich blättere die Bücher durch: Der Erleuchtungsstuss und die wahren Kriminalfälle sind voll mit Unterstreichungen, aber es fällt kein Der-Mörder-ist-Zettel heraus. Ich werfe einen Blick in den Nachttisch: Kleenexbox in Gänseblümchenmuster, Laptop, Aufladegeräte, ungeöffnete Sechserpackung Kondome. Ein Blick in den Papierkorb: nichts. Ein Blick unters Bett: nicht mal Staubflöckchen.
Das Zuhause des Opfers ist deine Chance, dir eine Vorstellung von dieser Person zu machen, die du nie kennenlernen wirst. Menschen filtern und stellen dar, selbst bei ihren Freunden, und dann filtern diese Freunde selbst noch einmal: Sie wollen nicht schlecht über den Toten reden, oder sie werden rührselig, wenn sie an ihren armen toten Kumpel denken, oder sie wollen nicht, dass du seine kleine Macke falsch interpretierst. Aber hinter der Tür zu den eigenen vier Wänden des Opfers fallen diese Filter weg. Du gehst durch diese Tür, und du suchst nach dem, was nicht beabsichtigt ist: was weggeräumt worden wäre, bevor Besuch kommt, was seltsam riecht und was zwischen die Sofakissen gerutscht ist. Nach den Fehlern, die das Opfer vor allen anderen verstecken wollte.
Dieser Raum liefert mir nichts. Aislinn Murray ist ein Bild in einem Hochglanzmagazin. Hier ist alles so sorgfältig geordnet, als hätte sie damit gerechnet, dass eine Versteckte-Kamera-Crew hereinplatzt und ihr Privatleben ins Internet stellt.
Paranoid? Kontrollfreak? Tatsächlich übermenschlich langweilig?
Aber, bitte, könnten Sie nicht einfach, verstehen Sie denn nicht, wie wichtig –
In dem einen Moment zeigte sie mehr von sich und war lebendiger als in jedem Detail ihres Zuhauses. Ich hätte es damals unmöglich wissen können, schließlich trug sie kein Zukünftiges-Opfer-Schild, aber dennoch: Da habe ich einmal einem lebenden Mordopfer in die Augen gesehen und es abblitzen lassen.
Sobald die Spurensicherung fertig ist, werden wir hier alles gründlich durchsuchen, und vielleicht bringt uns das irgendetwas, aber mein Eindruck ist, dass Aislinns Persönlichkeit – vorausgesetzt, sie hatte irgendwo eine versteckt – keine große Rolle spielt. Falls wir es schaffen, Lover-Boy zu identifizieren und handfeste Beweise gegen ihn zu finden, kann uns völlig egal sein, wer Aislinn war. Trotzdem macht es mich kribbelig, dass ich diese helle Kleinmädchenstimme höre, wo nichts zu hören sein sollte.
»Was gefunden?«, fragt Steve von der offenen Tür her.
»Fehlanzeige. Wenn sie nicht da draußen liegen würde, könnte man glatt meinen, es hat sie nie wirklich gegeben. Was ist mit der Küche?«
»Da ist so einiges interessant. Komm mal mit.«
»Wenigstens etwas«, sage ich und gehe hinter ihm her. Ich rechne mit einer Küche aus Chrom und Granit-Imitat, Erfolgsspur-Style für kleines Geld; stattdessen sehe ich Kiefernholz mit zu vielen Schnitzereien, eine rosakarierte Wachstuchtischdecke und gerahmte Drucke mit Hühnern, die rosa Karoschürzen tragen. Alles, was ich über diese Frau erfahre, macht sie für mich diffuser. Durch das Fenster nach hinten raus schaut man auf die gleiche ummauerte Miniterrasse, die ich auch habe, aber Aislinn hat eine verschnörkelte Holzbank auf ihre gestellt, damit sie da draußen sitzen und die Aussicht auf die Mauer genießen konnte. Ich überprüfe die Hintertür: abgeschlossen.
»Erstens«, sagt Steve. Er zieht vorsichtig die Backofenklappe auf, hakt einen behandschuhten Finger in den Spalt, anstatt den Griff zu berühren.
Zwei Bräter mit zu knusprigen braunen Haufen verschrumpeltem Essen: wahrscheinlich Kartoffeln und irgendwas in Teig Gebackenes. Er zieht die halboffene Tür des Grills auf: zwei schwärzliche Klumpen, die mal gefüllte Pilze oder Frikadellen waren.
Ich sage: »Heißt?«
»Heißt, es ist alles total angebrannt, aber nicht richtig verkohlt. Weil die Knöpfe zwar noch aufgedreht sind, die Geräte aber mit dem Sicherheitsschalter an der Wand ausgestellt wurden. Und sieh dir das an.«
Ein Teller mit Gemüse – grüne Bohnen, Erbsen – auf der Arbeitsplatte. Ein halb mit Wasser gefüllter Topf auf einem Kochfeld. Der Knopf für das Kochfeld ist auf höchste Stufe gestellt.
»Soph«, rufe ich. »Hat einer den Herd ausgemacht? Ihr oder die Streifenkollegen?«
»Wir nicht«, ruft Sophie zurück. »Und euren Kollegen hab ich gesagt: Falls ihr irgendwas angefasst habt, sagt’s mir jetzt. Ich bin ziemlich sicher, ich hab ihnen eine Höllenangst eingejagt. Wenn die in der Küche irgendwas abgestellt hätten, hätten sie’s mir gestanden.«
»Na und?«, sage ich zu Steve. »Vielleicht hat Lover-Boy sich verspätet, und Aislinn hat alles ausgemacht.«
Steve schüttelt den Kopf. »Den Grill, kann sein. Aber würdest du den Backofen ausmachen? Würdest du ihn nicht eher auf klein stellen und das ganze Essen reinpacken, damit es warm bleibt? Und würdest du das Kochwasser fürs Gemüse kalt werden lassen oder weiter sieden lassen?«
»Ich koche nicht. Ich hab eine Mikrowelle.«
»Ich koche. Du würdest nicht einfach alles ausmachen, schon gar nicht, wenn du spät dran bist. Du würdest das Wasser auf kleiner Flamme halten, damit du das Gemüse reinwerfen kannst, sobald er kommt.«
Ich sage: »Unser Mann hat den Sicherheitsschalter betätigt.«
»Sieht ganz so aus. Er wollte nicht, dass der Rauchmelder losgeht.«
»Soph. Kannst du mal bitte feststellen, ob du an dem Hauptschalter hier an der Wand Fingerabdrücke findest?«
»Kein Problem.«
»Habt ihr die Küche schon auf Fußspuren untersucht?«
»Nee, ich lass euch beide erst mal in Ruhe da rumspazieren, damit mein Leben ein bisschen interessanter wird«, ruft Sophie zurück. »Fußspuren haben wir uns als Erstes vorgenommen. Letzte Nacht hat es immer mal wieder geregnet, also muss jeder, der reingekommen ist, nasse Schuhe gehabt haben, aber diese Spuren sind längst getrocknet – bei der Hitze hier drin –, und sie haben keine brauchbaren Rückstände hinterlassen. Wir haben ein bisschen trockenen Schmutz gefunden, hier drin und da drin. Aber der könnte auch von den Polizisten stammen, als sie hier eingedrungen sind, und er hätte sowieso nicht für identifizierbare Spuren gereicht.«
Lover-Boy verändert sich in meiner Vorstellung. Ich hatte ihn als dümmlichen Schlappschwanz eingestuft, der einmal falsch zugeschlagen hatte und jetzt wahrscheinlich in seiner Wohnung saß, sich die Hosen vollmachte und nur darauf wartete, dass wir auftauchten, damit er sich alles von der Seele reden und uns erklären konnte, dass alles ihre Schuld war. Aber dieser Typ wäre schon halb zu Hause gewesen, bevor Aislinns Körper auf den Boden aufschlug. Er wäre niemals in der Lage gewesen, ruhig zu bleiben und strategisch zu denken.
Ich sage: »Er hat einen kühlen Kopf.«
»Und ob«, sagt Steve mit Erwartung in der Stimme, wie wenn du Essen riechst und auf einmal Hunger kriegst. »Gerade hat er seine Freundin niedergeschlagen. Wahrscheinlich weiß er nicht mal, ob sie tot ist oder noch lebt, aber er ist ruhig genug, um an den Rauchmelder und das Essen im Ofen zu denken. Falls das sein erstes Mal war, ist er ein Naturtalent.«
Der Rauchmelder ist über unseren Köpfen. Ich sage: »Aber warum will er nicht, dass die Bude abbrennt? Dann würden auch viele Spuren vernichtet. Mit ein bisschen Glück könnte die Leiche sogar so stark zerstört werden, dass wir gar nicht mehr feststellen könnten, dass es Mord war.«
»Vielleicht hat das was mit seinem Alibi zu tun. Wenn der Rauchmelder losgegangen wäre, hätte das sehr viel früher Leute auf den Plan gerufen. Vielleicht hat er sich gedacht, je länger es dauert, bis sie gefunden wird, desto schlechter könnten wir den Todeszeitpunkt bestimmen – und aus irgendwelchen Gründen will er das verhindern.«
»Und wieso hat er dann heute Morgen auf der Polizeiwache angerufen? Sie hätte noch einen, vielleicht auch zwei Tage hier liegen können, bevor jemand nach ihr sucht. Und dann hätten wir einen genauen Todeszeitpunkt vergessen können. Wahrscheinlich wären wir froh gewesen, wenn wir ihn auf einen Zeitraum von zwölf Stunden hätten eingrenzen können.«
Steve massiert sich rhythmisch den Hinterkopf, verstrubbelt sich das rote Haar. »Vielleicht hat er Panik gekriegt.«
Ich stoße einen skeptischen Laut aus. Lover-Boy springt hin und her wie ein Hologramm: jämmerliches Weichei, kühler Kopf, dann wieder Weichei. »Am eigentlichen Tatort ist er eiskalt, und ein paar Stunden später dreht er durch? So schlimm, dass er bei uns anruft?«
»Menschen sind nun mal unberechenbar.« Steve streckt den Arm nach oben und drückt mit der Spitze seines Kulis auf den Testknopf des Rauchmelders. Der piepst: funktioniert. »Oder aber der Anruf war gar nicht von ihm.«
Ich spiele das durch. »Er läuft zu irgendwem: Kumpel, Bruder, vielleicht sein Dad. Erzählt ihm, was passiert ist. Der Kumpel hat ein Gewissen: Er will Aislinn nicht so da liegen lassen, wenn sie vielleicht noch am Leben ist und Ärzte sie retten könnten. Sobald er einen Moment allein ist, ruft er die Polizei an.«
»Wenn es so war«, sagt Steve, »brauchen wir den Kumpel.«
»Allerdings.« Ich habe schon mein Notizbuch aus der Jackentasche gezogen: Verdächtiger: KPs, schnellstmöglich. Sobald wir wissen, wer Lover-Boy ist, brauchen wir eine Liste mit seinen Kontaktpersonen. Nach einem Kumpel mit Gewissen leckt sich jeder Detective die Finger.
»Da ist noch was«, sagt Steve. »Sie hatte das Gemüse noch nicht im Topf, hatte die Weingläser noch nicht gefüllt. Wie schon gesagt, er war gerade erst zur Tür reingekommen.«
Ich stecke mein Notizbuch wieder in die Tasche und sehe mich weiter in der Küche um. Schrank voll Porzellan mit hübschen rosa Blümchen drauf, Kühlschrank leer bis auf Magerjoghurt und Karottenstifte und eine Doppelpackung Obsttörtchen von Marks & Spencer fürs Dessert. Manche Leute bewahren einen Großteil ihrer Persönlichkeit im Kühlschrank auf, nicht so Aislinn. »Stimmt. Also?«
»Also wie hatten sie dann die Zeit, in Streit zu geraten? Die beiden sind kein altes Ehepaar, das sich seit Jahren auf die Nerven geht, er vergisst die Milch, und sofort kriegen sie Riesenzoff. Die beiden sind noch in der Romantisches-Dinner-Phase, wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Worüber streiten sie sich, kaum dass er reinkommt?«
»Du glaubst, es war gar kein Streit? Dass er es von Anfang an geplant hatte?« Ich klappe den Mülleimer auf: Marks-&-Spencer-Verpackungen und ein leerer Joghurtbecher. »Nee. Das würde nur passen, wenn er ein eiskalter Sadist wäre, der sich ein Opfer ausguckt und nur so zum Spaß umbringt. Und so einer hört nicht nach einem einzigen Schlag auf.«
»Ich behaupte ja nicht, dass er mit dem Vorsatz hergekommen ist, sie zu töten. Nicht unbedingt. Ich sage nur …« Steve zuckt die Achseln, kneift die Augen zusammen und mustert eine Porzellankatze mit rosa karierter Schleife, die uns vom Fensterbrett aus schizoid anstarrt. »Ich sage nur, dass es seltsam ist.«
»Schön wär’s.« Kleine rosa Notizzettel kleben an einem Schrank: Reinigung, Klopapier, Kopfsalat. »Vielleicht hatten sie sich schon vorher gestritten, bevor er kam. Wo ist das Handy?«
Ich hole Aislinns Handy in die Küche, um die Spurensicherer nicht zu stören. Steve stellt sich hinter mich und schaut mir über die Schulter, noch so etwas, was mich bei den meisten tierisch nervt. Steve schafft es, mir nicht ins Ohr zu atmen.
Es ist ein Smartphone, aber die Bildschirmsperre lässt sich mit einem Daumenwisch aufheben, ohne Passwort. Sie hat zwei ungelesene SMS, aber ich schaue mir zuerst ihre Kontakte an. Nichts unter Mum oder Dad oder Ähnlichem, aber sie hat einen Notfallkontakt: Lucy Riordan, mit Handynummer. Ich notiere sie mir für später – Glückspilz Lucy wird die offizielle Identifizierung vornehmen. Dann gehe ich ihre Textnachrichten durch und fange an, die Dinnergast-Geschichte zusammenzusetzen.
Lover-Boy heißt Rory Fallon, und er sollte um acht Uhr gestern Abend bei ihr sein. Sieben Wochen zuvor taucht er zum ersten Mal in Aislinns Handy auf, in der zweiten Dezemberwoche. War toll, dich kennenzulernen – hoffe, du hattest einen schönen Abend. Hättest du Freitag Zeit, dich auf einen Drink mit mir zu treffen?
Aislinn machte es ihm nicht leicht. Freitag geht nicht, aber vielleicht Donnerstag, und dann, ein paar Stunden später, nachdem er sich nicht prompt wieder gemeldet hatte, Sorry, hab mir gerade was für Donnerstag vorgenommen!
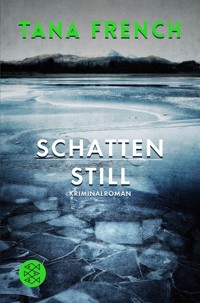



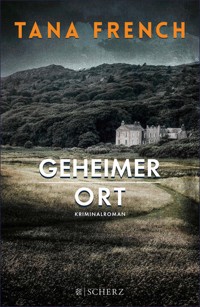







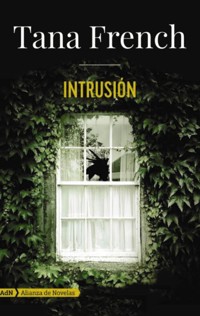
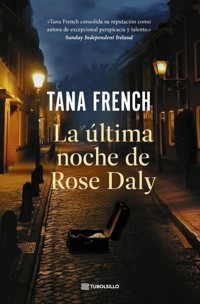
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)

![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)










