
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mordkommission Dublin
- Sprache: Deutsch
Dem Tod wie aus dem Gesicht geschnitten Als die junge Polizistin Cassie Maddox in ein verfallenes Cottage außerhalb von Dublin gerufen wird, schaut sie ins Gesicht des Todes wie in einen Spiegel: Die Ermordete gleicht ihr bis aufs Haar. Wer ist diese Frau? Wer hat sie niedergestochen? Und hätte eigentlich Cassie selbst sterben sollen? Keine Spuren und Hinweise sind zu finden, und bald bleibt nur eine Möglichkeit: Cassie Maddox muss in die Haut der Toten schlüpfen, um den Mörder zu finden. Ein ungeheuerliches Spiel beginnt. Die junge irische Kriminal-Literatin Tana French erzielte mit ›Totengleich‹, ihrem zweiten Roman, einen außergewöhnlichen Erfolg bei den Lesern und wurde von der Kritik in eine Reihe mit Crime-Autorinnen wie Minette Walters, Elizabeth George oder Val McDermid gestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Tana French
Totengleich
Kriminalroman
Kriminalroman
Über dieses Buch
Als die junge Polizistin Cassie Maddox in ein verfallenes Cottage außerhalb von Dublin gerufen wird, schaut sie ins Gesicht des Todes wie in einen Spiegel: Die Ermordete gleicht ihr bis aufs Haar. Wer ist diese Frau? Wer hat sie niedergestochen? Und hätte eigentlich Cassie selbst sterben sollen? Keine Spuren und Hinweise sind zu finden, und bald bleibt nur eine Möglichkeit: Cassie Maddox muss in die Haut der Toten schlüpfen, um den Mörder zu finden. Ein ungeheuerliches Spiel beginnt.
»Ich kannte sie von irgendwoher, hatte das Gesicht schon tausendmal gesehen. Dann trat ich einen Schritt vor, um genauer hinzuschauen, und die ganze Welt verstummte, gefror, während Dunkelheit von allen Seiten herantobte und in der Mitte gleißend weiß nur das Gesicht der jungen Frau blieb, denn das war ich.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Tana Frenchstiefgründige, hochspannende Romane um Täter, Opfer und Ermittler aus ihrem Dubliner Universum finden sich regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten und sind vielfach ausgezeichnet worden. Tana French wuchs in Irland, Italien und Malawi auf, machte eine Schauspielausbildung am Dubliner Trinity College und arbeitete für Theater, Film und Fernsehen. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Dublin.
Tana Frenchs Kriminalromane: ›Grabesgrün‹ ›Totengleich‹ ›Sterbenskalt‹ ›Schattenstill‹ ›Geheimer Ort‹
www.tanafrench.de
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bridge3, www.bridge3.de
Coverabbildung: Julian Calverley
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel
»The Likeness« im Verlag Hodder & Stoughton, London
© Tana French 2008
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2009
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400105-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Prolog
I
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Danksagung
Für Anthony, aus unzähligen Gründen
Prolog
Manchmal nachts, wenn ich allein schlafe, träume ich noch immer vom Whitethorn House. Im Traum ist es stets Frühling, kühles, zart dunstiges Spätnachmittagslicht. Ich steige die abgetretenen Steinstufen hoch und klopfe an die Tür – der prächtige Messingklopfer ist schwarz angelaufen und so schwer, dass man jedes Mal erschrickt –, und eine alte Frau mit Schürze und einem bauernschlauen, harten Gesicht lässt mich herein. Dann hängt sie den großen, rostigen Schlüssel wieder an ihren Gürtel und geht die Einfahrt hinunter davon, unter den fallenden Kirschblüten hindurch, und ich schließe die Tür hinter ihr.
Das Haus ist immer leer. Die Schlafzimmer sind kahl und hell, nur meine Schritte hallen von den Dielenbrettern, kreiseln durch die Sonne und die Staubkörnchen hinauf bis zur hohen Decke. Es riecht nach wilden Hyazinthen, deren Duft durch die weit offenen Fenster hereinweht, und nach Bienenwachspolitur. Weiße Farbflocken blättern von den Schiebefenstern ab, und eine Efeuranke ragt schwankend über die Fensterbank. Waldtauben, träge irgendwo draußen.
Im Wohnzimmer ist das Klavier aufgeklappt, kastanienfarben schimmerndes Holz, in den Sonnenstreifen fast blendend hell, leichter Wind, der die vergilbten Notenblätter bewegt wie ein Finger. Der Tisch ist für fünf Personen gedeckt, für uns – die Knochenporzellanteller und die langstieligen Weingläser, frisch geschnittenes Waldgeißblatt quillt aus einer Kristallschale –, aber das Tafelsilber ist matt angelaufen, und die dicken Damastservietten sind wattig vor Staub. Daniels Zigarettenetui liegt an seinem Platz am Kopfende des Tisches, offen und leer bis auf ein abgebranntes Streichholz.
Irgendwo im Haus, schwach wie ein Fingernagelklicken, sind Geräusche: ein Schlurfen, Flüstern. Mir bleibt fast das Herz stehen. Die anderen sind gar nicht fort, irgendwie hab ich das alles nur falsch verstanden. Sie verstecken sich bloß; sie sind noch da, für alle Zeit.
Ich folge den winzigen Geräuschen Zimmer für Zimmer durchs Haus, verharre nach jedem Schritt, um zu lauschen, aber ich bin nie schnell genug: Sie entgleiten stets wie Trugbilder, hinter die nächste Tür oder weiter die Treppe hinauf. Ein spitziges Kichern, augenblicklich gedämpft, das Knarren von Holz. Ich lasse Kleiderschranktüren weit aufschwingen, ich nehme drei Stufen auf einmal, ich wirbele oben um den Treppenpfosten herum und erhasche aus dem Augenwinkel noch eine rasche Bewegung: der fleckige alte Spiegel am Ende des Korridors, mein Gesicht darin, lachend.
I
Dies ist Lexie Madisons Geschichte, nicht meine. Ich würde Ihnen gern die eine erzählen, ohne in die andere hineinzugeraten, aber das funktioniert nicht. Früher dachte ich, ich hätte uns eigenhändig an den Rändern zusammengenäht, den Faden festgezurrt, und ich könnte die Naht jederzeit wieder auftrennen, ganz nach Belieben. Jetzt denke ich, dass sie schon immer tiefer reichte und weiter, dass sie unterirdisch verlief, außer Sichtweite und völlig außerhalb meiner Kontrolle.
Mein Anteil ist jedoch klar: alles, was ich getan habe. Frank macht ausschließlich die anderen verantwortlich, in erster Linie Daniel, wohingegen Sam offenbar meint, es wäre auf seltsam spiegelverzerrte Weise Lexies Schuld. Wenn ich sage, dass es nicht so war, werfen sie mir einen Seitenblick zu und wechseln das Thema – ich habe allmählich das Gefühl, dass Frank denkt, ich hätte irgendeine schleichende Variante des Stockholm-Syndroms. So etwas kommt bei verdeckten Ermittlern tatsächlich vor, aber in diesem Fall nicht. Ich will niemanden schützen, es ist niemand mehr da, der geschützt werden könnte. Lexie und die anderen werden nie erfahren, dass man ihnen die Schuld gibt, und wenn, wäre es ihnen egal. Aber unterschätzen Sie mich nicht. Mag sein, dass jemand anderer die Karten ausgeteilt hat, aber ich habe sie vom Tisch genommen, ich habe jede Karte gespielt, und ich hatte meine Gründe. Über Alexandra Madison müssen Sie vor allem eines wissen: Sie hat nie existiert. Frank Mackey und ich haben sie erfunden, vor langer Zeit, an einem strahlenden Sommernachmittag in seinem staubigen Büro auf der Harcourt Street. Er wollte Leute in einen Drogenring am University College Dublin, dem UCD, einschleusen. Ich wollte den Job, vielleicht mehr, als ich je irgendetwas im Leben gewollt hatte.
Er war eine Legende: Frank Mackey, noch nicht mal vierzig und bereits Leiter von verdeckten Operationen. Der beste Undercovercop, den Irland je hatte, hieß es, verwegen und furchtlos, ein Seiltänzer ohne Netz, niemals. Er schlenderte in IRA-Zellen und Verbrecherbanden hinein wie in seine Stammkneipe. Man hatte mir die Geschichte erzählt: Als »die Schlange« – ein Berufsgangster und Oberirrer, der einmal einen seiner eigenen Leute zum Krüppel geschlagen hatte, weil der ihm kein Bier spendieren wollte – misstrauisch wurde und drohte, ihm die Hand mit einer Nagelpistole zu durchschießen, sah Frank ihm kaltblütig in die Augen und bluffte, bis die Schlange ihm auf den Rücken klopfte und zur Entschuldigung eine nachgemachte Rolex schenkte. Frank trägt sie noch heute.
Ich war eine blutige Anfängerin, hatte die Polizeiakademie Templemore erst vor einem Jahr abgeschlossen. Als Frank ein paar Tage zuvor in einem internen Rundschreiben nach Cops suchte, die studiert hatten und für Anfang zwanzig durchgingen, trug ich eine neongelbe Weste, die mir zu weit war, und lief Streife in einer Kleinstadt im County Sligo, wo die meisten Einheimischen beängstigend ähnlich aussahen. Ich hätte seinetwegen nervös sein müssen, aber ich war es nicht, nicht im Geringsten. Ich wollte den Job zu sehr, um noch Platz für irgendetwas anderes zu haben.
Seine Bürotür stand auf, er saß auf der Kante seines Schreibtisches, in Jeans und einem verschossenen blauen T-Shirt, und blätterte in meiner Akte. Das Büro war klein und sah unordentlich aus, als würde er es hauptsächlich als Lagerraum nutzen. Der Schreibtisch war leer, nicht einmal ein Familienfoto. Auf den Regalen lagen außer Unterlagen Blues-CDs, Boulevardblätter, ein Poker-Spiel und eine rosa Frauenstrickjacke, an der noch das Etikett hing. Ich beschloss, dass ich den Typ mochte.
»Cassandra Maddox«, sagte er und blickte auf.
»Ja, Sir«, sagte ich. Er war mittelgroß, stämmig, aber fit, mit breiten Schultern und kurz geschnittenem braunen Haar. Ich hatte jemanden Unscheinbaren erwartet, der praktisch unsichtbar wäre, wie der »Krebskandidat« aus Akte X, aber dieser Bursche hatte ein raues, offenes Gesicht und eine Präsenz, die ein Hitzeflirren in der Luft zurückließ. Er war nicht mein Typ, aber ich war ziemlich sicher, dass er bei Frauen gut ankam.
»Frank. ›Sir‹ ist was für Schreibtischhengste.« Er sprach klassisch Dubliner Akzent, dezent, aber mit Vorsatz, wie eine Herausforderung. Er rutschte vom Schreibtisch und streckte die Hand aus.
»Cassie«, sagte ich und schüttelte sie.
Er deutete auf einen Stuhl und setzte sich wieder auf die Schreibtischkante. »Hier steht«, sagte er und tippte auf meine Akte, »Sie sind gut unter Druck.«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was er meinte. Als ich noch in der Ausbildung in einem heruntergekommenen Viertel von Cork stationiert war, hatte ich einmal einen schizophrenen Teenager beruhigt, der in Panik geraten war und sich mit dem Rasiermesser seines Großvaters die Kehle durchschneiden wollte. Ich hatte die Geschichte schon fast vergessen. Erst in dem Moment wurde mir klar, dass ich wahrscheinlich deshalb für den Job in die engere Wahl gekommen war.
»Ich hoffe«, sagte ich.
»Sie sind, wie alt – siebenundzwanzig?«
»Sechsundzwanzig.«
Das Licht, das durchs Fenster fiel, schien mir ins Gesicht, und er musterte mich mit einem langen, prüfenden Blick. »Sie könnten für einundzwanzig durchgehen, kein Problem. Hier steht, Sie haben drei Jahre studiert. Wo?«
»Trinity. Psychologie.«
Seine Augenbrauen schnellten hoch, gespielt beeindruckt. »Aha, ein Profi. Warum haben Sie keinen Abschluss gemacht?«
»Ich hab eine bislang unerforschte Allergie gegen angloirische Akzente entwickelt«, erklärte ich.
Das gefiel ihm. »Würden Sie am UCD Ausschlag kriegen?«
»Dann nehme ich meine Antihistamine.«
Frank hüpfte von seinem Schreibtisch und ging zum Fenster, winkte mir, ihm zu folgen. »Okay«, sagte er. »Sehen Sie das Pärchen da unten?«
Ein junger Mann und eine junge Frau kamen plaudernd die Straße hoch. Sie kramte einen Schlüssel hervor und schloss die Tür zu einem tristen Mietshaus auf, in dem sie verschwanden.
»Erzählen Sie mir was über die beiden«, sagte Frank. Er lehnte sich gegen das Fenster, hakte die Daumen in seinen Gürtel und sah mich an.
»Beides Studenten«, sagte ich. »Büchertaschen. Sie waren im Supermarkt einkaufen – die Einkaufstüten von Dunne’s. Sie hat mehr Geld als er, ihre Jacke war teuer, aber er hat einen Flicken auf der Jeans, und zwar nicht aus modischen Gründen.«
»Sind sie ein Paar? Befreundet? WG-Mitbewohner?«
»Ein Paar. Sie sind enger nebeneinander hergegangen, als Freunde das tun würden, die Köpfe enger zusammen.«
»Sind sie schon lange zusammen?«
Mir gefiel das, die neue Art, wie mein Verstand funktionierte. »Eine Weile, ja«, sagte ich. Frank zog fragend eine Braue hoch, und einen Moment lang war ich mir nicht sicher, woher ich das wusste, dann machte es klick. »Sie haben sich beim Sprechen nicht angesehen. Frische Pärchen sehen sich ständig an. Ältere müssen sich nicht mehr so oft vergewissern.«
»Wohnen sie zusammen?«
»Nein, sonst hätte er automatisch auch nach seinen Schlüsseln gesucht. Das da ist ihre Wohnung. Sie teilt sie sich aber mit wenigstens einer Person. Sie haben beide zu einem Fenster hochgeschaut, wollten nachsehen, ob die Vorhänge auf waren.«
»Wie ist ihre Beziehung?«
»Gut. Sie hat ihn zum Lachen gebracht – Männer lachen meistens nicht über die Scherze von Frauen, außer sie sind noch in der verliebten Phase. Er hat beide Einkaufstüten getragen, und sie hat ihm die Tür aufgehalten, bevor sie rein ist: Sie gehen fürsorglich miteinander um.«
Frank nickte. »Sehr gut. Undercoverarbeit ist zur Hälfte Intuition – und ich meine nicht irgendwelchen Hellsehermist. Ich meine, Sachen wahrnehmen und analysieren, ehe du überhaupt merkst, dass du es tust. Der Rest ist Schnelligkeit und Mumm. Wenn du etwas sagen willst oder tun willst, dann tust du es schnell und mit völliger Überzeugungskraft. Wer aus Unsicherheit zögert, ist geliefert, womöglich tot. Sie werden die nächsten ein, zwei Jahre überwiegend keine Kontakte haben. Haben Sie Familie?«
»Tante und Onkel«, sagte ich.
»Freund?«
»Ja.«
»Sie werden sie kontaktieren können, aber nicht umgekehrt. Meinen Sie, die kommen damit klar?«
»Das werden sie müssen«, sagte ich.
Er lehnte noch immer lässig am Fensterrahmen, aber ich bemerkte ein stechendes blaues Funkeln: Er beobachtete mich genau. »Hier geht’s nicht gerade um ein kolumbianisches Kartell, und Sie werden hauptsächlich mit den untersten Chargen zu tun haben – jedenfalls am Anfang, aber Sie müssen sich darüber klar sein, dass der Job gefährlich ist. Die eine Hälfte dieser Leute ist die meiste Zeit zugeknallt, und die andere Hälfte nimmt ihr Geschäft sehr ernst, was bedeutet, dass keiner von denen ein Problem damit hätte, Sie zu töten. Macht Sie das nervös?«
»Nein«, sagte ich, und das meinte ich auch so. »Überhaupt nicht.«
»Wunderbar«, sagte Frank. »Holen wir uns Kaffee und fangen wir an.«
Ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass das alles war: Ich war dabei. Ich hatte ein dreistündiges Einstellungsgespräch und einen Haufen bizarrer Tests mit Tintenklecksen und Fragen über meine Mutter erwartet, aber so arbeitet Frank nicht. Ich weiß bis heute nicht, wann genau er die Entscheidung getroffen hat. Lange Zeit habe ich auf den passenden Moment gewartet, um ihn danach zu fragen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob ich überhaupt wissen will, was er in mir gesehen hat, was ihm verraten hat, dass ich dafür geeignet war.
Wir holten uns angebrannt schmeckenden Kaffee und eine Packung Schokokekse aus der Kantine und verbrachten den Rest des Tages damit, Alexandra Madison zu erfinden. Ich dachte mir den Namen aus – »So behalten Sie ihn besser«, sagte Frank. Madison, weil er ähnlich klingt wie mein eigener Nachname, so dass ich mich umdrehen würde, wenn ich ihn hörte, und Lexie, weil meine Phantasieschwester so hieß, als ich klein war. Frank nahm ein großes Blatt Papier und entwarf ihren Lebenslauf für mich. »Sie wurden am ersten März 1979 im Holles Street Hospital geboren. Vater, Sean Madison, im diplomatischen Dienst, stationiert in Kanada – so können wir Sie rasch abziehen, falls nötig: ein Notfall in der Familie, und weg sind Sie. Außerdem bedeutet das, dass Sie in Ihrer Kindheit viel durch die Weltgeschichte gereist sind, als Erklärung dafür, warum keiner Sie kennt.« Irland ist klein; die Freundin von irgendeinem Cousin von egal wem ist unweigerlich mit einem zur Schule gegangen. »Wir könnten eine Ausländerin aus Ihnen machen, aber dann müssten Sie sich mit einem Akzent rumschlagen, und das will ich nicht. Mutter, Caroline Kelly Madison. Ist sie berufstätig?«
»Krankenschwester.«
»Vorsicht. Denken Sie schneller, achten Sie auf mögliche Konsequenzen. Krankenschwestern brauchen in jedem Land eine neue Zulassung. Sie hat in dem Beruf gearbeitet, aber aufgehört, als Sie sieben waren und Ihre Familie Irland verlassen hat. Möchten Sie Geschwister?«
»Klar, warum nicht?«, sagte ich. »Ich hab einen Bruder.« Das Ganze hatte etwas Berauschendes an sich. Ich hätte die ganze Zeit lachen können, vor lauter verschwenderischer, schwindelerregender Freiheit: Angehörige und Länder und Möglichkeiten breiteten sich vor mir aus, und ich konnte mir aussuchen, was ich wollte, ich konnte in einem Palast in Bhutan mit siebzehn Geschwistern und eigenem Chauffeur aufgewachsen sein, wenn mir danach war. Ich stopfte mir noch einen Keks in den Mund, damit Frank mich nicht lächeln sah und womöglich dachte, ich würde die Sache nicht ernst nehmen.
»Ganz wie Sie wollen. Er ist sechs Jahre jünger, also ist er in Kanada bei Ihren Eltern. Wie heißt er?«
»Stephen.« Mein imaginärer Bruder. Ich hatte eine lebhafte Phantasie als Kind.
»Verstehen Sie sich mit ihm? Wie ist er? Schneller«, sagte Frank, als ich Atem holte.
»Er ist ein kleiner Klugscheißer. Fußballverrückt. Hat dauernd Krach mit unseren Eltern, weil er fünfzehn ist, aber er spricht noch mit mir … «
Die Sonne fiel schräg über das verschrammte Holz der Schreibtischplatte. Frank roch sauber, nach Seife und Leder. Er war ein guter Lehrer, ein wunderbarer Lehrer. Sein schwarzer Kuli kritzelte Daten und Orte und Ereignisse nieder, und Lexie Madison entwickelte sich aus dem Nichts wie ein Polaroid, sie löste sich von dem Blatt Papier und schwebte in der Luft wie Weihrauch, eine junge Frau mit meinem Gesicht und einem Leben aus einem halbvergessenen Traum. Wann hatten Sie Ihren ersten Freund? Wo haben Sie da gewohnt? Wie hieß er? Wer hat mit wem Schluss gemacht? Warum? Frank holte einen Aschenbecher, schnippte für mich eine Player’s aus seiner Packung. Als die Sonnenstrahlen vom Schreibtisch glitten und der Himmel draußen vor dem Fenster langsam trüb wurde, drehte er sich mit seinem Stuhl herum, nahm eine Flasche Whiskey aus einem Regal und goss uns einen Schuss in den Kaffee. »Haben wir uns verdient«, sagte er. »Cheers.«
Wir machten aus Lexie eine Ruhelose: intelligent und gebildet, ihr Leben lang ein braves Mädchen, aber eines, das aufgewachsen war, ohne sich je irgendwo niederzulassen, und es auch nie gelernt hatte. Ein bisschen naiv vielleicht, ein bisschen unbedacht, allzu bereit, einem ohne nachzudenken alles zu verraten, was man wissen wollte. »Sie ist ein Köder«, sagte Frank unverblümt, »und sie muss der richtige Köder sein, damit die Dealer anbeißen. Sie muss so unschuldig wirken, dass sie sie nicht für eine Bedrohung halten, so unbescholten, dass sie ihnen nützen kann, und so rebellisch, dass sie sich nicht fragen, warum sie mitspielen will.«
Es war dunkel, als wir fertig waren. »Gute Arbeit«, sagte Frank, faltete den Lebenslauf zusammen und gab ihn mir. »In zehn Tagen beginnt ein Detective-Lehrgang, zu dem melde ich Sie an. Danach kommen Sie wieder her, und ich arbeite eine Weile mit Ihnen. Wenn die Uni im Oktober wieder anfängt, sind Sie immatrikuliert.«
Er angelte eine Lederjacke von der Regalecke, schaltete das Licht aus und schloss die Tür des dunklen, kleinen Büros. Auf dem Weg zur Bushaltestelle war ich wie in Trance, eingehüllt in Magie, ich trieb inmitten eines Geheimnisses und einer funkelnagelneuen Welt, während der Lebenslauf in der Tasche meiner Uniformjacke leise knisterte. Es ging so schnell, und es kam mir so einfach vor.
Ich werde nicht ausführlich auf die lange, verhedderte Kette von Ereignissen eingehen, die mich von der Undercoverarbeit ins DHG, das Dezernat für häusliche Gewalt, verschlug. Die Kurzversion: Der führende Amphetamin-Süchtige am UCD wurde paranoid und stach mit einem Messer auf mich ein, nach meiner Genesung hatte ich als im Dienst Verwundete einen Wunsch frei und ging zum Morddezernat, das Morddezernat entpuppte sich als zu große Nervenbelastung, ich stieg aus. Ich hatte seit Jahren nicht mehr an Lexie und ihr kurzes, schattenhaftes Leben gedacht. Ich bin nicht der Typ, der ständig über die Schulter nach hinten blickt, zumindest bemühe ich mich nach Kräften. Vorbei ist vorbei, sich etwas anderes vorzumachen ist Zeitverschwendung. Aber jetzt denke ich, ich habe immer gewusst, dass Lexie Madison Konsequenzen haben würde. Man kann nicht eine ganze Person erfinden, einen Menschen mit einem ersten Kuss und mit Humor und einem Lieblingssandwich, und dann erwarten, dass diese Person sich auflöst und wieder zu den Notizen und dem Kaffee mit einem Schuss Whiskey wird, wenn sie ausgedient hat. Ich glaube, ich habe immer gewusst, dass Lexie wiederkommen und nach mir suchen würde, eines Tages.
Sie brauchte vier Jahre. Sie suchte sich den Augenblick mit Bedacht aus. Sie trat an einem frühen Morgen im April wieder in mein Leben, einige Monate nach meinem Abschied vom Morddezernat, als ich gerade auf dem Schießstand war.
Unser Schießstand liegt unterirdisch mitten in der Stadt, tief unter dem Dubliner Straßenverkehr und einer dicken Schicht Smog. Ich hätte nicht dort sein müssen – ich war immer eine gute Schützin, und bis zu meinem nächsten Befähigungstest waren es noch Monate –, aber in letzter Zeit war ich morgens immer zu früh wach, um schon zur Arbeit zu gehen, und viel zu ruhelos für irgendetwas anderes, und ich hatte festgestellt, dass Zielschießen das Einzige war, was gegen die Nervosität wirkte. Ich ließ mir viel Zeit beim Aufsetzen der Ohrenschützer und beim Überprüfen meiner Pistole, wartete, bis alle anderen sich auf ihre eigenen Ziele konzentrierten, damit keiner sah, dass ich bei den ersten Schüssen schlotterte wie eine unter Strom gesetzte Zeichentrickfigur. Nervenbündel entwickeln besondere Strategien, unauffällige Tricks, damit niemand etwas merkt. Wer schnell lernt, schafft es schon bald, den ganzen Tag hindurch fast wie ein normaler Mensch zu wirken.
Ich war vorher nie so gewesen. Ich dachte immer, ein schwaches Nervenkostüm hätten nur Jane-Austen-Figuren und Mädchen mit Heliumstimmen, die ihre Drinks nie selbst bezahlen. In einer Krisensituation zittrig zu werden war für mich ebenso abwegig, wie mit einem Riechsalzfläschchen durch die Gegend zu laufen. Von dem Drogenboss der UCD niedergestochen zu werden hatte mich nicht aus der Bahn geworfen. Der Polizeipsychologe versuchte wochenlang, mich davon zu überzeugen, dass ich schwer traumatisiert war, bis er schließlich aufgeben und eingestehen musste, dass es mir gutging (mit leichtem Bedauern; er hat nicht oft Gelegenheit, mit niedergestochenen Cops herumzuexperimentieren, ich glaube, er hatte gehofft, bei mir irgendeinen ausgefallenen Komplex feststellen zu können), und mich wieder zur Arbeit gehen ließ.
Der Fall, der mich dann umhaute, war peinlicherweise kein spektakulärer Massenmord oder eine schlecht ausgegangene Geiselnahme oder ein netter, stiller Typ mit menschlichen Organen in Tupperdosen. Mein letzter Fall im Morddezernat war so simpel, nicht viel anders als Dutzende andere auch, nichts, was uns hätte vorwarnen können: Bloß ein kleines Mädchen, das an einem Sommermorgen tot aufgefunden wurde, und mein Partner und ich alberten im Büro herum, als die Meldung kam. Von außen betrachtet, lief es sogar gut. Offiziell lösten wir den Fall in knapp einem Monat, die Gesellschaft wurde von einem Übeltäter befreit, in den Medien und der Jahresstatistik nahm sich alles prächtig aus. Es gab keine dramatischen Verfolgungsjagden, keine Schießereien, nichts dergleichen. Ich war diejenige, die es noch am schlimmsten erwischt hatte, zumindest physisch, und ich war mit ein paar Kratzern im Gesicht davongekommen. Es waren nicht mal Narben zurückgeblieben. Ein richtiges Happy End, allenthalben.
Unter der Oberfläche jedoch – SOKO »Vestalin« oder Knocknaree-Fall: Wer einen vom Morddezernat darauf anspricht, selbst jetzt noch, selbst einen von den Jungs, die nicht die ganze Geschichte kennen, erntet sofort diesen Blick, Hände und Augenbrauen gehen vielsagend hoch, während der Angesprochene sich von dem Desaster und dem Kollateralschaden distanziert. In jeder entscheidenden Hinsicht haben wir verloren, und zwar absolut. Manche Leute sind kleine Tschernobyls, in ihnen glimmert ein lautloses, unaufhaltsames Gift: Komm ihnen zu nahe, und jeder Atemzug zerstört dich mehr und mehr. Einige Fälle – da können Sie jeden Cop fragen – sind heimtückisch und unheilbar, verschlingen alles, was mit ihnen in Berührung kommt.
Ich zeigte danach eine ganze Palette von Symptomen, bei denen der Psychologe in seinen kleinen Ledersandalen begeistert auf- und abgehüpft wäre, doch Gott sei Dank kam keiner auf die Idee, mich wegen ein paar Kratzern im Gesicht zur Therapie zu schicken. Es waren Traumasymptome wie aus dem Lehrbuch – zittern, nichts essen können, zu Tode erschrecken, wenn es an der Tür schellte oder das Telefon klingelte –, mit ein paar individuellen Beilagen. Meine Koordination schlug Kapriolen. Zum ersten Mal im Leben stolperte ich dauernd über meine eigenen Füße, lief gegen Türrahmen, stieß mir den Kopf an Schränken. Und ich hörte auf zu träumen. Früher hatte ich immer in großartigen, wilden Bilderfluten geträumt, Feuersäulen, die über dunkle Berge hinwegwirbelten, Kletterpflanzen, die massiven Backstein durchbrachen, Hirsche, die von Lichtbändern umhüllt in langen Sätzen den Strand von Sandymount entlangliefen; jetzt fiel ich in einen dumpfen, schwarzen Schlaf, der mich wie ein Hammer traf, kaum dass mein Kopf das Kissen berührte. Sam – mein Freund, obwohl mich dieser Gedanke mitunter noch immer verblüffte – sagte, ich solle mich gedulden, das würde sich irgendwann geben. Als ich erwiderte, ich hätte da meine Zweifel, nickte er sanft und sagte, auch das würde sich geben. Ab und zu konnte Sam mir ganz schön auf den Wecker gehen.
Ich zog die herkömmliche Cop-Lösung in Erwägung – Alkohol –, aber ich fürchtete, dann würde ich irgendwann um drei Uhr morgens die falschen Leute anrufen, um ihnen mein Herz auszuschütten, und außerdem stellte ich fest, dass Schießübungen mich fast ebenso wirkungsvoll betäubten, und zwar ohne irgendwelche unschönen Nebenwirkungen. Angesichts meiner sonstigen Reaktion auf laute Geräusche war das eigentlich völlig unlogisch, aber das kümmerte mich nicht. Nach den ersten paar Schüssen brannte bei mir im Hinterkopf eine Sicherung durch, und der Rest der Welt rückte irgendwo in nebulöse Ferne, meine Hände schlossen sich bombenfest um die Pistole, und dann waren da nur noch ich und die Pappfigur, der strenge vertraute Geruch nach Schießpulver in der Luft und mein Rücken, der sich gegen den Rückstoß stemmte. Hinterher war ich ruhig und benommen, wie unter Valium. Bis die Wirkung nachließ, hatte ich wieder einen Tag auf der Arbeit überstanden und konnte mir den Kopf an spitzen Ecken innerhalb meiner geschützten vier Wände stoßen. Irgendwann war ich so gut geworden, dass ich von zehn Schüssen neun Kopfschüsse aus vierzig Metern Entfernung schaffte, und der verschrumpelte kleine Mann, der den Schießstand leitete, hatte angefangen, mich mit dem Blick eines Pferdetrainers zu mustern und das Thema Polizeimeisterschaften anzusprechen.
An dem Morgen hatte ich gegen sieben mit dem Schießen aufgehört. Ich war in der Umkleide dabei, meine Pistole zu reinigen, und versuchte, mit zwei Kollegen von der Sitte Smalltalk zu machen, ohne bei ihnen den Eindruck zu erwecken, ich würde mit ihnen frühstücken wollen, als mein Handy klingelte.
»Ach, du Schande«, sagte einer der beiden. »Du bist doch beim DHG, nicht? Wer hat denn die Energie, seine Frau schon so früh am Morgen zu verdreschen?«
»Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben ist immer Zeit«, sagte ich und holte meinen Spindschlüssel aus der Tasche.
»Vielleicht ist es das Spezialeinsatzkommando«, sagte der Jüngere der beiden und grinste mich an. »Die brauchen Scharfschützen.« Er war groß und rothaarig, und er fand mich süß. Er präsentierte seine Muskeln möglichst vorteilhaft, und ich hatte ihn bei einem prüfenden Blick auf meinen Ringfinger ertappt.
»Die haben wahrscheinlich gehört, dass wir gerade keine Zeit haben«, sagte sein Kumpel.
Ich fischte das klingelnde Telefon aus meinem Spind. Auf dem Display stand Sam O’Neill, und das Symbol für entgangene Anrufe blinkte mich aus einer Ecke an.
»Hi«, sagte ich. »Was gibt’s?«
»Cassie«, sagte Sam. Er klang schrecklich: atemlos und krank, als hätte ihn jemand zusammengeschlagen. »Alles in Ordnung mit dir?«
Ich drehte den Jungs von der Sitte den Rücken zu und verzog mich in eine Ecke. »Mir geht’s gut. Wieso? Was ist los?«
»Menschenskind«, sagte Sam. Er gab einen harten, kleinen Laut von sich, als wäre seine Kehle zu eng. »Ich hab dich viermal angerufen. Ich wollte schon jemanden zu dir in die Wohnung schicken. Wieso bist du nicht an dein scheiß Handy gegangen?«
Das sah Sam gar nicht ähnlich. Er ist der sanftmütigste Mann, der mir je begegnet ist. »Ich bin am Schießstand«, sagte ich. »Es war in meinem Spind. Was ist denn passiert?«
»Tut mir leid. Ich wollte nicht … tut mir leid.« Er machte wieder dieses schroffe kleine Geräusch. »Ich bin rausgerufen worden. Zu einem Fall.«
Mein Herz machte einen gewaltigen Satz gegen den Brustkorb. Sam ist im Morddezernat. Ich wusste, dass ich mich wahrscheinlich besser hinsetzen sollte, aber ich konnte die Knie nicht beugen. Stattdessen lehnte ich mich gegen die Spinde.
»Wer ist es?«, fragte ich.
»Was? Nein – um Gottes willen, nein, es ist nicht … ich meine, es ist niemand, den wir kennen. Das heißt, ich glaube jedenfalls nicht … Hör mal, kannst du herkommen?«
Mein Atem war wieder da. »Sam«, sagte ich. »Was zum Teufel ist los?«
»Ich … kannst du nicht einfach herkommen? Wir sind in Wicklow, außerhalb von Glenskehy. Kennst du doch, oder? Folg der Beschilderung bis Glenskehy, durch das Dorf durch und halt dich dann in südlicher Richtung. Nach etwa einer Dreiviertelmeile geht rechts ein kleiner Weg ab – da siehst du schon das Absperrband. Wir warten da auf dich.«
Die Jungs von der Sitte blickten jetzt interessiert. »Mein Dienst fängt in einer Stunde an«, sagte ich. »So lange brauche ich allein, um da rauszufahren.«
»Ich rufe bei dir im Dezernat an. Ich sag denen, wir brauchen dich.«
»Das lässt du schön bleiben. Ich bin nicht mehr im Morddezernat, Sam. Wenn es um einen Mord geht, hab ich nichts damit zu tun.«
Die Stimme eines Mannes im Hintergrund: entschieden, lässig gedehnt, schwer zu überhören. Sie kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, wo ich sie hintun sollte. »Moment«, sagte Sam.
Ich klemmte das Handy zwischen Ohr und Schulter und fing an, meine Pistole wieder zusammenzusetzen. Wenn es niemand war, den wir kannten, dann musste es ein übler Fall sein, so wie Sam sich anhörte, sehr übel. Tötungsdelikte in Irland sind nach wie vor überwiegend ziemlich simple Angelegenheiten: Kämpfe im Drogenmilieu, Einbrüche, bei denen etwas schiefgeht, Ehedramen oder diese komplizierte Familienfehde in Limerick, die seit Jahrzehnten die Statistik versaut. Wir hatten noch nie solche Alptraumorgien wie in anderen Ländern: die Serienkiller, die raffinierten Folterungen, die Keller, in denen die Leichen wie Herbstlaub liegen. Aber bis dahin ist es nur noch eine Frage der Zeit. Seit zehn Jahren verändert sich Dublin so schnell, dass unser Verstand nicht mehr nachkommt. Das irische Wirtschaftswunder hat uns zu viele Leute mit Hubschraubern beschert und zu viele, die in kakerlakenverseuchte, heruntergekommene Wohnungen abgestürzt sind, viel zu viele, die ihr Dasein in neonhellen Bürowaben verachten, es mit dem Gedanken ans Wochenende ertragen, um dann wieder von vorn anzufangen, und allmählich brechen wir unter dem Gewicht zusammen. Gegen Ende meiner Zeit im Morddezernat spürte ich es nahen: spürte das hohe Singen des Wahnsinns in der Luft, die Stadt, die sich duckte und zuckte wie ein tollwütiger Hund, ehe er anfängt, um sich zu beißen. Früher oder später musste jemand den ersten Horrorfall erwischen.
Wir haben keine offiziellen Profiler, aber die Leute vom Morddezernat, die meist nicht aufs College gegangen sind und von meinem abgebrochenen Psychologiestudium beeindruckter waren, als sie es hätten sein sollen, schoben mir gern diese Rolle zu. Und ich spielte sie nicht mal schlecht. Ich las in der Freizeit viele Lehrbücher und Statistiken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sams Cop-Instinkte könnten seine beschützerischen verdrängt haben, so dass er mich hinzuziehen wollte, weil er es für nötig erachtete, weil er an einem Tatort etwas so Schlimmes vorgefunden hatte, dass er das für gerechtfertigt hielt.
»Moment mal«, sagte der Rothaarige. Er hatte den Muskelprotzmodus abgeschaltet und saß jetzt kerzengerade auf seiner Bank. »Du warst im Morddezernat?« Genau aus dem Grund hatte ich jede Kumpelhaftigkeit vermeiden wollen. Diesen begeisterten Tonfall hatte ich in den letzten paar Monaten viel zu oft gehört.
»Vor einer halben Ewigkeit«, sagte ich, während ich ihn mit meinem süßesten Lächeln und meinem Frag-bloß-nicht-weiter-Blick bedachte.
Rotschopfs Neugier und seine Libido lieferten sich ein kurzes Duell. Offenbar rechnete er sich aus, dass die Chancen seiner Libido ohnehin gleich null waren, denn seine Neugier gewann. »Du bist die, die diesen einen Fall bearbeitet hat, nicht?«, sagte er und rutschte ein paar Spinde näher. »Das tote Mädchen. Wie war das denn nun wirklich?«
»Alle Gerüchte stimmen«, erwiderte ich. Am anderen Ende des Telefons hatte Sam eine gedämpfte Auseinandersetzung, kurze gereizte Fragen, die von der lässigen Stimme unterbrochen wurden, und ich wusste, wenn der Rothaarige nur mal kurz die Klappe halten würde, käme ich dahinter, wer da sprach.
»Ich hab gehört, dein Partner ist durchgedreht und mit einer Verdächtigen in die Kiste gestiegen«, informierte Rotschopf mich netterweise.
»Das wäre mir neu«, sagte ich, während ich versuchte, mich aus der kugelsicheren Weste zu befreien, ohne das Handy zu verlieren. Mein erster Impuls war – noch immer –, ihm zu sagen, er solle doch einfach ein bisschen kreativ an sich rumspielen, aber weder der psychische Zustand meines Expartners noch sein Liebesleben waren mein Problem, nicht mehr.
Als Sam wieder ans Telefon kam, klang er noch angespannter und erschütterter. »Kannst du eine Sonnenbrille aufsetzen und eine Kapuze oder Mütze oder so?«
Ich verharrte mit der Weste halb über dem Kopf. »Hast du sie noch alle?«
»Bitte, Cassie«, sagte Sam, und er klang fast bis zum Zerreißen angespannt. »Bitte.«
Ich fahre eine alte, klapprige Vespa, was in einer Stadt, wo du bist, was du ausgibst, ganz schön uncool ist, aber auch seine Vorzüge hat. Im Stadtverkehr komme ich damit viermal schneller voran als der durchschnittliche Geländewagen, ich finde immer einen Parkplatz, und sie ist auch in sozialer Hinsicht praktisch, da ich auf Anhieb weiß, dass jeder, der sie mit einem schnöseligen Blick bedenkt, wahrscheinlich nicht mein neuer bester Freund werden wird. Sobald ich die Stadt hinter mir gelassen hatte, war es ideales Motorrollerwetter. Es hatte die ganze Nacht geregnet, stürmischer Graupelregen, der gegen mein Fenster geklatscht war, aber im Morgengrauen hatte er sich bereits verzogen, und der Tag war klar und blau, der erste in diesem Beinahe-Frühling. Früher war ich, wenn es morgens so war wie jetzt, raus aufs Land gefahren und hatte laut in den Wind gesungen, immer am Rande des Tempolimits.
Glenskehy liegt nicht weit von Dublin, versteckt und gottverlassen in den Wicklow-Bergen. Ich hatte mein halbes Leben in Wicklow gewohnt und das Kaff nur insofern zur Kenntnis genommen, als gelegentlich ein Straßenschild in die Richtung wies. Es war genau, wie ich erwartet hatte: eine Handvoll Häuser, die um eine Kirche mit Gottesdienst einmal im Monat und einen Pub und einen Kramladen herum alt wurden, so klein und abgelegen, dass es selbst von der Generation, die verzweifelt auf dem Land nach erschwinglichen Häusern sucht, übersehen worden war. Acht Uhr am Donnerstagmorgen, und die Hauptstraße – eine etwas hochtrabende Bezeichnung – war das perfekte Postkartenidyll und leer, bloß eine alte Frau zog ein Einkaufswägelchen an einem verwitterten Granitdenkmal vorbei irgendwohin, hinter ihr dichtgedrängt kleine schiefe Zuckerbäckerhäuser, und über allem ragten grün und braun und teilnahmslos die Hügel auf. Ich konnte mir vorstellen, dass hier jemand ermordet wurde, zum Beispiel ein Farmer in einem generationenalten Streit um einen Grundstückszaun, eine Frau, deren besoffener Gatte durch Hüttenkoller brutal geworden war, ein Mann, der vierzig Jahre zu lange mit seinem Bruder unter einem Dach gelebt hatte: tief verwurzelte, banale Verbrechen, so alt wie Irland, aber nichts, was bewirken würde, dass ein erfahrener Detective wie Sam sich so anhörte.
Und die andere Stimme am Telefon ließ mir noch immer keine Ruhe. Sam ist der einzige Detective, den ich kenne, der keinen Partner hat. Er liebt Alleinflüge, bei jedem neuen Fall mit einem anderen Team zu arbeiten – Kollegen in Uniform, die die Hilfe eines Experten anfordern, Partner aus dem Morddezernat, die bei einem großen Fall einen dritten Mann brauchen. Sam kommt mit allen gut aus, er ist die ideale Verstärkung, und ich war neugierig, für welche Leute, mit denen ich früher gearbeitet hatte, er diesmal die Verstärkung abgab.
Außerhalb des Dorfes wurde die Straße schmaler, wand sich zwischen leuchtenden Ginsterbüschen bergauf, und die Felder wurden kleiner und steiniger. Auf der Kuppe des Hügels standen zwei Männer. Sam, blond und stämmig und angespannt, die Füße breitbeinig fest auf dem Boden und die Hände in den Jackentaschen; und dicht neben ihm jemand, der sich mit erhobenem Kopf nach hinten gegen den steifen Wind lehnte. Die Sonne stand noch tief am Himmel, und die langen Schatten der beiden ließen sie riesig und unheilvoll erscheinen. Ihre Silhouetten hoben sich vor den dahinjagenden Wolken ab, fast zu hell, um sie anzuschauen, wie zwei Boten, die aus der Sonne kommend die schimmernde Straße hinuntergingen. Hinter ihnen flatterte und peitschte Polizeiabsperrband.
Sam hob die Hand, als ich winkte. Der andere Typ legte den Kopf schief, ein rasches Abkippen, wie ein Blinzeln, und ich wusste, wer er war.
»Ich glaub, ich spinne«, sagte ich, noch ehe ich von der Vespa gestiegen war. »Frankie. Wo kommst du denn her?«
Frank schlang einen Arm um mich und hob mich in die Luft. Vier Jahre hatten es nicht geschafft, ihn auch nur ein kleines bisschen zu verändern. Ich war mir ziemlich sicher, dass er sogar noch dieselbe abgewetzte Lederjacke trug. »Cassie Maddox«, sagte er. »Die beste falsche Studentin der Welt. Wie geht’s dir? Du beim Dezernat für häusliche Gewalt, wieso denn das?«
»Ich rette die Welt. Die haben mir ein Lichtschwert gegeben und alles, was dazugehört.« Ich bemerkte Sams verwundertes Stirnrunzeln aus dem Augenwinkel – ich rede nicht viel über meine Undercoverzeit, ich bin nicht mal sicher, ob er von mir je Franks Namen gehört hatte –, aber erst als ich mich ihm zuwandte, erkannte ich, dass er entsetzlich aussah, weiß um den Mund und die Augen zu weit aufgerissen. Etwas in mir verkrampfte sich: ein Horrorfall.
»Wie geht’s dir?«, fragte ich ihn und nahm den Helm ab.
»Super«, sagte Sam. Er versuchte ein Lächeln, aber es verrutschte ihm.
»Oho«, sagte Frank gespielt tuntig, während er mich auf Armeslänge von sich weghielt und musterte. »Lass dich mal anschauen. So was tragen also gutgekleidete Detectives heutzutage?« Als er mich das letzte Mal gesehen hatte, trug ich eine Cargohose und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Miss Kitty’s House of Fun Wants you«.
»Leck mich, Frank«, erwiderte ich. »Wenigstens hab ich mein Outfit in den letzten paar Jahren ein- oder zweimal gewechselt.«
»Nein, nein, nein, ich bin beeindruckt. Sehr businesslike.« Er wollte mich herumdrehen. Ich schlug seine Hand weg. Nur damit das klar ist, ich war nicht angezogen wie Hillary Clinton. Ich trug meine Arbeitskleidung – schwarzer Hosenanzug, weiße Bluse – und fand diese Garderobe auch nicht berauschend, aber als ich ins Dezernat für häusliche Gewalt wechselte, lag mir mein neuer Vorgesetzter andauernd damit in den Ohren, wie wichtig es sei, nach außen hin ein präsentables einheitliches Bild zu vermitteln und in der Öffentlichkeit Vertrauen aufzubauen, was anscheinend in Jeans und T-Shirt unmöglich ist, und ich hatte nicht die Energie zur Gegenwehr. »Hast du eine Sonnenbrille und eine Mütze oder so dabei?«, fragte Frank. »Würde stilistisch prima passen.«
»Habt ihr mich herkommen lassen, um mit mir über meinen Klamottenstil zu diskutieren?«, fragte ich. Ich kramte eine uralte rote Baskenmütze aus meinem Rucksack heraus und wedelte damit vor seiner Nase.
»Nein, darauf kommen wir ein andermal zurück. Hier, setz die auf.« Frank holte eine Sonnenbrille aus seiner Tasche, so eine abscheuliche verspiegelte à la Don Johnson 1985, und gab sie mir.
»Wenn ich wie ein Vollidiot mit dem Ding auf der Nase herumlaufen soll«, sagte ich und nahm sie beide ins Visier, »dann habt ihr hoffentlich eine gute Erklärung.«
»Dazu kommen wir gleich. Wenn sie dir nicht gefällt, kannst du auch den Helm wieder aufsetzen.« Frank wartete, bis ich die Achseln zuckte und die idiotische Verkleidung anzog. Die Aufregung, ihn zu sehen, war verflogen, und mein Rücken verkrampfte sich wieder. Sam, der krank aussah, Frank, der hier war und nicht wollte, dass ich am Tatort gesehen wurde: Das alles sah ganz danach aus, als ob ein Undercovercop das Opfer war.
»Hinreißend wie immer«, sagte Frank. Er hob das Absperrband an, damit ich mich darunter herduckte, und das war so vertraut, ich hatte diese rasche, mühelose Bewegung so oft gemacht, dass ich für den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen. Ich rückte automatisch meine Pistole am Gürtel zurecht und sah mich nach meinem Partner um, als wäre das hier mein Fall, ehe ich mich wieder erinnerte.
»Bislang wissen wir Folgendes«, sagte Sam. »Gegen Viertel nach sechs heute Morgen ging ein Bursche namens Richard Doyle auf diesem Weg hier mit seinem Hund spazieren. Er ließ ihn von der Leine, damit er ein bisschen herumlaufen konnte. Nicht weit vom Weg steht ein verfallenes Haus. Der Hund ist da rein und kam einfach nicht wieder raus. Schließlich musste Doyle hinterher. Als er reinkam, schnüffelte der Hund an der Leiche einer Frau herum. Doyle packte den Hund, nahm die Beine in die Hand und rief die Polizei.«
Ich entspannte mich ein wenig: Ich kannte keine anderen Frauen aus meiner Undercoverzeit. »Und wieso bin ich hier?«, fragte ich. »Ganz zu schweigen von dir, mein Alter. Bis du ins Morddezernat gewechselt, und keiner hat’s mir erzählt?«
»Wirst du gleich verstehen«, sagte Frank. Ich ging hinter ihm den Weg hinunter und konnte nur seinen Hinterkopf sehen. »Glaub mir, hundertpro.«
Ich blickte über die Schulter zu Sam. »Keine Sorge«, sagte er leise. Seine Gesichtsfarbe kehrte zurück, in leuchtenden, ungleichmäßigen Klecksen. »Du machst das schon.«
Der leicht ansteigende Weg war zu schmal, um zu zweit nebeneinander zu gehen, bloß ein matschiger Pfad mit struppigen, breit wuchernden Weißdornhecken auf beiden Seiten. Wo sich zwischen ihnen eine Lücke auftat, ähnelte der Hang einer Steppdecke aus ungleichmäßigen grünen Feldern, auf denen verstreut Schafe grasten – ein ganz junges Lamm blökte irgendwo in der Ferne. Die Luft war kalt und zum Trinken feucht, und die Sonne fiel lang und golden durch den Weißdorn. Mir kam der Gedanke, einfach weiterzugehen, über die Hügelkuppe und immer weiter, und Sam und Frank den brodelnden dunklen Fleck zu überlassen, der da im Morgenlicht auf uns wartete. »Da wären wir«, sagte Frank.
Die Hecke ging in eine zerfallende Steinmauer über, die ein vergrastes Feld begrenzte. Das Haus stand dreißig oder vierzig Schritte vom Weg entfernt und war eins von diesen Cottages, wie man sie überall in Irland findet. Sie stehen seit der großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts leer, weil die Bewohner gestorben oder ausgewandert sind und danach niemand mehr Besitzansprüche erhoben hat. Ein Blick genügte, um mein Gefühl zu verstärken, dass ich ganz weit wegwollte von dem, was mich hier erwartete. Das gesamte Feld hätte eigentlich wimmeln müssen vor konzentrierter, bedächtiger Aktivität – Uniformierte, die Köpfe gesenkt, die sich durchs Gras bewegen, Leute von der Spurensicherung in weißen Overalls, die mit Kameras und Linealen und Fingerabdruckpinseln hantieren, Männer von der Gerichtsmedizin, die eine Trage ausladen. Stattdessen sah ich rechts und links der Cottagetür zwei Uniformierte stehen, die von einem Bein aufs andere traten und leicht hilflos wirkten, während zwei Rotkehlchen auf dem Dach herumhüpften und empört durch die Gegend krakeelten.
»Wo sind denn alle?«, fragte ich.
Ich hatte Sam angesprochen, aber Frank sagte: »Cooper war schon hier und ist wieder weg.« Cooper ist der Pathologe. »Hab ihn gleich kommen lassen, damit er sie sich ansieht, wegen des Todeszeitpunkts. Die Kriminaltechnik kann warten. Den Spuren passiert ja nichts.«
»Quatsch«, sagte ich. »Klar passiert ihnen was, wenn wir da reingehen. Sam, hast du schon mal einen Doppelmord bearbeitet?«
Frank hob eine Augenbraue. »Gibt’s noch eine Leiche?«
»Deine, sobald die Kriminaltechniker da sind. Sechs Leute, die an einem Tatort herumtrampeln, ehe sie ihn freigegeben haben? Die drehen dir den Hals um.«
»Das Risiko geh ich ein«, sagte Frank munter und schwang ein Bein über die Mauer. »Ich wollte die Sache eine Weile unter Verschluss halten, und das ist schwierig, wenn hier überall die Spurensicherung herumwuselt. Die fallen nur auf.«
Irgendetwas war hier oberfaul. Es war Sams Fall, nicht Franks. Eigentlich hätte Sam die Entscheidung treffen müssen, wie mit den Spuren zu verfahren war und wer wann gerufen wurde. Was immer da in dem Cottage war, es hatte ihn heftig aus der Fassung gebracht, sonst hätte Frank ihn wohl kaum derartig überrennen und zur Seite drängen können, um den Fall prompt und wirkungsvoll genau so anzugehen, wie es ihm in den Kram passte. Ich suchte Sams Blick, aber er hievte sich gerade über die Mauer, ohne einen von uns beiden anzusehen.
»Kannst du in dem Aufzug über Mauern klettern«, fragte Frank süßlich, »oder soll ich dir behilflich sein?« Ich streckte ihm die Zunge raus und schwang mich rüber auf die Wiese, landete knöcheltief in langem, nassem Gras und Löwenzahn.
Das Cottage hatte zwei Räume gehabt, irgendwann, vor langer Zeit. Einer von ihnen sah noch immer einigermaßen intakt aus – sogar ein Großteil des Daches war erhalten –, der andere jedoch bestand nur noch aus Mauerresten und Fensterlöchern unter freiem Himmel. Ackerwinden und Moos und kleine, hängende blaue Blumen hatten in den Rissen Wurzeln geschlagen. Irgendwer hatte neben der Tür den Namen SHAZ aufgesprüht, nicht sehr künstlerisch, aber das Haus war selbst als Treffpunkt für Jugendliche ungeeignet. Sich selbst überlassen, verfiel es langsam und würde irgendwann einstürzen.
»Detective Cassie Maddox«, sagte Frank, »Sergeant Noel Byrne und Garda Joe Doherty, Polizeiwache Rathowen. Glenskehy gehört zu ihrem Revier.«
»Eine Strafe Gottes«, sagte Byrne. Er klang, als meinte er es ernst. Er war irgendetwas über fünfzig, mit rundem Rücken und wässrigen blauen Augen, und er roch nach nasser Uniform und Verlierer.
Doherty war ein schlaksiger junger Mann mit unvorteilhaften Ohren, und als ich ihm die Hand hinstreckte, glotzte er so überrascht wie eine Zeichentrickfigur. Ich konnte förmlich hören, wie seine Augäpfel plopp machten, als sie wieder zurückflutschten. Weiß der Himmel, was er über mich gehört hatte – die Gerüchteküche bei Cops funktioniert besser als in jedem Bingoclub –, aber ich hatte keine Zeit, mir deswegen Gedanken zu machen. Ich packte mein strahlendstes Lächeln aus, und er murmelte etwas und ließ meine Hand fallen, als hätte er sich daran verbrannt.
»Wir haben Detective Maddox gebeten, einen Blick auf unser Opfer zu werfen«, sagte Frank.
»Schon klar, hätt ich auch gemacht«, sagte Byrne, der mich angaffte. Ich war mir nicht sicher, ob er es so meinte, wie es sich anhörte; so forsch kam er mir eigentlich nicht vor. Doherty kicherte nervös.
»Bereit?«, frage Sam mich leise.
»Ich komm um vor Spannung«, sagte ich. Es kam mir etwas rotziger über die Lippen als beabsichtigt. Frank verschwand bereits im Cottage und zog den Vorhang aus Brombeerranken beiseite, der vor der Tür des inneren Raumes hing.
»Ladies first«, sagte er schwungvoll. Ich hakte mir die Machobrille mit einem Bügel vorn in die Bluse, holte Luft und trat ein.
Es hätte ein friedlicher, trauriger kleiner Raum sein können. Lange Streifen Sonnenlicht fielen schräg durch Löcher im Dach und schienen durch das Netz aus Zweigen vor den Fenstern, flirrend wie Licht auf Wasser; eine Kochstelle, seit hundert Jahren erkaltet, darauf Reste von Vogelnestern, die durch den Kamin herabgefallen waren, und der verrostete Eisenhaken für den Kochtopf hing noch immer einsatzbereit da. Eine Waldtaube gurrte zufrieden irgendwo in der Nähe.
Aber wer schon einmal eine Leiche gesehen hat, weiß, wie sie die Luft verändert: Die gewaltige Stille, das Nichtvorhandensein, so eindringlich wie ein schwarzes Loch, die Zeit ist stehengeblieben, und die Moleküle sind um das reglose Etwas erstarrt, das das letzte Geheimnis erfahren hat, das es nie verraten kann. Meistens sind Tote das Einzige im Raum. Bei Mordopfern ist es anders; sie kommen nicht allein. Die Stille schwillt zu einem ohrenbetäubenden Schrei an, die Luft ist bewegt und trägt eine Handschrift, von der Leiche steigt der Qualm des Brandmals auf, das die andere Person hinterlassen hat, die dich genauso fest packt: der Mörder.
An diesem Tatort fiel mir jedoch als Erstes auf, wie zart der Stempel war, den der Mörder hinterlassen hatte. Ich hatte mich innerlich gegen Dinge gewappnet, die ich mir nicht vorstellen wollte – nackt und breitbeinig, brutale dunkle Wunden, zu dicht, um sie zu zählen, verstreut herumliegende Körperteile –, aber diese Frau sah aus, als hätte sie sich bewusst auf dem Boden in Pose gelegt und danach ihren letzten Atemzug mit einem langen, ruhigen Seufzer ausgehaucht, Ort und Zeit selbst gewählt, ohne dabei irgendwelche fremde Hilfe zu benötigen. Sie lag im Schatten vor der Feuerstelle auf dem Rücken, akkurat, die Füße geschlossen und die Arme am Körper. Sie trug eine marineblaue Wolljacke, offen, darunter eine blaue Jeans – hochgezogen, Reißverschluss geschlossen –, Sneakers und ein blaues Top mit einem dunklen gebatikten Stern vorne drauf. Das einzig Ungewöhnliche waren ihre Hände, die zu festen Fäusten geballt waren. Frank und Sam waren neben mich getreten, und ich warf Frank einen verwunderten Blick zu – Ja und? –, aber er sah mich nur an, ohne dass sein Gesicht irgendetwas preisgab.
Sie war mittelgroß, hatte die gleiche Statur wie ich, kompakt und knabenhaft. Ihr Gesicht war von uns weg zur hinteren Wand gedreht, und in dem dämmrigen Licht konnte ich nur kurze schwarze Locken und ein Stück Weiß sehen: die hohe rundliche Wölbung einer Wange, die Spitze eines kleinen Kinns. »Hier«, sagte Frank. Er knipste eine winzige starke Taschenlampe an und beleuchtete ihr Gesicht mit einem scharfen kleinen Heiligenschein.
Einen Moment lang war ich verwirrt – Sam hat gelogen? –, denn ich kannte sie von irgendwoher, ich hatte das Gesicht schon tausendmal gesehen. Dann trat ich einen Schritt vor, um genauer hinzuschauen, und die ganze Welt verstummte, gefror, während Dunkelheit von allen Seiten herantobte und in der Mitte gleißend weiß nur das Gesicht der jungen Frau blieb, denn das war ich. Der Winkel der Nase, der weite Schwung der Augenbrauen, jede noch so winzige Rundung und Linie klar wie Eis: Das war ich, blaulippig und reglos, mit Schatten wie dunkle Blutergüsse unter den Augen. Ich konnte meine Hände nicht spüren, die Füße, konnte nicht spüren, wie ich atmete. Eine Sekunde lang meinte ich zu schweben, abgeschnitten von mir selbst, und Luftströmungen trügen mich davon.
»Kennst du sie?«, fragte Frank irgendwo. »Vielleicht Verwandtschaft?«
Es war, als würde ich blind; meine Augen konnten sie nicht richtig erfassen. Sie war ein Ding der Unmöglichkeit: eine Fieberhalluzination, ein irrer Riss durch alle Gesetze der Natur. Ich merkte, dass ich stocksteif auf den Fußballen stand, eine Hand fast an der Pistole, jeder Muskel bereit, diese Tote bis in den Tod hinein zu bekämpfen. »Nein«, sagte ich. Meine Stimme klang falsch, irgendwo außerhalb von mir. »Nie gesehen.«
»Bist du adoptiert?«
Sam riss den Kopf herum, erschrocken, aber die Unverblümtheit war gut, sie wirkte wie ein Kneifen. »Nein«, sagte ich. Einen schrecklichen, schwankenden Moment lang fragte ich mich das tatsächlich. Aber ich habe Fotos gesehen, meine Mutter müde und lächelnd in einem Krankenhausbett, ich neugeboren an ihrer Brust. Nein.
»Welcher Elternseite siehst du ähnlicher?«
»Was?« Ich brauchte eine Sekunde. Ich konnte den Blick nicht von der Frau abwenden. Ich musste mich zwingen zu blinzeln. Kein Wunder, dass Doherty, der Ohrenmann, so verblüfft gestiert hatte. »Nein. Meiner Mutter. Aber mein Vater ist nicht fremdgegangen, und das hier ist … Nein.«
Frank zuckte die Achseln. »Hätte ja sein können.«
»Angeblich hat jeder einen Doppelgänger, irgendwo«, sagte Sam leise neben mir. Er war mir zu nah. Erst nach einem Moment Verzögerung begriff ich, dass er bereitstand, um mich aufzufangen, im Notfall.
Ich falle nicht leicht in Ohnmacht. Ich biss mir fest und schnell innen auf die Lippe; der jähe Schmerz verschaffte mir wieder einen klaren Kopf. »Hat sie keinen Ausweis?«
Das winzige Zögern, bevor einer von ihnen antwortete, verriet mir, dass irgendetwas im Busch war. Scheiße, dachte ich mit einem erneuten dumpfen Schlag im Magen: Identitätsklau. Ich wusste nicht genau, wie so etwas funktionierte, aber ein Blick auf mich und eine kreative Ader hätten vermutlich genügt, und die Frau hätte den gleichen Pass wie ich bekommen und sich auf meine Kosten BMWs kaufen können.
»Sie hatte eine Studentenkarte bei sich«, sagte Frank. »Schlüsselbund in der linken Jackentasche, Maglite in der rechten, Portemonnaie in der vorderen rechten Jeanstasche. Zwölf Euro plus Kleingeld, eine Kontokarte, zwei alte Quittungen und das hier.« Er zog einen durchsichtigen Beweismittelbeutel aus einem Haufen an der Tür und klatschte ihn mir in die Hand.
Es war ein Ausweis vom Trinity College, glänzend und digitalisiert, nicht die laminierten bunten Papierdinger, die wir gehabt hatten. Die junge Frau auf dem Foto sah zehn Jahre jünger aus als das weiße, eingefallene Gesicht in der Ecke. Sie lächelte mit meinem eigenen Lächeln zu mir hoch und trug eine gestreifte, zur Seite gedrehte Ballonmütze, und eine Sekunde lang ging mein Verstand mit mir durch: Aber ich hatte doch nie so eine gestreifte, wann hab ich – ich tat so, als würde ich den Ausweis ins Licht halten, während ich das Kleingedruckte las, damit ich den anderen die Schulter zudrehen konnte. Madison, Alexandra J.
Einen schwindeligen Moment lang begriff ich vollkommen: Frank und ich hatten das hier zu verantworten. Wir hatten Lexie Madison Knochen für Knochen und Faser für Faser erschaffen, wir hatten sie getauft, und einige Monate lang hatten wir ihr ein Gesicht und einen Körper gegeben, und als wir sie wegwarfen, wollte sie mehr. Vier Jahre hatte sie gebraucht, um sich selbst neu zusammenzusetzen, aus dunkler Erde und Nachtwind, und dann hatte sie uns hierhergerufen, damit wir sahen, was wir getan hatten.
»Verdammt, das kann nicht sein«, sagte ich, sobald ich wieder atmen konnte.
»Als die Kollegen von der Streife ihren Namen durch den Computer laufen ließen«, sagte Frank und nahm mir den Beutel aus der Hand, »stellte sich raus, dass sie einen Vermerk hatte: Wenn dieser Frau was passiert, umgehend mich verständigen. Ich hab sie damals nicht aus dem System genommen, weil ich dachte, wir könnten sie vielleicht noch mal brauchen, früher oder später. Man weiß ja nie.«
»Ja«, sagte ich. »Das kannst du laut sagen.» Ich starrte auf die Leiche und rief mich zur Ordnung: Das da war kein Golem, das war eine tote Frau im richtigen Leben, Paradox inklusive. »Sam«, sagte ich. »Was haben wir?«
Sam warf mir einen raschen, forschenden Blick zu. Als er sicher war, dass ich nicht in Ohnmacht fallen oder loskreischen würde oder was immer er befürchtet hatte, nickte er. Er sah schon wieder ein bisschen mehr wie er selbst aus. »Weiblich, Hautfarbe weiß«, sagte er, »Mitte zwanzig bis Anfang dreißig, eine Stichwunde in der Brust. Cooper sagt, sie starb gegen Mitternacht, plus minus eine Stunde. Genauer kann er es nicht sagen: Schock, schwankende Umgebungstemperatur, eventuelle körperliche Aktivität kurz vor dem Todeszeitpunkt und so weiter.«
Anders als die meisten Leute komme ich gut mit Cooper klar, aber ich war froh, dass ich ihn verpasst hatte. Das kleine Cottage kam mir zu voll vor, voller trampelnder Füße und sich bewegender Menschen und auf mich gerichteter Blicke. »Wurde sie hier erstochen?«, fragte ich.
Sam schüttelte den Kopf. »Schwer zu sagen. Wir müssen abwarten, was die Kriminaltechnik sagt, aber der Dauerregen letzte Nacht hat viele Spuren vernichtet – wir werden keine Fußabdrücke da draußen auf dem Feldweg finden, keine Blutspur, nichts dergleichen. Aber ich würde sagen, das hier ist nicht der Tatort. Sie war noch mindestens eine Weile auf den Beinen, nachdem sie verwundet wurde. Siehst du da? Das Blut ist geradlinig an ihrer Jeans runtergelaufen.« Frank richtete den Taschenlampenstrahl gehorsam darauf. »Und sie hat Dreck an beiden Knien und einen Riss an einem, als wäre sie gerannt und hingefallen.«
»Auf der Flucht«, sagte ich. Das Bild wallte in mir auf wie etwas aus jedem vergessenen Alptraum: der Weg, der sich in die Dunkelheit hineinschlängelt, und sie, die verzweifelt rennt, Füße, die hilflos auf Kieseln wegrutschen, ihr Atem wild in den Ohren. Ich konnte spüren, wie Frank vorsichtig zurücktrat, wortlos, beobachtend.
»Könnte sein«, sagte Sam. »Vielleicht war der Mörder hinter ihr her, oder sie hat es geglaubt. Sie könnte sogar von seiner Haustür aus eine Spur hinterlassen haben, aber die ist natürlich längst verschwunden.«
Ich wollte etwas mit den Händen machen, mir durchs Haar fahren, über den Mund, irgendwas. Ich stopfte sie in die Taschen, um sie ruhig zu halten. »Sie ist also hier rein und zusammengebrochen.«
»Nicht ganz. Ich glaube, sie ist da drüben gestorben.» Sam zog die Brombeerzweige beiseite und deutete mit dem Kinn auf eine Ecke des vorderen Raumes. »Da haben wir eine ziemlich große Blutlache. Schwer zu sagen, wie viel Blut das genau ist – vielleicht kann das Labor uns da behilflich sein –, aber wenn nach einer solchen Nacht noch so viel vorhanden ist, würde ich tippen, dass sie eine ordentliche Menge verloren hat. Vermutlich hat sie aufrecht sitzend an der Wand gelehnt – das meiste Blut ist vorn auf ihrem Top und auf dem Schoß und am Hosenboden ihrer Jeans. Wenn sie gelegen hätte, wäre es an den Seiten runtergelaufen. Siehst du?«
Er zeigte auf das Top der jungen Frau, und der Groschen fiel bei mir mit einem Knall: keine Batikfarbe. »Sie hat den Stoff vorn zusammengedreht und auf die Wunde gepresst, um die Blutung zu stoppen.«
Tief in der Ecke da zusammengekauert; rauschender Regen, Blut, das ihr warm durch die Finger quillt. »Und wie ist sie dann hier rübergekommen?«, fragte ich.
»Unser Mann hat sie am Ende eingeholt«, sagte Frank. »Irgendjemand auf jeden Fall.« Er bückte sich, hob einen Fuß der Frau am Schnürsenkel an – ein Zucken schoss mir durch den Nacken, als er sie berührte – und richtete die Taschenlampe auf die Ferse ihres Sportschuhs: abgewetzt und braun, mit tief eingegrabener Erde. »Sie wurde hergeschleift. Da war sie schon tot, denn unter dem Körper ist keine Lache: Sie hat also nicht mehr geblutet. Der Typ, der sie gefunden hat, schwört, er hat sie nicht angerührt, und ich glaube ihm. Er sah aus, als würde er sich gleich die Seele aus dem Leib kotzen. Der ist todsicher keinen Zentimeter näher ran als nötig. Jedenfalls, sie wurde relativ kurz nach Eintritt des Todes bewegt. Cooper sagt, die Leichenstarre hatte noch nicht eingesetzt, und es sind keine sekundären Leichenflecke vorhanden – und sie war auch nicht lange draußen im Regen. Sie ist kaum feucht. Wäre sie die ganze Nacht im Freien gewesen, wäre sie klatschnass.«
Ganz allmählich, als würden sich meine Augen jetzt erst an das dämmerige Licht gewöhnen, wurde mir klar, dass all die dunklen Kleckse und Tupfen, die ich für Schatten und Regenwasser gehalten hatte, in Wahrheit Blut waren. Es war überall: streifte den Boden, tränkte die Jeans der Frau. Verkrustete ihre Hände bis zu den Gelenken. Ich wollte nicht in ihr Gesicht sehen, wollte niemandem ins Gesicht sehen. Ich hielt den Blick auf ihr Top gerichtet, unfokussiert, so dass der dunkle Stern verschwamm und diffus wurde. »Fußabdrücke?«
»Null«, sagte Frank. »Nicht mal von ihr. Sollte man nicht meinen, bei dem Erdboden, aber wie Sam schon gesagt hat, der Regen. Nebenan haben wir jede Menge Matsch, mit Abdrücken von dem Typen, der die Polizei verständigt hat, und von seinem Hund – das war mit ein Grund, warum ich keine großen Bedenken hatte, mit dir hier reinzumarschieren. Das Gleiche gilt für den Weg zum Cottage. Und hier drin … « Er bewegte den Taschenlampenstrahl am Rand des Fußbodens entlang, tauchte ihn in Ecken: breite, leere Erdflächen, viel zu glatt. »So sah es überall aus, als wir ankamen. Die Abdrücke, die du um den Leichnam herum siehst, die sind von uns und Cooper und den Uniformierten. Wer immer die Tote bewegt hat, er hat anschließend hinter sich saubergemacht. Mitten auf der Wiese liegt ein abgebrochener Ast Ginster, wahrscheinlich von dem großen Strauch an der Tür. Ich schätze, er hat damit den Boden glattgefegt, bevor er ging. Wir lassen ihn im Labor auf Blut oder Abdrücke untersuchen. Und ohne Fußabdrücke … «
Er reichte mir einen anderen Beweismittelbeutel. »Fällt dir daran was auf?«
Es war ein Portemonnaie, weißes Lederimitat, bestickt mit einem silbernen Schmetterling und mit schwachen Blutspuren darauf. »Es ist zu sauber«, sagte ich. »Du hast gesagt, es hat vorn in der Jeanstasche gesteckt, und das Blut ist ihr in den Schoß gelaufen. Dann müsste das Portemonnaie voller Blut sein.«
»Exakt. Die Tasche ist steif vor Blut, völlig durchtränkt, aber das hier hat kaum was abbekommen. Das Gleiche bei der Taschenlampe und den Schlüsseln: kein Tropfen Blut, nur ein paar Schmierflecken. Sieht so aus, als hätte unser Killer ihre Taschen durchsucht und alles abgewischt, ehe er es zurückgesteckt hat. Wir lassen alles auf Fingerabdrücke untersuchen, was lange genug stillhält, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass was dabei rauskommt. Hier war jemand sehr, sehr vorsichtig.«
»Irgendwelche Anzeichen von Vergewaltigung?«, fragte ich. Sam zuckte zusammen. Ich hatte das Stadium längst hinter mir.
»Cooper will erst die Obduktion abwarten, aber vorläufig deutet nichts in diese Richtung. Wenn wir Glück haben, finden wir fremdes Blut an ihr» – viele Messerstecher verletzen sich selbst –, »aber im Grunde rechne ich nicht mit DNA.«
Mein erster Eindruck – der unsichtbare Killer, der keine Spuren hinterlässt – war gar nicht so falsch gewesen. Nach ein paar Monaten im Morddezernat riechst du aus einer Meile Entfernung, wenn du es mit so einem Fall zu tun hast. Mit dem letzten klaren Fetzen meines Verstandes rief ich mir in Erinnerung, dass dieser Fall, ganz gleich, wie er sich darstellte, nicht mein Problem war. »Na toll«, sagte ich. »Was habt ihr denn überhaupt? Wisst ihr irgendwas über sie, außer dass sie am Trinity eingeschrieben ist und einen falschen Namen hat?«
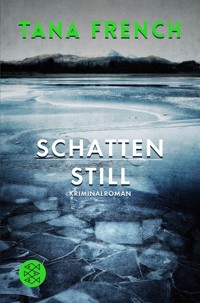



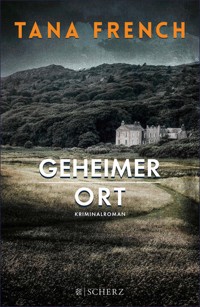







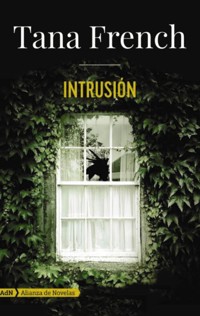
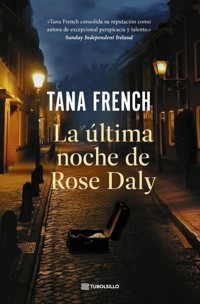
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)

![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)










