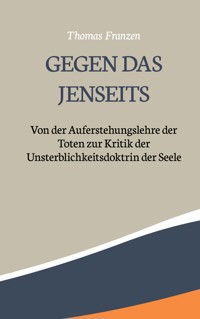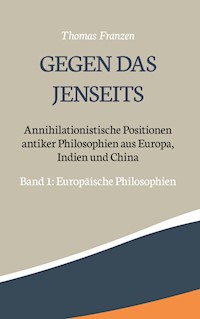
Gegen das Jenseits: Annihilationistische Positionen antiker Philosophien aus Europa, Indien und China E-Book
Thomas Franzen
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gegen das Jenseits: Annihilationistische Positionen antiker Philosophien aus Europa, Indien und China
- Sprache: Deutsch
Zweifellos gehört die eigene Sterblichkeit mit zu den Gewissheiten, die den Menschen existentielle Angst einflösst. Häufig hat er daraus in der Geschichte den Schluss gezogen, dass mit dem eigenem Sterben nicht das Ende des Lebens, sondern der Anfang eines neuen Lebens gekommen sei. Diese Vorstellung eines Jenseitsleben ist heute in Europa und Nordamerika, in China und Südkorea, in Australien und anderen Ländern auf dem Rückzug. Es stellt sich daher die Frage, ob der Annihilationismus eine neue Erscheinung ist, die mit Wohlstandsgesellschaften im Zusammenhang steht, oder nicht doch auch ältere Wurzeln hat. Die vorliegende Reihe geht dieser Frage nach, indem sie Positionen antiker Philosophien aus Europa, Indien und China vorstellt, die die einfache "Lösung" der Sterblichkeit, d.h. die Leugnung des Endlichkeit des Lebens, kritisiert oder ganz negiert. In diesem ersten Band wollen wir die antiken Philosophien Europas untersuchen. Beginnend mit der Vorsokratik und anschießend mit Philosophen und Gelehrten der Nachsokratik bis hin zur Römischen Kaiserzeit versuchen wir das kritische Gedankengut hinsichtlich eines postmortalen Lebens darzustellen, das in der griechischen Welt entspross und in dem römischen Imperium die Lebenseinstellung vieler Menschen prägte. In einem Anhang wollen wir kurz auf einige Naturvölker eingehen, die überraschenderweise ein gewisses Mißtrauen gegenüber Spekulationen, die ein Jenseits zum Inhalt haben, hegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Europäische Philosophien der Antike
1.1. Annihilationistische Positionen in der Vorsokratik (7. - 5. Jahrhundert v.u.Z.)
1.1.1. Ionische Aufklärung
1.1.1.1. Anaximander
1.1.1.2. Xenophanes
1.1.1.3. Heraklit
1.1.2 Nachparmenidische Naturphilosophie
1.1.2.1 Empedokles
1.1.2.2. Anaxagoras
1.1.2.3. Leukipp und Demokrit
1.1.2.3.1. Physik
1.1.2.3.2. Ethik
1.2. Annihilationistische Positionen von der Nachsokratik bis in die Römische Kaiserzeit
1.2.1 Zurückweisung homerischer Unterweltsfabeln, pythagoreischer Wiedergeburtsversprechungen und der Auferweckungshoffnungen römischer Christen
1.2.2 Aristoteles
1.2.3 Cicero und die Stoiker
1.2.4 Epikureer
1.2.5 Andere Philosophen- und Personengruppen
1.2.6 Grabepigramme
Anhang: Annihilationistische Positionen bei Naturvölkern
Literaturverzeichnis
Für Andreas, Nadine, Moritz und Marit
Einleitung
Nach Ansicht einer Reihe von (Religions-) Philosophen und Ethnologen ist und war das Faktum des Todes historisch die vorrangige Quelle für die Entstehung religiöser Orientierungssysteme1, die, soweit wir wissen, nur Menschen ausgestalten. Allein sie hätten ein Bewußtsein, daß ihr Leben mit Notwendigkeit zu Ende gehen werde.2 Dieses antizipative Todesbewußtsein beschrieb Schopenhauer als eine bloß dem Menschen zukommende Gewißheit darüber, daß ein jedes und damit auch das eigene Dasein endlich und all das bemühte Streben und Handeln letzten Endes nur vergeblich sei.3
Eben dieses Wissen sei es, das in ihm Bedenken, ja geradezu im Innern blankes Erschrecken und Entsetzen errege4, ein tiefes Grausen vor dem Tode, das zu haben man nicht zu Unrecht als eines der Merkmale beschrieben hat, das die menschliche Gattung essentiell vom restlichen Tierreich unterscheidet5. Dieses existentielle Grausen und Entsetzen, das ihn bei der Konfrontation mit dem Tod überkommt, dürfte zentraler Grund und Nährboden dafür sein, daß das ihm eigene Bewußtsein seiner Sterblichkeit Furcht oder Angst vor dem Tod auslöst. Diese antizipative Angst oder Furcht vor dem Tod soll nach Ansicht von Philosophen ein nur bei Menschen auftretendes6, universelles Phänomen7 des Menschen sein. Der entscheidende Grund, daß das als Problem begriffene Faktum des Todes religiöse Glaubenssysteme generiert, ist nun, daß derartige Vorstellungen den Menschen, wie das Yinger8 betont, an seiner Furcht vor dem Tode greifen und ihm für das emotive Problem eine Lösung bereitstellen. Was die Religion dem Menschen als "Heilmittel"9 oder "Gegengift"10 gegen seine Todesfurcht präsentiert, ist letztlich allerdings lediglich die behauptete Leugnung des Problems der Unausweichlichkeit des Todes in Vorstellungen seiner bzw. seiner Seele zukommenden Unsterblichkeit.11 Dieses universale Verlangen des Menschen nach Leugnung seines Todes beruht dabei auf einer tiefen Disposition, keine Zerstörung seiner Persönlichkeit zuzulassen und damit die endgültige Annihilation im Tode schlicht zu negieren.12 "Daß der physische Tod nicht das Ende des menschlichen Lebens zu sein scheint, ist eine der Vorstellungen, welche den menschlichen Universalien zuzuordnen ist."13 Insofern sei sowohl die Idee einer Seele als Sitz der Persönlichkeit eines Menschen14 als auch die Annahme der Unsterblichkeit15 und damit der Fortdauer der Seele nach Zerstörung des Körpers16, d.h. also nach dem Tod, eine Universalie, die in der Geschichte menschlicher Kulturen überall auftritt. Denn der Ansicht von Resch nach wurde bis jetzt "... kein Volk gefunden, … daß nicht in irgendeiner Weise an die Fortdauer der Seelen und Geister sowie an ein Jenseits glaubte... ."17 Genau diese Vorstellung eines Jenseitsleben ist eben nach der Auffassung vieler Wissenschaftler der Kern religiöser Glaubenssysteme18 und zwar, weil hier der Ursprungsgrund für das Aufkommen von Religiosität liegt. Denn laut Aussage des Philosophen und Schriftstellers Unamuno "... geht alle Religion ... von der Unsterblichkeit aus"19, oder anders gesagt, habe die Religion als Aspekt menschlicher Kultur ihren Ursprung im Jenseitsglauben: "Der Glaube an Geister [und Götter] ist die Folge des Glaubens an die Unsterblichkeit"20, postuliert der angesehene Ethnologe Malinowski und daher meint der Philosoph und Theologe Schurr auch: "When theology is slighted, religion means life beyond death"21. Bereits Luther schrieb nämlich: "Negatio enim futurae vitae tollit simpliciter Deum"22.
Doch ist der Jenseitsglaube tatsächlich eine menschliche Universalie, wie uns die Beispiele der Philosophen und Ethnologen versichern? Beschränken wir uns auf den Glauben der Deutschen, muß die Antwort: "Nein" lauten. Nach einer Umfrage23 aus dem Jahre 2019 war nämlich nur 46% der Deutschen der Ansicht, daß der Mensch eine den Tod ihres Körpers überdauernde, unsterbliche Seele habe, und bloß 40% der Befragten ab 18 Jahren gab an, daß es ein Leben nach dem Tod geben werde. Und das bedeutet, daß offenbar die Mehrheit der Deutschen der Ansicht ist, daß mit dem Tod des Körpers auch alle ihre Persönlichkeit tragenden Merkmale verschwinden und daher ein postmortales Leben nicht existieren würde. Doch diese Umkehrung der von den Philosophen und Ethnologen behaupteten natürlichen Glaubenssätze ist nur ein Aspekt des Säkularisierungstrends, der in der EU, in China, Südkorea, Australien, Kanada und sogar den USA seit rund 60 Jahren die Vormachtstellung der Kirchen zurückdrängt. Verantwortlich hierfür dürften Veränderungen der Familienverhältnisse und der Wertorientierungen, die Angebotserweiterung für Konsum- und Freizeitaktivitäten und die Absicherung elementarer Versorgungsleistungen von Seiten des Sozialstaates sein. Bei diesen Gründen kommen solche Aspekte der Lebenswirklichkeit zum Tragen, die Wohlstandsgesellschaften bestimmen24, sie sind der geeignete Katalysator, der die Entwicklung zur Annihilation befördert.
Insofern ist zu fragen, ob die Entwicklung annihilationistischer Positionen auf die Bedingungen solcher Gesellschaften begrenzt ist und man sie nur bei modernen Gesellschaften antrifft. Ist die Annihilation also nur eine Frage von Wohlstandsgesellschaften und fehlt sie daher bei Naturvölkern oder Hochkulturen früherer Jahrtausende? Die Beantwortung dieser Frage ist Gegenstand unserer Untersuchung. Dabei wollen wir zunächst die antike Philosophie Europas betrachten. Beginnend mit der Vorsokratik und anschießend mit Philosophen und Gelehrten der Nachsokratik bis hin zur Römischen Kaiserzeit versuchen wir das kritische Gedankengut hinsichtlich eines postmortalen Lebens darzustellen, das in der griechischen Welt entspross und in dem römischen Imperium die Lebenseinstellung vieler Menschen prägte. In einem Anhang dieses ersten Bandes wollen wir kurz auf einige Naturvölker eingehen, die überraschenderweise ein gewisses Mißtrauen gegenüber Spekulationen, die ein Jenseits zum Inhalt haben, hegen. Der zweite Band unserer Untersuchung thematisiert die indischen und chinesischen Philosophien der Antike, inwieweit diese relevante Ansichten ausdrücken, die auf die letztliche Leugnung jenseitigem Lebens hinzielen.
1 vgl. Malinowski, B. (1954), S. 641: "the fact of death, which of all human events is the most upsetting and disorganizing to man´s calculation,... the main source of religious belief"; vgl. auch ders. (1983), S. 32: "Von allen Ursprüngen der Religion ist das letzte Grundereignis des Lebens - der Tod - von größter Wichtigkeit."
2 vgl. u.a. Dobzhansky, T. (1967): "Self-awareness is ... one of the fundamental, possibly the most fundamental, characteristic of the human species. This characteristic is an evolutionary novelty. … Self-awareness has, however, brought in its train somber companions - fear, anxiety, and death-awareness. ... Death-awareness is a bitter fruit of man´s having risen to the level of consciousness and of funktioning ego. ... Death-awareness is a concomitant of self-awareness ..." (S. 69) "Deathawareness became established in human evolution as a species trait. However, this trait was not, and possibly is not, adaptive in itself. It is an integral part of the complex of human facultaties, the core of which is constituted by self-awareness, capacity for abstract thought, symbol formation, and the use of language." (S. 76) "... The fundamental fact of death-awareness ... is ... one of the basic characteristics of mankind as a biological species." (S. 72); Fromm, E. (1980), S. 202 f.: "Mit diesem Bewußtsein seiner selbst und mit dieser Vernunft begabt, ist sich der Mensch seiner Getrenntheit von der Natur und von anderen Menschen bewußt; er ist sich seiner Machtlosigkeit und seiner Unwissenheit bewußt; und er ist sich seines Endes bewußt: des Todes."; Weizsäcker, C.F.v. (1978), S. 154: "Der Mensch ist das Lebewesen, welches weiß, daß es sterben muß. Unter dem, was Tiere wahrnehmen, ist wohl eine Mitwahrnehmung des herannahenden eigenen Todes in der Furcht oder im Erlöschen der selbsterhaltenden Triebe vorhanden, vielleicht wesentlich. Ein reflektiertes Wissen, daß er sterben muß, werden wir erst dem Menschen zusprechen."
3 vgl. Schopenhauer, A. (1991 b), S. 185 f.: "Nachdem das innere Wesen der Natur (der Wille zum Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche der bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüstig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei. Seine Verwunderung ist aber um so ernstlicher, als es hier zum ersten Male mit Bewußtseyn dem Tode gegenübersteht, und neben der Endlichkeit alles Daseyns auch die Vergeblichkeit alles Strebens sich ihm mehr oder minder aufdringt."
4 vgl. Schopenhauer, A. (1991 a), S. 73: "Das Tier lernt den Tod erst im Tode kennen: der Mensch geht mit Bewußtseyn in jeder Stunde seinem Tode näher, und dies macht selbst Dem das Leben bisweilen bedenklich, der nicht schon am ganzen Leben selbst diesen Charakter der steten Vernichtung erkannt hat.", (1991 b), S. 536 f.: "Das Thier lebt ohne eigentliche Kenntniß des Todes: daher genießt das thierische Individuum unmittelbar die ganze Unvergänglichkeit der Gattung, indem es sich seiner nur als endlos bewußt ist. Beim Menschen fand sich, mit der Vernunft, notwendig die erschreckende Gewißheit des Todes ein."
5 vgl. Herzog, E. (1960), S. 20: "Und in der Tat ist die Fähigkeit, vor dem Tode Grauen zu empfinden, eines der wesentlichen Merkmale, die den Menschen vom Tier unterscheiden."
6 vgl. Schulz, W. (1976), S. 104
7 vgl. Becker, E. (1976), S. 9, 10, wo Becker sagt, "daß die Furcht vor dem Tode etwas Universelles ist"; vgl. auch u.a. S. 39; sowie Tillich, P. (1954), S. 35: "Die Angst des Schicksals und des Todes ist grundlegend, universal und unausweichlich." oder Cassirer, E. (1990), S. 138: "Die Furcht vor dem Tod ist unzweifelhaft einer der allgemeinsten und am tiefsten verwurzelten Instinkte des Menschen."
8 vgl. Yinger, J.M. (1970), S. 123: "The most significant tendencies with which religion everywhere grapples is fear of death.". Nach Ansicht von Becker, E. (1976), S. 300 "hat die Religion [sogar] die beste Lösung für das Todesproblem anzubieten".
9 vgl. Schopenhauer, A. (1991 b), S. 537: "Wie aber durchgängig in der Natur jedem Uebel ein Heilmittel, oder wenigstens ein Ersatz beigegeben ist; so verhilft die selbe Reflexion, welche die Erkenntniß des Todes herbeiführte, auch zu metaphysischen Ansichten, die darüber trösten, und deren das Thier weder bedürftig noch fähig ist."
10 vgl. Schopenhauer, A. (1991 b), S. 537: "Hauptsächlich auf diesen Zweck sind alle Religionen und philosophischen Systeme gerichtet, sind also zunächst das von der reflektirenden Vernunft aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift der Gewißheit des Todes."
11 vgl. Becker, E. (1976), S. 9: "Der Gedanke an den Tod, die Furcht vor ihm, verfolgt das Tier Mensch wie nichts sonst; er ist eine der Triebfedern menschlichen Handelns, eines Handelns, das hauptsächlich ausgerichtet ist, dem Schicksal des Todes zu entgehen oder es zu besiegen, indem wir leugnen, daß es unser aller endgültiges Schicksal ist."
12 vgl. Malinowski, B. (1954), S. 641: "The affirmation that death is not real, that man has a soul and this is immortual arises out of a deep need to deny personal destruction..."
13 vgl. Weiss, G. (1985), S. 219
14 vgl. Weiss, G. (1987), S. 123: "Die Idee der Seele ist eine menschliche Universalie. Jeder menschliche Körper beherbergt ein inneres Wesen - die Seele, die gleichzeitig sein Lebensprinzip ist."
15 Frazer, J.G. (1913), S. 468
16 vgl. Resch, A. (1992), S. 597
17 Resch, A. (1981), S. 28
18 vgl. u.a. Malinowski, B. (1983), S. 36: "Die Überzeugung des Menschen von der Kontinuität des Lebens ist eine der höchsten Gaben der Religion ..."
19 Unamuno, M.d. (1925), S. 52; zur Religion und zur Unsterblichkeit der Seele im Werk von Unamuno vgl. u.a. Schürr, F. (1962), S. 25 f., 28 f., 36 f. oder Martinez Cruzado, R.F. (1982), insb. S. 25 - 47
20 Malinowski, B. (1983), S. 36 f. (Einschub von mir - T.F.)
21 Schurr, G.M. (1968), S. 162
22 Luther, M. (1883), Bd. 43, S. 363, 21
23https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/christen-an-ostern-immer-wenigerdeutsche-glauben-an-gott-a-1263630.html
24 vgl. Pollak, D. (2016)
1. Europäische Philosophien der Antike
1.1. Annihilationistische Positionen in der Vorsokratik (7. - 5. Jahrhundert v.u.Z.)
1.1.1. Ionische Aufklärung
Die geistige Wiege europäischer Philosophie stand in einer Stadt in Kleinasien, in Milet, das an der Mündungsbucht des Mäander ins Ägäische Meer gelegen über mehrere Jahrhunderte die bedeutendste von Griechen gegründete und besiedelte Handelsmagistrale war und das den Seehandel im 8. bis 6. Jahrhundert v.u.Z. beherrschte. In diesem Klima freien Austauschs von Waren wie von Wissen kamen innerhalb eines Jahrhunderts drei Gelehrte hervor, die ersten Philosophen des Abendlandes, nämlich Thales (ca. 624 - 546 v.u.Z.)25, der einer der "Sieben Weisen"26 der Antike war, Anaximander (ca. 611 - 546 v.u.Z.)27 und Anaximenes (um 585 - 525 v.u.Z.)28, die den Schritt "vom Mythos zum Logos"29 vollzogen und damit das bisherige Denken revolutionierten. Zwar gelang dieser Übergang nicht ganz unerwartet, ohne jedes Zwischenstadium, Gestalten wie Pherekydes standen durchaus zwischen solchem Glauben an Mythen und dem Aufkommen wissenschaftlich-philosophischer Vernunft30, selbst die ersten Philosophen unterlagen noch vielfachen Einflüssen traditioneller Vorstellungen31. Gleichwohl obsiegten die ionischen Vorsokratiker auffallend schnell - und auch radikal - über das alte religiös-mythische Denken und begründeten damit schließlich die Kultur des Logos und d.h. das von der Macht rationaler Argumente beherrschte okzidentale Denken in Wissenschaft und Philosophie.
Ob nun Thales, Anaximander und Anaximenes eine Art philosophische Schule in Milet bildeten, wie einzelne Hinweise von Theophrast32 andeuten mögen, sei offen gelassen33. Was alle drei Denker eint, ist das, was nach Aristoteles34 die Absicht ihres Bemühens war, nämlich, vom "Warum" der Dinge angeregt, die gewissen "Prinzipien und Ursachen", die archái kai aitíai der Natur, aufzudecken. Wie nun der Stagirite weiter sagt, wird dieses "Warum" auf den Begriff der "Sache" zurückgeführt35, und genau dies wurde der entscheidende Schritt, den die Milesier über das alte Denken der Mythen taten, nämlich statt Willkür-Verhalten von Ur-Hebern (Dämonen, Gottheiten) unpersönliche Ur-Sachen als Begründung kausaler Beziehungen festzumachen36 sowie in ihnen nomologische Zusammenhänge von Sach-Verhalten anzusetzen. Deutlich kommt diese Modernität zuvorderst in rationalen Deutungen von Naturphänomenen zum Tragen: die Vorhersage der Sonnenfinsternis des Jahres 585 v.u.Z.37 und besonders die Begründung der Nilschwelle aus einem durch die Passatwinde bewirkten Rückstaus des Flußwassers38 durch Thales, der Entwurf einer Erdkarte39 und die Erklärung des Windes aus der auf Grund von Sonneneinstrahlung erwärmten Luft40 durch Anaximander, die Herleitung der Wolkenbildung und der Entstehung von Regen aus Verdichtungen der Luft und diese als Folge von Abkühlung41 durch Anaximenes. Historisch sind allerdings vorwiegend ihre Versuche von Bedeutung, die Natur als Ganzes auf ein als Arché bezeichnetes Prinzip zurückzuführen: Wasser bei Thales42, das Apeiron bei Anaximander und Luft bei Anaximenes43. In philosophischer Hinsicht liegt deren Bedeutsamkeit 1. im Aspekt der Einheit der Welt und Einheitlichkeit der Naturdinge, ein Gesichtspunkt, der nicht den Einzeltatsachen, als die die Welt erscheint, zu entnehmen ist, sondern ein vorgängig an derartige Phänome herangetragene Welt- und Naturdeutung ist44, 2. in der Differenzierung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit und demgemäß zwischen den Meinungen und der Wahrheit45, und 3. in der Anwendung des Prinzips der Einfachheit wissenschaftlich-philosophischer Theorien, d.h. in der Erklärung der Komplexität der Welt durch Reduzierung auf ein Minimum an Annahmen46 sowie 4. in ihrer Unterstellung eines Gesetzes der Erhaltung dieses Seinsprinzips47.
25 vgl. zu den Lebensdaten von Thales die Chronik des Apollodor (2. Jahrhundert v.u.Z.) in: Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 42/43 (fr. 1 / DK 11 A 1) und Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 84, Fn. 1; zu Thales als Persönlichkeit der Geschichte vgl. u.a. Classen, C.J. (1965), S. 930 f. oder Fehling, D. (1985), S. 53 - 63
26 vgl. zu den "Sieben Weisen" der Antike die Ausführungen und Fragmente in: Capelle, W. (1968), S. 61 - 66 sowie Snell, B. (1938), Mosshammer, A.A. (1976) oder Fehling, D. (1985), zu Thales als Weisen und einer der "Sieben Weisen vgl. auch noch die Ausführungen von Classen, C.J. (1965), S. 931 - 935
27 vgl. zu den Lebensdaten des Anaximander die Chronik des Apollodor in: Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 64/65 (fr. 5 / DK 12 A 1)) und die Anmerkungen u.a. von Heidel, W.A. (1921), S. 253 f., Classen, C.J. (1970), S. 30 f., Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 109 - 111
28 zur Lebenszeit des Anaximenes vgl. den Hinweis aus der Chronik des Apollodor in: Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 86/87 (fr. 1 / DK 13 A 1) sowie Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 157 f.
29 vgl. den Titel von Nestle, W. (1966)
30 vgl. Capelle, W. (1968), S. 30 f.; zu Pherekydes vgl. u.a. Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 54 - 78 und insbesondere die Gesamtdarstellung von Schibli, H.S. (1990)
31 vgl. dazu die Anmerkungen u.a. von Röd, W. (1988), S. 26 ff.
32 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 70/71 (fr. 15 / DK 12 A 9, B 1) und S. 88/89 (fr. 6 / DK 13 A 5)
33 zu Gunsten einer Art milesischer Philosophenschule spricht unter anderem Guthrie, W.K.C. (1962), S. 43 f., Fn. 2. Dagegen betrachten Kahn, C.H. (1960), S. 28 oder Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 110 f. die Angaben mit Skepsis und sehen aus Theophrast´s Hinweisen lediglich die gemeinsame Herkunft aus Milet und den Kontakt zwischen ihnen verbürgt.
34 Aristoteles (1982), S. 16/17 (Met. I 2, 983 b 3 - 4)
35 vgl. Aristoteles (1982), S. 16/17 (Met. I, 2, 983 a 28 - 29)
36 vgl. Röd, W. (1981), S. 167
37 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 42/43 (fr. 2 / DK 11 A 5); vgl. dazu auch die Ausführungen von Hartner, W. (1969) oder Mosshammer, A.A. (1981) und zur Leistung des Thales als Astronom u.a. Classen, C.J. (1965), S. 943 - 945
38 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 48/49 (fr. 13 / DK 11 A 16); vgl. dazu die Ausführungen von Röd, W. (1975), S. 6 f., (1981), S. 163 f., (1988), S. 23 f.
39 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 64/65 (fr. 2 / DK 12 A 6); zur Erdkarte des Anaximander vgl. u.a. Berger, H. (1903), S. 25 ff., 29 ff., 39 ff., 84 f., Heidel, W.A. (1921), S. 247 - 252, Kahn, C.H. (1960), S. 82 - 84, Classen, C.J. (1970), S. 34 f., Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 113 f.
40 vgl. Capelle, W. (1968), S. 81 (fr. 19 / DK 12 A 24)
41 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 92/93 (fr. 7 /DK 13 A 5), S. 90/91 f. (fr. 7 u. 10 / DK 13 A 7)
42 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 46/47 f. (fr. 10 / DK 11 A 12), S. 50/51 (fr. 18)
43 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 86/87 f. u. 96/97 (fr. 2, 3, 4, 6, 7, u. 15 u. 16 / DK 13 A 4, B 2, 3, A 5 u. 7, A 10)
44 vgl. Röd, W. (1988), S. 25, 29, 37
45 vgl. Röd, W. (1981), S. 173, (1988), S. 37 f., Graeser, A., (1984), S. 41, (1985), S. 16
46 vgl. Sambursky, S. (1965), S. 19 f.
47 vgl. Sambursky, S. (1965), S. 20 f., Röd, W. (1988), S. 25
1.1.1.1. Anaximander
Hinsichtlich seiner Konzeption überragt Anaximander bei weitem sowohl den Thales als auch den Anaximenes an Originalität wie Radikalität und - zumindest aus Sichtweise heutiger Wissenschaft - an einer an Genialität grenzenden visionären Kühnheit wissenschaftlich-philosophischer Spekulation. Es ist dies vielleicht auch der Grund, weshalb Anaximander der einzige der Milesier ist, von dem wir ein Fragment seiner Aussagen, wenn auch bloß über Dritte, und zwar über den Auszug eines Buches von Theophrast im Werk des Simplikios (im 5. Jahrhundert u.Z.) über Physik, besitzen.48 Die entsprechende Passage lautet: "Anaximander ... behauptete, Arché und Element der seienden Dinge sei das Apeiron, wobei er als erster den Terminus Arché einführte. Als solchen bezeichnet er weder das Wasser noch ein anderes der üblichen Elemente, sondern eine andere unbeschränkte Wesenheit, aus der sämtliche Universa sowie die in ihnen enthaltenen kosmischen Ordnungen entstehen: »Aus welchen [seienden Dingen] die seienden Dinge ihr Entstehen haben, dorthin findet auch ihr Vergehen statt, wie es in Ordnung ist, denn sie leisten einander Recht und Strafe für das Unrecht, gemäß der zeitlichen Ordnung«, darüber in diesen eher poetischen [metaphorischen] Worten sprechend."49 Der genaue Sinn der Apeiron genannten Arché und dem von den Anführungszeichen umschlossenen Zitat des Anaximander ist unter den Wissenschaftlern, wie man dies vermutlich kaum anders erwarten konnte, sehr kontrovers, doch für den Zusammenhang mit der Thematik unserer Abhandlung müßten einige wenige Hinweise ausreichen.
Als solch Unbestimmtes kann Apeiron quantitative und qualitative Konnotationen besitzen. Hinsichtlich der Ausdehnung besagt das, daß dieses Apeiron ungeheuer groß und sein mächtiger Umfang uns unermesslich ist. Es umfaßt alles53 und ist damit seiner Größe und der Unermesslichkeit seiner Grenzen wegen etwas Abstraktes, doch nichts bloß Formalhaftes, sondern ein aktuell Existentes54. Doch obschon es jedwede Möglichkeit unmittelbarer Erfahrbarkeit übersteigt und als das gemeinsame Eine das Ergebnis geistiger Konstruktion ist55, ist das Apeiron ein vom Denken unabhängig existentes Dinghaftes, eine Natur oder Wesenheit56. Wenn nun Anaximander diese Arché apeiron nennt und damit als etwas vollauf Undurchdringbares kennzeichnet, dann ist dies besonders auch für ihre essentiellen Bestimmungen anzusetzen. Die aristotelischen Festlegungen des Apeiron als Gemisch57 oder Zwischenform zwischen Feuer und Luft58, Luft und Wasser59, Wasser und Feuer60 bzw. neben den Elementen von Stofflichkeit61 sind dann wohl eher Verkennungen seiner Undurchdringbarkeit und Projektionen von Aristoteles eigenen Vorstellungen in Auffassungen des Anaximander und genau eben nicht die Wiedergabe anaximandrinischer Ansichten.62 Wenn überhaupt könnte man dessen abstrakte Essens vielleicht als ein steuerndes63 Prinzip und d.h. letztlich als das "Gesetz der Natur" wie auch als Machtaspekt verdinglichter, unpersönlicher Göttlichkeit64 identifizieren, die den physikalischen Gesetzen gewissermaßen Leben(skraft) eingibt. Woraus diese "Naturkraft" bestehen soll, bleibt vollkommen unbestimmt, jedoch eine konkrete Stofflichkeit dürfte sie nach der klaren Aussage des Theophrast65, wonach Anaximander selbst wohl gar nichts darüber gesagt habe, was dieses Apeiron sei, ob es die Luft oder Wasser oder Erde besage oder ob es eine andere Stofflichkeit enthalte, nicht besitzen. Würde zum Apeiron irgendeine Stofflichkeit gehören, hätte nämlich Anaximander dies offensichtlich ohne Probleme äußern können.66 Dessen einzige Bestimmungen seiner Wesenheit liegen daher meines Erachtens völlig in seiner Funktion, sich durch einen, durch ihre Gesetzmäßigkeit gesteuerten Evolutionsprozeß produktiv zu entfalten.
Als miteinander verschränkte Gesetzlichkeit und Produktivität entfachte nämlich das anfangslose67 und anscheinend als solches stofflose Apeiron den Angaben des Pseudo-Plutarch68 entsprechend einen mehrstufigen Materialisationsprozeß, und zwar sonderte es zunächst eine als Keimzelle wirkende Entität ab, eine in Analogie zu Geburtsvorgängen umschriebene Entstehung eines Gebildes, das Stoffqualitäten oder Stoffelemente erzeugen kann69 und tatsächlich die zwei primären Stoffqualitäten bzw.
Grundsubstanzen des Warmen und Kalten hervorbrachte, aus denen durch den nachfolgenden Konzentrationsprozeß die Erde sowie deren Atmosphäre und ein die Lufthülle des Erdzylinders umhüllenden Feuerball wachsen konnten. Durch den Gegensatz zwischen Feuersphäre und dem Urfeuchten der Erde kam es zur Verdunstung des Wassers und damit zur Entstehung von Winden und zum Austrocknen der Landmassen aus dem Urfeuchten70 wie auch zum Auseinanderplatzen des Feuerballs und daraus der Entstehung einzelner Feuerringe, aus denen sich einst die Sonne, der Mond und die Sterne bildeten71.72 Der gesetzmäßigen Generierung des Kosmos folgte eine zweite Phase biologischer Evolution, und zwar die Entstehung erster Lebewesen im Urmeer der Erde durch Sonnenbestrahlung und Erdwärme, der Übergang von Meerestieren auf das Land und damit die Entstehung der Landtiere und schließlich die Entwicklung der Gattung Mensch im Inneren irgendwelcher Fische, aus denen die schon zur Selbstversorgung herangereiften Menschen herausausstiegen und dann als geschlechtsreife Lebewesen aufs Festland übertraten73.74
Die unbestimmte Arché bleibt als solches von dieser Evolution des Kosmos und der Lebewesen unbeeinflußt, d.h. sie ist unveränderlich75 und als ihr anfangsloses Prinzip unvergänglich76; sie umfaßt danach den unermeßlichen Kosmos in Raum und Zeit und umhüllt genauso die Einzeldinge und Lebewesen77, deren Seinsgrund sie (weiter) ist. Als solches "Allumfassendes" ist aber das Apeiron ebenfalls der steuernde Grund der Gesetzes-Ordnung des Kosmos und der Einzeldinge der Welt - genau diese Ordnung des Bestehenden thematisiert das überlieferte Fragment des Anaximander. Was der Philosoph hier, wie sich Theophrast ausdrückte, in poetischen Worten sagte, ist, daß das ganze Geschehen des letztlich dem Apeiron entstammenden Weltganzen der Notwendigkeit und des Ausgleichs von Entstehen und Vergehen unterliegt und daß sämtliches Entstehen, Bestehen und Vergehen ein Zeitmaß haben muß und hat; deren Ordnung, d.h. der Prozeß selbst wie dieses Zeitmaß des Entstehens und Vergehens ist durch die Gesetzlichkeit des Apeiron bestimmt. Nach und neben der Geburt, dem Entstehen des Weltganzen wie der Einzeldinge ist also hier das Vergehen, der Tod, als zweiter der Hauptaspekte anaximandrinischer Vorstellungen zum Gegenstand seiner Reflexionen erhoben und dann zugleich auch als genuine Problematik okzidentaler Philosophie ausgewiesen. D.h. schon von ihren Anfängen an im 6. Jahrhundert v.u.Z., also spätestens seit Anaximander, gehören Sterben und Totsein mit zu den Fragestellungen, auf die die Philosophie in Europa bis in die Moderne hinein immer wieder Antworten suchte. Und zum mindesten zum Beginn ihrer Auseinandersetzung werden Sterben und Totsein durch Anaximander aufrichtig mit dem nüchternen Ernst des an dem Sach-Verhalt des Sterbens und Totseins interessierten Philosophen und ohne den Rückgriff auf die von der Religion und den Mythen angebotenen Jenseitshoffnungen aufgegriffen und als tatsächliche Vernichtung individuell Bestehenden aufgefaßt.78 Weder den traditionell mit Attributen von Göttlichkeit ausgestatteten Gestirnen noch Menschen wird eine Sonderrolle ihres Entstehen eingeräumt, sie alle sind nur differente Glieder eines von der einen Arché gesteuerten und initiierten Evolutionsprozesses, weshalb sie mit den anderen Dinge der Welt natürlich auch derselben Gesetzmäßigkeit ihres Vergehens unterliegen. In materieller Hinsicht sind Gestirne wie auch die Menschen und jedes der Dinge dieser Welt eben bloß Erscheinungsformen der vom Zeugungskeim hervorgebrachten derselben gegensätzlichen Stoffqualitäten oder Grundsubstanzen des Warmes und des Kalten.
Diese fundamentale Gegensätzlichkeit der das Weltganze wie die Einzeldinge grund-legenden Stoffqualitäten bzw. nachfolgend der Grundsubstanzen identifizierte Anaximander nun als Ur-Sache von Vergehen und Tod, d.h. also, daß über das Anerkenntnis individueller Vernichtung sein Interesse auf das Warum des Vergehens (nach Beantwortung des Warum ihres Entstehens) geht, warum alle Dinge, welche einmal geschaffen wurden, überhaupt wieder vernichtet werden müssen. Mit dieser Fragestellung hat er das Problem dessen, was man später "Theodizee" nennen wird, angerissen79, obwohl sein Gerichtshof von dem Wirken der Götter gereinigt war und lediglich Ur-Sachen von ihm zum Verfahren zugelassen waren - genau diese quasi-juridische Perspektive ist es, die Anaximander auch für ihre Lösung, für die Verurteilung der Dinge zum Vernichtetwerden, zur Anwendung bringt.
Nach seiner Aufassung80 versuchen die aus dem erwähnten Zeugungskeim herausgetretenen Stoffqualitäten oder Grundsubstanzen von Natur aus auf Kosten der jeweils anderen die Verbreitung ihrer Stofflichkeit auszudehen und ihr zeitliches Bestehen über jene Spanne hinaus, die ihnen die rechte Gesetzes-Ordnung des Apeiron zubilligte, zu verlängern. Dieser Tendenz zur Pleonexie ihres Bestehens in Raum und Zeit wegen geraten beide Qualitäten in Gegensatz zueinander, d.h. metaphorisch ausgedrückt: in rechtliche Auseinandersetzungen, bei denen das Stoffelement, das gesetzeswidrig die Suprematie hatte und einen Übergriff auf die Sphäre seines Pendants beging, dazu verurteilt wird, seinem Geschädigtem Schadensersatz zu zahlen, indem es jetzt diesem im Ausgleich das Zuviel und Zulange zurückerstattet und hiermit der benachteiligten Stoffqualität oder Grundsubstanz zu bestehen verhilft - zu Lasten eigenen Bestehens. Weil diese Reparationen dem Ausmaß und der Zeitspanne, die dem Geschädigtem von Natur aus ohnedies zustehen sollen, hinzurechnet werden, entsteht wiederum mit Notwendigkeit eine Situation des Unrechts, insofern nun das einstige Opfer zulasten seines früheren Aggressors sein Bestehen über jene Ausdehnung und Zeitspanne, die ihm von der Natur zugestanden waren, hinaus ausbreiten und verlängern möchte; diese unzulässige Suprematie hat schließlich von Seiten des Geschädigtem aufs neue eine Forderung nach Wiedergutmachung auf Kosten des Bestehens des Angreifers zur Folge. Durch diese von ihrem Grunde antagonistische Dynamik der Natur gibt es eine Periodizität von Rechtsverletzung und Reparationszahlung, deren Ordnung die vorgängig vom Apeiron festgelegte Ausbreitung und Zeitspanne für die Seienden als Rechtsmaß wie Strafmaß definieren; der beständige Wechsel von Tag und Nacht, die Kontinuität der Abfolge der Jahreszeiten, von Hitze und Trockenheit im Sommer und Kälte und Regen im Winter und anderes mehr dürften für Anaximander als Vorbild und Beispiel, wie das vom Apeiron geordnete, zeitliche Nacheinander im Entstehen und Vergehen der Seienden zur Wirkung kommt, gedient haben. Insofern hat dann aber auch nach den Vorstellungen des Anaximander die Vernichtung des Individuums darin ihren Sinn und für den Sterblichen eine Art von Beruhigung, daß es sich in dem Kreislauf des Entstehens und Vergehens einbezogen weiß und erkennt, daß sein beständiges Übergreifen nach Weiterleben nicht nur keine Chance auf Realisierung hat, sondern ein Unrecht ist gegenüber dem Anderen und letztlich gegenüber dem Ganzen der Natur. Der eigene Tod ist demnach das Recht der anderen und deshalb ein Gesetz des Apeiron, das die Menschen bejahen sollten.
48 Angesichts der Unsicherheit der Quellenlage bei Thales und dem Vorhandensein jedenfalls eines originalen Zitats von Anaximander lassen Cherniss, H.F. (1970), S. 5, Fehling, D. (1985), S. 65 oder Ferber, R. (1986), S. 552 im Gefolge des Diogenes Laertius (1990), Bd. 1, S. 73 f. (II, 1 f.) die Geschichte okzidentaler Philosophie nicht durch Thales wie zumeist, sondern mit Anaximander beginnen.
49 Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 71 (fr. 15 / DK 12 A 9); Mansfeld und Primavesi übersetzen die originalen Termini Apeiron mit Unendliches und Arché mit Anfang.
50 vgl. besonders die Ausführungen von Kahn, C.H. (1960), S. 231 - 233 sowie Tumarkin, A. (1943), S. 56 f., Kraus, W. (1984), S. 64
51 vgl. u.a. Classen, C.J. (1962), S. 161, 163, 165
52 vgl. Classen, C.J. (1986), S. 58, 94 f., 98, Röd, W. (1988), S. 41
53 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 68/69 (fr. 10 / DK 12 A 15, B 3)
54 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 55
55 vgl. u.a. Classen, C.J. (1962), S. 162
56 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 72/73 (fr. 18 / DK 12 A 11, B 2), S. 70/71 (fr. 15 / DK 12 A 9, B 1)
57 vgl. Aristoteles (1984), S. 236/237 (Met. XII, 2, 1069 b 22), (1987 b), S. 18/19 (Phys. I, 4, 187 a 20 - 23); gegen diese Deutung des Aristoteles spricht unter anderem Theophrast aus den bei Hölscher, U. (1968), S. 18 zitierten Belege.
58 vgl. u.a. Aristoteles (1982), S. 42/43 (Met. I, 7, 988 a 28 - 32), (1987), S. 18/19 (Phys. I, 4, 187 a 12 - 16)
59 vgl. u.a. Aristoteles (1982), S. 48/49 (Met. I, 8, 989 a 12 - 15), (1987), S. 114/115 f. (Phys. III, 4, 203 a 16 - 18)
60 vgl. Aristoteles (1987), S. 30/31 f. (Phys. I, 6, 189 b 1 - 3)
61 vgl. Aristoteles (1987), S. 124/125 f. (Phys. III, 5, 204, 23 f. u. 205 a 4 f.); dieser Interpretation des Aristoteles widerspricht Pseudo-Plutarch´s Nachricht in: Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 72/73 (fr. 17 / DK 12 A 10), daß in der Kosmogonie des Anaximander das Apeiron einen Keim absondert, der bestimmte Stofflichkeiten erst erzeugen kann.
62 vgl. dazu u.a. Classen, C.J. (1962), S. 164, (1970), S. 41 - 43, Seligman, P. (1962), S. 35 - 49, Zeller, E. (1963 a), S. 275 - 291, Hölscher, U. (1968), S. 16 - 18, 34 - 37, Kraus, W. (1984), S. 72 - 74
65 vgl. das Zitat des Theophrast in: Hölscher, U. (1968), S. 37
66 vgl. Klowski, J. (1966), S. 8: "Wenn Anaximander seine ´Urmaterie´ weder als Wasser, Luft, Feuer und dergl. bestimmt hat, noch ihm daran lag, die stoffliche Unbestimmtheit derselben zu betonen, so liegt der Schluß nahe, daß der Begriff der Urmaterie erst von Späteren in Anaximanders Lehre hineinprojeziert worden ist." vgl. auch die Aussagen von Kraus, W. (1984), S. 63, 72, u. 74: "Für Anaximander aber war das Unendliche keine Materie, von der jeder Teil mit dem Ganzen gleichartig ist, kein Stoff, aus dem die Welt besteht, sondern der ewige Urquell alles Seins, der in unerschöpflicher Fruchtbarkeit Welten um Welten erzeugt." oder Buchheim, T. (1994), S. 67 u. 58: "Von daher erscheint es auch keineswegs als wahr, was sowohl Aristoteles als auch ... fast die gesamte Überlieferung zu Anaximander nahelegen möchte: daß nämlich das apeiron des Anaximander eine Art unbestimmter Stoff gewesen sei, aus dem alles andere und bestimmt Begrenzte entstanden sei."
68 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 72/73 (fr. 17 / DK 12 A 10)
69 nach Classen, C.J. (1962), S. 167 f., (1970), S. 48 oder Guthrie, W.K.C. (1962), S. 90, Krafft, F. (1971), S. 98 anaximandrinisch
70 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 68/69 f. (fr. 12 u. 14 / DK 12 A 27)
71 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 72/73 f. (fr. 17 u. 20 / DK 12 A 10 u. 11)
72 zur Kosmogonie und Kosmologie des Anaximander vgl. u.a. Kerschensteiner, J. (1962), S. 29 - 59, Guthrie, W.K.C. (1962), S. 89 - 101, Kahn, C.H. (1960), S. 75 - 109, Classen, C.J. (1970), S. 47 - 54, Krafft, F. (1971), S. 98 - 118, (1985), S. 23 - 38, Rescher, N. (1982), S. 7 - 26, Schmitz, H. (1988), S. 37 - 51, Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 145 - 153, Rapp, C. (2007), S. 44 - 46
73 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 78/79 (fr. 26 - 29 / DK 12 A 30 u. 11) u. Capelle, W. (1968), S. 87 f. (fr. 39 u. 41 / DK 12 A 10 u. 30)
74 zur Zoogonie und zur Anthropogonie des Anaximander vgl. u.a. Loenen, J.H. (1954), Guthrie, W.K.C. (1962), S. 101 - 104, Kahn, C.H. (1960), S. 109 - 113, Classen, C.J. (1970), S. 54 - 56, Quintela, M.V.G. (1987), Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 153 - 156, Rapp, C. (2007), S. 47
75 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 72/73 (fr. 18 / DK 12 A 11, B 2)
79 vgl. Jaeger, W. (1964), S. 48: "Anaximanders Erklärung der Natur ist etwas anderes und ist mehr als bloße Erklärung der Natur im Sinne moderner ´Wissenschaft´; sie ist die erste philosophische Theodizee."; vgl. auch Kraus, W. (1984), S. 71
80 vgl. dazu auch die Interpretationen des Fragments u.a. von Jaeger, W. (1964), S. 46 - 48, Classen, C.J. (1970), S. 56 - 60, Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 129 - 133, Rapp, C. (2007), S. 41 - 44
1.1.1.2. Xenophanes
Wie schon Anaximander und Heraklit soll auch Xenophanes (ca. 570 - ca. 475 v.u.Z.) aus einer der Küstenstädte Kleinasiens, und zwar aus Kolophon, kommen, das er als junger Mann im Alter von ca. 25 Jahren allerdings der persischen Besetzung im Jahre 545 v.u.Z. durch Harpagos, dem Statthalter des Perserkönigs Kyros, wegen verlassen mußte.81 Nach seiner Emigration führte er seinen Angaben gemäß ein durch Sorgen geprägtes, unruhiges Wanderleben in Großgriechenland82, wobei er allem Anschein nach auch Sizilien bereiste, ohne aber dort eine ständige Heimstatt finden zu können. Ob er jemals in Elea auf Sizilien war, wie das Platon und Aristoteles darstellen, ist unklar, daß auf ihn jedoch die eleatische Schule der Philosophie zurückgeht, ist mit ziemlicher Sicherheit eine Legendenbildung späterer Doxographen83. Denn trotz einer Akzentverschiebung seiner Philosophie gegenüber der ionischen Denktradition blieb Xenophanes mit den Aufklärern seiner Heimatregion innerlich verbunden. Diese auffällige Verlagerung des Schwerpunktes seiner Vorstellungen betraf in erster Linie den Bereich der Religion und Theologie, auf dem der als Rhapsode84 auftretende Philosoph unerbittlich den überkommenen Götterglauben mit Kritik und Spott überzog, doch zugleich eine moderne Theologie vertrat, die für spätere Philosophen und Theologen zum Vorbild geriet.
Wie die Milesier, aber auch Heraklit85 suchte Xenophanes erfahrbare Ursache an Stelle göttlicher Urheber zur Erklärung natürlicher Phänomene festzumachen.86 Beispielsweise soll er nach Aussage des Aetius die Entstehung von Blitzen auf Bewegungen von Wolken wie die Existenz und das Auftreten von Kometen, Meteoren und dergleichen auf Verdichtungen und Bewegungen zu Feuer gewordener Wolken zurückgeführt haben87 und hat damit transzendente Urspünge dieser von vielen Menschen traditionell als göttliches Wirken mißverstandener Erscheinungen offensichtlich ausgeschlossen. Auch die vom Volksglauben herkömmlich als götterhafte Gestalten aufgefaßten himmlischen Gestirne, wie Sonne, Mond und Sterne, sind nach Auffassung des Xenophanes vollkommen natürliche Phänomene, nämlich lediglich feurige Wolken.88 Bemerkenswert ist jedoch, daß Xenophanes diese Zurückweisung mythischer Erklärungen ohne Umschweife direkt angeht: "Was sie Iris nennen, auch das ist eine Wolke, und zwar eine, die purpurn, hellrot und gelbgrün aussieht."89 D.h. nicht Zeus´ "goldbeflügelte" Botin90 hängt, wie sonst Zeus meist selber91, einen Regenbogen an Wolken und spannt diesen vom Himmel her bis zur Erde, sondern eine ganz normale Wolke ist es, die in den Augen des Xenophanes einen Regenbogen erzeugt.92 Ähnliches hat er, wie Aetius das berichtet, ebenfalls vom Elmsfeuer (elektrische Gasentladungen u.a. an Schiffsmasten) behauptet, das nach dem damaligen Volksglauben von den Dioskuren, den "Zeussöhnen", erregt wurde, seiner Ansicht nach jedoch bloß Bewegungen von Wolken widerspiegelt.93
Hintergrund von Xenophanes´ Schritt zur Wissenschaft war seine gegen die Dicherfürsten Homer und Hesiod gerichtete scharfe und oftmals spöttische Mythologiekritik.94 Denn Homer und Hesiod hätten den kleinen wie großen Göttern Eigenschaften und Handlungen beigelegt, die bei den irdischen Menschen als völlig unmoralisch gelten, wie Diebstahl, Ehebruch oder Lüge.95 Jedoch wendet sich dessen Hauptvorwurf an Homer und Hesiod nicht gegen diese Amoralität ihrer Göttervorstellungen, sondern gegen deren plumpen Anthropomorphismus, daß sich also die Erzieher des Volkes96 ihre Götter nach Vorbild der Menschen ersonnen und ihnen die gewohnte Gestalt, Kleidung und Sprache wie die der Menschen selbst angehängt hätten.97 Insofern seien diese Göttergestalten lediglich Objektivationen des Bildes, die sich die Menschen aller Völker, bzw. wenn möglich, auch die Tiere von sich selber machen98, bzw. anders gesagt, bloß die Projektionen menschlicher Verhältnisse, inbegriffen ihrer politischen Herrschaftsverhältnisse, ins Göttliche99. Angesichts dieser harten Zurückweisung mythologischer Göttervorstellungen ist es kaum überraschend, wenn in den Testimonien von Xenophanes erzählt wird, er habe jedwede Mantik abgelehnt.100
Angesichts seiner Kritik an den in Griechenland verbreiteten Göttermythen und der Heranziehung ursächlicher Zusammenhänge zur Erklärung natürlicher Phänomene konnte es sicherlich naheliegen, in seinen Gedanken naturphilosophischen Inhalts enge Verknüpfungen mit den Arché-Konzepten der Milesier festzumachen, wie das verschiedene Doxographen nun auch sehr klar zum Ausdruck brachten.101 Wie bei Heraklit ist das aber nur zum Teil angängig, insofern Xenophanes den Kosmos als ewig bezeichnet hat, unentstanden und unzerstörbar102, und demzufolge auch ihm Ansichten wie die der Milesier von der Arché als dem Ursprung der Dinge fremd waren. Gleichwohl sah er in dem All einen Prozeß des Entstehens und Vergehens von Einzeldingen am Werke, dessen Prinzip die Erde und das Wasser sind, die nach Auffassung des Xenophanes die Grundstoffe aller Naturdinge darstellen: "Erde und Wasser ist alles, was entsteht und wächst."103 "Alles" dürfte in diesem Fragment alle Naturdinge beinhalten, und demzufolge besteht innerhalb der natürlichen Welt jedes durch Entstehen und Wachsen charakterisierte Naturding oder Lebewesen aus einem der Grundstoffe, d.h. aus Erde oder Wasser allein oder, wie etwa unsere Erdoberfläche104, aus Mischungen der Grundstoffe von Erde und Wasser.105 Bemerkenswert ist, daß Xenophanes diese Vorstellung der Mischung und Entmischung von Erde und Wasser durch Fossilfunde von Meerestieren und von Muscheln im Landesinneren versuchte zu begründen.106 Ohne irgendeine Einschränkung trifft nach seiner Ansicht diese Konzeption auch auf alle Menschen zu: "Denn wir alle sind aus Erde und Wasser geboren."107 In diesen Kontext paßt sehr gut dann auch Macrobius´ Mitteilung, daß nach der Auffassung des Xenophanes die Seele des Menschen aus Erde und Wasser bestehe.108 Entscheidend ist nun die Mitteilung des Diogenes Laertius, daß nach der Auffassung des "Xenophanes ... alles Gewordene vergänglich ist"109, so daß menschliche Lebewesen, die geboren werden, genauso dem Vergehen unterliegen wie die natürlichen Dinge insgesamt. "Denn aus Erde ist dieses alles und alles endet als Erde."110
Dieses letzte Fragment ist jedoch nicht direkt als Bestätigung der Behauptung von der Vergänglichkeit alles Gewordenen anwendbar. Denn mit dem "dieses alles" ist nicht gesagt, was der Bezugspunkt der Aussage konkret ist, ob der gesamte Kosmos oder alle Lebewesen oder bloß Pflanzen, die aus der Erde wachsen. Zudem könnte dieses Fragment auf Grund seiner Beschränkung auf die Erde als Konstituens durchaus in gewissem Widerspruch zu Xenophanes´ Auffassung zweier Grundstoffe der Naturdinge, d.h. von Erde und Wasser stehen. Als eine Lösung dieser Probleme des Textes schlug Deichgräber vor, die Erde als Arché des Kosmos als Ganzem und die Erde und das Wasser als Grundstoffe der Naturdinge aufzufassen111, was voraussetzt, Wasser als Produkt der Erde anzunehmen112. Auf der Basis des für die Erde als Arché des Alls herangezogenen Fragments und einer von Hippolytos bezeugten Ansicht des Xenophanes, daß auf dem Erdglobus periodisch sich ereignende Überschwemmungen und Austrocknungen stattfinden113, behauptete schließlich Deichgräber, daß Xenophanes anscheinend zwei kreisförmige Bewegungen unterschieden hat, einerseits die periodische Wiederkehr der Überflutungen und des Ausdörrens des Erdglobus und andererseits die Entwicklung des Wassers aus der Erde und wieder zurück zur Erde.114 Sollte diese Interpretation zutreffen, ist zu fragen, ob das zyklische Geschehen nicht einen Kreislauf von Wiedergeburten für den Menschen einschließt, eine mit dem oben angeführten Testimonium zur Vergänglichkeit alles Geborenen augenscheinlich widersprechende Schlußfolgerung, die in der Vorstellung einer Seelenwanderung bei Xenophanes´s Zeitgenossen Pythagoras und den Anhängern dessen Ordens allerdings merklichen Widerhall fand. Tätsachlich ist Xenophanes selbst deren erster Zeuge - und Kritiker: "Sie [die Pythagoreer] sagen, daß er [Pythagoras] einmal vorbeikam, als ein Hündchen geschlagen wurde, dieses bemitleidete und sprach: »Hören sie bitte auf zu schlagen! Denn es ist die Seele eines Freundes [d.h. eines Mitgliedes des pythagoreischen Ordens]; als ich ihre Stimme hörte, habe ich sie sofort erkannt.«"115 Der ganze Tonfall dieser Aussage wie auch die Zurücknahme des Xenophanes als ein sich nur auf Gewährsleute beziehender, gutherziger Berichterstatter zeigen meines Erachtens klar auf, daß sein Referat nichts als bloßer Spott ist, d.h. eine auf die Pythagoreer und ihr Eintreten für eine als Transmigration bestimmte Unsterblichkeit der Seele gemünzte, beißende Satire.116 Insofern bestätigt dieser deutliche Verweis auf die Pythagoreer nur die Mitteilung des Diogenes Laertius, daß nach der Ansicht des Xenophanes alles Gewordene der Vergänglichkeit unterliegt.
Allerdings scheint mir ohnehin Deichgräbers Interpretation recht fragwürdig zu sein, da einerseits seine Behauptung, daß die Erde als solche das Wasser hervorbringe, keine überzeugende Begründung aus den Fragmenten des Xenophanes hat, andererseits die Fragmente, die Erde und Wasser als Grundstoffe behaupten, dem zitierten Fragment, daß die Beziehung der Dinge nur zur Erde vorträgt, schlußendlich nicht widersprechen brauchen. Zumindest könnte man dieses Fragment auch auf eine Weise verstehen, die besagt, daß jegliches Naturding, das sich jedenfalls auch aus Erde konstituiert, wie etwa die menschlichen Seelen (und Körper), am Ende wieder Erde wird - eine Interpretation, die tatsächlich nicht ausschließt, daß Naturdingen neben Erde auch Wasser als Bestandteile ihres Wesens eignen müssen. Daß hiermit Xenophanes durchaus den völligen Untergang, die Annihilation des Individuums im Totsein, in Kauf genommen hat, bestätigt die folgende Überlegung, die an den Ausgangspunkt seiner Philosophie, die Mythenkritik, anknüpft. Wie beschrieben, kritisierte Xenophanes die Mythen eines Homer oder Hesiod vor allem wegen des Anthropomorphismus ihrer Göttervorstellungen, wobei seine Kritik, wie uns Aristoteles mitteilt, in gleicher Weise wie etwa das Aussehen und das Handeln der Götter deren Existenzform betrifft: "Xenophanes sagte, jene, welche behaupten, daß die Götter geboren wurden, sündigen genausoviel wie jene, die sagen, daß sie sterben."117 D.h. die Vorstellung, daß Götter wie Menschen einmal geboren werden und sterben müssen, dürfte Xenophanes´s Auffassung nach nur noch als eine Blasphemie gelten. Insofern zielt seine Mythenkritik gar nicht auf Beseitigung eines Götterglaubens, wie man anfangs meinen könnte, sondern auf die Propagierung eines von jeder Relativität menschlicher Bezugnahme befreiten, fast absoluten Gottesbegriffs118: "Ein einziger Gott ist unter Göttern und Menschen der Größte, weder dem Körper noch der Einsicht nach den sterblichen Menschen gleich."119 "Als ganzer sieht er, als ganzer versteht er als ganzer hört er"120 und "ohne Anstrengung des Geistes lenkt er alles mit seinem Bewußtsein."121 "Immer verbleibt er am selben Ort, ohne irgendwelche Bewegung. denn es geziemt sich für ihn nicht, bald hierhin, bald dorthin zu gehen, um seine Ziele zu erreichen."122 Gegegenüber dem Anaximander und Heraklit, die dem Apeiron bzw. dem Feuer-Logos lediglich göttliche Qualitäten zuschrieben, sie aber gleichwohl bloß als ursächliche Entitäten verstanden, denen keine personalen Eigenschaften zukamen, stellt Xenophanes´ Monotheismus natürlich eine gewaltige Rückbewegung der Philosophie dar, da er die Lenkung des Ganzen der Welt durch seinen einen Gott offensichtlich wieder personalisiert. Bei anderer Gelegenheit hat Xenophanes, zum mindesten dem Bericht des Theophrast nach, gesagt, daß dieser eine Gott das Vollkommenste von allem sei.123 Für unseren Kontext ist entscheidend, daß Xenophanes seinen Gottesbegriff auf dem Wege der Negation menschlicher Attribute (des "Körpers" und des Geistes bzw. der "Einsicht") und mit Hilfe von Superlativen (der "Größte", der "Vollkommenste") erreicht, um zwischen Gott und Mensch jegliche Ähnlichkeit auszuschließen. Und diese harte Demarkationslinie sollte man geradeso auch zwischen dem ewigen Leben des Gottes, der Unentstandenheit und Unsterblichkeit des Vollkommensten124, und der Bestehensform des von Unvollkommenheit geprägten Menschen ziehen dürfen, und das besagt, daß man sowohl dessen Geborensein wie auch die "Sterblichkeit" und damit die Endgültigkeit seines Vergehens als zu den Charakteristika menschlicher Existenzweise hinzurechnen hat; das von den überkommenen Mythen unterstellte nachtodliche Weiterleben, das ja die Sterblichkeit letzten Endes unterläuft, widerspräche vollkommen Xenophanes´ Kampf gegen jeden Anthropomorphismus und für den Gott als dem Vollkommensten. Auf indirekte und verdeckte Weise hat Diogenes Laertius diesen Zusammenhang angesprochen und als die für ihn ausgewiesene Auffassung des Xenophanes wiedergegeben: "Das Wesen des Gottes ... gleiche in nichts dem Menschen ... und er [der Gott] sei ... ewig, ... alles Gewordene vergänglich."125 Bei gebotener Vorsicht gegenüber seinen sonstigen Aussagen über Xenophanes dürfte in dieser Hinsicht der Bericht des Diogenes Laertius wohl zuverlässig sein: Gottes Wesen beinhaltet Unsterblichkeit, Menschen kennzeichnet Vergänglichkeit, und insofern bestehen zwischen der Gottheit und dem Menschen keinerlei Ähnlichkeiten.126 Wie für Xenophanes die Aussagen der Mythen, daß die Götter sterblich seien, sündhafte Blasphemie sind, dürften für ihn fraglos alle Ansichten dahingehend, daß die sterblichen Menschen in Wirklichkeit unsterblich seien, einer furchtbaren Hybris der Menschen gegenüber Gott gleichkommen.
81 vgl. Diogenes Laertius (1990), Bd. 2, S. 167 f. (IX, 18 f.) in Verbindung mit Heitsch, E. (1983), S. 22/23 u. 30/31 (fr. 3 u. 8 / DK 21 / B 3 u. 8) und die Erläuterungen zur Datierung der Lebenszeit von Xenophanes durch Guthrie, W.K.C. (1962), S. 362 f., Steinmetz, P. (1966), S. 13 - 34, Heitsch, E. (1983), S. 121 f., Lesher, J.H. (1992), S. 70 f., Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 179 f.
82 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 232/233 (fr. 44 / DK 21 B 8)
83 vgl. dazu die Ausführungen von Lesher, J.H. (1992), S. 3 f., Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 180 f., jeweils mit Angabe der Testimonien.
84 vgl. Diogenes Laertius (1990), Bd. 2, S. 168 (IX, 18)
85 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 274/275 f. (fr. 86 / DK 22 A 1)
86 vgl. u.a. Steinmetz, P. (1966), S. 66 f.
87 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 222/223 (fr. 19 u. 20 / DK 21 A 45 u. 44)
88 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 218/219 f. (fr. 7 - 13 / DK 21 A 32, 40, 38, 41, 43)
89 Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 222/223 (fr. 21 / DK 21 B 32)
90 vgl. Homer (1975), S. 134 u. 177 (Il. 8, 398 u. 11, 185)
91 vgl. Homer (1975), S. 173 f. u. 301 (Il. 11, 27 f. u. 17, 547 f.)
92 zur Interpretation dieses Fragments vgl. Lesher, J.H. (1992), S. 139 - 144
93 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 222/223 f. (fr. 22 / DK 21 A 39)
94 zur Zurückweisung der Homerischen Göttergestalten durch Xenophanes vgl. auch die Kritik von Feyerabend, P.K. (1986)
95 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 226/227 (fr. 26 u. 27 / DK 21 B 11 u. 12)
96 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 226/227 (fr. 25 / DK 21 B 10)
97 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 226/227 (fr. 29 / DK 21 B 14)
98 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 226/227 (fr. 28 u. 30 / DK 21 B 16 u. 15)
99 vgl. Capelle, W. (1968), S. 124 (fr. 40 / DK 21 A 32) in Verbindung mit Aristoteles (1976 b), S. 48 f. (Pol. I, 2, 1252 b 23 - 26): "Aus demselben Grunde behaupten auch alle, daß die Götter durch einen König regiert werden, weil sie selbst teils jetzt noch, teils früher unter Königen standen. Wie nämlich die Menschen die Gestalten der Götter nach sich selbst abbilden, so auch deren Lebensformen."
100 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 230/231 (fr. 41) und Lesher, J.H. (1992), S. 221 (DK 21 A 52)
101 vgl. Lesher, J.H. (1992), S. 216 (DK 21 A 36)
102 vgl. Lesher, J.H. (1992), S. 213 - 216 (DK 21 A 32 - 37)
103 Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 (fr. 2 / DK 21 A 29, B 29)
104 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 f. (fr. 6 / DK 21 A 33)
105 zur Interpretation vgl. Lesher, J.H. (1992), S. 132 - 134
106 vgl. Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 f. (fr. 6 / DK 21 A 33); zur Interpretation vgl. u.a. Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. (1994), S. 193 - 195
107 Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 (fr. 3 / DK 21 B 33)
110 Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 (fr. 4 / DK 21 B 27), in Anlehnung an: Heitsch, E. (1983), S. 61 geringfügig modifiziert.
111 vgl. Deichgräber, K. (1938), S. 14 f.
112 vgl. Deichgräber, K. (1938), S. 16 auf Basis von: Mansfeld, J., Primavesi, O. (2021), S. 216/217 (fr. 5 / DK 21 B 37)
113