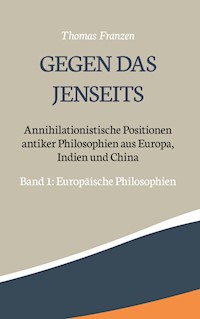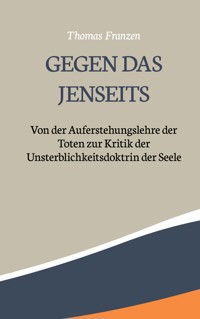
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gegen das Jenseits: Von der Auferstehungslehre der Toten zur Kritik der Unsterblichkeitsdoktrin der Seele
- Sprache: Deutsch
Die wichtigste Triebfeder für die Ausbreitung des Christentums war vermutlich der Glauben an die Auferstehung der Toten. Während diese Lehre jedoch ein von den frühen Christen akzeptierter Glaubensinhalt war, machte die Diskussion zum Problem der (Beweisbarkeit der) Unsterblichkeit der Seele eine, wenn wir dazu ihre Debatte im Hoch- und Spätmittelalter miteinbeziehen, recht bemerkenswerte Wandlung durch. Diese Entwicklung ist Gegenstand dieses Bandes. Der erste Teil geht dem Weg nach, wie vom Auferstehungsglauben aus die Unsterblichkeitsdoktrin zur Durchsetzung machtpolitischer Interessen der Kirchenhierachie immer bedeutender wurde. Im zweiten Teil sehen wir, wie trotz Verbote aristotelischer Philosophie, deren Realisierung von der Folterung bis zur Ermordung auf dem Scheiterhaufen reichen konnte, Kritiker der Unsterblichkeitslehre der Seele sehr offen ihre Einwände darzulegen versuchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Weg von der Auferstehunglehre der Toten zur Machtpolitik der Kirche
2.1 Von der Auferstehung der Toten als Glaubenslehre zur Unsterblichkeit der Seele als Kirchendoktrin
2.2 Die Doktrin der Unsterblichkeit der Seele als Ausdruck machtpolitischer Interessen der Kircheninstitution
Der Kampf um die Deutung von Aristoteles im Mittelalter und Renaissance
3.1 Pantheismus: Amalrich von Bena und David von Dinant
3.2 Lateinischer Averroismus: Averroes, Siger von Brabant und die Sigerianer
3.3 Theologischer Voluntarismus: Von Duns Scotus bis Wilhelm von Ockham
3.4 Alexandrismus: Johannes Buridan und die Buridaner
3.5 Italienischer Spät-Aristotelismus: Pomponazzi und Anhänger
Ausblick
Literaturverzeichnis
Für Angela
1. Einleitung
Unter der Regentschaft der sog. Adoptivkaiser im 2. Jahrhundert u.Z. errang das antike Römische Reich seine größte Ausdehnung, eine Entfaltung imperialer Herrschaft, die trotz allem schon der Philosoph unter ihnen, Marc Aurel, nur noch mit Mühen gegen die mit aller Macht von Osten einfallenden germanischen Stämme der Markomannen und Quaden aus der Donauregion wie gegen das Partherreich, vor allem aber auch wegen des Einbrechens schwerer Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Erdbeben, Pestepidemien) halten konnte. Denn bereits sein eigener Sohn und Nachfolger auf dem Kaiserthron, Commodus (180 - 192 u.Z.), bahnte mit seinem Größenwahn den Zerfall des Imperium Romanum an, der im Westen gegen Ende des 5. Jahrhundert im Zuge der Völkerwanderungen schließlich mit der politischen Auflösung des Weströmischen Reiches endete. Während dieser Zeit der Blüte und des Untergangs trat eine neue Religion, das Christentum, in Erscheinung, das, ausgehend von Palästina, einer Unruheprovinz am Rande des Reiches, binnen verhältnismäßig kurzer Zeit vom Status einer Sekte häretischer Juden der Zeitenwende zu einer im Jahre 313 u.Z. vom Toleranzedikt des Kaisers Konstantin des Großen1 protegierten und vom oströmischen Kaiser Theodosius I. im Jahre 380 bzw. 391/2 u.Z.2 zur Staatskirche ausgerufenen, allein berechtigten Religion einer Weltmacht avancierte. Denn trotz aller Verleumdungen und trotz, aber vielleicht auch wegen der Verfolgungen der Christen von Seiten einzelner Kaiser war die Ausbreitung des Christentums offenkundig nicht aufzuhalten. Doch was war der Motor des Erfolges der Christen, was waren die Gründe, die die Menschen angespornt haben, dieser neuen religiösen Bewegung nachzufolgen? Entgegen späterer Epochen konnten dafür jedenfalls keine äußeren Gründe bestimmend gewesen sein, denn eine (latente) gewaltsame Bekehrung der Bevölkerung zum Christentum lag den Herrschern des Römischen Reiches bis zum Kaiser Theodosius I. gänzlich fern, wie ihre häufigen Christenverfolgungen zeigen, und die frühe Christenheit verfügte (noch) nicht über genügend Macht, ihre Missionierung und Ausbreitung zwangsweise aufzuziehen. Verantwortlich für den Übertritt der Menschen zum Christentum waren daher allem Anschein nach eine Reihe innerer Aspekte ihrer Lehre3, die sie auf die Verkündung eines Juden namens Jesus von Nazareth zurückführten. Ein bedeutender und vielleicht der bestimmende Gesichtspunkt war (und ist) die Jenseitsgläubigkeit des Christentums, die es in der Erwartung körperlicher Auferstehung der Verstorbenen konkretisiert hat - und eben dieser sich auf die vermeintliche Auferweckung ihres Sektengründers stützende Glauben, daß die Toten auferstehen, war dann wohl auch eine der wichtigsten Triebfedern für die Ausbreitung des Christentums4. Genau diesen Zusammenhang zeigen die aus dieser Zeit stammenden Epigramme auf den Gräbern auf, denn die sich ihr Fortleben oder ihre Auferstehung erhoffenden Grabinschriften gläubiger Christen5 kontrastieren auffällig mit dem nüchteren, aufgeklärten Realismus, den, wie ich oben dargelegt habe, die aus der Römischen Kaiserzeit stammenden Epitaphe heidnischer Verstorbenen bemerkenswert oft kennzeichnete. Tatsächlich dürfte in dieser Lehre von der Auferstehung die oder zumindest eine der Kernaussagen christlichen Glaubens bestehen, jedenfalls erklärte Paulus, ein wahrscheinlich auf Grund halluzinativer Auditionen und Visionen zum Christentum konvertierter Heidenapostel, in einem im Jahre 52 u.Z. für die Gemeinde in Korinth verfaßten Brief, daß in dem Glauben, daß die Toten auferstehen, die christliche Verkündigung überhaupt erst ihre originäre Sinnhaftigkeit erfahre:
"Wenn nun von Christus gepredigt wird, daß er von den Toten auferweckt worden ist, wie können da einige unter euch behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist nichtig, was wir verkündigen, nichtig auch, was ihr glaubt. Als falsche Zeugen Gottes werden wir entlarvt, weil wir zulasten Gottes bezeugt haben, er habe Christus auferweckt, den er doch gar nicht auferweckt hat - wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann wären auch die in Christus Entschlafenen verloren. Hätten wir in diesem Leben die Hoffnung auf Christus gehabt und sonst nichts, so wären wir die bedauernswertesten von allen Menschen."6.
In dem an die Hebräer gerichteten Brief wiederholte Paulus bzw. genauer: der Verfasser des Schreibens, diese Position, daß zu den Fundamenten christlichen Glaubens die Erwartung der Auferstehung der Toten gehöre7. Auch spätere Kirchenlehrer, wie etwa der Apologet Justinus, der Märtyrer (um 100 - 165 u.Z.)8, und die Kirchenväter Tertullian von Karthago (um 160 - nach 220 u.Z.)9 oder Augustinus von Hippo (354 - 430 u.Z.)10 erklärten, daß die leibliche Auferstehung der Toten derjenige Glaubensaspekt sei, der die Christen von den Heiden und, in der Zurückweisung gnostischer Strömungen ins Christentum11, die Christen untereinander unterscheidet.12 Tatsächlich blieb dann auch diese Lehre von der Auferstehung der Toten bis in die Neuzeit hinein ein - bis auf wenige Ausnahmen - weder durch Theologen noch Laien hinterfragter, jedenfalls nicht von ihnen öffentlich angefochtener Glaubensinhalt des Christentums.13
Doch gerade in seiner Auseinandersetzung mit den Einwürfen gnostischer Religionen wie denen der Philosophie, vor allem des Platonismus, war damit die Frage postmortalen Leben für die Protagonisten der Christenheit keinesfalls umfassend beantwortet. Allerdings rankte der zuweilen mit großer Heftigkeit geführte Disput nicht um diese Lehre von der Auferstehung der Toten, sondern um das in antiker Tradition stehende Problem der Unsterblichkeit oder Vergänglichkeit der Seele bzw. in concreto: um die Beweisbarkeit der Natürlichkeit ihrer Immortalität. Während die Lehre von der Auferstehung der Toten jedoch ein, wie erklärt, bereits von den frühen Christen akzeptierter Glaubensinhalt war, machte die Diskussion zum Problem der (Beweisbarkeit der) Unsterblichkeit der Seele eine, wenn wir dazu ihre Debatte im Hoch- und Spätmittelalter miteinbeziehen, recht bemerkenswerte Wandlung durch.
1 vgl. die Übersetzung der "Mailänder Vereinbarung" von Konstantin aus dem Jahre 313 u.Z. bei Keil, V. (1989), S. 58/59 - 66/67, der das Toleranzedikt des Galerius von 311 u.Z. (ebd. S. 40/41 f.) allerdings vorausging. Zur Ergänzung vgl. auch das Toleranzedikt von Konstantin gegenüber dem (alt-römischen) Heidentum aus dem Jahre 324 u.Z. (ebd., S. 174/175 - 182/183)
2 vgl. die Übersetzung von Theodosius I. Edikt "Cunctos populos" (Februar 380 u.Z.) bei Ritter, A.M. (1994), S. 170 und das Verbot öffentlicher Kultbetätigungen im Sinne des Heidentums aus dem Jahre 391 u.Z. bei: ebd., S. 188 f.
3 vgl. dazu die Ausführungen von Harnack, A.v. (1924), S. 111 - 129
4 so auch u.a. Harnack, A.v. (1924), S. 111 f., 120, Greshake, G. (1986), S. 280, Winkelmann, F. (1996), S. 75 - 77. Genau diesen Grund führt Arnobius of Sicca (1949), S. 145 f. (Adv. nat. 2, 33) hinsichtlich seines persönlichen Übertritts zum Christentum an.
5 vgl. die bei Geist, H. (1976), S. 173 - 182 wiedergegebenen Grabinschriften Nr. 463 - 493
6 1 Kor. 15, 12 - 19
7 Hebr. 6, 1 f.
8 vgl. Justinus (1917), S. 133 (Dial. 80, 4): "Wenn ihr zusammenkommen solltet mit solchen, welche sich Christen nennen und ... behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten, sondern ihre Seelen würden schon beim Tode in den Himmel aufgenommen werden, dann haltet sie nicht für Christen ... ."
9 vgl. Tertullian (1960), S. 4/5 (Res. 1): "The resurrection of the dead is Christian men´s confidence. By believing it we are what we claim tobe." und Tertullian in: Stücklin, C. (1974), S. 12/13 f. (De virg. vel. 1, 3)
10 vgl. die bei Daley, B. (1986) zitierten Stellen aus den Sermones (214, 12; 241, 1; 361, 2) des Augustinus.
11 zur Eschatologie gnostischer Christen vgl. Rudolph, K. (1990), S. 207 - 213
12 vgl. auch den Verfasser des Barnabasbriefes in: Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 26/27 (Barn. 1, 6) und die Glaubensbekenntnisse des Frühchristentums in: Denzinger, H. (1999), S. 21 - 52 (DS 2 - 76)
13 zur Eschatologie christlicher Patristik vgl. besonders die Monographien von Fischer, J.A. (1954) und Pelikan, J. (1961), die Ingersoll Lecture für 1956 von Wolfson, H.A. (1965) und den Beitrag zum Handbuch der Dogmengeschichte von Daley, B. (1986), bes. S. 91 - 248. Als wertvolle Hilfsmittel und Einführungen zur sog. Patrologie vgl. Kraft, H. (1991), Altaner, B., Stuiber, A. (1993), Drobner, H.R. (1994), Gombocz, W.L. (1997), S. 230 - 331
2. Der Weg von der Auferstehunglehre der Toten zur Machtpolitik der Kirche
2.1 Von der Auferstehung der Toten als Glaubenslehre zur Unsterblichkeit der Seele als Kirchendoktrin
Am Anfang christlicher Philosophie standen Aussagen, die die Beweisbarkeit der Natürlichkeit ihrer Unsterblichkeit und/oder das Faktum der Immortalität der Seele ausdrücklich zurückwiesen14: Unter Aufnahme der von Platon herkommenden Ansicht, daß nur das Unentstandene unzerstörbar und unvergänglich sei, christlichem Glauben gemäß jedoch unsere ganze Welt durch Gott erschaffen sei, behauptete Justinus, der Märtyrer (um 100 - 165 u.Z.)15, man dürfe der Seele des Menschen keineswegs natürliche Unsterblichkeit zuschreiben16.17 Denn im Gegensatz zur Schöpfer-Gottheit sei die Seele nicht Leben, sondern nehme an einem solchem Leben nur Anteil, d.h. von Natur aus bleibe die Seele des Menschen sterblich, und lediglich die göttliche Gnade könne, wenn sie das will, seine Seele auch nach Verlassen ihres Körpers am Leben belassen.18 Genau dies unterstellt zwar Justinus für den Zeitraum zwischen Tod und Auferstehung bei den Frommen wie den Sündern zunächst, meint aber, daß nach einer gewissen Weile die Sünder endgültig absterben: leibliche Auferstehung ist nach ihm19 bloß den Christengläubigen vorgesehen20.21 Auch sein Schüler Tatian, der Syrer (vor 150 - nach 172 u.Z.)22, wies, indem er deren enge Verknüpfung mit dem Körper sowie, hieraus folgend, deren Zusammengesetztheit und Vielteiligkeit hervorhebt23, jegliche natürliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen zurück und behauptet, daß dessen Seele mit der Auflösung des Körpers zusammen abstirbt24. Erst bei der Auferstehung der Leiber der Verstorbenen25 am Ende des Weltenlaufs würden sowohl Gläubige wie auch die Sünder verschiedene, aber unsterbliche Daseinsweisen erfahren.26 Auch für Theophilus von Antiochien (um 180 u.Z.)27 ist der Mensch als Ganzheit von Körper und Seele, obwohl er für beides, d.h. zu seiner Unsterblichkeit wie zur Sterblichkeit fähig ist28, letztlich doch sterblich, als seine Unsterblichkeit, vom Gehorsam gegenüber Gott abhängig, nur ein gnädiges Belohungsgeschenk ist, während die Sterblichkeit, die er als Zerschlagung des Menschen (als Ganzes seiner Leib-Seele-Einheit) veranschaulicht29, bei widersetzlichem Verhalten offenbar kein weiteres Handeln des Christen-Gottes voraussetzt30 und somit dem natürlichen Lauf geschöpflicher Dinge entspricht. Denn ihr Gnadengeschenk seliger31 Unsterblichkeit empfingen die gläubigen Christen erst durch ihre Auferstehung32, die eine des Körpers und der Seele sei33, den Sündern drohe bei ihrer Auferstehung dagegen endlose Bestrafung34, ein Zustand, den er der Ewigkeit zum Trotz nicht Unsterblichkeit nennen möchte. Wie schon Theophilus35 wies auch Irenäus von Lyon (vor 177 - nach 200 u.Z.)36 die These von einer dem Menschen naturgemäß zukommenden Unsterblichkeit seiner Seele mit dem Argument zurück, da in diesem Falle der Mensch mit Gott verähnlicht würde37, seine erschaffene Seele aber, wie auch Justinus gesagt hatte, nicht selbst Leben sei, sondern nur Anteil hätte an jenem Leben, daß ihr Gott verleihe38, weswegen Lehren, gemäß denen einer Seele von Natur aus Unsterblichkeit zukomme, eine falsche Auffassung beinhalteten39. Gleichwohl würde aber diese auch nach Zerstörung des Körpers eines Menschen fortbestehen40, jedoch sei dieses nachtodliche Dasein seiner Seele, die sowohl ihr Empfindungsvermögen als auch die Erinnerungen an Dinge und Taten ihres Diesseitsleben sowie ihre ganze Individualität aufbewahrt und beibehält41, vollständig dem göttlichen Willen geschuldet42. Nach der Auferstehung des Körpers und der Seele aller Verstorbener43 würden jedoch Gläubige und Sünder, wie bereits zuvor während der Wartezeit in Sphären der Unterwelt44, ihren Verdiensten entsprechend verschiedene Jenseitsorte bewohnen45. Mit ähnlichen Argumenten wie Justinus und Tatian begründete Arnobius von Sicca (vor 284 - nach 304 u.Z.)46 schließlich seinen dezidierten Standpunkt, daß die Seele des Menschen von Natur aus sterblich sei: Geschaffenheit der Menschenseele47, obgleich nicht durch jenen einen höchsten Christengott, sondern durch niedere Gottheiten48, einerseits, ihre materielle Beschaffenheit und Zusammengesetztheit wie Verbundenheit mit dem Körper49, festgemacht an allgemeiner Vergeßlichkeit50 und dem Fehlen von Wiedererinnerungen früherer Leben im Besonderen51, an Schmerzempfindung und Leidensfähigkeit52 sowie an ihrer Veränderlichkeit, andererseits53 seien mit den vor allem platonischen Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Menschenseele unvereinbar54. Mit dem Apologeten Justinus, jedoch im klaren Gegensatz zu Tatian behauptet Arnobius, daß nach der Auferstehung der Verstorbenen, die er den Platonikern gegenüber offen bejaht55, durch göttliche Gnade56 nur die Christen-Gläubigen selige Unsterblichkeit empfingen57, während sämtliche Sünder, nachdem sie längere Zeit bestraft würden, völliger Vernichtung anheimfielen58. Berücksichtigt man ferner die Polemik des Hermias (2. Hälfte des 2. Jh. u.Z.), die die Divergenzen antiker Philosophie in Bezug auf das Wesen und die (Un-)Sterblichkeit der Seele des Menschen anprangerte, jedoch ohne eine eigene christliche Position aufzuzeigen59, die als lateinische Übersetzung von Cassiodor überlieferte Erklärung des Clemens von Alexandrien (um 140/150 - vor 215 u.Z.) zum 1. Petrusbrief, daß die Seele im Tod mit dem Körper hingegossen werde und deshalb von ihrer natürlichen Konstitution her vergänglich sei60, und schließlich die Philosophen aus Arabien zur Zeit des Origines (um 185 - 254 u.Z.), von denen der Kirchenhistoriker Eusebius von Cäsarea uns berichtet, sie verträten die Lehre, daß die Seelen der Menschen im Tod mit den Körpern verschwänden und sie erst mit der körperlichen Auferstehung zum Leben neu aufwachten61, dürfte feststehen, daß Ansichten, die die Nicht-Natürlichkeit der Unsterblichkeit der Seele beteuerten, mit zu den originären Positionen patristischer Philosophie gehörten, wobei einzelne Lehrer wie Tatian, Theophilus, Arnobius und die von Eusebius erwähnten Araber sogar generell jedes Weiterleben der vom Körper getrennten Seele vor der Auferstehung des Toten bestritten.
Natürlich gab es auch in der Spätantike christliche Philosophen, die versuchten, die Natürlichkeit der Unsterblichkeit der Seele argumentativ nachzuweisen, Tertullian62 war hier wohl der erste, der eine auch den Namen verdienende Argumentation für die Natürlichkeit der Immortalität menschlicher Seele gegeben hat, ihm folgten Kirchenlehrer wie Origines63, ferner Laktantius Firmianus (vor 290 - ca. 325 u.Z.), Gregor von Nyssa (335/40 - nach 394 u.Z.), Nemesius von Emesa (um 400 u.Z.) und schließlich der Kirchenvater Augustinus.64 Letztlich konnte sich dann auch dieser Zweig christlicher Anthropologie gegenüber den erwähnten Kritikern der Unsterblichkeit bzw. der Beweisbarkeit der Immortalität der Seele durchsetzen. Allerdings interessieren uns jetzt nicht die vorgebrachten Argumente der Kirchenväter, die ihnen gemäß die Unsterblichkeit der Seele belegen sollen, vielmehr möchte ich darauf eingehen, welchen Zusammenhang sie zwischen der Lehre von der Auferstehung der Toten und der These von der Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Seele annahmen derart, daß bei vielen späteren Diskussion die Auferstehung der Verstorbenen ein wenig dem Gesichtskreis philosophierender Theologen entschwand und (fast) nur noch die angebliche Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Menschenseele zur Debatte stand.
Im ersten Clemensbrief65, welchen man gemeinhin dem dritten Nachfolger des Apostels Petrus auf dem Bischofsstuhl von Rom (90/92 - 101 u.Z.) zuweist, wie in dem zweiten Clemensbrief66, einer Predigt aus dem 2. Viertel des 2. Jahrhunderts u.Z., ist anstelle des Ausdrucks der Auferstehung der Toten von der Auferstehung des "Fleisches"67 die Rede, obwohl sie mit beiden Konzepten letztlich denselben Glaubensinhalt zur Sprache bringen wollten. Denn in Tradition alttestamentalischer Termini macht die auf die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts u.Z. datierte Bußschrift vom "Hirt des Hermes" deutlich, daß der benutzte Begriff "Fleisch" ursprünglich nicht in einem sprachlichen Gegensatz zur Seele des Menschen stand, sondern einen Gegenpol für den dem Menschen innewohnenden, unsterblichen Geist Gottes gebildet hat, der das irdische "Fleisch", d.h. also den Menschen, belebt68. Insofern bedeutete "Fleisch" im Zusammenhang mit der Auferstehung im Grunde genommen den gesamten Menschen, perspektivisch als sterbliches, d.h. geschöpfliches Wesen.69 - Auch andere Begriffe aus dem Alten und Neuen Testament der Christen, die man auf den Menschen bezog, wie vor allem "Geist" oder "Seele", betrafen immer nur den einen gesamten Menschen hinsichtlich eines spezifischen Aspektes, nicht aber einen Teil seines Wesens. Ein anthropologischer Dualismus oder Trichotomismus war der Gedankenwelt der Christenheit daher gänzlich fremd.70 - Aus diesem Grunde konnten unter anderen Justinus71, Irenäus72, Tertullian73 oder (Pseudo?) Athanasius (295/300 - 373 u.Z.)74 das Bekenntnis von der Auferstehung der Toten auch als eine Glaubensregel von der Auferstehung des Fleisches formulieren. In den Auseinandersetzungen der Apologeten und Kirchenväter mit der Gnosis und der Philosophie der Antike, vor allem mit Vertretern des Platonismus, nahm der alte Terminus "Fleisch" aber eine neue Ausrichtung und Bedeutung auf, die ihn zum Gegenbegriff zur Menschenseele degradierte: zum (seelenlosen) Körper. Wenn nämlich Gnostiker wie Basilides, Valentius, Marcion, Apelles75 die Auferstehung des Fleisches leugneten76 und ein glühender Verfechter platonischer Philosophie, wie etwa der Christenkritiker Celsus, sie als Hoffnung lächerlicher Leute77 geißelte, war damit durchaus nicht der völligen Annihilation des Menschen im Tode das Wort geredet. In beiden Konzeptionen lag nämlich das Heil der Menschen im Freiwerden der Seele von seinem dem Verfall preisgegebenen Körper und in der Rückkehr der Seele zu ihrem im Himmel beheimateten Urgrund - und gingen hierin vom Faktum der Unsterblichkeit der Seele aus. Bei allen ihren Unterschieden78 postulierten die beiden den christlichen Auferstehungsglauben angreifenden Denksysteme der Gnosis und des Platonismus daher einen Dualismus im Menschen von Seele und Körper, den die Apologeten und Kirchenlehrer der Christenheit jedenfalls analytisch übernahmen. So dichotomisierten Justinus79, Athenagoras80, Clemens von Alexandrien81, Tertullian82, Origines83, Ambrosius (um 334/339 - 397 u.Z.)84, Augustinus85 und andere den Menschen zur Verbindung oder Synthese der beiden die Einheit seiner Person bildenden Substanzen der Seele und des Körpers und verstanden den Tod als Trennung der Seele vom Körper. Vor diesem Hintergrund war - implizit - die Auferstehung zum mindesten begrifflich bereits dualistisch angesetzt: als Auferstehen oder Unsterblichkeit der Seele und als Auferweckung des Körpers der Verstorbenen. Und was jetzt vor allem die Verteidiger des Christenglaubens von den Gnostikern und den Platonikern unterschied, war dann nur noch ihr unbeugsames Insistieren auf der Auferstehung des Fleisches, die sie mindestens analytisch auf die Auferweckung des Körpers der Verstorbenen reduzierten. Insofern konnte Tertullian sagen, daß ihn als einen Christen von den Gnostikern und Platonikern nicht deren Ansicht vom Heil der Seele scheiden würde, sondern deren stetiges Leugnen der Auferstehung des Fleisches, d.h. der Auferstehung des Körpers, die für ihn der Angelpunkt des Heiles der Menschen sei.86 Aus dieser Perspektive ihrer Diskussion mit den Kritikern des Christentums wurde aus einer Auferstehung der Fleisches als einer des Ganzmenschen eine Zusatz-Hoffnung auf die Auferstehung der Körper87, die allein der Zweck der Auferstehung sei88 und die Auferweckung oder Unsterblichkeit der Seele der Verstorbenen gleichsam additiv erweitert89: Auferstehung ist, wie Justinus das recht deutlich sagte, ein Glaube, der ein Mehr zum Inhalt hat, d.h. der mehr ist als die Aussicht auf ein Weiterleben der Seele90.
Im Gegensatz zum Thnetopsychitismus des Tatian, Theophilus, Arnobius und der von Eusebius erwähnten Araber griffen, wie gesagt, die meisten Apologeten und Kirchenväter die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele auf, die sie vom Prinzip her mit den Gnostikern und den Platonikern teilten. Aufgrund ihres Auferstehungsglaubens führten sie in den antiken Gedanken der Immortalität der Seele aber neue Aspekte ein, zunächst das Moment der Zeitlichkeit, die das Weiterleben der Seele eines Menschen von der Auferstehung seiner Körperlichkeit abspalteten und damit die zuvor nur analytische Dichotomie zwischen (Unsterblichkeit der) Seele und (Auferstehung des) Körpers ontologisierten. Abgesehen nämlich von den wenigen Patriarchen, Propheten und Märtyrern, die nach den Aussagen des Ignatius von Antiochien (1. Drittel des 2. Jahrhunderts u.Z.)91, des Polykarp von Smyrna (ca. 3. Viertel des 2. Jahrhunderts u.Z.)92 wie nach den Ansichten von Justinus93, Irenäus94 oder Tertullian95 und anderer auf Grund ihres Glaubensbeweises sofort ihre selige Auferstehung erfahren, ist für den normalen Sterblichen im Glauben der Christen die Auferstehung seines Körpers auf einen als Jüngsten Tag bezeichneten Zukunftstermin verschoben, weil das ursprünglich für eine alsbaldige Zeit angekündete Kommen des Reiches Gottes96 offenbar ausblieb. Dieses zeitliche Hinausschieben ist genau das, was neben der Leugnung körperlicher Auferstehung als solcher der Ansicht von Justinus97 oder Irenäus98 entsprechend Christen von Gnostikern unterscheidet. Doch prinzipiell ist natürlich ein verzögertes Auferstehen der Körper von Verstorbenen auch dann denkbar, wenn beim Akt der Auferweckung der Toten mit den Körpern ebenfalls ihre einstigen Seelen neu erschaffen werden, wenn, anders formuliert, die Seele mit dem Tod des Körpers untergeht. Nach der Ansicht christlicher Vertreter der Unsterblichkeit der Seele sprechen aber dagegen zwei wichtige Gesichtspunkte: Einerseits scheinen nämlich einzelne Stellen aus den Schriften, die die Christen als das Wort ihrer Gottheit unterstellen, auf ein postmortales Dasein der Seele hinzudeuten, wie etwa das jesuanische Gleichnis vom Prasser und Lazarus99, die Erzählung vom Hadesaufenthalt von Jesus100 und ein Vers aus dem Genesis-Buch des sog. Alten Testaments der Christen101. Andererseits wäre eine Vernichtung der Seele des Verstorbenen bis zur Auferstehung mit der Vorstellung göttlicher Gerechtigkeit unvereinbar. Damit tritt nun ein neuer Aspekt im Denken der Christen auf den Plan, der neben der Vorstellung körperlicher Auferstehung esssentielle Bedeutung für die Ausgestaltung ihres Jenseitsglauben trägt, nämlich deren Vergeltungslehre102. Denn der sog. Jüngste Tag, bei dem die Toten auferstehen, ist nach der maßgebenden Auffassung des Jesus von Nazareth und des Apostels Paulus der Tag göttlichen Gerichts über alle Verstorbenen, bei dem einem jeden für die Taten im Leben dem Verdienst nach vergolten wird.103 Insofern galt etwa Tertullian104 das Jüngste Gericht am Ende des Weltenlauf, dessen Eintreten der Apostel Paulus105 mit zu den Fundamenten christlicher Glaubenslehre zählte, als der (letzte) Tag der Vergeltung für das Gute wie für das Böse, das die Menschen im Leben getan haben. Für ihn106 wie auch für den Verfasser des Barnabas-Briefes (um 130/132 u.Z.)107 und den Apologeten Tatian108 ist die Vergeltung beim Jüngsten Gericht sogar der für einen Christen entscheidende Grund ihres Hoffens auf die Auferstehung der Toten109 - auch münden nahezu alle Glaubensbekenntnisse aus der Entstehungszeit des Christentums ein in die Bekenntnisse von der Auferstehung des Fleisches und zuvor vom Richten des Christus über Lebende und Tote110, konkreter: vom gerechten Gericht über Seelen und Leiber111, das die "Fides Damasi" genannte Formel und das Bekenntnis "Quicumque" aus der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts u.Z. als Rechenschaftablegen begangener Taten der Verstorbenen sowie deren Vergeltung als Lohn guter Verdienste durch das ewige Leben und als Bestrafung der Sünder durch ewige (Feuer-) Qualen beschreiben112. Aus dieser Perspektive war das Weiterleben der Gerichteten durchaus kein amorphes Jenseitsdasein, welches für alle die gleiche Umgebung bot, der Aufenthaltsort der vom Gericht Gottes verurteilten Auferstandenen war vielmehr doppelt angelegt: als Hölle, wo es Finsternis und Heulen und Zähneknirschen geben soll, samt eines Höllenfeuers für die Bestrafung der Sünder113, als Himmel, der den Bereich ewiger Seligkeit umfassen soll, für eine gerechte Belohnung der Tugendhaften114. Denn gerade dieses Differenzieren zwischen Sündern und Frommen sowie ihrer Gerichtsurteile, sei es zum Aufenthalt im Strafort der Hölle, sei es in die Sphäre des Himmels als Belohnung, war dann das, was nach der Aussage des Apostels Paulus115 wie auch später nach der Ansicht z.B. des Verfassers des Barnabasbriefes116, von Athenagoras von Athen117, Hippolyt von Rom (vor 189 - 235 u.Z.)118, Clemens von Alexandrien119, Johannes Chrysostomos (um 350 - 407 u.Z.)120 oder Augustinus von Hippo121 die Gerechtigkeit Gottes beim Jüngsten Gericht zur Geltung bringt. Doch wenngleich die nach den jeweiligen Verdiensten vorgenommene Einweisung der Auferstandenen ins Reich der Finsternis der Hölle bzw. der Seligkeit des Himmels ursprünglich auf den unbestimmten Jüngsten Tag des Gerichts anberaumt war, meinten die gläubigen Apologeten und Kirchenlehrer der Christen, zumindest Aspekte von Strafe und Lohn für den Zeitraum zwischen Tod und Auferstehung einführen zu müssen, da ansonsten Gottes Gerechtigkeit diese Zeit aussparte. Denn für die Sünder wäre es nach Auffassung von Justinus schließlich eine unverdiente Wohltat, daß mit dem Tod des Körpers auch ihre Seelen untergingen, weil dann auch alle psychischen Möglichkeiten bewußten Empfindens gerechter Strafe zu Grunde gingen122, eine ebenso Tertullians Auffassung entsprechend unannehmbare Vorstellung göttlicher Ungerechtigkeit, die ihn dazu führte, auch für den Zeitraum bis zur Auferstehung der Verstorbenen eine Vorwegnahme von Bestrafungen und Belohnigungen anzunehmen, zum mindesten für vergangene Taten, die die Seelen allein verantworten müßten123.124 Ebenso klar bestätigte auch Origines diese Verknüpfung, daß die Seele unsterblich sein müsse, damit eine postmortale Vergeltung ihrer Taten ihrem Verdienste nach stattfinden kann125. Wie schon zuvor Justinus126, Irenaeus127, Hippolyt128, Tertullian129, Origines130, Ambrosius131 konzipierte Augustinus entsprechend verschiedene Aufenthaltsräume für die von den Körpern separierten Seelen für die Zeit zwischen Tod und Auferstehung, worin ihnen gemäß ihren Taten im Leben entweder Ruhe oder Schmerz, d.h. Lohn für die Guten oder Strafe für die Bösen zuteil werden sollen132. Insofern war also die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele - für Origines eine Hauptlehre der Christen133 - von den Bedingungen göttlicher Gerechtigkeit her ethisch geboten, ein Grund, den die Thnetopsychitisten nicht genügend beachtet haben.
Trotz ihrer Differenzen in Bezug auf den Tatbestand postmortalen Weiterlebens der Seele gab es jedoch in der Frage, was denn das Endziel des Heils für die Menschen sei, zwischen den Gruppierungen christlicher Apologeten und Kirchenlehrer keinen Unterschied. Denn für die Verfechter ihrer Unsterblichkeit war das Dasein der vom Körper getrennten Seele nur ein Wartezustand134 auf die Auferstehung, der den Andeutungen vom Hirt des Hermes135, von Clemens von Alexandrien136 oder Origines137 und mit Einschränkungen von Augustinus138 nach aber auch Chancen der Sühne und Läuterung bot139, nichtsdestoweniger, wie Tertullian herausstellte, eine unabdingbare Bedingung für die Auferstehung, weil allererst eine Seele, die auch nach dem Tod des Körpers fortlebt, die für ein bewußtes Erleben von Schuld und Verdienst und damit von Strafe und Lohn erforderliche Identität zwischen Verstorbenen und Auferstandenem gewährleistet140. Doch abgesehen von dem endlichen Zeitrahmen der Bestrafung und Belohnung der Seele vor der Auferstehung, der der von dem Sektengründer Jesus von Nazareth verheißenen Ewigkeit der Höllenqualen und Himmelfreuden widersprach, war ihr jenseitiges Dasein immer nur als etwas Intermediäres141, als ein Zwischenzustand konzipiert, der mit der leiblichen Auferstehung seine Vollendung finden sollte142. Denn wie die Menschen als solche nicht allein aus Seele bzw. lediglich aus Körper bestehen, sondern zusammen Seele und Körper besitzen143, muß auch die kommende Auferstehung beides, sowohl Seele als auch den Körper betreffen144, denn ohne eine leibliche Auferstehung, und damit nur durch das Faktum der Unsterblichkeit der Seele, wäre nach Ansicht von Tertullian Gottes Schöpfungsakt wie Erlösungstat halbiert145. Auch vom Gesichtspunkt der Vergeltung her erscheint die Auferweckung der Körper, wie dies etwa die Kirchenlehrer Athenagoras (um 180 ul.Z.)146, Irenäus147 oder Tertullian148 bekräftigten, als notwendig, weil allererst ein körperliches Auferstehen auch jene Handlungen eines Menschen dem Jüngsten Gericht Gottes zuführen könnte, die von seinem früheren Körper und nicht durch die Seele allein ausgelöst wurden. Insofern erfordere die göttliche Gerechtigkeit - neben einer Vergeltung für die Taten der Seele eines Menschen direkt nach seinem Tode149 - auch eine Auferstehung des Körpers, damit alle seine Taten vor das Endgericht am Jüngsten Tage kommen und sich mit diesem Gottes Gerechtigkeit ganz erfüllen kann. Mit dem Bewirken der Unsterblichkeit der Seele allein wäre daher noch nicht sein ganzes Werk getan150, erst seine Auferweckung der Körper der Verstorbenen vollendet die göttliche Verheißung der Auferstehung und die mit der Auferstehung verknüpfte Vergeltung der Taten der Verstorbenen. Mit dieser Konzeption entstanden daher aus der einen beteuerten Auferstehung des Fleisches, d.h. des Ganzmenschen, implizit zwei separate Vorgänge postmortalen Lebens151, wobei die erste Hälfte der Auferstehung der Toten, die des Faktums der Unsterblichkeit der Seele, der zweiten, der Auferweckung ihrer Körper, als Bedingung vorangeht, bis bei der künftigen Auferstehung der Körper sich Seele und Körper aufs Neue vereinen und damit den gesamten Prozeß der Auferstehung der Toten und der Vergeltung ihrer Taten vollenden. Interessant ist, daß die vom Ende des 2. Jahrhunderts u.Z. stammende Märtyrerakte des Apollonius bereits von solcher Aufspaltung und Verdoppelung der Auferstehung und Vergeltung spricht.152 Daß, wie gesagt, mit Tertullian das Bestreben christlicher Apologeten und Kirchenlehrer zum Durchbruch kam, die Natürlichkeit der Unsterblichkeit der Seele mit den Mitteln philosophischer Argumente aufzuzeigen, läßt sich nun als eine sehr einsichtige Strategie werten, der harten Zurückweisung körperlicher Auferstehung von Seiten der Gnostiker und Platoniker entgegenzutreten. Aus ihrer Sicht mag nämlich die Erklärung153, daß der Christengott als Schöpfer der Menschheit eben alles tun und daher auch Körper auferwecken könne, zwar evident gewesen sein, einen hinlänglich Gebildeten konnte dieses Argument, wie schon der Kirchenlehrer Origines anmerkte154, wohl kaum gewinnen. Denn der Hinweis auf die dem Schöpfergott zugesprochene Allmacht zeigt wenig auf, wenn überhaupt, dann nur seine bloße Möglichkeit zur Auferweckung von Körpern, nicht deren Faktizität. Auch die von Seiten der Christen angeführten Naturvorgänge als Analogien zur Auferstehung155 dürften eher geringe Überzeugungskraft aufweisen. Doch geben sie einen Hinweis darauf, welche Bedeutung man den Beweisgängen ihrer Philosophen, daß die Seele des Menschen von Natur aus unsterblich sei, beizumessen hat. Innerhalb des von der Christengottheit getragenen Bedingungsgefüges lassen sich solche Beweise der Unsterblichkeit der Seele als Versuche charakterisieren bzw. interpretieren, vom unbezweifelten Ziel der Auferstehung der Toten her die Notwendigkeit göttlicher Eingriffe argumentativ einzugrenzen. Das bewerkstelligen die philosophischen Beweise zur Immortalität der Seele natürlich schon per se, da sie deren separates Weiterleben nicht mehr auf eine durch Gott gegebene Gnade beziehen, sondern definite Natur-Notwendigkeiten der Seele dafür verantwortlich sehen. Angesichts der von Tertullian156 angeführten verworrenen Hoffnungen und den Unsicherheiten in Bezug auf die Erwartungen der Menschen auf die Auferstehung gaben sie zudem für jeden Menschen, nicht zuletzt allen Nicht-Christen, die Gewißheit, daß zumindest ein Teil ihrer Taten schon nach ihrem Tode sofort vergolten würden. Unter den etwa von Athenagoras beschriebenen theologischen Prämissen des Menschen als Einheit von Seele und Körper und dem Endziel der Vergeltung aller Handlungen eines Menschen beim Jüngsten Gericht war dann, wenn ein Beweis der Natürlichkeit der Unsterblichkeit der Seele vorhanden war, die leibliche Auferstehung und der Vergeltungsakt sozusagen als logischer Schluß herleitbar157. Der argumentative Vorteil - oder wenn man will, auch Nachteil - dieser Strategie war mithin, dem Zentraldogma der Christenheit den Anstrich eines quasi-Naturgesetzes zu verleihen, um Gegnern und Kritikern die Auferstehung der Toten plausibler auszumalen.158 Gleichwohl erwuchs aus solchen Beweisen der Unsterblichkeit der Seele (noch) kein Ersatz, aber immerhin eine Bedingung für die Auferstehung der Toten159, deren Glaubwürdigkeit dadurch in gewisse Abhängigkeit von der Tragfähigkeit rationaler Argumente für die Unsterblichkeit der Seele geriet. In der Spätantike wurde jedoch diese Anlehnung nicht zu einem Problem, weil selbst jene Kirchenlehre wie Origines160 oder Augustinus161, die die Unsterblichkeit der Seele als rational beweisbar befanden, nur Gott allein Unsterblichkeit zuerkannten, wie eine dazu oft angebrachte Stelle aus einem der Briefe des Paulus an Timotheus aussagt162 - in letzter Hinsicht war daher die Unsterblichkeit der Seele für die Kirchenlehrer ein Gnadengeschenk ihrer Christengottheit und damit ein Glaubensinhalt163.
14 vgl. Campenhausen, H.v. (1963), S. 309 f., Bissels, P. (1967), S. 323; vgl. dazu auch die Ausführungen von Greshake, G. (1986), S. 281 - 284
15 zu Justinus Thnetopsychitismus vgl. Götzmann, W. (1927), S. 34 - 37 oder Fischer, J.A. (1954), bes. S. 51 - 54
16 vgl. Justinus (1917), S. 9 f. (Dial. 5, 1 f.)
18 vgl. Justinus (1917), S. 11 (Dial. 6, 1 f.); vgl. auch ebd. S. 10 (Dial. 5, 4)
19 Ebenso beschränken die unbekannten Verfasser der "Didache" und der Autor des 1. Clemensbriefes die Auferstehung der Toten auf die Christengläubigen (vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 20/21 (Didache 16, 5 f.), S. 110/111 (1 Clem. 26, 1)
20 vgl. Justinus (1917), S. 10 (Dial. 5, 3); vgl. auch die Stellen aus der Apologie des Justinus (1913), S. 71 (Text S. 17 (Apol. 1, 8), S. 74 (Text S. 20) (Apol. 1, 10)
21 An späteren Stellen seines Dialogs mit dem Juden Tryphon behauptet Justinus (1917), S. 190 (Dial. 117, 3), S. 212 (Dial. 130, 2) allerdings, daß die verdammten Sünder ewige Feuerstrafe erwartet; dieselbe Ansicht vertritt Justinus (1913), S. 72 (Text S. 18) (Apol. 1, 8), S. 75 (Text S. 21) (Apol. 1, 12), S. 84 (Text S. 30) (Apol. 1, 17 u. 18), S. 88 (Text S. 34) (Apol 1, 21), S. 113 (Text S. 59) (Apol. 1, 45), S. 139 (Text S. 85) (Apol. 2, 1), S. 145 (Text S. 91) (Apol. 2, 6 (7)), S. 149 (Text S. 95) (Apol. 2, 9) ebenso in seinen Apologien und setzte damit voraus (ebd. S. 84 f. (Text S. 30 f. (Apol. 1, 18)), daß nicht nur Tugendhafte, sondern genauso Sünder einmal körperlich auferweckt werden.
22 zu Tatians Auffassung von der Sterblichkeit der Seele vgl. Götzmann, W. (1927), S. 37 - 39, Fischer, J.A. (1954), S. 54 f. oder Pelikan, J. (1961), S. 11 - 29
23 vgl. Tatian (1913), S. 217 f. (Text S. 43 f.) (Or. 15, 2 u. 6)
24 vgl. zunächst die Aussagen des Tatian (1913), S. 203 (Text S. 29) (Or. 6, 3), S. 205 (Text S. 31) (Or. 7, 6), S. 216 f. (Text S. 42 f.) (Or. 14, 3 - 5), S. 220 (Text S. 46) (Or. 16, 4), S. 227 (Text S. 53) (Or. 20, 6) sowie vor allem S. 215 (Text 41) (Or. 13, 4): "Wenn sie [die Seele] daher allein für sich lebt, so neigt sie sich niederwärts zur Materie und stirbt zugleich mit dem Fleisch."
25 vgl. Tatian (1913), S. 203 (Text S. 29) (Or. 6, 1)
26 vgl. Tatian (1913), S. 214 f. (Text S. 40 f.) (Or. 13, 1): "Nicht unsterblich, ihr Bekenner des Griechentums, ist unsere "Seele" an sich, sondern sterblich: sie kann aber trotzdem dem Tode entrinnen. Denn sie stirbt und erfährt zusammen mit dem Körper ihre Auflösung, wenn sie die Wahrheit nicht erkannt hat; später, am Ende des Weltlaufs, steht sie freilich mit dem Körper auf, aber nur, um als Strafe den Tod in der Unsterblichkeit zu empfangen: dagegen stirbt sie überhaupt nicht, mag auch ihre zeitweilige Auflösung erfolgen, wenn sie mit der Erkenntnis Gottes ausgerüstet ist."
27 zu Theophilus Auffassung zur Sterblichkeit und Auferstehung vgl. Fischer, J.A. (1954), S. 55 f., 85 f., 105 f., 161 - 163
28 vgl. Theophilus (1913), S. 55 (Ad Autolyc. 2, 24), S. 57 (Ad Autolyc. 2, 27)
29 vgl. Theophilus (1913), S. 57 (Ad Autolyc. 2, 26)
30 vgl. Theophilus (1913), S. 57 (Ad Autolyc. 2, 27)
31 vgl. Theophilus (1913), S. 25 (Ad Autolyc. 1, 14)
32 vgl. Theophilus (1913), S. 58 (Ad Autolyc. 2, 27), S. 57 (Ad Autolyc. 2, 26)
33 vgl. Theophilus (1913), S. 18 (Ad Autolyc. 1, 7)
34 vgl. Theophilus (1913), S. 25 (Ad Autolyc. 1, 14)
35 vgl. Theophilus (1913), S. 57 (Ad Autolyc. 2, 27)
36 zu Irenäus´ Auffassung vom Wesen und Leben der Seele des Menschen vgl. Götzmann, W. (1927), S. 43 - 45, Fischer, J.A. (1954), bes. S. 56, 163 - 168, 245 - 247 oder Pelikan, J. (1961), S. 101 - 118
37 vgl. Irenäus (1912 a), S. 297 (Adv. haer. III, 20, 1), (1912 b), S. 158 (Adv. haer. V, 3, 1)
38 vgl. Irenäus (1912 a), S. 204 f. (Adv. haer. II, 34, 3 f.)
39 vgl. Irenäus (1912 a), S. 296 (Adv. haer. III, 20, 1)
40 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 f. (Adv. haer. II, 34, 1)
41 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 f. (Adv. haer. II, 34, 1)
42 vgl. Irenäus (1912 a), S. 203 - 205 (Adv. haer. II, 34, 2 - 4)
43 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 (Adv. haer. II, 33, 5)
44 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 (Adv. haer. II, 34, 1), (1912 b), S. 234 f. (Adv. haer. V, 31, 2)
45 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 (Adv. haer. II, 33, 5), (1912 b), S. 234 f. (Adv. haer. V, 31, 2)
46 zur Ansicht von der Mortalität der Seele bei Arnobius vgl. Karpp, H. (1950), S. 171 - 185 oder Fischer, J.A. (1954), bes. S. 56 - 63, 181 - 185
47 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 147 f. (Adv. nat. 2, 35)
48 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 149 (Adv. nat. 2, 36)
49 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 201 (Adv. nat. 3, 12)
50 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 139 (Adv. nat. 2, 26)
51 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 140 f. (Adv. nat. 2, 28)
52 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 140 (Adv. nat. 2, 27) in Verbindung mit S. 127 (Adv. nat. 2, 14)
53 vgl. ergänzend die Aussage des Arnobius of Sicca (1949), S. 201 (Adv. nat. 3, 12)
54 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 127 f. (Adv. nat. 2, 14 f.)
55 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 126 (Adv. nat. 2, 13); vgl. aber auch die Gleichsetzung der Seele mit dem Menschen als solchen bei Arnobius, ebd., S. 126 (Adv. nat. 2, 13)
56 vgl. dazu besonders auch die Aussagen des Arnobius of Sicca (1949), S. 148 (Adv. nat. 2, 35), S. 173 f. (Adv. nat. 2, 62), S. 176 - 178 (Adv. nat. 2, 64 - 66)
57 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 128 (Adv. nat. 2, 14), S. 145 (Adv. nat. 2, 32), S. 145 f. (Adv. nat. 2, 33), S. 148 (Adv. nat. 2, 36), S. 164 (Adv. nat. 2, 53), S. 173 f. (Adv. nat. 2, 62)
58 vgl. Arnobius of Sicca (1949), S. 128 (Adv. nat. 2, 14), S. 145 f. (Adv. nat. 2, 33), S. 173 (Adv. nat. 2, 61), S. 176 (Adv. nat. 2, 64)
59 vgl. Hermias (1913), S. 115 f. (Text S. 5 f.)
60 vgl. die Hinweise auf die "Adumbrationes" bei Karpp, H. (1950), S. 103, Fn. 1, Fischer, J.A. (1954), S. 63. In anderen Werken vertritt Klemens freilich die konträre Position, daß nämlich die Seele von Natur aus unsterblich sei.
61 vgl. Eusebius (1932), S. 301 (VI, 37); vgl. auch den Hinweis von Origines (1974), S. 33 f. (Dial. Herac. 10) selbst auf solche Leute, nach denen eine Seele keine Wahrnehmung mehr nach Lösung vom Leben, d.h. nach dem Tode besäße.
62 vgl. u.a. Tertullian (1980), S. 75 (De an. 14, 1), S. 152 (De an. 45, 1), S. 126 f. (De an. 33, 2), S. 202 - 206 (De test. an, 4, 1 - 11); zur Natürlichkeit der Unsterblichkeit der Menschenseele vgl. ders. (1960), S. 96/97 (De res. carn. 35, 2) sowie S. 10/11 (De res. carn. 3, 1)
63 zur Natürlichkeit substantieller Unsterblichkeit der Menschenseele vgl. Origines (1985), S. 814/815 (De princ. IV, 4, 9)
64 vgl. Götzmann, W. (1927), S. 45 - 104 (- 125), der die Unsterblichkeitsbeweise der sog. Kirchenväter eingehend darstellt.
65 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 110/111 (1 Clem. 26, 3)
66 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 162/163 (2 Clem. 9, 1)
67 zur Geschichte des Konzepts von der Auferstehung des Fleisches vgl. Kretschmar, G. (1968)
68 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 448/449 (Herm. Sim. 5, 7, 2)
69 vgl. Greshake, G. (1986), S. 177 f.
70 vgl. u.a. Schmid, J. (1957) oder Heinzmann, R. (1974), S. 544
71 vgl. Justinus (1917), S. 133 f. (Dial. 80, 4 f.)
72 vgl. Irenäus (1912 a), S. 33 (Adv. haer. I, 10, 1), S. 278 (Adv. haer. III, 16, 6)
73 vgl. Tertullian (1960), S. 4/5 (De res. carn. 1, 1) in Verbindung mit der Aussage ders. (1915 a), S. 320 (Praescr. haer. 13) und bei Stücklin, C. (1974), S. 14/15 (De virg. vel. 1, 3)
74 vgl. Denzinger, H. (1999), S. 39 f. (DS 46 f.)
75 vgl. u.a. die Hinweise von vgl. Irenäus (1912 a), S. 72 f. (Adv. haer. I, 24, 3 u. 5), S. 79 (Adv. haer. I, 27, 2 f.), S. Tertullian (1915), S. 341 (Präaescr. haer. 33), (1980), S. 6/7 f. (De res. carn. 2, 3 f.)
76 vgl. ergänzend den Hinweis u.a. von Irenäus (1912 a), S. 18 (Adv. haer. I, 6, 1), S. 68 (Adv, haer. I, 22, 1), (1912 b), S. 233 (Adv. haer. V, 31, 1)
77 vgl. Celsus (1984), S. 125 f. (V, 14), S. 169 (VII, 32), S. 190 f. (VIII, 49)
78 Für Tertullian (1980), S. 99 (De an. 23, 5) war Platon der "Krämer aller Ketzer", d.h. hier: der Gnostiker.
79 vgl. Justinus (1917), S. 11 (Dial. 6, 2)
80 vgl. Athenagoras (1913), S. 350 (Text S. 82) (De res. 10), S. 359 (Text S. 91) (De res. 15), S. 365 (Text S. 96) (De res. 18) sowie S. 361 (Text S. 93) (De res. 16)
81 vgl. Clemens (1937), S. 111 (Strom. IV, 164, 5) sowie (1938), S. 75 (Strom. VII, 71, 3)
82 vgl. u.a. Tertullian (1912), S. 228 (De paenit. 3), (1960), S. 94/95 (De res. carn. 34, 10) sowie Tertullian (1980), S. 111, 163, 166 (De an. 27, 2; 51, 1; 52, 1)
83 vgl. Origines (1985), S. 112/113 (De princ. I, 1, 6), S. 710/711 (De princ. IV, 2, 4) sowie (1959), S. 258 (Comm. Joh. 13, 23), (1993), S. 253 (Comm. Matth. 13, 9)
84 vgl. Ambrosius (1915), S. 100 (Comm. Luc. 2, 79) sowie (1970), S. 88/89 u. 92/93 f. (De bono mort. 2, 3 u. 3, 8)
85 vgl. u.a. Augustinus (1978), S. 119 (De civ. 13, 11) sowie S. 113 (De civ. 13, 6)
86 vgl. Tertullian (1960), S. 8/9 (De res. carn. 2, 12), S. 24/25 (De res. carn. 8, 2), (1972), S. 562/563 (Ad Marc. V, 9, 2); vgl. auch ders. (1980), S. 53 (De an. 3, 1)
87 vgl. auch u.a. Tertullian (1960), S. 50/51 (De res. carn. 18, 8 - 12), (1972), S. 562/563 f. (Ad Marc. V, 9, 3 f.)
88 vgl. Athenagoras (1913), S. 361 (Text S. 93) (De res. 16) oder Methodius im Panarion des Epiphanius (1994), S. 169 f. (Pan. 64, nr. 44, 3; 44, 4; 45, 1) überlieferten Fragment zur Auferstehung.
89 vgl. Greshake, G. (1986), S. 186 f.
90 vgl. Justinus (1913), S. 85 (Text S. 31 (Apol. 1, 18)
91 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 196/197 (Ign.Magn. 9, 2)
92 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 274/275 f. (Mart. Pol. 14, 2)
93 vgl. aus der Märtyrerakte des Justinus die Nr. 5 in: Rauschen, G. (1913), S. 311 f. (Text S. 23 f.)
94 vgl. Irenäus (1912 b), S. 109 (Adv. haer. IV, 33, 9)
95 vgl. Tertullian (1960), S. 120/121 (De res. car. 43, 4), (1980), S. 172 f. (De an. 55, 4 f.)
96 Mt. 10, 23, Mk. 9, 1; 13, 30; 14, 25; Röm. 13, 11-14; 1 Kor. 7, 29-31; 10, 11; 15, 52; 1 Thess. 4, 15 - 5, 11
97 vgl. Justinus (1917), S. 132 - 134 (Dial. 80, 2 - 5), bes. S. 133 (Dial. 80, 4); vgl. auch ebd. S. 52 (Dial. 35, 1 f.)
98 vgl. Irenäus (1912 b), S. 233 f. (Adv. haer. V, 31, 1)
99 Luk. 16, 19 - 31; vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 f. (Adv. haer. II, 34, 1) oder Tertullian (1960), S. 44/45 (De res. carn. 17, 2), (1972), S. 452/453 (Ad Marc. IV, 34, 10 - 13), (1980), S. 60 f. (De an. 7, 2), S. 180 f. (De an. 57, 11 u. 58, 1)
100 Mt. 12, 40, Röm. 10, 6 f., Eph. 4, 8-10, 1 Petr. 3, 18-20; vgl. Irenäus (1912 b), S. 234 f. (Adv. haer. V, 31, 1 u. 2) oder Tertullian (1980), S. 61 (De an. 7, 3), S. 171 f. (De an. 55, 1 u. 2)
101 Gen. 2, 7; vgl. Theophilus (1913), S. 49 (Ad Autolyc. 2, 19), Irenäus (1912 b), S. 166 f. (Adv. haer. V, 7, 1), Tertullian (1972), S. 110/111 (Adv. Marc II, 9, 1 - 4)
102 vgl. Harnack, A.v. (1924), S. 124
103 Mt. 16, 27; Röm. 2, 5 - 11; 2 Kor. 5, 10, dazu ergänzend auch Ps. 62, 13; Spr. 24, 12 und Offb. 20, 12 f.
104 vgl. Tertullian (1960), S. 58/59 (De res. carn. 22, 2); vgl. auch u.a. (1912), S. 227 (De paen. 2)
105 1 Hebr. 6, 1 f.; vgl. auch u.a. Apg. 17, 31
106 vgl. Tertullian (1915), S. 517 (Text S. 171) (Apol. 48), (1960), S. 56/57 (De res. carn. 21, 3 u. 4)
107 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 36/37 (Barn. 5, 6 f.), S. 72/73 (Barn. 21, 1)
108 vgl. Tatian (1913), S. 203 (Text S. 29) (Or. 6, 1)
109 vgl. aber auch die Zurückweisung ungenannter Kirchenlehrer durch Athenagoras (1913), S. 358 (Text S. 90) (De res. 14), daß die Vergeltung bzw. die Gerechtigkeit beim Jüngsten Gericht Gottes einziger Grund für die Auferstehung der Toten sei.
110 vgl. Denzinger, H. (1999), S. 24, 25, 26, 27, 28, 29 f., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43 f., 45, 47 (DS 10, 11 + 12, 13 + 14, 15 + 16, 17 + 19, 22, 23, 25 f., 27 + 28, 29, 30, 40, 41, 42, 51, 60, 63)
111 vgl. Denzinger, H. (1999), S. 38, 39 f., 41 (DS 45, 46 f., 48)
112 vgl. Denzinger, H. (1999), S. 49 u. 52 (DS 72 u. 76)
113 zur Geschichte der Höllendoktrin vgl. Vorgrimler, H. (1993), Minois, G. (1994)
114 zur Kulturgeschichte des Himmels vgl. Lang, B., McDannell, C. (1990)
115 Röm. 2, 5 - 11; zur Formel von Gottes gerechtem Gericht vgl. neben der Stelle Röm. 2, 5 auch noch Apg. 17, 31; 1 Petr. 2, 23; Offb. 16, 5; 19, 2
116 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 26/27 (Barn. 1, 6) in Verbindung mit S. 72/73 (Barn. 21, 1)
117 vgl. Athenagoras (1913), S. 366, 368 (Text S. 98, 100) (De res. 19 u. 20)
118 vgl. Hippolyt (1836), S. 197 f. (Frag. De univ./Contr. Platon, nr. 2)
119 vgl. Clemens (1937), S. 268 (Strom. VI, 45, 3)
120 vgl. Johannes Chrysostomus (1915), S. 220 - 228 (Math. Comm. Hom. 13, 5)
121 vgl. Augustinus (1960), S. 106/107 (Ench. 14, 55) in Verbindung mit (1978), S. 584 - 588 (De civ. 20, 1 u. 2)
122 vgl. Justinus (1913), S. 84 (Text S. 30) (Apol. 1, 18) und (1917), S. 10 (Dial. 5, 3)
123 vgl. Tertullian (1980), S. 181 - 183 (De an. 58, 2 - 8); vgl. auch u.a. (1960), S. 46/47 (De res. carn. 17, 8)
124 vgl. auch u.a. Irenäus (1912 a), S. 202 f. (Adv. haer. II, 34, 1) und Clemens (1937), S. 268 (Strom. VI, 45, 3)
125 vgl. Origines (1974), S. 42 f. (Dial. Herac. 25 f.), (1985), S. 90/91 (De princ., Praef. 5)
126 vgl. Justinus (1917), S. 10 (Dial. 5, 3)
127 vgl. Irenäus (1912 a), S. 202 (Adv. haer. II, 34, 1), (1912 b), S. 234 f. (Adv. haer. V, 31, 2)
128 vgl. Hippolyt (1836), S. 194 - 196 (Frag. De univ./Contr. Platon, nr. 1 u. 2 Anfang)
129 vgl. Tertullian (1960), S. 46/47 (De res. carn. 17, 8), (1972), S. 454/455 (Adv. Marc. IV, 34, 13) sowie (1980), S. 60 f. (De an. 7, 1 - 4) und S. 171 - 173 u. 181 - 183 (De an. 54, 55 u. 58)
130 vgl. Origines (1985), S. 758/759 (De princ. IV, 3, 10) in Verbindung mit S. 90/91 (De princ., Praef. 5) sowie (1981), S. 84/85 (Hom. Lev. IX, 4, Z. 17 - 20) in Verbindung mit (1996), S. 144/145 (Comm. Röm. IX, 41, Z. 17 - 19) und Origines in: Harl, M. (1972), S. 440/441 (Comm. Ps. 118, v. 160 a)
131 vgl. Ambrosius (1970), S. 136/137 f. (De bono mort. 10, 45 - 47)
132 vgl. Augustinus (1960), S. 180/181 (Ench. 29, 109) sowie (1955), S. 268/267 (De praed. sanct. I, 12, 24), (1975), S. 12 (De cura pro mort. 5, 7), (1977), S. 205 (De an. et or. II, 4, 8), (1978), S. 74 (De civ. 12, 9) in Verbindung mit S. 116 (De civ. 13, 8)
133 vgl. Origines (1926), S. 227 (Contr. Cels. III, 22)
134 vgl. Justinus (1917), S. 10 (Dial. 5, 3), Irenäus (1912 b), S. 235 (Adv. haer. V, 31, 2), Tertullian (1960), S. 46/47 (De res. carn. 17, 8), (1980), S. 202 f. (De test. an. 4, 1)
135 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 354/355 f. (Herm. Vis. 7, 1 - 6)
136 vgl. Clemens (1938), S. 41 (Strom. VII, 34, 3), S. 61 f. (Strom. VII, 56, 5 u. 57, 1); vgl. auch die Aussage ebd., S. 106 (Strom. VII, 102, 5), daß Gott keine Rache kennt.
137 vgl. u.a. Origines (1927), S. 25 f. (Contr. Cels. V, 15), (1980), S. 179 f. (Hom. Jer. 16, 5 u. 6), (1985), S. 426/427 - 432/433 (De princ. II, 10, 4 f.)
138 vgl. Augustinus (1960), S. 124/125 - 128/129 (Ench. 18, 68 u. 69), (1978), S. 705 - 707 (De civ. 21, 13), S. 731 - 737 (De civ. 21, 26)
139 zur Geschichte des sog. Fegefeuers vgl. Le Goff, J. (1990)
140 vgl. Tertullian (1915), S. 169 (Apol. 48), (1980), S. 126 f. (De an. 33, 2)
141 vgl. Tertullian (1980), S. 181 (De an. 58, 3)
142 vgl. Irenäus (1912 b), S. 235 (Adv. haer. V, 31, 2)
143 vgl. Tertullian (1960), S. 110/111 (De res. carn. 40, 3); vgl. auch das Zitat von Pseudo-Justin (De res. 8) bei Greshake, G. (1986), S. 185 f.)
144 vgl. auch u.a. Athenagoras (1913), S. 358 - 360 (De res. 15)
145 vgl. Tertullian (1960), S. 6/7 (De res. carn. 2, 2), S. 92/93 (De res. carn. 34, 3)
146 vgl. zunächst die Aussage des Athenagoras (1913), S. 364 f. (Text S. 96 f. (De res. 18)
147 vgl. Irenäus (1912 a), S. 185 f. (Adv. haer. II, 29, 1 u. 2)
148 vgl. Tertullian (1915), S. 517 (Text S. 171) (Apol. 48), (1960), S. 46/47 (De res. carn. 17, 8 u. 9), (1972), S. 454/455 (Adv. Marc IV, 13), (1980), S. 181 (De an. 58, 2), S. 203 (De test. an. 4, 1)
149 Diesen Aspekt vorgezogener Vergeltung der Taten der Seelen lehnte Athenagoras (1913), S. 365 (Text. S. 97) (De res. 18), S. 367 - 372 (Text S. 99 - 104) im Gegensatz zu Justinus, Tertullian und anderen strikt ab, jedoch bezieht der Apologet seine Kritik auf die Vorstellungen vor allem der Platoniker, die ausschließlich die Unsterblichkeit der Seele und folglich die Vergeltung lediglich der auf seelische Akte zurückzuführenden Taten akzeptierten. Aus christlicher Sicht, die von der Auferstehung der Toten ausgeht, treffen deshalb Athenagoras Argumente auch auf jene Auferstehung der Körper von Verstorbenen zu, die in Konzepten anderer Apologeten und Kirchenlehrer der auf die Zeit zwischen Tod und Auferstehung beschränkte Vergeltung der vom Körper abgespaltenen unsterblichen Seelen nachfolgt.
150 vgl. das Zitat von Pseudo-Justin (De res. 7) bei Greshake, G. (1986), S. 194
151 vgl. Greshake, G. (1986), S. 201 f.
152 vgl. Rauschen, G. (1913), S. 326 f. (Text S. 38 f.: Märtyrerakte des Apollonius, Nr. 37 u. 42)
153 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 110/111 (1 Clem. 27, 5), Justinus (1913), S. 85 f. (Text S. 31 f.) (Apol. 1, 18 f.), Athenagoras (1913), S. 341 f. (Text S. 73 f.) (De res. 3), S. 349 (Text S. 81) (De res. 9), Hippolyt (1836), S. 197 f. (Frag. De univ./Contr. Platon, nr. 2), Tertullian (1915), S. 171 f. (Apol. 48), (1960), S. 30/31 f. (De res. carn. 11, 3 - 10), Arnobius of Sicca (1949), S. 147 (Adv. nat. 2, 35)
154 vgl. Origines (1927), S. 36 (Contr. Cels. V, 23) und insbesondere die Aussage des Origines aus der Schrift des Methodius im Panarion des Epiphanius (1994), S. 141 f. (Pan. 64, nr. 12 u. 13)
155 vgl. Lindemann, A., Paulsen, H. (1992), S. 108/109 f. (1 Clem. 23, 4 u. 24, 2 - 26, 1), Theophilus (1913), S. 22 - 24 (Ad Autolyc. 1, 13), Tertullian (1960), S. 32/33 f. (De res. carn. 12 u. 13)
156 vgl. Tertullian (1980), S. 181 (De an. 58, 3)
157 vgl. dazu etwa die Ausführung seiner Vorgehensweise zur Verteidigung der Auferstehung der Toten bei Athenagoras (1913), S. 357 f. (Text S. 89 f.) (De res. 14)
158 vgl. Greshake, G. (1986), S. 284 f.
159 vgl. Stuiber, A. (1957), S. 100 f.
160 vgl. Origines (1974), S. 43 (Dial. Herac. 27)
161 vgl. Augustinus (1964), S. 38 (Gen. ad litt., VII, 28 (43)) und den bei Greshake, G. (1986), S. 283, Fn. 327 zitierten Brief (ep. 166) des Augustinus.
162 1 Tim. 6, 16
163 vgl. Augustinus (1936), S. 179 (De trin. XIII, 9 (12))
2.2 Die Doktrin der Unsterblichkeit der Seele als Ausdruck machtpolitischer Interessen der Kircheninstitution
Angesichts dieser, seine ältere Ansicht zur Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Seele zurücknehmenden Position des Augustinus, der für die Christenheit schließlich als einer der wichtigsten Kirchenlehrer werden sollte, bleibt jedoch unsere Frage offen, wieso Diskussionen im Hoch- und Spätmittelalter genau über diese Problematik oftmals derart heftige Formen annahmen, daß einzelne Kritiker der Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Seele um Leib und Leben bangen mußten. Den meines Erachtens entscheidenden Grund, von dem aus sich überhaupt erst die für das Mittelalter kennzeichnende Schärfe der Auseinandersetzungen der Theologen erklärt, ließ aber bereits Justinus in der 1. Apologie anklingen: die sittliche Aufrechthaltung der Staatsordnung. Denn die Durchsetzung staatstragender Moralität sei nur mit Hilfe der Verheißung göttlicher Belohungen für die Tugendhaften und der Androhung unbegrenzter Feuerstrafen für die Sünder erfolgreich164, wobei er diese jenseitigen Vergeltungen der Taten der Verstorbenen schon vor ihrer Auferstehung ansetzte und auf die mit bewußten Empfindungen ausgestatteten Seelen bezog165. Insofen existierten keine tauglicheren Instrumentarien für die Stützung der Staatsordnung als die Erwartung ewigen Heils für die Tugendhaften und die Angst gegenüber ewig dauernder Bestrafung für die Sünder.166 Jedes nachhaltige Leugnen einer aus ihrer Natur herkommenden Unsterblichkeit der Seele konnte nach dieser Argumentation als Gefährdung der Staatsordnung gelten. Was die Grundlagen dieser Auffassung angeht, vertraten andere Apologeten und Kirchenlehrer, freilich kaum überraschend, fast dieselbe Position wie Justinus. Vor ihm deutete nämlich bereits der Apologet Aristides aus Athen in seiner an Kaiser Hadrian (117 - 138 u.Z.) gerichteten Verteidigungsschrift auf den Zusammenhang hin, daß die Moralität menschlichen Handelns von der Erwartung jenseitiger Vergeltung abhängen dürfte167, und später ergänzte Athenagoras diese Auffassung dahingehend, daß um ein moralisches Handeln durchzusetzen dessen nachtodliches Vergelten beim Jüngsten Gericht unbedingt erforderlich erscheint168. Den psychologischen Mechanismus, der hinter dem Vergeltungsgedanken steht, nämlich durch Verbreitung von Angst die Menschen zum Handeln im Sinne der Moral anzustacheln, machten demgegenüber Kirchenlehrer wie Origines169 oder Hieronymus170 deutlich171. Denn die von ihnen nur als Möglichkeit diskutierte Perspektive, daß durch die Gnade ihres Gottes die Strafe für die Sünder doch nicht eine Ewigkeit andauern könnte, sollte normalen Durchschnittschristen verschwiegen werden, insofern das einfache, häufig unbekümmerte Volk gemeinhin nur durch den maximalen Pegel an Furcht vom Sündigen sich abschrecken läßt. Gegenüber dem Nihilismus der Epikureer glaubten wiederum Kirchenlehrer wie Athenagoras172, Arnobius173 die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele bzw. der Auferstehung der Toten aus dem Argument jenseitiger Vergeltung ihrer Taten verteidigen zu müssen, da andernfalls Gesetzlosigkeit und Sittenlosigkeit und damit der Untergang jeglicher (Staats-) Ordnung drohe. Was also Justinus, von Kirchenlehrern wie Origines, Hieronymus, Athenagoras oder Arnobius unterstützt, den heidnischen Machthabern anbot, war demnach nichts anderes, als seine Auferstehungslehre für Machtinteressen einzusetzen, um psychischen Druck auf die Bevölkerung aufzubauen, damit diese ihnen willfährig Gehorsam leiste.
Was bei Justinus jedoch Strategie zur Verteidigung der Christenheit gegenüber den schroffen Vorwürfen und Vorurteilen von Seiten der Nicht-Gläubigen war174, erwuchs während des Hochmittelalters sozusagen zur geistigen Angriffswaffe und zum Machtinstrument der Kircheninstitution des Christentums selbst. Auf welchen - nicht unbedingt immer rechten - Pfaden es überhaupt im Mittelalter nach Zerstörung des Römischen Reiches zur Ausbildung kirchlicher Machtstrukturen kam, sei dahingestellt, für die Entwicklung christlicher Eschatologie war wesentlich, daß spätestens mit Papst Gregor VII. (1073 - 1085 u.Z.)175 eine Phase des Papsttums einsetzte, in der es weltliche Vorherrschaft gegenüber Kaiser und Königen ergänzend zum absoluten Primat innerhalb der römischen Kirche beanspruchte. So nahm Gregor für sich etwa das Recht in Anspruch, den Kaiser abzusetzen und seine mit göttlichem Gelübde zur Loyalität verpflichteten Gefolgsleute vom Treueeid loszusprechen. Dieses in einem schon zu Beginn seines Pontifikats formulierten persönlichen Memorandum "Dictatus Papae"176 niedergelegete Postulat politischer Macht gewann, jedermann erkennbar, äußere Gestalt im Investiturstreit mit Heinrich IV. (1056 - 1106 u.Z.), bei welchem der Kaiser genötigt war, reumütig Gregor um Absolution und Aufhebung des Bannes nachzusuchen, - auch wenn sein demütigender Triumph über Heinrich vor den Toren von Canossa im Januar des Jahres 1077 u.Z. für ihn sich letztlich nicht auszahlte, denn der den Untergang Heinrichs prophezeiende Papst mußte, nachdem seine Verbündeten, die von ihm zum Schutz gerufenen Normannen, die Stadt Rom verwüstet hatten, auf den stärker werdenden Druck der Bevölkerung hin selbst ins Exil nach Salerno gehen, wo er im guten Glauben, daß er die Gerechtigkeit geliebt und jedwede Ungerechtigkeit gehaßt habe, einige Monate später von der ganzen Welt allein gelassen seinen Tod fand. Trotz dieser Niederlage war natürlich der Machtanspruch der Päpste auf Weltherrschaft nicht verschwunden, sondern nur vorerst abgeschlagen. Schon Papst Innocenz III. (1198 - 1216 u.Z.)177 nutzte wenige Jahrzehnte später die nach dem frühen Tod von Staufer-Kaiser Heinrich VI. (1190 - 1197 u.Z.) einsetzende Zeit der Thronwirren und des Machtvakuums aus, um das Papsttum sowohl hinsichtlich seines Primats innerhalb der römischen Kirche selbst als auch mit seinem Anspruch auf Suprematie gegenüber allen irdischen Gewalten einem neuen Höhepunkt zuzuführen. Seinem eigenen Selbstverständnis nach verstand sich Innocenz als Stellvertreter des Christus bzw. als Vikar des Gottes der Christenheit selbst und also nicht mehr, wie dessen Vorgänger, nur als Nachfolger des Apostels Petrus - bei der Wiederkehr seines Weihetages deklarierte er sich dann auch in päpstlicher Selbstbescheidenheit als in die Mitte gestellt zwischen Gott und die Menschen und insofern zwar geringer als Gott, aber bei weitem größer als alle Menschen, als der von Gott legitimierte Richter über alle Menschen, selbst von niemand zu richten, nur seinem Gott verpflichtet.178 Aufgrund dieser Stellung beanspruchte er gottähnliche Universalgewalt im Sinne innerkirchlichen Vorrangs in Bezug auf die Glaubenslehre und die Organisation der Kircheninstitution wie auch als Vorherrschaft gegenüber allen irdischen Machthabern.179 Denn der Papst sei schließlich der Bevollmächtigte desjenigen, der über die weltlichen Könige herrscht, Fürsten gebietet und irdische Reiche nach Gutdünken vergibt, und deshalb Herrscher nicht nur über die ganze Kirche, sondern für die gesamte Welt.180 Zwar gestand Innocenz vor dem Hintergrund der sog. Zwei-Schwerter-Theorie dem Bereich des Politischen durchaus einen gewissen Eigenraum zu181, jedoch in Ausnahmefällen182 nahm er sich Rechtsbefugnisse und die Verpflichtung politischer Einwirkungen heraus, um seinen Anspruch auf Vollgewalt einzulösen. Denn königliche Gewalten erhielten seiner erklärten Auffassung nach ihre Autorität grundsätzlich nur von der bischöflichen Autorität des Papstes, wie der Mond, der die Nacht befehlige und damit die weltliche Macht zum Ausdruck bringe, sein (fahles) Licht nur von dem der Sonne bekomme, die als das größere Licht den Glanz päpstlicher Autorität verkörpere183