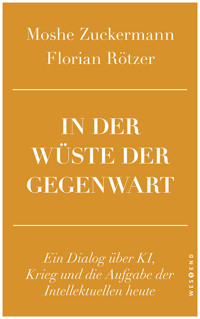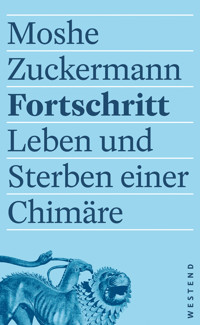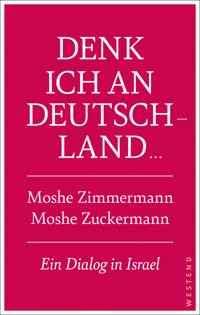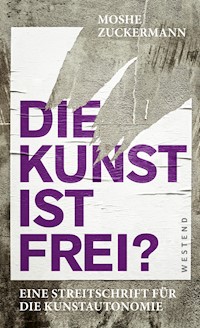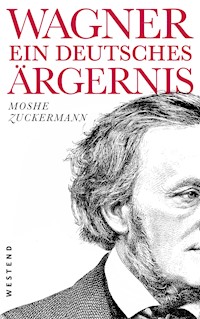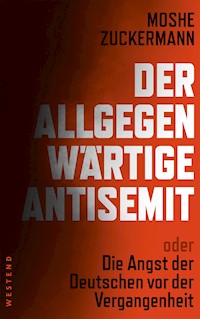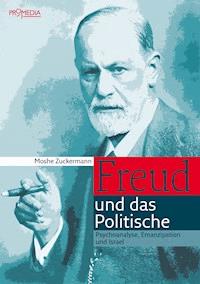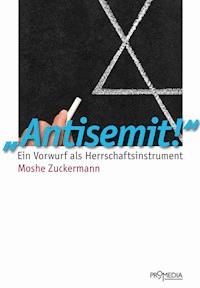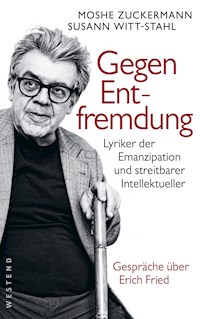
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 6. Mai 2021 jährt sich der 100. Geburtstag von Erich Fried. Moshe Zuckermann und Susann Witt-Stahl beleuchten das dichterische Werk des herausragenden Literaten Frieds und sein engagiertes Wirken als Marxist, Friedenskämpfer und Antifaschist. Zugleich liefert das Buch eine Diagnose der dramatischen Defizite kritischer Theorie und Praxis in unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ebook Edition
Moshe ZuckermannSusann Witt-Stahl
Gegen Entfremdung
Lyriker der Emanzipation und streitbarer Intellektueller
Gespräche über Erich Fried
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-825-9
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Vorbemerkung
Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Erich Fried am 6. Mai 2021 haben wir eine Reihe von Gesprächen über den bedeutenden Lyriker und Intellektuellen geführt. Der Gedankenaustausch begann Mitte Oktober 2020 und wurde Anfang Februar 2021 abgeschlossen. Er umfasst Analysen und Ansichten zu Frieds dichterischem Werk, seinem Wirken als marxistischer Denker und Aktivist sowie zur zeitgenössischen und gegenwärtigen Rezeption des ebenso hochbewunderten wie auch oftmals verhassten und verleumdeten Schriftstellers. Die Erträge unseres Dialogs finden sich in diesem Band. Herzlich danken möchten wir dem Schauspieler Rolf Becker für das Vorwort, das er verfasst hat.
Moshe Zuckermann und Susann Witt-Stahl Tel Aviv und Hamburg, im März 2021
Vorwort
Erich Fried würde sich freuen, könnte er das nachstehende Gespräch lesen. Er würde vermutlich wie zu seinen Lebzeiten kritische und selbstkritische Anmerkungen einbringen – vor allem zu der für ihn kaum voraussehbaren, allenfalls zu erahnenden Entwicklung, die mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus ein Jahr nach seinem Tod begann und sich seitdem in Unheilvolles steigert. Was vor 1989 als Systemauseinandersetzung wahrgenommen wurde, enttarnt sich mit fortschreitender Krise als Versuch imperialistischer Staaten, sich schrittweise die Welt gefügig, wenn nicht untertan zu machen:
Dann wieder
Was keiner geglaubt haben wird
was keiner gewusst haben konnte
was keiner geahnt haben durfte
das wird dann wieder das gewesen sein
was keiner gewollt haben wollte1
1987, bereits gezeichnet von seiner schweren Krebserkrankung und den daraus folgenden Operationen, wurde Fried der Goldene Schlüssel der Stadt Smederevo im damals noch relativ friedlichen Jugoslawien verliehen. Zwölf Jahre später, am 24. März 1999, begann mit dem Krieg der NATO, zugleich dem ersten Angriffskrieg, an dem Deutschland seit 1939 beteiligt war, die endgültige Zerschlagung Jugoslawiens – Auftakt zur Einkreisung Russlands und Chinas. Große Teile der Industrieanlagen Smederevos mit dem größten Stahlwerk des Landes wurden zerstört und mit der Donaubrücke die Verbindung in den Norden Jugoslawiens, der Wojwodina, unterbrochen. Noch heute, 22 Jahre nach dem Bombardement, leiden und sterben dort Menschen an den Folgen freigesetzter Giftstoffe aus den nahe gelegenen Chemiebetrieben von Pančevo und Novi Sad sowie der erstmals großflächig eingesetzten Uranmunition. »Was keiner geahnt haben durfte« – Erich Frieds Warnungen, sein »Hass gegen das Sterben/ […] unter den Händen der Mörder/ von morgen/ die heute schon leben«2 wurden und werden seitens der Obrigkeiten und der ihnen verpflichteten Medien überhört, zurückgewiesen, diffamiert; sie wurden und werden aber auch von vielen als hilfreich wahrgenommen, beispielsweise jenen, die er bei Straßenprotesten, Großdemonstrationen wie 1969 gegen die Notstandsgesetze im Bonner Hofgarten oder auf Veranstaltungen wie dem Vietnamkongress 1969 ansprach und die sich wie wir heute dank seiner literarischen Hinterlassenschaft auf ihn beziehen können bei der Suche nach Gemeinsamkeit schaffender Orientierung. »Außer diesem Stern, dachte ich, ist nichts und er/ Ist so verwüstet./ Er allein ist unsere Zuflucht und die/ Sieht so aus«3 – Bertolt Brechts bitterbesorgte Äußerung von 1949 konkretisierte sich in Dichtungen und bei Auftritten von Erich Fried. Einerseits scheute er die Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland und nach Österreich, Länder, deren Sprache die seiner Dichtungen blieb: »Wen politische Ereignisse geschädigt haben, der wird politisch hellhörig, vielleicht überempfindlich«; andererseits interessierte ihn der in den Sechzigerjahren aufkommende Widerstand gegen die Restaurationsentwicklung in Westdeutschland, gegen Adenauers Definition der Bundesrepublik als »Wächter der westlichen Welt gegen die Einflüsse aus dem Osten« – im Klartext nicht nur der Studentenbewegung: als Aufmarschgebiet gegen die DDR und die Sowjetunion.
Aus diesem Zusammenhang, denke ich, ergaben sich auch Erich Frieds Reisen nach Bremen, wo ich ihn im Herbst 1969 im kurz zuvor eröffneten Buchladen von Bettina Wassmann kennenlernte, der bald zum Treffpunkt der damaligen »linken Szene« werden sollte. Fried interessierte, was genau zu den Schülerunruhen geführt hatte, deren Anlass die Erhöhung der Straßenbahnpreise gewesen war. Das Eingreifen mehrerer Tausend der in den Bremer Stahlwerken der Klöckner AG Beschäftigten, das Auftreten ihres Betriebsratsvorsitzenden Bonno Schütter aufseiten der vor dem Rathaus demonstrierenden Schülerschaft hatten den Senat der Hansestadt zum Nachgeben gezwungen. Frieds Fragen konzentrierten sich auf ein mögliches Zusammengehen von Studenten- und Arbeiterbewegung (wie ansatzweise 1968 in Frankreich) sowie auf die von ihm erhoffte Verbreiterung des Widerstands gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetzgebung, die Hetze der Springerpresse.
Für mich überraschend: Hier war ein Poet, der sich nicht nur mit seinen Schriften – wie der Gedichtsammlung und Vietnam und, die für uns zur selbstauferlegten Pflichtlektüre geworden war –, sondern sich konkret und öffentlich beteiligte. Freundlich und behutsam fragend und nachfragend, meist lächelnd, manchmal fast hilflos wirkend – aufgehoben zugleich durch sein Bestehen auf Genauigkeit und Detailinformationen: Was beispielsweise bei den Protesten gegen die Notstandsgesetze zur Besetzung des Bremer Theaters geführt habe, wie Intendanz und Kulturbehörde darauf reagiert hätten; was denn nur den Regisseur und Schauspieldirektor Peter Zadek, dessen Familie zur Zeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland Vergleichbares erlitten hatte wie seine, veranlasst habe, sich von den Schülerunruhen zu distanzieren mit seiner im Spiegel veröffentlichten Erklärung, wo sich mehr als drei Deutsche im Gleichschritt bewegten, handle es sich um Nazis.
Nach den Jahren der Schüler- und Studentenunruhen trafen wir uns nur noch gelegentlich, meist zufällig, ohne uns zu verabreden – nie hätte ich gewagt, ihn nach seiner Erreichbarkeit zu fragen. Die Themen unserer damaligen Gespräche: die Rote-Armee-Fraktion (RAF), Vietnam, Israel-Palästina. Mich erfüllte dankbare Übereinstimmung mit allem, was er über Ulrike Meinhof geschrieben hatte, unterschiedliche, teils auch differierende Einschätzungen gab es zur RAF: Als kritische Mitglieder der Gewerkschaften lehnten wir ihren Alleingang mit den daraus resultieren tödlichen Konsequenzen politisch ab, bestanden aber gegenüber der moralisch-bürgerlichen Verurteilung ihres Handelns auf unserer Wahrnehmung, dass sich hier eine Gruppe dem gleichen Gegner entgegenstellte wie wir – unter Einsatz ihres Lebens. So schrieben wir 1974:
Die Befreiung der Arbeiterklasse und aller Unterdrückten ist nur möglich durch den Kampf gegen die tausend Stricke, mit denen die Arbeiterschaft an diese Ordnung gefesselt ist und die von den Massen selbst zerrissen werden müssen.4
Erich Fried ließ den Aufsatz, den ich ihm gegeben hatte und dem das Zitat entnommen ist, mir gegenüber unkommentiert, jedoch nicht in seinen Schriften:
Die Gewalt
[…]Das Grundgesetz der Gewalt lautet: »Recht ist, was wir tun. Und was die anderen tun das ist Gewalt«
Die Gewalt kann man vielleicht nie mit Gewalt überwinden aber vielleicht auch nicht immer ohne Gewalt5
Vietnam: Der Krieg war vorbei, hatte mit der ersten und bis heute größten militärischen Niederlage der USA geendet. Erich Frieds Interesse galt den Auswirkungen auf diese beiden am Krieg beteiligten Länder. Am 1. Mai 1975 hatte ich auf dem Flug nach Nakhon Phanom, der US-Airbase in Thailand an der Grenze zu Laos, ein Gespräch mit einem amerikanischen Offizier, der mir fassungslos, erschüttert, unter Tränen des Zorns seine eben gekaufte Zeitung mit der Titelzeile »Takeover« – Machtübernahme durch den Vietkong – reichte. So viele seiner Kameraden hätten in dem zehnjährigen Krieg ihr Leben lassen müssen (die Millionen Opfer in Vietnam erwähnte er nicht), nur weil das Pentagon »die Bombe« nicht eingesetzt habe. Nur an das Kopfschütteln von Erich Fried kann ich mich erinnern, seine Antwort findet sich in den Zeilen von Gedichten wie:
Was bleibt?
[…]Zorn bleibt und Widerstand und keine Ruhe Und Wünsche bleiben auch einfache Wünsche für Menschen […]6
»Und Wünsche bleiben …« Israel und Palästina – mir bleibt hier nur, auf die nachstehenden brieflich geführten Gespräche von Moshe Zuckermann mit Susann Witt-Stahl zu verweisen. Beiden verdanke ich Einsichten, die mir sonst, nach dem Tod mehrerer Freunde in beiden Ländern, kaum zugänglich gewesen wären. Nicht nur die Verhältnisse in Israel und die von Israel zu Palästina und ihre außenpolitischen Beziehungen haben sich verändert, sondern vor allem die Verhältnisse hierzulande im keineswegs mehr »geruhsamen Deutschland«, von dem einst Heinrich Heine schrieb.
Wenige Jahre nach meiner einzigen Israel-Palästina-Reise 1981 begegnete ich, wieder einmal zufällig, Erich Fried auf einem Flug. Wir hatten reichlich Zeit, die aber nicht reichte, um uns auszutauschen über das, was ihn seit seiner Kindheit bewegte und ihm bis zuletzt am Herzen lag:
[…] Solidarität mit allen unschuldig Verfolgten und Benachteiligten, auch etwas wie Mitverantwortlichkeit für das, was Juden in Israel den Palästinensern und anderen Arabern tun; auch für das, was sie in aller Stille jenen Juden antun, die dagegen kämpfen und protestieren.7
Er schlug eine Fortsetzung unseres Gesprächs bei sich zu Hause in London vor. Unsere erste Verabredung, zugleich unsere letzte Begegnung.
Bevor ich sterbe
Noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens damit doch einige wissen: Es ist nicht warm aber es könnte warm sein
Bevor ich sterbe noch einmal sprechen von Liebe damit doch einige sagen: Das gab es das muss es geben
Noch einmal sprechen vom Glück der Hoffnung auf Glück damit doch einige fragen: Was war das wann kommt es wieder?8
Die Frage der letzten Zeilen dieses Gedichtes liest sich zugleich als Aufforderung, uns der Stellungnahme angesichts gegenwärtiger politischer Konflikte nicht zu verweigern; wie auch Erich Fried nicht, der 1984 – wenige Jahre nach seinem Bevor ich sterbe und trotz seiner Erkrankung, die ihn bereits auf das nahende Ende seines Lebens verwies – unnachgiebig versicherte: »Ich bin Ihnen/ noch nicht zu alt geworden/ um mich zu empören.«9 In diesem Sinn gebe ich den folgenden Dialog, der mit seiner Kritik der Verhältnisse – in Israel, Palästina, vor allem in Deutschland – auf die Möglichkeit und Notwendigkeit ihrer Veränderung verweist, dankbar weiter.
Rolf Becker Hamburg, im Februar 2021
Einleitung
Susann Witt-Stahl (SWS)
Erich Fried galt in der Bundesrepublik ab den Sechzigerjahren bis zu seinem Tod 1988 als Ikone der politischen Lyrik. Als marxistischer Intellektueller, der regelmäßig die zahlreichen Leichen im Keller des postfaschistischen Deutschlands ausgrub und mit ihnen eine Dauerpräsentation der vergangenheitspolitischen Schande veranstaltete, wurde er von seinen Anhängern als »Stören-Fried« verehrt und von seinen zahlreichen Gegnern als ebensolcher zum Teufel gewünscht. Nicht zuletzt auch, weil er mit seinen ideologiekritischen Sprachexperimenten und seinem Wortwitz den wachsenden Orwellianismus in der politischen Kultur der spätkapitalistischen Gesellschaft karikierte und damit dessen Urheber und Profiteure bloßstellte. Die größten Erfolge feierte er allerdings mit seiner Liebeslyrik, nicht zuletzt, weil in dieser das »Herz der herzlosen Zeit« pochte, wie es in seinem Gedicht Du heißt, und darin seine grenzenlose Menschlichkeit Ausdruck fand, mit der er der Liebe einen Erkenntnischarakter zusprach und besonders an die kämpfende Linke die Erwartung richtete, sich schon im Heute moralisch nicht mehr so zu verhalten, wie es der Mensch im Stande der Unfreiheit tut, sondern wie er es nach seiner Befreiung tun müsste:
Zusätzliche Bedingung
Wichtig
ist nicht nur
dass ein Mensch
das Richtige denkt
sondern auch
dass der
der das Richtige denkt
ein Mensch ist.1
Was könnte es noch und gerade in unserer Gegenwart sein, das seine Werke und sein Wirken noch anrühren könnten?
Moshe Zuckermann (MZ)
Nun, es kommt darauf an, wer sich von seinem Schaffen angezogen fühlt. Man darf heute wahrscheinlich davon ausgehen, dass die allermeisten Deutschen eher nichts mit Frieds Marxismus und radikaler Politik- und Gesellschaftskritik am Hut haben. Jene, die sich von ihm angezogen fühlen, tun es wohl, weil sie seine Gesinnung teilen beziehungsweise das zunehmende Absterben dieser Gesinnung betrauern. Mit Fried haben sie einen herausragenden Vertreter ihrer Weltanschauung, der so brillant war, dass sie sich bei ihm gleichsam noch geborgen fühlen dürfen. Aber es mag da, gerade was seine Gedichte anbelangt, noch etwas eine Rolle spielen: Fried war ein Liebeslyriker allerhöchsten Ranges – ich scheue mich nicht, ihn mit Heine zu vergleichen –, der sich einer Vorstellung von Liebe verpflichtet sah, nach der sich die Menschen ein Leben lang sehnen. Eine Liebe, die sich klischiert-romantischer Schwärmerei entzieht, sie oft gar konterkariert, und dennoch voller Hingebung, ja zuweilen total ist.
SWSZu seinem Marxismus und seinen linksradikalen Positionen, die immer dann die Gemüter vor allem der bürgerlichen Rechten besonders erhitzten, wenn er sie in Form von provokativen Kommentaren zu konkreten tagespolitischen Ereignissen in die Öffentlichkeit trug, kam ja noch eine weitere Anschauung, nämlich ein kompromissloser jüdischer Humanismus, der schon zu seiner Zeit weitgehend nicht mehr existierte und heute völlig marginalisiert ist. Das passte gar nicht in die Landschaft einer BRD, die sich damals gerade mit einer »Wiedergutmachungspolitik« gegenüber dem Judenstaat Israel das Ticket für den Wiedereintritt in die Riege der »zivilisierten Nationen« erkauft hatte, um an der Seite der USA vor allem wirtschaftlich die Geschicke auf dem Globus mitzubestimmen. Fried betonte ja oft, dass er nicht stolz sei auf sein Judesein, weil es schließlich kein Verdienst sei, von jüdischen Eltern gezeugt worden zu sein, aber seine jüdische Identität war ihm keineswegs gleichgültig.
MZEs ist in der Tat so, dass Judentum, wenn es nicht orthodox-religiös definiert ist, eigentlich schwer bestimmbar ist. Es stimmt, Judesein ist kein Verdienst, was es aber doch heißt, Jude zu sein, ist mitnichten ausgemacht. Zunächst, weil es selbst im Religiösen verschiedene, einander heftig bekämpfende Strömungen gibt: das orthodoxe nichtzionistische Judentum, das nationalreligiösen Zionismus und Messianismus miteinander verknüpfende Judentum sowie das Reformjudentum, welches das archaisch-traditionelle Judentum zu modernisieren trachtet. Wenn man aber vom Religiösen absieht, gibt es zudem das Judentum als Schicksalsgemeinschaft oder als weitgehend säkular lebensweltlich perpetuierte Tradition. Bedeutend für den hier erörterten Zusammenhang ist freilich jenes Judentum, das sein Selbstverständnis aus der Reaktion auf die geschichtliche Leiderfahrung der Juden bezieht. Der daraus sich bildende rigorose Humanismus besagt im Wesentlichen, dass der aus der Leiderfahrung Konsequenzen ziehende Jude keiner Gesinnung anhängen darf, die Weltanschauung und Praxis der Verfolger und Täter historisch reproduziert. Das Andenken der jüdischen Opfer, letztlich aber aller Opfer dieser Welt insgesamt, werde besudelt, wenn man sich mit der Haltung der Täter identifiziert. Nirgends bei Fried gewinnt dieses Grundpostulat seiner Gesinnung deutlicheren und unerbittlicheren Ausdruck als in seinem erschütternden Poem Höre Israel.
SWSIch denke, ein Leitmotiv seines gesamten Werks und ein zentrales Movens seines Schaffens war der von Adorno formulierte »neue kategorische Imperativ«: Die Menschen im Stande der Unfreiheit haben »ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«.2 Dessen eingedenkend hat er eine Sensibilität für dem Faschismus an der Macht entsprungene gefährliche Kontinuitäten und auch für die Alltagsbarbarei der kapitalistischen Gesellschaft im Normalzustand eingeklagt und beharrlich vor einer regelmäßig verdrängten Tatsache gewarnt: Die Bedingungen der Möglichkeit der Wiederholung sind keineswegs aus der Welt geschafft. So erzeugte auch jedes Anzeichen von mangelnder Wachsamkeit bei Antifaschisten, jeder Ansatz von Saturiertheit und Selbstgefälligkeit, besonders zur falschen Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen, großes Unbehagen bei ihm. Beispielsweise machte er in einer Notiz über die Feierlichkeiten zum »Tag der Befreiung« von 1985 darauf aufmerksam, dass Gedenken ohne das Eintreten für eine radikal andere politische Praxis letztlich nichts als ein leeres Ritual und damit eine Erscheinungsform des kalten Vergessens ist:
Es ist gut, das Dritte Reich überlebt zu haben, die Ermordeten und ihre Mörder, und wohlbehalten, was immer das heißen mag, angekommen zu sein in dieser heutigen Zeit. Aber solange die Machthaber an der Macht sind, die das Wettrüsten weitertreiben, und solange immer noch Atomraketen aufgestellt werden und solange Sprachregelungen der Wahrheit im Wege stehen und solange der Geist des Befehlens und des solchen Befehlen Gehorchens andauert und solange die, die dagegen kämpfen, verfolgt und verleumdet werden – hier nicht minder als dort –, ist das nicht Anlass genug zu einer Befreiungsfeier.3
MZDas scheint mir von außerordentlicher Bedeutung, der Bezug auf Adorno mithin in der Tat sehr treffend zu sein. Denn das allzu selbstgefällige »Zur-Ruhe-Kommen« der unachtsamen politischen und gesellschaftlichen Kritik wurzelt in einer historischen optischen Täuschung, die den Unterschied zwischen der Wirkmächtigkeit des dramatischen Geschichtsereignisses und der der weniger sichtbaren Strukturbedingungen seiner Entstehung, vor allem aber seines Fortwirkens nicht genügend beachtet. In diesem Sinne äußerte Adorno bereits 1966, dass jede Debatte über Erziehungsideale »nichtig und gleichgültig« sei jenem zentralen Erziehungsziel gegenüber, dass sich Auschwitz nicht wiederhole. Auschwitz, meinte er, sei die Barbarei gewesen, gegen die alle Erziehung gehe, und fügte dann bezeichnenderweise hinzu:
Man spricht vom drohenden Rückfall in die Barbarei. Aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er; Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen. […] Der gesellschaftliche Druck lastet weiter, trotz aller Unsichtbarkeit der Not heute. Er treibt die Menschen zu dem Unsäglichen, das in Auschwitz nach weltgeschichtlichem Maß kulminierte.4
Was sich da bei Adorno wie eben auch bei Fried abbildet, ist zweierlei: zum einen der Schock und die von diesem herrührende Sprachlosigkeit angesichts des Zivilisationsbruchs des Holocausts. Man muss dabei bedenken, dass niemand von sich behaupten konnte, auf das Grauen von Auschwitz von vornherein vorbereitet gewesen zu sein. Auch der Marxismus, der den Faschismus so hochkarätig durchschaut und theoretisch durchdrungen hatte, musste vor der Unsäglichkeit dieses einzigartigen Rückfalls in die Barbarei verstummen. Zum anderen begriffen Adorno und Fried, dass Auschwitz eben nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus konkreten, empirisch rekonstruierbaren gesellschaftlichen Bedingungen erwachsen war. Und diese waren mitnichten »nach Auschwitz« aus der Welt geschafft. Daher auch das Postulat, die Barbarei bestehe weiterhin, solange die Bedingungen fortdauerten. Daraus gebot sich auch für sie die Haltung des kritischen Nicht-zur-Ruhe-Kommens. Es sei hervorgehoben, dass es dabei um die strukturellen Bedingungen der Barbarei ging, die als solche unterschiedliche Erscheinungen zeitigen mochten, der Holocaust also nicht relativiert werden, sondern zum Maßstab dessen, was durch Auschwitz menschenmöglich, also historisch geworden war, genommen werden sollte.
SWSFür ein »kritisches Nicht-zur-Ruhe-Kommen« war Fried wohl schon lebensgeschichtlich prädestiniert. Kurz bevor Stefan Zweig – der bereits 1934 aus Wien nach Großbritannien geflohen war und später ins brasilianische Exil gelangte – seinen Abgesang auf Die Welt von Gestern anstimmte, musste Fried seine Geburtsstadt verlassen und fand Zuflucht in London. Dort hatte er zwar bis zum Lebensende seinen Wohnsitz, konnte es aber nicht als neue Heimat betrachten. Anders jedoch als Zweig, den die Zerstörung seiner Lebenswelt, seine Entwurzelung und die langen Jahre »heimatlosen Wanderns« 1942 in den Freitod treiben sollten, betrachtete Fried, wie sein Sohn Klaus in einem von einem Kollegen und mir geführten Interview betonte, seine
Zuflucht insofern als Exil, als er dieses fremde Land (was Großbritannien für ihn in gewisser Weise immer blieb) als eine Art Aussichtspunkt nutzte, um von dort aus auf sein eigenes kulturelles Erbe zu schauen. Es ermöglichte ihm eine Objektivität, die es ihm erlaubte, sowohl mit der deutschen Sprache zu leben, als auch genug Abstand zu gewinnen, um sie vor dem stumpfen Erbe der faschistischen Ideologie zu retten.5
Für Erich Fried bedeutete Sprache offenbar Überleben. Denn er brauchte sie, um seinen tiefen seelischen Schmerz (etwa vom Anblick des durch die Prügel der Gestapo geschundenen Vaters, der kurz darauf einer schweren Magenverletzung erlag), seine Verzweiflung über Krieg, Massenmord und Unterdrückung beredt werden zu lassen, aber auch als Munition für die Waffe seiner Kritik, mit der er sich gegen die ihn verstörenden Verhältnisse verteidigte, indem er sie angegriffen hat. So heißt es in einem Gedicht aus dem 1950 veröffentlichten Zyklus Reich der Steine:
Die ersten Schritte
[…]
Denn wenn ich jetzt verstumme
kann ich mich nie mehr heben
und keinen Wert mehr haben
und nicht mehr schauen nach oben.6
Fried hat also auch die von Auschwitz diktierte Sprachlosigkeit mit Sprache überwunden. Der Literaturwissenschaftler Gerhard Lampe, der eine bemerkenswerte Biografie über Fried verfasst hat, schrieb darin: »In der Sprache hat Fried, wenn nicht eine Heimat, so doch ein Asyl gefunden.«7 Aus dieser Perspektive des »Asylanten« und zur Wanderschaft Genötigten, der, auch wenn er sich vor weiterer Verfolgung in Sicherheit bringen konnte, als Migrant und wohl auch als Jude ein Marginalisierter blieb, ist vielleicht auch sein unverstellter Blick als Dichter auf die Welt zu erklären, die, wie er meinte, nicht bleiben darf, wie sie ist.
MZJa, das gilt nicht nur für Fried, sondern für viele jüdische Asylanten der damaligen Zeit. Adorno hat bekanntlich seine Rückkehr nach Deutschland aus dem US-amerikanischen Exil mit der Unverzichtbarkeit der Sprache für ihn, und zwar der deutschen Sprache, begründet. Man kann natürlich im Exil leben und die Sprache des Gastlandes annehmen, aber das hat zumeist nicht geklappt – man vergleiche die Schriften Adornos im Deutschen mit seinen auf Englisch verfassten Texten; da findet sich ein Niveauunterschied ums Ganze. Für viele bedeutete die deutsche Sprache Heimat und nicht nur Asyl, wie denn die deutsche Kultur für viele schlechterdings unersetzbar war. Auch zahlreiche aus Nazideutschland nach Palästina emigrierte Juden haben diesen Sprach- und Kulturverlust nie so recht verwunden. Und es ist bezeichnend, wie gerade die deutschen Juden, die Verhassten und Vertriebenen, sich von ihrer Muttersprache nicht oder nur schwer zu trennen vermochten. Das war tragisch, denn es handelte sich letztlich um eine einseitige Liebe. 1964 formulierte es Gershom Scholem wie folgt:
Ich bestreite, dass es ein […] deutsch-jüdisches Gespräch in irgendeinem echten Sinne als historisches Phänomen je gegeben hat. Zu einem Gespräch gehören zwei, die aufeinander hören, die bereit sind, den anderen in dem, was er ist und darstellt, wahrzunehmen und ihm zu erwidern. Nichts kann irreführender sein, als solchen Begriff auf die Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Juden in den letzten 200 Jahren anzuwenden. Dieses Gespräch erstarb in seinen ersten Anfängen und ist nie zustande gekommen.8
Es ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass Frieds unverstellter Blick als Dichter auf die Welt sich im Exil und selbst dann in dem zum neuen Residenzland gewordenen Exil nur auf Deutsch erhalten konnte. Dichter war er auf Deutsch, und nur mit dieser Sprache, die auch die Sprache seiner barbarischen Verfolger war, konnte er kämpfender Dichter werden.
SWSAuch die Forderung des unermüdlichen Kampfes gegen das Vergessen war eine Grundkoordinate seines Denkens, die er nicht zuletzt schonungslos an, manchmal sogar gegen sich selbst richtete. Er war dafür bekannt, dass er ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte, »auch für schlechte Sachen«, betonte er in einem Interview für das DEFA