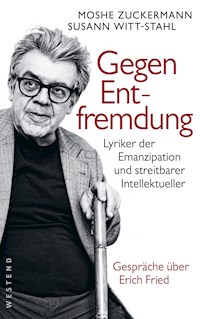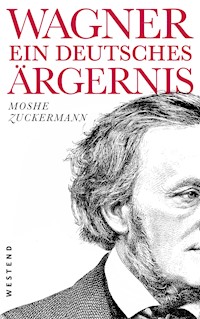13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Ungeist geht um in Deutschland - in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus werden wahllos und ungebrochen Begriffe durcheinandergeworfen, Menschen perfide verleumdet und verfolgt, Juden von Nicht-Juden des Antisemitismus bezichtigt. Die Debattenkultur in Deutschland ist vergiftet und die Realität völlig aus dem Blickfeld des Diskurses geraten. Deutsche solidarisieren sich mit einem Israel, das seit mindestens fünfzig Jahren Palästinenser knechtet, und wer das kritisiert, wird schnell zum Antisemiten. Moshe Zuckermann nimmt in seinem Buch den aktuellen Diskurs schonungslos in den Blick und spricht sich für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der deutsch-israelischen Geschichte aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ebook Edition
Moshe Zuckermann
Der allgegenwärtige Antisemit
oderDie Angst der Deutschen vor der Vergangenheit
Mit einem Beitrag von Susann Witt-Stahl
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-720-7
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Vorwort
Ein Ungeist geht um in Deutschland – es ist, als habe sich der Orwellsche Neusprech ein neues Feld für seine realhistorische Manifestation gesucht und es gefunden: im Antisemitismusdiskurs des heutigen Deutschland. Wahllos und ungebrochen werden Begriffe durcheinandergeworfen, Menschen perfide verleumdet und verfolgt, Juden von Deutschen des Antisemitismus gezeiht, eine gesamte Debattenkultur in ein Tollhaus neuralgischer Befindlichkeiten und unaufgearbeiteter Ressentiments verwandelt, wobei sich linke Gesinnung nach rechts wendet und rechte Ideologen sich den Anschein der Liberalität zu geben trachten. Im Mittelpunkt des Wirrsals steht der Nahostkonflikt beziehungsweise der israelisch-palästinensische Konflikt, der aber nicht etwa historisch, politisch, ökonomisch oder sonst wie analysiert wird, sondern lediglich die Plattform für das gesteigerte Toben von Meinungen, Zuschreibungen, Schmähungen und selbstgefälligen Parteinahmen darstellt. Es geht indes letztlich vordringlich um das Verhältnis von Deutschen zu Juden, um die Last der deutsch-jüdischen Vergangenheit und um ihre perversen Auswirkungen auf den gegenwärtigen deutschen Diskurs über diese Kategorien. Und weil Judentum, Zionismus und Israel in diesem inadäquaten, ideologischen Gerangel gleichgestellt werden, um daraus – negativ gewendet – die widersinnige Gleichstellung von Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik abzuleiten, diese Gleichstellung sich aber zum unerbittlichen Glaubensbekenntnis verfestigt hat, gerät die Realität völlig aus dem Blickfeld des Diskurses: Deutsche solidarisieren sich mit einem Israel, das seit mindestens fünfzig Jahren Palästinenser knechtet, und wenn man sie darauf hinweist, dass diese Solidarität nicht haltbar ist, gerät man in ihrem Munde zum Antisemiten, zum Israelhasser oder gar zum sich selbsthassenden Juden. Dies alles soll in der vorliegenden Schrift erörtert werden. Um aber das argumentative Niveau zumindest ein wenig zu wahren, mögen im Folgenden einleitend Anmerkungen zu den Begriffen des Holocaust und der Holocaust-Erinnerung angeboten werden. Sodann sollen in einem gesonderten Kapitel die Kategorien des Zionismus und des aus ihm in die Welt gekommenen Staates Israel im Hinblick auf dessen Geschichte und Strukturen, Widersprüche und Konfliktachsen anvisiert werden. Erst nachdem die Kategorien der realen Verhältnisse und der ihnen innewohnenden moralischen Dimension, von denen hier ausgegangen wird, dargelegt worden sind, soll es in den folgenden Kapiteln an die Analyse des in Deutschland grassierenden Ungeists und seiner bedenklichen Wirkungen gehen, nicht zuletzt im Hinblick auf die von besagter ideologischen Realitätsverweigerung herrührenden moralischen Defizite. Zunächst aber eine Anmerkung in eigener Sache.
Ich bin 1949 in Israel geboren. 1960 sind meine Eltern nach Deutschland emigriert, wo ich das zweite Jahrzehnt meines Lebens verbrachte. 1970 bin ich aus bewusster zionistischer Entscheidung nach Israel zurückgekehrt und lebe seitdem in diesem Land, vermutlich auch für den Rest meines Lebens. Es ist mein Land, in dem Sinne, dass sich in ihm meine Lebenswelt gebildet hat, dass ich seine Kultur aufgesaugt habe, seine Sprache spreche und meine berufliche Laufbahn in ihm verfolgt habe. Ich sehe dieses Land aber auch äußerst kritisch, weil es sich zu etwas entwickelt hat, das nicht nur zu meinen Vorstellungen der Jugendzeit in einem krassen Gegensatz steht, sondern weil es meines Erachtens auch in einem Gegensatz zu jedweder humanen, aufgeklärten und friedlich ausgerichteten Gesellschaft steht. In dieser kritischen Einstellung haben sich sowohl Enttäuschung als auch ein lebensgeschichtlich geformtes Involvement sedimentiert. Das sehen viele meiner Landsleute anders. Es soll in dieser Schrift um die Erörterung dessen gehen, warum dem so ist. Gewiss ist eins: Wenn der von Israel praktizierte historische Weg der Zionismus ist, dann bin ich schon seit Jahrzehnten kein Zionist mehr. Ich war nie Antizionist im Sinne des Postulats, dass der Zionismus überhaupt nicht in die Welt hätte kommen dürfen. Aber ich bin eben auch kein Zionist, wenn der Zionismus das ist, als was er sich in Israel manifestiert. Man muss kein Zionist sein, um in Israel zu leben, gar leben zu wollen. Man hat es nur nicht leicht. Aber auch das ist Teil meines Selbstverständnisses.
Den Band beschließt ein Gastbeitrag der Publizistin Susann Witt-Stahl. Sie betrachtet das Phänomen der erklärtermaßen als »Abbruchunternehmen der Linken« agierenden »Antideutschen« in ihrer Funktion als Verfechter einer ideologischen Vergangenheitspolitik zu Gunsten deutscher Eliten und Großmachtinteressen. Nicht zuletzt in der Verherrlichung von kriegerischer Gewalt und dem emphatischen Hass auf das humanistische Judentum dieser und verwandter politischer Strömungen erkennt Witt-Stahl nicht nur eine Kontinuität deutscher Zustände, sondern auch faschistoide und andere regressive Tendenzen.
Moshe Zuckermann, Tel Aviv, im Juni 2018
Holocaust und Holocaust-Erinnerung
Dass eine Nomenklatur ideologisch werden kann, dürfte inzwischen mehr oder minder als Gemeinplatz gelten. Das hat nicht nur mit der epistemologischen Krise hinsichtlich des Adäquanzverhältnisses von Gegenstand und Begriff beziehungsweise von Benennung und Benanntem zu tun, sondern die Benennungspraxis selbst scheint sich zuweilen solcherart verselbstständigt zu haben, dass es aussehen mag, als ginge es mittlerweile um nichts mehr als um agonale Grabenkämpfe, bei denen Geschichte, Welt und Wirklichkeit, wenn schon nicht ganz und gar ignoriert, so doch in die Zweitrangigkeit des Epiphänomens verwiesen werden. Ideologisch kann eine Benennung aber auch dann werden, wenn sich im Namen die bewusste, aber eben auch nicht nur bewusste beziehungsweise vorbewusst manipulative Verhüllung oder Entstellung des Benannten niederschlägt. Eine Nomenklatur ist immer dann ideologisch, wenn etwas am Benannten heteronom seinem Begriff entschlagen wird, genauer, wenn der Nennungsbegriff das Benannte für heteronome Interessen dahingehend zurichtet, dass die Wahrnehmung des Benannten wesenhaft affiziert, der Gegenstand der Wahrnehmung mithin regelrecht unkenntlich gemacht wird.
Dabei hat der relativ neutrale Umgang mit der Benennung dessen, was als »Zweiter Weltkrieg« kodiert worden ist, spätestens bei dem am europäischen Judentum verübten Völkermord seine Grenzen. Dies ist nicht allein dem Umstand geschuldet, dass sich im Geschichtsereignis »Zweiter Weltkrieg« mehr historische Tiefenschichten und materielle gesellschaftliche Strukturen sedimentiert haben, als der Begriff je zu indizieren vermag, sondern vor allem deshalb, weil mit der Massenvernichtung der Juden etwas geschichtlich Präzedenzloses eingetreten war, etwas, das zunächst in der Tat namenlos bleiben musste, weil seine Unsäglichkeit der adäquaten Namensgebung entbehrte. Nicht von ungefähr ist in diesem Zusammenhang der diagnostische Begriff des »Zivilisationsbruchs« geprägt worden;1 denn allein schon die Vorstellung, dass der Rückfall in die Barbarei durch die Zivilisation, beziehungsweise durch die immanente Logik ihres neuzeitlichen Laufs gezeitigt worden war, musste ihr eigenbegriffliches, optimistisch-linear durchwehtes, aufklärerisch motiviertes Selbstverständnis brüchig werden, ihre selbstherrliche Eigenvorstellung ins Schwanken geraten lassen.
Nun können bekanntlich Bildverbote und Namenstabus nie wirklich durchgehalten werden. Die sprachlichen Paraphrasen, die zur Kennzeichnung der geschichtlichen Monstrosität entstanden, wie »industrielle Massenvernichtung der Juden« oder »Massenvernichtung des europäischen Judentums«, waren kommunikationstechnisch zu unökonomisch. Es etablierten sich denn bald prägnante Bezeichnungen – etwa die frühzeitig konsensuell im Hebräischen eingeführte »Shoah« oder das im Deutschland der Fünfzigerjahre als Pars pro Toto häufig gebrauchte »Auschwitz«. Schon »Shoah«, als die von der Sprache der Heiligen Schrift bezogene »höchste Katastrophe« oder »der totale Untergang«, belässt den innerhistorischen Kausalzusammenhang der Katastrophe im Unbestimmten: Nicht nur mag sie gottgewollt sein, sondern auch unter säkularen Gesichtspunkten wäre im Hebräischen »Shoah« als Bezeichnung von verheerenden Auswirkungen einer großen Naturkatastrophe zulässig. Als erst recht prekär erweist sich der über das amerikanische Englisch in den Nomenklatur-Diskurs eingedrungene, ursprünglich altgriechische Begriff des »Holocaust«, der zwar die Bedeutung von »Inferno« und »Zerstörung« angenommen hat, ursprünglich jedoch »Brandopfer« beziehungsweise – als das attributive holókaustos – »völlig verbrannt« meinte. Wenn schon die religiöse Dimension eines quasi Unabwendbaren in Zusammenhang mit der jüdischen »Shoah« mehr als problematisch erscheint, nimmt sie sich mit dem vom außerjüdischen Sprachduktus geprägten »Holocaust« als höchst fragwürdig, wenn nicht gar blank ideologisch aus. »Brandopfer« enthält nicht nur die latente Deutung von schicksalhafter Heimsuchung, sondern vermittelt auch mutatis mutandis das Moment einer (religiös durchwehten) Apologie.
In jedem Fall soll hier nicht die Geschichte der Massenvernichtung des europäischen Judentums, sondern das Problem ihrer ideologischen Vereinnahmung beziehungsweise ihrer instrumentalisierenden Ideologisierung anvisiert werden. Gerade die einschneidende Bedeutung des Realereignisses für die Erfahrung und das Verständnis der modernen Zivilisation (gewisse philosophische Strömungen würden gar von der Zivilisation insgesamt reden wollen) macht es notwendig, dem Problem seiner ideologisierten Rezeption nachzugehen. Der Begriff »Holocaust« mag hierfür einstehen.
Seit Martin Walsers umstrittener Friedenspreis-Rede von Oktober 19982 macht im deutschen Diskurs das Wort von der »Instrumentalisierung« des Holocaust-Andenkens die Runde. Dass Walser dabei von der »Instrumentalisierung der Schande« redete, mithin die Betonung auf die Befindlichkeit(en) des Tätervolkes legte, weniger, wenn überhaupt, von dem Unsäglichen, das den historischen Opfern widerfahren war, sprach, gab die Marschroute für die alsbald infolge der Rede entbrannte Debatte an: Von privatem Gewissen war da die Rede, von »durchgängiger Zurückgezogenheit in sich selbst« und »innerlicher Einsamkeit«, womit das Problem der Auseinandersetzung mit den kollektiv begangenen Verbrechen entkollektiviert, die Erörterung diesbezüglicher moralischer Belange entöffentlicht wurde. Solcherweise ins Subjektive verfrachtet, konnte denn die Frage der bildlichen Rezeption der weltgeschichtlichen Monstrosität als die eines individuell-psychischen Durchhaltevermögens abgehandelt werden. Da man Auschwitz instrumentalisiere, es als »Moralkeule« fremdbestimmt gebrauche, böte sich Verdrängen und Wegschauen als heilsames Gegenmittel an. Nicht alles müsse man ertragen, schon gar nicht als sensibler Privatmann. Dass freilich Walser mit diesen die »durchgängige Zurückgezogenheit in sich selbst« postulierenden Gedanken nicht in »innerlicher Einsamkeit« verharrte, sondern ganz im Gegenteil sie mit größter Verve vor breitester Öffentlichkeit verkündete, mochte die Vermutung aufkommen lassen, ihm selber gehe es nicht so sehr um seinen privaten Seelenfrieden, sondern darum, den deutschen Diskurs über den Holocaust nachhaltig zu beeinflussen; um etwas Politisches also. War das legitim?
Die Antwort hierauf bemisst sich zunächst nicht am Inhalt. Denn eine wie auch immer ausgerichtete Instrumentalisierung der Vergangenheit ist letztlich unumgänglich: Weder dem Einzelnen noch dem Kollektiv ist es möglich, historisch Geschehenes nicht durch die »Brille« des Gegenwärtigen wahrzunehmen und zu erinnern; man kommt ja sozusagen nicht aus seiner eigenen Haut heraus. Und da sich die sozialen, politischen und kulturellen Bedingungen der Wahrnehmung fortwährend ändern, wandelt sich auch die Erinnerung – sie ist stets kontextgebunden. Damit sind nicht nur negative Interessen, fremdbestimmte Bedürfnisse und ideologische Verblendungen gemeint, sondern, im Gegenteil, auch nachmaliges Wissen, tiefergehende Reflexion von bereits Gewusstem oder schlicht: die sogenannte »zeitliche Perspektive«. So ist beispielsweise das Schweigen um den Holocaust in den ersten Jahren nach der israelischen Staatsgründung durchaus durch die instrumentellen Interessen, die der staatstragenden, um die Heranbildung des »Neuen Juden« bemühten Ideologie des Zionismus zugrunde lagen, erklärbar; nicht minder jedoch spielten dabei in den realen Lebenswelten Momente des noch akuten Traumas, des überlebensstrategischen Bedürfnisses nach Verdrängung und andere psychische Hinderungsfaktoren bei der Auseinandersetzung mit der Monstrosität des Geschehenen eine gewichtige Rolle. Es sollte in manchen Fällen Jahrzehnte dauern, ehe sich die seelische Bereitschaft einstellte, die eigene Biografie zu konfrontieren. Ähnliches gilt strukturell (obschon unter gänzlich verschiedenen Vorzeichen) auch für die alte Bundesrepublik. Das Beschweigen der verbrecherischen deutschen Vergangenheit im restaurativen Klima, das die Fünfzigerjahre der alten Bundesrepublik beherrschte, ermöglichte sich nicht zuletzt durch die zeitgeschichtliche »Notwendigkeit«, die BRD als Bollwerk gegen den befürchteten Vorstoß des Kommunismus in den Westblock, mithin in die »Völkergemeinschaft« zu integrieren. Die unerhörte Leichtigkeit, mit der die »Entnazifizierung« vorgenommen, und die Schnelligkeit, mit der sie abgeschlossen wurde, gehören in die subkutane Geschichte jener Zeit des bereits tobenden Kalten Krieges. Nicht wenige Historiker vertreten indes noch heute die Ansicht, dass ein solches (Be-)schweigen Voraussetzung für die Entwicklung der alten BRD zur dann immerhin funktionierenden liberalen Demokratie war. Für US-amerikanische Juden avancierte der Holocaust zudem zu einer Art säkularer Ersatzreligion, nicht zuletzt im Zuge eines sich zunehmend pluralisierenden Identitätsdiskurses.
Instrumentalisierung im Sinne einer gleichsam »verträglichen« Integration von historisch Geschehenem in die späteren Perzeptions- und Rezeptionsbedingungen ist, so besehen, nahezu unumgänglich. Zu klären bleibt dabei freilich, wann diese notwendige Vereinnahmung des Vergangenen durch das Gegenwärtige ins Heteronome umschlägt, und zwar solcherart, dass die gegenwärtige Erinnerung sich dem zu Erinnernden wesenhaft entfremdet. Vom Inhalt aus kann also nicht jede Form instrumentalisierender Erinnerung als legitim erachtet werden: Spätestens wenn das Wesen des zu Erinnernden im Hinblick auf fremdbestimmte Zwecke entstellt worden ist, wird man behaupten dürfen, dass zumindest, was die herkömmliche Raison d’Être gemeinhin postulierten Gedenkens anbelangt, ein »unzulässiger« Umgang mit der Vergangenheit stattfindet.
Ausgangspunkt adäquaten Gedenkens muss demgemäß die Erörterung des Wesens des zu Erinnernden bilden. Dabei stößt man freilich, gerade im Falle des Holocaust- Andenkens, auf gravierende Schwierigkeiten. Denn nicht nur lässt sich das Unsägliche der weltgeschichtlichen Katastrophe noch immer weder in ihrer historischen Genese noch in ihren realen Manifestationen bis zum Letzten ergründen; schon das Bestreben, partikulare und universelle Dimensionen der Monstrosität, verschiedene Perspektiven der Täter- und Opferkollektive, aber selbst noch die im Opferkollektiv vorherrschende Heterogenität unter einen umfassenden, gleichsam allgemeingültigen Einheitsbegriff zu subsumieren, scheint sich zunehmend konsensuellem Einvernehmen zu entziehen. Das hat größtenteils damit zu tun, dass die nunmehr über siebzig Jahre währende Holocaust-Rezeption das Geschichtsereignis interessengeleitet ideologisiert, nicht minder aber auch damit, dass das akkumulierte historische Wissen darum und die sich allmählich einstellende zeitliche Perspektive ein zunehmend differenzierteres Bild davon geschaffen hat. Wenn aber die sowohl in Israel beanspruchte als auch in Deutschland im Rahmen der Mahnmal-Debatte3 thematisierte »Einzigartigkeit der Shoah der Juden« nolens volens in eine (wie immer begründete) Hierarchisierung der Holocaust-Opfer ausartet, stößt man unversehens auf etwas Wesenhaftes: Gerade weil sich das Geschichtsbild mittlerweile ausdifferenziert hat, gerade weil das nachmalige Wissen um die Pluralität der Identitäten seiner Protagonisten und ihre zunehmend enttabuisierte »Zulassung« zum aktuellen Holocaust-Diskurs einer einheitlichen Sicht der weltgeschichtlichen Monstrosität offenbar zuwiderläuft,4 lässt sich ein ihm innewohnendes Moment der gemeinsamen universellen Grundlage bestimmen – der Stand der Opfer qua Opfer und (komplementär dazu) der Täter qua Täter.
So trivial sich dieser offensichtliche, zudem noch dichotom simplifizierte Tatbestand ausnehmen mag, kodiert er doch jenes allgemeine Moment, um welches es zunächst bei jedem adäquaten Gedenken dessen, was historisch geschah, gehen muss: um die Tatsache, dass das, was als »Rückfall in die Barbarei«,5 als »Zivilisationsbruch« beziehungsweise als »Sonnenfinsternis der westlichen Zivilisation« apostrophiert worden ist, etwas im historischen Kontext Geschehenes, von Menschen an Menschen Verübtes ist; dass es also um politische Prozesse, gesellschaftliche Strukturen, kulturelle Zusammenhänge und um Ideologien geht. Dass es sich um industrialisierte, bürokratisch angeordnete, administrativ verwaltete Formen der Massenvernichtung von Menschen, also um eine auf modernen Institutionen basierende, gerade im sich der emanzipativen Aufklärung und zivilisatorischen Fortschritts rühmenden Kulturraum zugetragene Praxis der Barbarei handelt. Die Opfer im Stande ihres Opfer-Seins und die Täter in dem ihres Täter-Seins zu erinnern, heißt, jene historischen Zusammenhänge ergründen zu lernen, welche Menschen letztlich Täter beziehungsweise Opfer haben werden lassen. Es heißt aber zugleich auch, sich der Einsicht zu verschreiben, dass die jenen historischen Zusammenhängen zugrunde liegenden Strukturen, mithin die stete Drohung eines potenziellen Rückfalls in die Barbarei, noch keineswegs aus der Welt geräumt sind, dass sie ganz im Gegenteil, dem verblendeten Alltagsblick allgemeinen materiellen Wohlstands und gesellschaftlicher Behaglichkeit freilich unsichtbar geworden, welthistorisch durchaus fortwesen.
Damit ist mitnichten gesagt, dass das spezifisch Jüdische an der Shoah der Juden ignoriert werden könne. Was an Juden verbrochen worden ist, ist ihnen als Juden widerfahren. Das sollte sich vor allem die deutsche Gedenkkultur stets vor Augen halten. Es muss gleichwohl auch festgehalten werden, dass die vermeintlich homogene jüdische Identität den Juden als solchen zumeist »von außen« (d.h. von Nichtjuden) aufgezwungen wurde; dass sie also objektiv als solche bestimmt wurden, ohne dass dabei ihre eigene – subjektive – Selbstbestimmung beachtet worden wäre. Dass also Juden auf der Rampe von Auschwitz orthodox-religiös, traditionell oder atheistisch, dass sie kommunistisch, konservativ oder liberal, dass sie arm oder reich, gebildet oder ignorant, zionistisch, nicht zionistisch oder gar antizionistisch sein konnten; dass sich darüber hinaus im heutigen Israel die Holocaust-Diskurse orthodoxer und säkularer, aschkenasischer und orientalischer, neu eingewanderter und alteingesessener, alter und junger Juden gravierend unterscheiden mögen, verweist darauf, dass der Begriff des Jüdischen am Holocaust eher die objektive Fremdbestimmung des Juden als solchen meint, weniger, wenn überhaupt, das individuelle Selbstverständnis. Aber genau das ist es, was die Juden qua Juden zum eigentlichen Paradigma der weltgeschichtlichen Monstrosität erhebt. Denn eines war all den Juden des Holocaust, spätestens auf der Rampe von Auschwitz, und zwar unabhängig von ihrer »vormaligen« Identität, von ihrer nationalen, ethnischen, kulturellen, klassenmäßigen Zugehörigkeit, gemeinsam: Sie wurden alle zu Opfern; und jene, die sie zu solchen machten, wurden zu Tätern. Die praktisch vollführte, systematisch betriebene Vernichtung der Juden als einer zur Ausrottung vorbestimmten Menschenkategorie hat sie folglich zur paradigmatischen Verkörperung der Opfer im welthistorischen Maßstab werden lassen.
Es ließe sich, so besehen – über das authentische partikulare Andenken hinaus –, das Andenken der Juden im Stande ihres Opfer-Seins als ein Allgemeines denken. Ohne die spezifische Erinnerung eines bestimmten Kollektivs an seine Opfer antasten zu wollen, könnte die paradigmatische Dimension des jüdischen Holocaust-Schicksals zur Grundlage universeller Erinnerung der Opfer erhoben werden, wobei es dann freilich keiner partikular bestimmten – religiösen, ethnischen, nationalen – Identität der Opfer mehr bedürfte, sondern ebendessen, was alle auf der Rampe von Auschwitz bereits waren und erst recht schon bald nach der vermeintlich noch sortierenden Selektion wurden: Opfer. Die anonymisierende Tendenz entspräche dabei einerseits der inneren Tendenz des weltgeschichtlichen barbarischen Gewaltaktes, konterkarierte aber andererseits die ebendiesem Gewaltakt zugrunde liegende Ideologie: Die zur Ausrottung bestimmten »Untermenschen« würden allgemein – enthierarchisiert! – als Menschen erinnert werden. Menschen (und keine Dämonen) haben den Holocaust an Menschen (und keinen »Untermenschen«) verbrochen.
Die kollektive anamnetische Handlung verfolgt also einen Doppelzweck. Zum einen ist sie bestrebt, der konkreten historischen Opfer zu gedenken. Die Vorstellung Walter Benjamins von der Erinnerung als einem »rettenden« Akt6 spielt dabei eine zentrale Rolle, darf allerdings nicht narzisstisch vereinnahmt, oder ideologisch verdinglicht werden. Schon in absehbarer Zukunft, wenn die Generation der Opfer und der Täter nicht mehr da sein wird, dürfte sich diese Gedenkpraxis ohnehin größtenteils in die Sphäre der Erinnerungskulturen partikularer Lebenswelten und des individuellen, privaten Andenkens verlagern. Zum anderen versteht sich aber der kollektive Erinnerungsakt als Grundlage einer auf die Zukunft ausgerichteten Handlungsmaxime. Das »Wozu?« der Erinnerung ist hierbei »instrumentell« rasch beantwortet: Auf dass »Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«7. Was damit praxisbezogen einhergeht, ist denkbar einfach, letztlich trivial. Denn wenn es primär darum geht, die historischen Bedingungen des Holocaust als politische Prozesse, gesellschaftliche Determinanten, kulturelle Zusammenhänge und Ideologien zu begreifen, zudem die Einsicht aufrecht zu halten, dass die Strukturen, die diesen historischen Bedingungen zugrunde liegen, noch keineswegs aus der Welt geräumt sind, dann kann es sich bei diesem – der Opfer im Stande ihres Opfer-Seins gedenkenden – Erinnerungsakt um nichts anderes als um eine jene Strukturen radikal bekämpfende, sie aus der Welt zu räumen bestrebte politische, soziale und kulturelle Praxis handeln. Nur eine jeglichem Rassendünkel, ethnisch motiviertem Vorurteil, autoritärer Obödienzgesinnung und gesellschaftlicher (auch wirtschaftlicher) Ausgrenzung, Verfolgung und Ausbeutung rigoros entgegentretende, mithin um wirkliche Demokratie, soziale Gerechtigkeit, kulturellen Pluralismus und vor allem um menschliche Freiheit bemühte, politische Praxis wäre im Stande, die gesellschaftlich bedingte, historisch entstandene und kulturell legitimierte Existenz von Opfern als solchen tendenziell aufzuheben, somit aber auch der historischen Opfer im Stande ihres Opfer-Seins wahrhaft zu gedenken.
Zu bedenken gilt es gleichwohl immer wieder, dass sich die Gedenkpraxis allzu leicht in eine verdinglichte Handlungsroutine und ein fetischisiertes Lippenbekenntnis umschlagen, die Praxis mithin zur manifesten Ideologie gerinnen kann. Das Gebetsmühlenartige zeremoniellen Gedenkens, welches Martin Walser aus prekärster Motivation angriff, droht in der Tat das »rettende« Moment des Gedenkens zu entsorgen, solange es das schlecht Bestehende mit der Patina moralisierender Wohlanständigkeit affirmativ überzieht. Das gilt für die Selbstviktimisierungsrhetorik der gewaltdurchwirkten israelischen politischen Kultur in nicht minderem Maße als für die larmoyanten Normalisierungsdiskurse der nunmehr historisch zu sich gekommenen Bundesrepublik, mag aber auch an der Ideologie des abstrakt proklamierten, zugleich aber interessengeleitet massiv vollzogenen Kampfes der USA gegen die selbst konstruierte »Achse des Bösen« deutlich abgelesen werden. Die Auschwitz-Matrix hat zurecht eine perennierende Idiosynkrasie in die Welt gesetzt – der Rückfall in die Barbarei droht nunmehr nicht nur, sondern hat in der Tat »nach weltgeschichtlichem Maßstab«8 stattgefunden; das lässt sich bei aller Verdrängung aus keinem politisch adäquaten Bewusstsein mehr auslöschen. Zu fragen gilt es freilich, wie das in emanzipativer Absicht erhaltene Gedenken aus den Fängen der es zurichtenden Ideologisierungstendenz zu befreien wäre. Letztendlich nur durch die Einrichtung befreiter gesellschaftlicher Praxis, aber vorerst durch die kritische Reflexion dessen, was das an Auschwitz für immer zu Gedenkende zur Ideologie des »Holocaust« hat verkommen lassen.
Wäre somit das Problem der Instrumentalisierung zu Ende erörtert, gar aus der Welt geschaffen? Mitnichten. Denn es stellt sich heraus, dass auch die sich emanzipativ dünkende Politpraxis oft (und erstaunlich leicht) in den Modus heteronomer Instrumentalisierung emanzipativer Ziele und Inhalte zurückfällt. Man kann, wie sich zunehmend erweist, den Begriff des »Opfers« selbst solcherart vereinnahmen und fremdbestimmten Zwecken unterwerfen, dass der vermeintliche Kampf gegen Menschen und Konstellationen, die das Opfer zu einem solchen haben werden lassen, ins Gegenteil seines Selbstverständnisses umschlägt. In Israel und Deutschland ist dies besonders deutlich zu beobachten.
In Israel fällt auf, mit welch ideologischer Verve sich eine Freund-Feind-Dichotomie breitgemacht und nachgerade staatsoffiziell etabliert hat. Man postuliert freudig den »Ausnahmezustand« und verschreibt sich der ideologischen »Ernüchterung« von vermeintlich naiven Friedensbestrebungen, der politischen Abkehr von vormaliger pazifierender Gesinnung, der Verfemung von »Verrätern«, die sich solcher Abkehr widersetzen, und dem Suhlen in chauvinistisch-patriotischem Schlamm. Den Wenigsten fällt dabei auf, dass in gewissen Zeiten, insbesondere solchen, in denen der »Ausnahmezustand« einer verbrecherischen Praxis des eigenen Kollektivs geschuldet ist, gerade der Widerstand gegen die eigenen »Freunde«, die Loslösung von »natürlichen« Bindungen und die bewusste Eigenwandlung zum »Feind« ideologischer Selbstviktimisierung würdig wären, als wahrhafter Patriotismus ausgelegt zu werden. Zentral wirkt sich dabei die instrumentelle Vereinnahmung der Opferkategorie aus: Man basiert die Selbstviktimisierung auf der paranoiden Grundannahme, dass »alle Welt gegen uns« sei, auf dem religiös begründeten Fundamentalglauben, dass »wir allein in der Welt« seien, mithin uns »in alle Ewigkeit auf Waffengewalt« werden stützen müssen – ohne aber Rechenschaft darüber ablegen zu wollen, welchen gravierenden Anteil man an der Genese der beklagten »Einsamkeit« selbst hat beziehungsweise wie blind man mittlerweile gegenüber dem unabweisbaren Kausalnexus zwischen der israelischen Gewaltanwendung gegen die Palästinenser und der weltweiten Verurteilung Israels angesichts dieser verbrecherischen Okkupationspraxis geworden ist. Sich selbst als Opfer zu wähnen, während man sich historisch zum Täter gewandelt hat, ist letztlich nichts weiter als moralischer Verrat an den historischen Opfern des eigenen Kollektivs, deren (beziehungsweise deren »Andenken«) man sich perverserweise bedient, um die eigene, gewaltdurchwirkte, immer neue Opfer erzeugende Politik zu rechtfertigen. Denn genau das bedeutet ja, der Opfer im Stande ihres Opferseins nicht gedenken zu wollen. Wer sich selbst bewusst einmauert, darf sich nicht wundern, dass es ihm im eigenen Gemäuer einsam werden mag, unter Umständen sogar lebensbedrohlich einsam; wenn er aber diese Einsamkeit zur Ideologie erhebt, mithin das eigene falsche Bewusstsein mit der Erinnerung an die Verfolgungsgeschichte des eigenen Kollektivs verfestigend begründet, dann instrumentalisiert er nicht nur das Andenken der Opfer nämlicher Verfolgungsgeschichte, sondern pervertiert es aus letztlich narzisstischen Beweggründen und Bedürfnissen.
Komplementär zu dieser Entwicklung in Israel hat sich in Deutschland eine gewisse (nicht zuletzt staatsoffizielle) Israel-Solidarität herangebildet, die sich aus einer abstrakt ideologisierten »Empathie« mit »den Juden« speist, welche sich ihrerseits als historische Schuldabtragung dem »jüdischen Volk« gegenüber begreift und darstellt. Das Instrumentalisierende dieser »Solidarität« erweist sich nicht nur daran, dass man im Namen der historischen Opfer, die das eigene Täterkollektiv geschaffen hat, einem repressiv agierenden und sich gewalttätig ausrichtenden Israel die Konformität zugesteht, sondern vor allem daran, dass die Beweggründe solcher Konformität eher mit dem zu tun hat, was Walser im Jahre 1998 artikuliert hat als mit dem Andenken an die historischen Opfer als solche. Das mag sich widersinnig ausnehmen – hat doch Walser öffentlich (und mit suggestiver Emphase) proklamiert, wie sehr ihm die vorherrschende Andenkenspraxis zuwider ist, wohingegen die Israel-«Solidarisierer« genau das Gegenteil vertreten, nämlich die Permanenz des »Andenkens« mittels der unabdingbaren Solidarität mit Israel. Was aber beiden Seiten gemeinsam ist, darf nicht am Inhalt ihrer Proklamationen bemessen werden, sondern an dem sie (nolens volens gemeinsam) antreibenden Impuls: dem narzisstischen Umgang mit der Schuld, der spätestens dann zur Ideologie gerät, wo die eigene identitäre Befindlichkeit zum Masstab der Verhaltenspraxis »den Juden«, »dem Zionismus« und »Israel« gegenüber erhoben wird. Der Realitätsverlust dem realen Israel gegenüber ist angelegt in dem Drang, sich aus geschichtlichen Gründen mit »den Juden« solidarisieren zu wollen, welche aber als Abstraktum nichts mit realen Juden, geschweige denn mit den historischen Opfern der Naziverbrechen zu tun haben. Die Abkoppelung der »Juden« als Projektionsfläche von realen Juden sowie von den historischen Opfern der Nazi-Verfolgung ist, so gesehen, in der instrumentalisierenden Gedenkpraxis, die ihrerseits einer primär narzisstischen Befindlichkeitsregulierung entstammt, angelegt. Die neuralgische Reaktion vieler Platzhalter solcher »Israel«- und »Juden«-Solidarität auf die Aufforderung, sich real auf Juden und Israel einzulassen, bezeugt und reproduziert stets das mittlerweile zur kruden Ideologie verkommene Grundmuster besagten »Gedenkens«.
Die Kritik der Instrumentalisierung von historischer Vergangenheit zur Verfolgung fremdbestimmter Interessen in aktuellen Zusammenhängen und Bezügen sieht sich also zweierlei Problemen ausgesetzt: Zum einen muss sie davon ausgehen, dass eine wie immer geartete Vereinnahmung von Vergangenem durch dessen Rezeptionspraxis schon dadurch unumgänglich ist, dass man sich der Last späteren Wissens und der entsprechenden Aufladung des Vergangenen mit Inhalten des Gegenwartskontexts schlechterdings nicht entschlagen kann. Zu fragen bleibt dabei einzig, in welcher Absicht instrumentalisiert wird und, insofern man sich der Erinnerung als Andenken verschreibt, inwiefern im Andenkensprozess das Wesen des zu Erinnernden – bei aller heteronomen Vereinnahmung – erfasst und gewahrt wird. Zum anderen kommt man aber nicht um die Einsicht herum, dass selbst noch die wohlmeinende, die Koordinaten des zu Erinnernden vermeintlich einhaltende Gedenkpraxis in die ideologische Falle einer sekundären Instrumentalisierung der Vergangenheit hineintappen mag. Nicht nur wirkt sich dabei eine interessengeleitete Emphase aus, die dem Fremdbestimmten in der Gegenwart das Primat über die Vergangenheit verschafft, sondern die damit einhergehende ideologische Verblendung trägt ein Eigenes dazu bei, das Wesen des zu Erinnernden vor dem Bewusstsein der Gegenwart immer hermetischer abzuriegeln. Dem ist einzig durch die fortwährende kritische Reflexion der Andenkenspraxis und der ihr zugrunde liegenden Gedenkmatrix beizukommen. Eine zutiefst sisyphische Unternehmung, die der Vermutung recht zu geben scheint, dass die authentische Erinnerung vergangenen Leids sich letztlich nur in einer Gesellschaft einzustellen vermag, die die Bekämpfung dessen, was das Leid gesellschaftlich generiert, zu ihrer eigentlichen Raison d‘Être hat werden lassen und zur moralischen Maxime erhoben hat. Eine Gesellschaft wäre dies mithin, in der die heteronome Instrumentalisierung der Vergangenheit sich erübrigt haben wird.
Israel
Wie soll man im Jahre 2018 über Israel schreiben? Keine leicht zu beantwortende Frage. Das »Sollen« scheint zunehmend eine Frage des Standpunkts zu sein. Und der Standpunkt ist schon längst nicht mehr die legitime Positionierung im Rahmen eines heterogenen Diskurses. Gewisse Standpunkte werden nur noch grob überrannt, niedergeschmäht und mit perfiden Mitteln dermaßen schmählich delegitimiert, dass man von einem wahren medialen Terror reden darf, von ideologisch zubereiteten Ausschlussmechanismen, die inzwischen bei der leisesten Regung von etwas nicht Akzeptiertem so ins Werk gesetzt werden, dass alle Maßstäbe einer rational geführten Debatte ins Wanken geraten und die kritische Debatte zur Kloakenrhetorik verkommt.
Die Rede ist hier von der Kritik an Israels Politik und deren Auswirkung auf die israelische Gesellschaft. Die Rede ist hier vom Zionismus als Staatsideologie Israels. Die Rede ist hier auch von Antisemitismus beziehungsweise der Verwendung der Kategorie des Antisemitismus und ihrer ideologisch prästabilisierten Instrumentalisierung im Rahmen des Diskurses um Israels Politik. Es ist in den letzten Jahren zum Konsens geronnen, Kritik an Israel als antizionistisch oder auch – rigoroser und unerbittlicher – gleich als antisemitisch zu apostrophieren. Man sprach früher in Deutschland von einem »Todschlagargument« und von der »Auschwitzkeule«. Das sind heute aber schon obsolete Begriffe, denn sie hatten, wie immer ideologisch bereits durchwirkt, das Argument noch zur Voraussetzung, mithin die Vorstellung von einer – sei’s noch so lippenbekenntnishaft proklamierten – diskursiven Erörterung. Das Faktische wird aber heute nur noch in Abrede gestellt; das falsche Bewusstsein zur Wahrheit erhoben; der schiere Versuch, etwas von der Analyse des real Unabweisbaren zu retten, der ideologisch verformten »Meinung« überantwortet.
Wie also im Jahre 2018 über Israel schreiben, wenn davon ausgegangen werden muss, dass Wahrhaftigkeit und Integrität nur noch ein böses Gefauche und ingrimmige Aggression zu zeitigen vermögen? Wie dem, was es gegen diese unzulängliche Reaktion anzuführen gilt, das Wort reden, ohne selbst in die Falle unzulänglicher Polemik zu verfallen? Es scheint, dass nichts an der traditionellen Methode der Argumentation, der faktischen Erörterung und der Analyse vorbeiführt, wenn man dem Ernst dessen, worum es hier geht, Gerechtigkeit widerfahren lassen möchte. Dass man es dabei mit maßloser Perfidie und ideologischer Borniertheit zu tun hat, darf einen nicht davon abhalten, um der Wahrhaftigkeit dessen, was auf dem Spiel steht, mit historischen, soziologischen und psychologischen Instrumentarien zu operieren. Dass dies nur bedingt auf Gehör stoßen dürfte, ist Teil dessen, was es zu erörtern gilt – bedauerlich, aber um der Wahrheit willen hinnehmbar.
Wer sind die Adressaten dieser einleitenden Worte und des ihnen folgenden Kapitels? Im Prinzip sowohl die Protagonisten des israelischen Diskurses als auch die des deutschen. Da es hier aber zunächst um Israel geht, mögen die israelischen Adressaten mit der Erörterung dessen bedient werden, was sie (vielleicht) schon wissen, aber konsequent zu verdrängen beziehungsweise in ein falsches Bewusstsein umzumodeln pflegen. Die deutschen Adressaten, die in den nachfolgenden Kapiteln direkt angesprochen werden, mögen sich hier über Grundlegendes informieren. Viele, allzu viele von ihnen haben es bitter nötig.
Ein einheitliches Narrativ gibt es für Israel nicht. Denn es kommt von vornherein nicht nur darauf an, wer der Sprecher des Narrativs ist (jüdischer Israeli, Palästinenser, orthodoxer Jude, säkularer Zionist oder nationalreligiöser Siedleranhänger, um nur einige der möglichen Kategorien aufzuzählen); es kommt auch darauf an, an welchem historischen Datum man das Narrativ ansetzt. Schon der geschichtliche Ausgangspunkt färbt die Struktur des Narrativs unweigerlich ein.
1897 – Der erste zionistische Kongress
Geht man von 1897 aus, dem Jahr des ersten zionistischen Kongresses, so hebt dieses Narrativ mit der historischen Genese des Zionismus an. Im Zionismus manifestierte sich zweierlei: zum einen die nationale Befreiungsbewegung der Juden im Rahmen des infolge der Französischen Revolution sich in Europa heranbildenden politischen Paradigmas der nationalen Selbstbestimmung, wobei sich freilich der Zionismus im Vergleich zu anderen nationalen Bewegungen unter stark abweichenden strukturellen Bedingungen zu entfalten hatte. Zum anderen die rigorose Loslösung von den traditionell ausgerichteten, religiösen Lebenswelten, wie sie sich über Jahrhunderte in zahlreichen Ländern als (ghetto- beziehungsweise schtetlmäßig) geschlossene Gemeinschaften generiert hatten. Sie kennzeichneten sich durch das religiös bestimmte diasporische Bewusstsein, das sie zwar in der messianisch beseelten Hoffnung trug, dereinst in das Land der Urväter zurückzukehren, aber im schroffen Gegensatz zu dem stand, was der Zionismus als säkularisierte, aktiv gewordene politische Bewegung vertrat.
Von Bedeutung war dabei, dass der Zionismus als eine reaktive Bewegung in die Welt kam. Er verstand sich ideologisch zum einen als Reaktion auf das »degenerierte Dasein« der Juden in ihren jeweiligen Wirtsgesellschaften, ein Dasein, das (gemäß zionistischer Vorhaltungen) von Wehrlosigkeit gegenüber Gewaltausbrüchen ihrer Umwelt, gebückter Haltung gegenüber Verfolgung und Diskriminierung und zumeist unproduktiver Arbeit in der Zirkulationssphäre geprägt war. Verdichtet hat sich diese Sicht jüdischen Lebens »im Exil« im zionistischen Ideologem der »Negation der Diaspora«. Zum anderen reagierte der Zionismus direkt auf den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich zunehmend herausbildenden und verfestigenden modernen Antisemitismus. Dieser unterschied sich vom traditionellen Judenhass primär darin, dass er nicht mehr religiös gespeist war – geboren in der säkularisierten bürgerlichen Gesellschaft, richtete sich das antijudaistische Ressentiment nunmehr vorwiegend gegen die Juden als soziale und ökonomische Kategorie. Ihm kam dabei entgegen, dass die Juden selbst einen – wie immer problembeladenen – Eingang in die bürgerliche Gesellschaft erfuhren. Mit der die westliche Moderne mitgenerierenden europäischen Aufklärung korrespondierte die jüdische Haskala sowie die Reformbewegung der jüdischen Religion, welche diese dem modernen Leben anzupassen trachtete.
Der Reaktion auf den Antisemitismus kam eine vielschichtige Funktion zu. Denn insofern das antisemitische Ressentiment auf dem (historisch entstandenen und entsprechend erklärbaren) »Fremden« an den Juden basierte, konfrontierte es die Juden mit dem ihnen vorgehaltenen »Problem«, auf welches sie – ob sie es nun wollten oder nicht – einzugehen hatten. Es waren nicht die Juden, die sich selbst als »Problem« empfanden, aber indem die Gesellschaft, in welche sie Eingang suchten, ihnen das »Problem« entgegenhielt, zwang sie sie, das »Problem« zu verinnerlichen und ihm »Lösungen« anzubieten. Man verfolgte dabei dreierlei Strategien, die sich allesamt auf den objektiven Zustand der Juden im Angesicht des sich verbreitenden Antisemitismus mehr oder minder bezogen. Man meinte zum einen, das »Problem« durch eine selbst auferlegte Assimilation, also Anpassung an die Wirtsgesellschaft, entkernen und neutralisieren zu können. Dem kam subjektiv entgegen, dass das säkularisierte Judentum ohnehin bestrebt war, den Habitus der Orthodoxie und die diesem eignenden, äußeren Kennzeichen abzulegen, um sich im Sinne des »deutschen Bürgers mosaischen Glaubens« zu normalisieren, mithin unliebsame Auffälligkeiten loszuwerden. Emanzipation bedeutete in diesem Zusammenhang nichts anderes als das Ablegen der historisch entstandenen Abweichungen von der Norm. Zum Zweiten bot sich der im 19. Jahrhundert an gesellschaftlichem Einfluss gewinnende Sozialismus für die jüdische Emanzipation an, allerdings nicht als Sonderlösung der »jüdischen Frage«, sondern als Emanzipation der Juden im Rahmen der allgemeinen Befreiung des Menschen, wie ihn der Sozialismus universell anstrebte. Dieser Ansatz forderte zwar eine gewisse »Selbstaufgabe« des Juden im Sinne des Ablegens dessen, was er gewohnt war, als seine besonderen Kennzeichen anzusehen – etwa die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft oder die geschichtlich geprägte, gesonderte Loyalität zum eigenen »Volk«. Dafür wurde er aber »entschädigt«, indem er sich einem Kampf anschloss, der darauf abzielte, die Gesellschaftsordnung, die ihn weltgeschichtlich zum prononcierten Objekt gesteigerter Verfolgung und Unterdrückung hat werden lassen, zu überwinden. Zum Dritten wuchs ebendie vom politischen Zionismus ins Leben gerufene historische Lösung der Gründung einer eigenen nationalen Heimstätte für das jüdische Volk heran. Aber die schiere Idee, den Judenstaat zu gründen, war zum Zeitpunkt ihrer gewachsenen Institutionalisierung – eben im Ersten Zionistischen Kongress von 1897 – mit historischen Widrigkeiten behaftet. Denn der Staat der Juden wurde in der Tat im Überbau einer nicht existierenden Basis gegründet. Damit die Basis bestehe, war es notwendig, ihr Territorium zu bestimmen. Das musste aber erst noch erobert werden. Für diese Eroberung aber war eine besiedelnde Bevölkerung nötig; es bedurfte der Ankunft eines kolonisierenden Volkes. Erst dann konnte der Staat als formaler Rahmen jener kolonisierenden Bewegung gegründet werden. Und erst nach der Gründung des Staates wurde die kritische Masse der nötigen Bürgerbevölkerung importiert. Der Staat der Juden, ausgesprochene Spätfolge der europäischen Nationalstaatsideologie, ist der einzige Staat der Welt, der ideell bestimmt wurde, bevor es die materielle Basis für die Verwirklichung seiner Idee gab; der territorial bestimmt wurde, ehe es das Kollektiv für die Besiedlung dieses Territoriums gab; der gegründet wurde, ehe die notwendige Bürgermasse für seine Existenz bestand. Ein basisloser Überbau also? Ein Überbau ohne gesellschaftliche Praxis? Nein. Denn das Bewusstsein der »Notwendigkeit« der Gründung eines Judenstaates ist durch das soziale Sein der (europäischen) »Diaspora« bestimmt worden. Das ist der historische Grund für die zentrale Rolle, die das Postulat der »Diaspora-Negation« in der zionistischen Ideologie spielte. Lange bevor der Zionismus wusste, was es mit dem »Neuen Juden«, den er postulierte, auf sich hatte, wusste er, was er nicht sein sollte: Er sollte das negative Abziehbild des »diasporischen Juden« bilden. Noch vor der Staatsgründung ereignete sich die Shoah. Die Eliminierung der realen Praxis dessen, was die »Diaspora-Negation« aufzuheben gedachte, ist primär nicht durch die Ideologie der »Diaspora-Negation« bewerkstelligt worden, sondern durch die Verwirklichung der rassistischen Vernichtungsideologie der Nazis. Was wäre der Judenstaat ohne den Antisemitismus des 19. Jahrhunderts? Was wäre er ohne Auschwitz? Und erwies er sich dann als prinzipielle Antwort auf diese, als Lösung des »jüdischen Problems« von ehedem?
1945 – Nach der Shoah
Bevor diese schwerwiegende Frage angegangen werden kann, seien hier drei weitere Narrative diesem ersten, sich auf 1897 als Ausgangspunkt beziehenden angefügt. Geht man nämlich von 1945 aus, intensiviert sich das ursprüngliche zionistische Narrativ durch die Monstrosität dessen, was mit 1945 sein Ende gefunden hat: die Shoah.
Wohl nie zuvor hat sich der konstitutive Charakter eines Geschichtsereignisses für die Gründung und Fortentwicklung eines Staates als so wirkmächtig erwiesen wie die Shoah für die Errichtung des Staates Israel und der nachfolgenden Herausbildung seines gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sowie seiner politischen Kultur. Die Dinge liegen offenbar klar auf der Hand. Denn wenn sich die Staatsgründung Israels als die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das exilierte jüdische Volk versteht, die Shoah aber als die aus der diasporischen Heimatlosigkeit geborene Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes begriffen wird, so stellt sich der Kausalnexus von Israel und der Shoah gleichsam von selbst her. Es ist kaum anzunehmen, dass sich ein aufgeklärter Mensch heute mit Vorbedacht einfallen ließe, den vom Zionismus so apostrophierten »Judenstaat« völlig getrennt vom modernen Geschichtsereignis des jüdischen Volkes par excellence zu denken. »Israel« und »die Shoah« haben sich im Bewusstsein der Menschen nach 1945 als so zusammengehörend eingebrannt, dass es nahezu als Sakrileg erscheinen mag, wenn schon nicht die Shoah getrennt von Israel, so gewiss Israel getrennt von der Shoah zu betrachten.
Dabei liegen die Dinge, genau besehen, ganz und gar nicht so klar auf der Hand. Denn nicht nur hatte sich der monströse Völkermord ereignet, bevor es den israelischen Staat überhaupt gegeben hat; nicht nur fand er in einer vom heutigen Israel fernen Region statt und widerfuhr Menschen, die weder israelische Staatsbürger sein konnten noch unbedingt eine Affinität zum künftig zu errichtenden Judenstaat aufwiesen; bis zum heutigen Tag lebt ein Großteil des jüdischen Volkes außerhalb der Grenzen des Staates Israel, und viele der Shoah-Überlebenden kamen nach Gründung des Staates nicht nach Israel, sahen mithin im Staat der Juden nicht unbedingt den Ort, in dem sie sich bei ihrem Neuanfang nach der Katastrophe einrichten, ihre Lebenswelt etablieren wollten. Schon daran erweist sich, dass die Verbindung von Israel und der Shoah eine eher ideelle ist und bereits von Anbeginn an sehr stark von einer ideologischen Dimension heteronomer Vereinnahmung durchwirkt war. Denn wenn die vermeintliche Selbstverständlichkeit des Nexus von Israel und der Shoah darauf beruht, dass die Errichtung des Staates Israel gleichsam die »Antwort« des jüdischen Volkes auf die ihm widerfahrene Katastrophe darstellt, dann setzt eine so gedachte Kausalverbindung das Hauptgewicht auf die Staatsgründung, womit die Geschichtskatastrophe der Shoah zum Epiphänomen eines ihr Nachfolgenden, quasi zum Argument gerät. Nimmt man aber die Unsäglichkeit der Shoah ernst, begreift man sie als eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte, als einen »Zivilisationsbruch«, dann verbietet sich die sinnstiftende Dimension der israelischen Staatsgründung; sie kann nichts zur Deutung der Shoah beitragen. Der Versuch, die Shoah zu begreifen, gar zu erklären, unterwirft sich somit unweigerlich ihrem sui generis