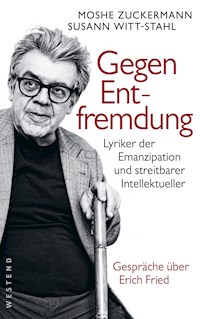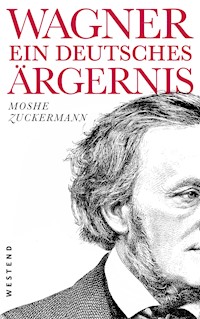15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seine politischen Führer und Ideologen haben den Staat Israel an eine historische Weggabelung manövriert, von der nur Sackgassen auszugehen scheinen. Israel sieht sich vor eine Wahl gestellt, die ihm letztlich nur zwei Möglichkeiten offenhält: Es kann sich zur Lösung des Konflikts mit den Palästinensern für die Zwei-Staaten-Variante entscheiden, d. h. eine Friedenslösung zwischen zwei souveränen Staaten Israel und Palästina akzeptieren. Israel kann aber auch eine territoriale Teilung zwischen Israel und Palästina torpedieren. Eine binationale Lösung wäre mit Entscheidungen verbunden, die den Zionismus - Israels Staatsideologie - gravierend belasten, ja das gesamte zionistische Projekt infrage stellen. Dass letztlich nichts an einer Zwei-Staaten-Lösung vorbeiführt, wie Zuckermann meint, leuchtet den meisten Politikern ein. Der Autor stellt daher die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die Rettung des zionistischen Projekts nicht wahrgenommen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Moshe Zuckermann Israels Schicksal
© 2014 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Lektorat: Hannes HofbauerGestaltung: Stefan Kraft
ISBN: 978-3-85371-823-0 (ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-375-4)
Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected]
Über den Autor
Moshe Zuckermann, 1949 in Tel-Aviv geboren, ist Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel-Aviv. Als Sohn von Holocaust-Überlebenden entschloss er sich nach zehnjährigem Aufenthalt in Deutschland mit 20 Jahren zur Rückkehr nach Israel. Er gilt als profunder Kritiker israelischer Politik. Zuletzt erschien von ihm bei Promedia: »›Antisemit!‹ Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument« (2010, 3. Auflage 2014, als E-Book erhältlich).
Inhalt
Vorwort
Im Juli 2014 war es wieder einmal so weit. Ein »Anlass« hatte die Gewaltspirale zwischen Israelis und Palästinensern so hochgeschraubt, dass ein neuer Krieg anstand. Israels Süden, aber auch Tel-Aviv wurden von Hamas-Raketen beschossen; die israelische Luftwaffe bombardierte »strategische Ziele« im Gazastreifen; die Hamas kurbelte die Propaganda des »Widerstands« gegen den »zionistischen Feind« an; das israelische Kabinett bestätigte die Rekrutierung von Zigtausenden Reservisten für eine mögliche Bodenoffensive, die dann auch kam, weil man sich mit einer »neuen strategischen Bedrohung« konfrontiert sah – dem weitverzweigten Tunnelsystem, das vom Gazastreifen bis an den Rand israelischer Siedlungen führt; die Palästinenser haben zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen bereits weit über 1000 Tote zu verzeichnen, unter ihnen viele Zivilisten, horrend viele Kinder; auf israelischer Seite sind es über 40 Tote, zum größten Teil Soldaten. In Israels Städten warnen Sirenen vor Luftangriffen; ganze Wohngebiete im Gazastreifen sind ein einziger Trümmerhaufen, dem Erdboden gleichgemacht. Das alte Szenario, das alte Spiel, neue Tote, neues Leid. Es war wieder, es ist immer wieder Kriegszeit.
Die Antwort auf die Frage, wie es wieder dazu gekommen war, kann nicht einfach gegeben werden. Sie hängt davon ab, wann man den »Anfang« der diesmaligen Gewalteskalation markiert, mithin, was der »Anlass« dazu war. Oder auch (kindisch gefragt): Wer hat diesmal angefangen? Abgebrühte politische Kommentatoren pflegen in solchem Zusammenhang die Interessenlage zu durchforsten: Die Hamas hatte Interesse am neuen Gewaltausbruch, weil sie sich gegenüber der PLO und in Anbetracht der Schläge, die sie durch israelische Militäraktionen im Westjordanland in den Wochen vor Ausbruch des Krieges erlitten hat, als souverän agierender Faktor profilieren musste. Von Netanjahu heißt es, er habe den bevorstehenden Waffengang nicht gewollt, wobei er aber die Entführung und Ermordung der drei israelischen Jugendlichen dazu instrumentalisiert hatte, einen Keil zwischen Hamas und PLO zu treiben und bei dieser Gelegenheit mit den Infrastrukturen der Hamas in der Westbank aufzuräumen, den »Anlass« also mitkreierte. Avigdor Lieberman, der aus taktischen Machterwägungen seine Partei vom Likud losgelöst hat, nutzte die Gewaltsituation aus, um sich durch forcierte Kriegstreiberei gegenüber Netanjahu zu profilieren. Ganz zu schweigen von Naftali Bennetts rechtsradikaler Agitation für einen massiven Waffengang, bei der machttaktische Überlegungen gekoppelt mit Förderung der Siedlerinteressen, als deren parlamentarischer Vertreter er gelten darf, eine gravierende Rolle spielten.
Man könnte auch wieder die Rolle der wie stets in Kriegszeiten gleichgeschalteten Medien anvisieren, die erneute Versammlung der Bevölkerung ums »nationale Stammesfeuer« sowie die Lust auf Brachialgewalt bei gewissen Militärinstanzen und Publizisten. Dies wäre aber müßig: Es war die ewige Wiederkehr des zur perfiden Ideologie geronnenen »Unabwendbaren«. Dass die eigentliche Ursache dieses Gewaltzirkels im Unwillen zum Frieden wurzelt, wurde erst gar nicht zur Sprache gebracht. Darin wussten sich Hamas und Netanjahus Regierungskoalition verschwistert. Der auf Gewaltlosigkeit setzende Mahmud Abbas ist wohl als Hauptverlierer aus diesem Waffengang hervorgegangen. Im Interesse daran dürfte es ebenfalls ein stilles Einverständnis zwischen Netanjahu und Hamas gegeben haben.
Nicht nur aus aktuellem Anlass wird dieser erneute mörderische Gewaltausbruch am Anfang des Vorwortes zu diesem Band angeführt. Von nicht minderer Bedeutung ist, dass er in seiner Ursache, seinem Ablauf und seiner Auswirkung einer Strukturlogik gehorcht, die im vorliegenden Band Thema ist. Denn es geht in diesem Band um Israel und seine Bereitschaft zum Frieden. Es geht um das historische Projekt des Zionismus als ideologische Raison d’être Israels. Es geht um die Zukunft des zionistischen Israel. Aber auch um mögliche Abgründe im Ursprung.
Die Grundüberlegung, die die Entstehung der vorliegenden Schrift angetrieben hat, ist in meiner eigenen intellektuellen Arbeit neueren Datums angesiedelt. Die Frage, warum sich das zionistische Israel in eine historisch ausweglose Situation manövriert hat, soll hier aus der Logik des Zionismus selbst, also von einer ihm immanenten Perspektive erkundet werden. Aber die Arbeit an den strukturellen Gründen für die anvisierte Grundeinsicht habe ich schon seit vielen Jahren verschiedenen Orts und in unterschiedlichem Rahmen vorgenommen. Ich habe in dieser spezifischen Hinsicht kaum etwas zu revidieren. Aus diesem Grund werden im vorliegenden Band auch, leicht überarbeitet, bereits publizierte Texte aufgenommen. Sie sind unabdingbar für die Argumentation der neuen Grundeinsicht, sind aber unabhängig von dieser entstanden – vielleicht aber fungierten sie zum Zeitpunkt der Entstehung als eine Art Vorbewusstsein für das hier Vorgetragene – die Sorge um Israels Zukunft und um die friedliche Lösung seines Konflikts mit den Palästinensern umtreibt mich ja seit Jahren. Auch in diesem Sinne ist der vorliegende Text als ein stufenweise entstandenes Ganzes zu verstehen, in welchem sich Wiederholungen von Themen und Motiven als Akkumulationsindex, mithin als Schichtung sich zunehmend erweiternder Einsichten in den historischen, gesellschaftlichen und politischen Prozess des Zionismus und der anhand dieser Einsichten argumentativ abgeleiteten Schlussfolgerung begreifen.
Moshe ZuckermannTel-Aviv, im Juli 2014
Das Paradoxon
Etwas Elementares an Israels Politik bleibt unentschlüsselt. Dem Augenschein nach ist alles klar, liegt auf der Hand, spricht gleichsam »für sich selbst«; und dennoch wird aus dem vermeintlich Selbstverständlichen nicht die naheliegende Konsequenz gezogen, namentlich die praktische Verwirklichung dessen, was sich zwangsläufig als unentrinnbare Einsicht aufdrängt. Und das Merkwürdige: Alles wurde im vergangenen Jahrzehnt bereits dutzendfach bis ins letzte Detail ausdiskutiert, gerann mithin zum integralen Bestandteil des öffentlichen israelischen Politdiskurses. Um es einfach zu formulieren: Israel steht vor der historischen Entscheidung zwischen der Zwei-Staaten-Lösung, d. h., der Lösung des Konflikts mit den Palästinensern durch Anerkennung eines von den Palästinensern errichteten souveränen Staates an der Seite Israels, und der Lösung des Konflikts durch die Errichtung eines binationalen Staates, eines Staates also, in dem Juden und Palästinenser als gleichwertige Bürger gemeinsam leben würden. Es gibt keine andere strukturelle Möglichkeit außerhalb dieser beiden Grundoptionen. Denn die Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung bedeutet die objektive (graduelle) Entstehung einer binationalen Struktur, die, wenn von beiden Seiten akzeptiert, in einen binationalen Staat münden wird; wenn aber von beiden Seiten abgelehnt – und im Hinblick auf die Verfestigung dessen, was im jüdisch-israelischen Diskurs als »demographisch tickende Zeitbombe« apostrophiert wird, zu einem gestandenen Zustand, in dem Juden eine Minorität im eigenen Land bilden –, Israel zu einem Apartheidstaat im vollen Sinne des Wortes werden lassen wird. Diese letzte Möglichkeit wird von der westlichen Welt längerfristig kaum akzeptiert werden können, von den Palästinensern selbst ganz zu schweigen (für viele in der außerwestlichen Welt praktiziert das israelische Okkupationsregime schon seit langem eine vollentfaltete Apartheid-Ideologie); die Isolation Israels würde in diesem Fall Dimensionen annehmen, zu denen im Vergleich der historische Präzedenzfall des internationalen Boykotts gegen den südafrikanischen Apartheidstaat erblassen dürfte, wenn man die geopolitische Explosivität des israelisch-palästinensischen Konflikts in Rechnung stellt – denn der Nahostkonflikt kodiert mehr als »nur« ein herkömmliches Menschenrechtsproblem. Erwähnt sei zudem, dass die Option eines Bevölkerungstransfers im Sinne Meir Kahanes (oder in der gemilderten Version von Rehavam Zeevi und Avigdor Lieberman) hier gar nicht thematisiert zu werden braucht. Denn sie bildet keine historisch reale Lösung des Konflikts, solange sich die Palästinenser ihr widersetzen. Wollte man sie dennoch verwirklichen, würde ein solcher Akt nicht nur zwangsläufig zu einem regionalen Krieg zwischen Israel und der arabischen Welt führen, sondern es ist auch davon auszugehen, dass viele Israelis, einschließlich solcher, die sich der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts gegenüber gemeinhin apathisch verhalten, eine solche Option ablehnen und sich ihrer Verwirklichung emphatisch widersetzen würden.
Was also letztlich auf der Waagschale liegt, ist der Fortbestand des zionistischen Staates, wie ihn sich der klassische Zionismus vorstellte und als Realität anvisierte (einschließlich des unhinterfragbaren Postulats, wonach Juden stets eine Mehrheit in ihrem Land zu bilden hätten). Die Verweigerung der Zwei-Staaten-Lösung bedeutet, so besehen, die Beschleunigung des historischen Endes des zionistischen Projekts, wie man es bis jetzt gekannt hat. Nichts führt an dieser Schlussfolgerung vorbei. Das besagt nicht, dass es nicht möglich sein werde, als Juden in einem künftig errichteten binationalen Staat zu leben, aber es ist auch klar, dass es sich nicht mehr um einen Staat der Juden handeln würde (auch nicht in der nebulösen Selbstdarstellung eines »jüdisch-demokratischen Staates«), sondern um einen Staat, der nunmehr keine »jüdische Einfärbung« bzw. ausgeprägte »jüdische Lebensweise« einzufordern hätte. Man kann sich das Leben von Juden in einem solchen Staat vorstellen, aber es geht dabei um das friedliche Zusammenleben mit Nichtjuden. So lebt ja etwa die Hälfte aller Juden an verschiedenen Orten der Welt bis zum heutigen Tag. Dies ist jedoch mitnichten das Begehren der allermeisten in Israel lebenden jüdischen Bürger. Diese verlangen dezidiert den »ewigen« Fortbestand des Judenstaates; ob nun demokratisch oder theokratisch, auf jeden Fall einen von Juden national beherrschten Staat. Genau dies war ja auch die erklärte ideologische Zielsetzung des politischen Zionismus von seinem Anbeginn – die Gründung einer nationalen Heimstätte für die Juden. Wie lässt sich also erklären, dass Israels offizielle Politik der letzten Jahrzehnte strukturell einen Weg beschreitet, der nicht anders enden kann als mit dem historischen Ende des zionistischen Staates? Wie lässt sich der tatkräftige Aktionismus der israelischen Politpraxis verstehen, der im Gegensatz zu allem, was sämtliche Knesset-Parteien (mit Ausnahme der Kommunisten und der nichtzionistischen arabischen Parteien) als unverbrüchliche Matrix ihrer Grundanschauung (nämlich die Erhaltung Israels als zionistischen Staat) proklamieren, steht bzw. dieses fundamentale Bekenntnis de facto von Grund auf unterminiert?
Eine mögliche Erklärung dafür liegt im Ideologischen. Begreift man Ideologie als falsches Bewusstsein, welches u. a. eine bestehende Realität rechtfertigen und wesentliche Kritik an ihr, mithin alternative Realitätsentwürfe effektiv unterwandern soll, so zeichnet sich die israelische Ideologie, die die Diskrepanz zwischen dem Festhalten am zionistischen Ideal und der realen Verhinderung seiner Verwirklichung zu überbrücken vermeint, durch unterschiedliche Gesinnungskoordinaten aus. Die religiöse Koordinate basiert auf dem Glauben, dass »alles zum Besten gerichtet« sei, »die Ewigkeit Israels nie versagen« werde, das »Volk in Einsamkeit« lebe und sich »nach anderen Völkern nicht zu richten« habe, die Territorien Eretz Israels mithin – Territorien des von Gott »verheißenen Landes« – nicht für besetzt zu erachten seien, daher auch nicht zur politischen Disposition stünden und ohnehin nicht verhandelbar seien. Diese Glaubensideologie steht in keinem Widerspruch zur politischen Praxis, da sie gar nicht erst gefordert ist, Rechenschaft über besagten Widerspruch abzulegen. Wer Gott fundamental vertraut, regt sich kaum je über politisch wie gesellschaftlich wechselnde Konjunkturen auf: Wer selbst noch nach der Shoah an der Doktrin festhält, dass man sich »in jeder Generation« erhebe, »um uns zu vernichten«, aber »Gott rettet uns [stets] vor ihnen«, wird sich nicht allzu schnell davon abschrecken lassen, dass »alle Welt gegen uns« sei – man erwartet von ihm kein rational fundiertes (sondern wenn überhaupt, ein eher zweckrationales) Argument über die Geschichte, ihre Auswirkungen und ihre realen Gefahren: Im hier erörterten Zusammenhang lehrt ihn die Geschichte einzig das, was das unerschütterliche Festhalten am Gottesglauben rechtfertigt.
Aber auch bei der säkularen Ideologiekoordinate, die den Anspruch einer rationalen Fundierung ihrer Gesinnung erheben müsste, stellt sich heraus, dass die ihr zugrunde liegenden Argumente mitnichten darauf aus sind, den offensichtlichen Widerspruch zwischen den entstehenden Realitätsstrukturen und der offiziellen Politik der israelischen Regierungen in den letzten Dekaden zu konfrontieren, geschweige denn, ihn zu beheben. Selbst nachdem man sich von der chimärenhaften Vision eines »Groß-Israels« verabschiedete (mithin eine, wie immer schwache, Einsicht in die Notwendigkeit einer zur verfolgenden Realpolitik demonstrierte), schafften es alle israelischen Regierungen, sich diversen Erklärungen, Apologien und Ausreden zu verschreiben, die allesamt den parteilichen Macht- und Herrschaftserhalt, den stagnierenden »Status quo« bzw. das Dogma der Alternativlosigkeit zu garantieren trachteten: Von der permanenten Postulierung eines amorphen »Recht-des-begangenen-Wegs«, über die Fetischisierung der »Sicherheit« als Schlüsselfaktor der nationalen Prioritätshierarchie (und die »Besiedlung« der besetzten Gebiete als Ableitung vom Primat der »Sicherheit«), bis hin zur dezidierten Proklamation, es gebe »keinen Partner für den Frieden« auf der palästinensischen Seite (bzw. die Erkenntnis, »die Araber« verstünden »nur Gewalt«) und der Selbstbelobigung Israels als der »einzigen Demokratie im Nahen Osten« – stets sah sich Israel »vergewaltigt«, den Weg der realen Lösung des Territorialkonflikts mit den Palästinensern nicht zu begehen, vielmehr genötigt, das Siedlungswerk (als »adäquate zionistische Antwort«) unentwegt zu erweitern, d. h., die notwendigen materiellen Bedingungen für einen wahren Frieden mit den Palästinensern objektiv (»Fakten im Gelände« schaffend) zu verhindern. Zieht man in Betracht, wie sehr sich die religiöse und die säkulare Ideologie miteinander verbandelten, mithin der religiöse Faktor zum integralen Bestandteil der israelischen politischen Kultur und ihrer Praxis mutierte (ein prononciert vormoderner Faktor also in eine sich selbst als modern-fortschrittlich verstehende politische Entität infiltriert wurde); und fügt man dem noch den sich zunehmend verfestigenden Hang des israelischen Diskurses zur Selbstviktimierung hinzu, eine Tendenz, die jede Kritik an Israels Politik und jeden Widerstand gegen diese als »Selbsthass« (seitens Juden) und »Antisemitismus« (seitens Nichtjuden) zu deuten weiß, ermisst man erst eigentlich die Macht des apathischen Sich-ab-findens mit dem krassen Widerspruch zwischen den Grundpostulaten der zionistischen Ideologie (einschließlich der in ihr angelegten nationalen Identität der Juden Israels) und dem, was die Realität ankündigt und strukturell unabweislich generiert.
Die Reproduktion des Musters einer konjunkturellen Kohäsion der israelischen Gesellschaft, ein die »Sicherheit«-Ideologie bedienendes Muster, das sich stets einstellt, wenn Israel in eine Kriegssituation gerät, sei in diesem Zusammenhang kurz angerissen. Das nationale Tamtam-Getrommel dröhnt, eine größere Militäraktion steht an – im hier anvisierten Fall handelt es sich um »Gegossenes Blei« im Jahre 2009 –, die jüdische Bevölkerung des Landes konsolidiert sich, als sei sie nicht sozial, ethnisch und kulturell zutiefst zersplittert, Parlament und Militär, rechte wie linke Zionisten, Presse, Medien und »Publikum« – alles versammelt sich ums kollektive Stammesfeuer, euphorisiert von den »Erfolgen« der Luftwaffe, einem Festival der Gewaltbarbarei frönend. Die Ernüchterung kommt dann mit den ersten Särgen der gefallenen Soldaten nach vollzogenem Bodeneinsatz, den man so sehr »nicht gewollt« (und doch herbeigesehnt) hat, und der Erkenntnis, man habe nichts im Hinblick auf die militärische Überwindung des Feindes, geschweige denn, auf die Befriedung der Region bewirkt. Ein gleichgeschalteter Diskurs erweist sich als unfähig, den Wirkzusammenhang des Gewaltzirkels zu reflektieren: Dass man nämlich die Hamas selbst hochzüchtete, indem man die PLO demontierte, die Autonomiebehörde ausschaltete und Arafat paralysierte, wie es sich Ariel Sharon über Jahrzehnte erträumt hatte; dass der Abzug aus dem Gazastreifen kein Friedensakt war, wenn man das geräumte Territorium zugleich hermetisch abriegelte und ökonomisch wie zivilgesellschaftlich abwürgte, um sich dann aber zu wundern, wie sich seine Bevölkerung radikalisierte; dass man immer wieder darauf insistierte, keinen Gesprächspartner zu finden, bis die altbekannte Gewalteskalation zum einzig möglichen Modus der »Kommunikation« geriet. Der unmittelbare Grund für den Gewaltausbruch im Jahre 2009 lag im Bedürfnis, das Fiasko des zweiten Libanonkrieges zu kompensieren und daraus das entsprechende Politkapital im gerade laufenden Wahlkampf herauszuschlagen (welcher freilich zeitweilig in Klammern gesetzt wurde). Der tiefere Grund lag darin, dass man sich wie ehedem als ach so friedenswillig präsentierte, ohne im Geringsten die Bereitschaft aufzubringen, den Preis für den Frieden zu zahlen. Und man wusste auch, warum: Zahlte man ihn, erlöschte alsbald das Stammesfeuer, und man sähe sich womöglich einem potenziellen Bürgerkrieg ausgesetzt, der stets angedroht wird und mittlerweile wohl in der Tat das Vorbewusstsein eines jeden jüdischen Israelis kolonisiert hat. Es gibt keine Gewissheit, dass dem so sein werde, gewiss ist aber, dass man damit droht und sich davor fürchtet. Dann schon lieber das periodische Tamtam-Gedröhn – es suhlt sich so schön im Einheitsmorast. Bis zum nächsten Mal wieder, wenn die Reproduktion des Musters vermeintlicher Konsolidierung wieder an der Zeit ist, jenes Einheitsgefühls, das nicht möglich wäre, würde man nicht für den unhinterfragbaren Fortbestand des »ewigen Feindes« sorgen – als fetischistische Bedingung für die konsensuelle Konsolidierung gegen ihn … und so weiter und so fort.
Von einem Muster ist hier die Rede, das ideologische Werte wie »Sicherheit«, »Alternativlosigkeit« und »kollektive Einheit« zu einem homogenen Ganzen einschmelzt, sich dabei des komplementären Ideologems einer sich zunehmend aufblähenden Selbstviktimisierung bedienend, je mehr die gewaltsame Aggression Israels zunimmt. Es soll unter anderem dafür sorgen, dass sich unter Israels Bürgern keine allzu kritische, keine allzu ehrliche Selbstreflexion herausbildet, welche die der politisch-militärischen Handlungsausrichtung Israels innewohnende Grundlogik zu hinterfragen vermöchte, mithin lästige, das »Recht des begangenen zionistischen Weges« belangende Fragen – vom nationalen Ziel und historischen Zweck dieses Weges ganz zu schweigen. All diese Beobachtungen und Diagnosen verharren indes auf der phänomenologischen Ebene empirischer Beschreibungen von allseits Bekanntem, das sich in fortlaufenden Medienberichten und einem ermüdend perpetuierten Alltagsdiskurs reproduziert. Es bedarf der tieferen Erklärung, warum dem so ist, eine Erklärung, die über das ideologisch präformierte falsche Bewusstsein, die Manipulationsapparaturen der Apologie, den allumfassenden Illusionsmechanismus hinausginge, welche ja allesamt nichts anderes zu bewirken trachten, als die stete Verfestigung der dumpfen Hinnahme einer immerwährenden politischen Stagnation und einer ihr anverwandten historischen Perspektive der Ausweglosigkeit.
Man könnte sich zur Klärung dieses Sachverhalts an den Freud’schen Kategorien des gegen den Lebenstrieb (Eros) – onto- wie philogenetisch – wirkenden Todestrieb (Thanatos) versuchen, an der Möglichkeit also, dass nicht weniger als durch Lebenswillen und Überlebenstrieb die Menschen auch durch Todessehnsucht und eine unbewusste Ausrichtung auf Selbstauflösung angetrieben werden. Davon sei hier abgesehen, und sei’s, weil die Gegner Freuds, die die Triftigkeit dieser Kategorie in Abrede stellen, sie als »unwissenschaftlich«, als spekulativ oder auch schlicht als hanebüchen abzutun pflegen. Vorzuziehen ist demnach das Verharren auf einer dem breiten Publikum zugänglicheren Ebene, die die historische Dynamik auch dort zulässt, wo sie sich mit Fragen der politischen Psychologie und der Spannung zwischen dem objektiv Bestehenden und der diesem Bestehenden entgegengesetzten Selbstwahrnehmung befasst. Es lässt sich etwa fragen, ob die in Israel lebenden Juden sich nicht dessen bewusst sind (oder zumindest vorbewusst ahnen), an einem großen historischen Projekt zu partizipieren, das auf geborgter Zeit lebt. Einem Projekt, dessen einzige Aussicht, längerfristig zu überleben, in seinem Vermögen liegt, mit seiner geopolitischen Umwelt in Frieden zu leben, sich indes als unfähig erweist, den Weg, der seinen Fortbestand garantieren würde, zu beschreiten, weil er bei Beschreitung dieses Weges auf etwas verzichten müsste, das sich zu seinem gefestigten Selbstbild entwickelte und formte, ja zum Wesen gerann – einem Wesen, das sich gerade aus dem Gegensatz zum geopolitischen Umfeld speist und das Unterschiedensein von diesem Umfeld, mithin die eingefleischte Feindseligkeit ihm gegenüber sanktioniert. Denn es drängt sich die Frage auf, wie es dazu kam, dass der Zionismus sein Versprechen, den Juden der Welt eine nationale Heimstätte zu errichten, die ihr Leben in Frieden und wahrer Sicherheit garantieren würde, nicht einzuhalten vermochte, vielmehr einen hundertjährigen Kampf um sein Werden und Bestehen mit der trüben Erkenntnis bilanzieren muss, dass der Jude als Individuum nirgends auf der Welt so bedroht ist wie gerade in Israel, und es dementsprechend mitnichten auszuschließen sei, dass die nächste Kollektivkatastrophe des jüdischen Volkes sich gerade im territorialen Bereich des politischen Zionismus ereignen werde. Die politische Führerschaft Israels pflegt ihren Bürgern und der »Welt« zu erklären, wie sehr sie genau dies zu verhindern trachte. Gefragt werden muss gleichwohl, warum sich Israel noch immer in der Situation befindet, in der dies die sich dem Land stellende Herausforderung und dies das zu Verhindernde ist. Es lässt sich darüber hinaus fragen: Instrumentalisieren Israels Führer das Shoah-Andenken nicht in empörender Weise, um ein militärisches Abenteuer zu rechtfertigen, welches sie irrational-begierig herbeisehnen, das eine reale Katastrophe der israelischen Bevölkerung bewirken könnte? Und warum nimmt das die israelische Bevölkerung in relativer Apathie hin, jedenfalls ohne sich dezidiert gegen diese Möglichkeit zu stemmen? Warum erweist sie sich jedes Mal aufs Neue als passiv und servil gegenüber dem, was sie »heimsucht«, und zeigt sich sogar begeistert von jenen, deren politisches Werk sich zumeist als Reproduktion der Realität herausstellt, in der sich die permanente Bedrohung des in Israel lebenden jüdischen Kollektivs erhält. Man hat versucht, dies mit dem Shoah-Trauma des jüdischen Volkes zu erklären, mit historischen Erschütterungen und Ängsten, die sich in verhärtete ideologische Positionen übersetzen. Es ist an der Zeit zu fragen, ob besagte Erschütterungen und Ängste sich mittlerweile nicht dermaßen gründlich verdinglicht haben, dass sie den Bezug zum historischen Ursprung völlig verloren haben und einzig noch als Mittel der Rationalisierung einer tiefer liegenden Angst fungieren: des Entsetzens vor der Erkenntnis, das gesamte zionistische Projekt sei einen steilen Abhang hinuntergerollt, und gerade jene, die seine Fahnen in überbordendem Pathos und ideologischem Überschwang schwenken, seine Totengräber seien, Förderer seines historischen Endes.
Nun erhebt sich die Frage, ob man über die israelische Bevölkerung überhaupt als eine homogene Entität reden kann? Ist das hier apostrophierte »Israel« nicht eine Abstraktion, die manifeste Kontroversen, Konflikte und reale Gegensätze, welche die israelische Gesellschaft und ihre politische Kultur durchwirken, einebnet? Dem ist gewiss so, man kann das israelische Kollektiv ohne Zweifel historisch differenzierter und strukturell heterogener anvisieren. Dies ginge jedoch an der hier zu erörternden Tiefendimension vorbei: Man kann die zionistische Linke, die an ehrlich gemeinten Friedensidealen festhält, bejubeln (dabei aber auch fragen, warum sie in Israels Parteienlandschaft nur eine verschwindende Minorität bildet); man kann Israels arabische Parteien anführen (sich aber auch fragen, warum sie stets außerhalb des israelischen Konsenses geblieben sind, selbst als Koalitionspartner dessen, der sie als unterstützende politische Kraft ansah); man kann an jenen denken, der vielleicht trotz allem eine Wende herbeiführen und den Friedensweg beschreiten wollte (sich zugleich aber auch fragen, warum er als »Verräter des Zionismus« ermordet wurde). Man kann sich zudem fragen, was der Anteil der »Araber« im Allgemeinen und der Palästinenser im Besonderen an der Verhinderung der Lösung des Nahostkonflikts gewesen sei. In der Tat lässt sich dies fragen und der Versuch unternehmen, die Frage zu beantworten, was aber wiederum an der hier aufgezeigten Fragestellung vorbeigehen würde: Wie lässt sich erklären, dass die zionistische Bevölkerung Israels es nicht schafft (letztlich wohl auch nicht schaffen will), den historischen Weg zu beschreiten, der den längerfristigen Fortbestand des von ihr getragenen historischen Projekts einzig zu garantieren vermöchte? Warum unterstützt sie, was zwangsläufig zum objektiven Ende dieses Projekts führen muss? Der Grund hierfür kann nicht mit letzter Gewissheit benannt werden. Aber wenn es dereinst an der Zeit sein wird, sich Rechenschaft über den (katastrophischen oder sonst wie anders gearteten) Zusammenbruch des zionistischen Projekts abzulegen, wird man nicht an der Frage vorbeikommen, ob das dieses Projekt tragende Kollektivsubjekt an dessen Fähigkeit, unter den historischen Bedingungen seiner Entstehung und gemäß der sein Dasein legitimierenden Koordinaten langfristig zu existieren, jemals wirklich geglaubt hat. Und nach Hunderten von israelischen Friedenssongs, von Filmen über den »Konflikt« und Tausenden von Büchern über den Zionismus, seine Ziele und seine historischen Visionen wird man der elementaren Frage nicht entrinnen können: Wollte Israel jemals den Frieden? Wollte es wirklich längerfristig als zionistischer Judenstaat existieren? Historisch-empirisch wird sich die Antwort darauf von selbst ergeben.
Aspekte der Diaspora-Negation
Schwer vorzustellen, aber es gab einen Moment in der Geschichte des Zionismus, in welchem Deutsch als Unterrichtssprache in (Erez) Israel als reale Option gehandelt wurde. Es handelt sich um eine Episode aus den Jahren 1913-14, die unter dem leicht bombastischen Namen »der Sprachkrieg« in die Annalen eingegangen ist. Mehr als die Tatsache, dass gerade Deutsch, das später vielen Israelis als »Sprache der Täter« galt, eine solche Option darstellte – wer konnte schon im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts die von Deutschen am jüdischen Volk verbrochene weltgeschichtliche Katastrophe voraussehen –, erstaunt, dass eine der Seiten in diesem tobenden »Kulturkampf« eine nichtzionistische Körperschaft war: Die »Esra«-Gesellschaft war die Hauptfinanziererin der Institution »Technikum«, späterhin Technion (das weltbekannte Polytechnikum in Haifa), welche gelernte Arbeiter in den technischen Berufen und Ingenieursbereichen heranziehen sollte. Aus praktischen Erwägungen meinte man, Deutsch sei als Lehrsprache in dieser Institution vorzuziehen; nicht nur war ein gewichtiger Teil des potenziellen (deutschsprachigen) Lehrkörpers des Hebräischen nicht mächtig, sondern das Hebräische selbst war noch nicht entwickelt genug, um eine profunde Lehre in besagten wissenschaftlichen technischen Bereichen zu ermöglichen. Die Episode fand schnell ihr Ende, und Hebräisch wurde bekanntlich vorgezogen. Es wurde schließlich zur Nationalsprache des künftig zu errichtenden Staates Israel erkoren.
Dass die Entscheidung über die Nationalsprache der Errichtung des Staates voranging, hatte mit der allgemeinen Anomalie, die die Genesebedingungen der jüdischen Nationalbewegung und ihrer Entwicklung in der Moderne betreffen, zu tun. Diese Anomalie weist einige Dimensionen auf.
Erstens, die zionistische Bewegung war ihrem Wesen nach reaktiv – ihr Bestreben, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten, wurzelte primär in der Heraufkunft des modernen Antisemitismus im Europa des 19. Jahrhunderts und als Reaktion auf diesen. Der Antisemitismus entfaltete sich im Zeichen der Dialektik der Emanzipation, der die Kollektive ausgesetzt waren, die sich selbst national zu bestimmen und sich als solche im Rahmen der neuen Nationalstaaten zu etablieren begannen. Aber gerade die politisch-gesellschaftliche Emanzipation, von der anfangs die Nationalbewegungen Europas beseelt war, war es auch, die den repressiven Zugang zu den Juden aktuell bestimmte, insoweit diese bestrebt waren, an den verschiedenen nationalen Emanzipationsbewegungen zu partizipieren. Was sehr bald als »das jüdische Problem« (bzw. »die jüdische Frage«) apostrophiert wurde, basierte auf der vermeintlich prinzipiellen Frage, als was genau sich die Juden in die neue bürgerliche Gesellschaft integrieren möchten. Als Religion? Als Nation? Als Volk? Alle drei Kategorien sind im traditionellen jüdischen Selbstverständnis nicht voneinander zu trennen. Das allein konnte schlechterdings keine Antwort auf diese Frage bieten, denn die Grundsätze der bürgerlichen Gesellschaft peilten ja gerade die (zumindest theoretische) Trennung von religiöser und bürgerlicher Zugehörigkeit an. Das »jüdische Problem« war, so besehen, eine Erfindung von Nichtjuden, die dem Judentum aufoktroyiert wurde, das sich in die europäischen Aufklärungsprozesse und in deren Auswirkungen nationalstaatlichen und sozial-bürgerlichen Auswirkungen einreihen wollte. Drei fundamentale Zugänge entfalteten sich auf jüdischer Seite als mögliche Lösungen des »Problems«: Assimilation – d. h., Integration in die sich heranbildende bürgerliche Gesellschaft bei Vertuschung der prägnanten Erkennungszeichen der Juden als eine gesonderte Gemeinschaft; in Deutschland wurde diese Ausrichtung als »deutsche Bürger mosaischen Glaubens« kodifiziert. Sozialismus – d. h., Verschmelzung der jüdischen Emanzipation mit der allgemeinmenschlichen Emanzipation; nicht von ungefähr schlossen sich viele Juden europäischen sozialistischen Bewegungen an und traten gar als Revolutionsführer in verschiedenen Zusammenhängen hervor. Zionismus – d. h., die politische Lösung der Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk; interessanterweise meinte selbst der universalistisch und sozialistisch gesinnte Mose Hess, dass im Falle der Juden keine andere als die nationale Lösung Bestand haben könne.
Zweitens, der Zionismus als Folgeerscheinung der nationalen Befreiungsbewegungen, die sich in Folge der Französischen Revolution mit all ihren Auswirkungen verbreitete und verfestigte, entbehrte an seinem Anfang die drei notwendigen Vorbedingungen für die Entstehung eines modernen politischen Nationalismus. Denn so unterschiedlich sich die Entfaltung nationaler Formen in England, Frankreich, Deutschland, Italien und anderen westlichen Staaten manifestierte, so war allen gemeinsam die Einheit des Territoriums, auf dem der Nationalstaat gegründet wurde, die Einheit des dieses Territorium bevölkernden Kollektivs qua Nationalkollektiv von Bürgern und die kulturelle Einheit, primär verkörpert in der Etablierung einer anerkannten nationalen Hochsprache. Alle drei Vorbedingungen waren im Falle des Zionismus nicht gegeben: Das Territorium, auf dem der Staat errichtet werden sollte, war weder im Besitz derer, die ihn anvisierten, noch in Besitz derer, die ihn besiedeln sollten. Das Kollektiv, welches die bürgerliche Gemeinschaft dieses Staates stellen sollte, existierte nicht als ein organisches Kollektiv im soziologischen Sinne; die Juden lebten auf unzähligen Ländern in vielen Erdteilen verstreut. Von selbst versteht sich, dass noch keine einheitliche Nationalkultur bestand – sogar um die Nationalsprache musste, wie gesagt, »gekämpft« werden. Das besagt nicht, dass die zionistische Bewegung keine regulative Ideen und praktische Handlungswege besaß, um diesem Grundzustand abzuhelfen. Und doch darf als unabweisbar gelten, dass im Gegensatz zu jeder anderen europäischen Nationalbewegung der Judenstaat nicht als Ergebnis sozialer-politischer Kämpfe innerhalb eines auf einem gegebenen Territorium existierenden Kollektivs (wie im französischen Fall) entstand, auch nicht als Ergebnis der Erhebung gegen einen fremden Besatzer im Territorium des Kollektivs (wie im deutschen Fall), sondern als abstrakte Idee fernab des Territoriums, auf dem sich die Idee künftig verwirklichen sollte. Herzls Diktum »In Basel gründete ich den Jüdischen Staat« ist, so besehen, symptomatisch für die strukturelle Abweichung, die der Etablierung und Entfaltung der Nationalen Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes und dem von ihr gestellten Ziel einer Staatsgründung von Anbeginn aneignete. Wenn der »jüdische Staat« in Basel gegründet wurde, wurde er in einem basislosen Überbau gegründet. Seine erste Basis war die reale Wirklichkeit der »Diapora«, nicht die Erez Israels bzw. Palästinas.
Drittens, wenn man das reaktive Moment bei der Entstehung der zionistischen Bewegung mit besagter die materiellen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer Ziele belangenden Abweichung miteinander verbindet, lässt sich leicht nachvollziehen, wie sich die Bewegung und ihre Ideologie primär ex negativo konsolidierte. Den prononcierten Ausdruck fand dies im Slogan »Negation der Diapora«. Dieser wurde zwar durch das Postulat der Erschaffung des »Neuen Juden« ergänzt, aber es will scheinen, als habe der Zionismus weniger zu bestimmen gewusst, was der »Neue Jude« im Wesen zu sein hätte, als wovon er sich verabschieden sollte: Er sollte nicht mehr den typischen Berufen der Zirkulationssphäre nachgehen (Hausierertum, Handel, Bankwesen etc.), Berufe, in denen sich Juden aus historischen Gründen der Verfolgung und Unterdrückung auszeichneten. Er sollte nicht mehr wehrlos sein, d. h. das ohnmächtige Opfer von Pogromen, Verfolgung und sozialer Exklusion. Und er sollte sich nicht mehr »gebückt« gebärden, identitätslos und national »ohne Rückgrat«, darauf aus, sich seiner nichtjüdischen Umgebung zu assimilieren. Der »Neue Jude« sollte die historische Verneinung des »diasporischen Juden« bilden, wie ihn der Zionismus wahrnahm und verachtete. Der Pionier, der mit einem Arm den Pflug führt und auf der Schulter des anderen das Gewehr trägt, gerann zum ikonischen Bild des »Neuen Juden«, der – über die reale Notwendigkeit, zu arbeiten, den Boden zu bearbeiten und sich vor Feinden in seiner neuen Lebensrealität in Palästina zu wehren, hinaus – vor allem die Abwendung von der diasporischen Wirklichkeit, deren Negation und Liquidierung die Zionisten glorifizierte, symbolisierte.