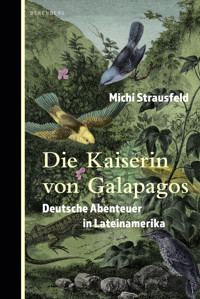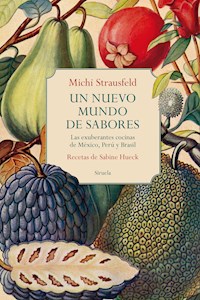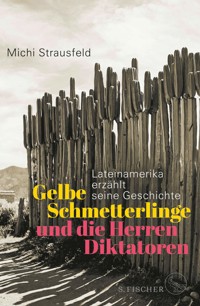
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein neuer, subjektiver, frischer Blick auf die große Literatur Lateinamerikas. Geschrieben von Michi Strausfeld, die für den Boom der lateinamerikanischen Literatur in Deutschland seit den 1970er Jahren maßgeblich verantwortlich ist. Und ergänzt mit persönlichen Porträts der führenden Autoren, die sie alle kannte. Eine einzigartige und farbige Darstellung der großartigen Literatur Lateinamerikas in ihrer ganzen Spannbreite von einer der profundesten Kennerinnen weltweit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michi Strausfeld
Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren
Lateinamerika erzählt seine Geschichte
Über dieses Buch
Vor gut 50 Jahren reiste Michi Strausfeld zum ersten Mal nach Lateinamerika. Dort begann ihre große Liebe zur lateinamerikanischen Literatur, die nie mehr nachließ. Ihre Vermittlung dieser großen, bedeutenden Literatur nach Deutschland schob den Boom seit den 1970er Jahren an und hätte ohne ihren Einsatz nicht diese nachhaltige Wirkung erfahren.
In diesem Buch nun schreibt Michi Strausfeld die ganze Geschichte der lateinamerikanischen Literatur, von den Anfängen bei Kolumbus bis zu den neuen Erzählern des 21. Jahrhunderts. Sie ergänzt diese Erzählung durch einfühlsame Porträts der Protagonisten des Booms, die sie alle persönlich kannte. Eine einzigartige und farbige Darstellung der großartigen Literatur Lateinamerikas von einer der profundesten Kennerinnen weltweit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Motto]
Einleitung Romane, die Geschichte schreiben
Ein Erbe von dreißig Jahrhunderten
»Bevor es war, wusste Amerika bereits, wie es sein würde.«
»Die Einheit des uneinheitlichen Hispanoamerika liegt in seiner Literatur.«
Die Literatur bringt uns das Denken und Fühlen Lateinamerikas näher
Zitatnachweise
Teil 1
Kapitel 1 Kolumbus
Kolumbus wird nicht heiliggesprochen
Kolumbus wird entmystifiziert
Vom Monolog zum Dialog
Zwei gleichwertige Wurzeln: Die Geschichte beginnt nicht mit Kolumbus
Lehrmeister Alejo Carpentier oder Nachhilfe de luxe in Paris
Zitatnachweis
Kapitel 2 Die großen Eroberer Hernán Cortés, Francisco Pizarro und Pedro de Valdivia
Bernal Díaz und die Eroberung Mexikos
Die Eroberung aus der Sicht der Eroberten
Quetzalcóatl
La Malinche
Die Eroberung des Inka-Reichs aus der Sicht der Chronisten
Inés Suárez und die Eroberung Chiles
Carlos Fuentes überall: Die Welt ist mein Zuhause
Zitatnachweise
Kapitel 3 Die Suche nach El Dorado
Erste Kunde und Expeditionen
Die Lagune von Guatavita
Der Mythos lebt weiter
Lope de Aguirre
Entmystifizierung von El Dorado
Eine starke Frau: Mit Isabel Allende in San Francisco
Zitatnachweise
Kapitel 4 Die Kolonialzeit – Drei Jahrhunderte Stillstand
Die Vernichtung der Maya-Dokumente
Der Bewahrer der aztekischen Berufe
Die erste Feministin Mexikos
Der Rebell
Die Verlockung der Utopie
Mönche mit Gewissen und die Schwarze Legende
Brasilien
Exorzismus in Cartagena de Indias
Unruhe breitet sich aus
In Itaparica gehen die Uhren anders: Besuch bei João Ubaldo Ribeiro
Zitatnachweis
Kapitel 5 Simón Bolívar und die Unabhängigkeiten von Haiti bis Kuba
Toussaint L’Ouverture
Simón Bolívar
Das Scheitern des Libertadors
General San Martín
Die Einsamkeit des Ruhms: Mit Gabriel García Márquez in Barcelona
Zitatnachweise
Kapitel 6 Das Jahrhundert der Caudillos
Diktaturen von Feuerland bis zum Rio Grande
Mexiko verliert die Hälfte seines Territoriums
Paraguay – Das verschlossene Paradies
Brasilien – Vom Kaiserreich zur Republik
Das Ende des Reiches, in dem die Sonne nie unterging
Eher Handwerker als Schöpfer: Mit Augusto Roa Bastos in Cerisy-la-Salle
Zitatnachweise
Teil 2
Kapitel 7 Die mexikanische Revolution
Pancho Villa und Emiliano Zapata
Bürgerkrieg und erste Reformen
Revolutionsromane
Juan Rulfo
Frauen melden sich zu Wort
Rulfos Feuerzeug
Zitatnachweise
Kapitel 8 Faszinierende Naturgewalten
Drei exemplarische Romane
Der Sertão
Der Urwald
Mit Mario Vargas Llosa auf dem Amazonas
Kapitel 9 Hispanoamerika auf der Suche nach seiner Identität
Cono Sur
Die Andenländer
Guatemala und Mexiko
»Die Wörter sind meine Augen«: Mit Octavio Paz in Stockholm
Zitatnachweise
Kapitel 10 Brasilien und die Karibik erkunden ihr schwarzes Erbe
Herrenhaus und Sklavenhütte
Négritude und Kreolismus
»Wir bleiben nur ganz kurz«: Auf der Copacabana mit Darcy Ribeiro
Zitatnachweise
Teil 3
Kapitel 11 Die kubanische Revolution
Aufbruch und erste Erfolge
Die grauen 1970er Jahre
Exil- und Inselliteratur
Spezialperiode in Friedenszeiten
Kuba im 21. Jahrhundert
Kino und Literatur: Manuel Puig und Guillermo Cabrera Infante
Zitatnachweise
Kapitel 12 Der Boom und die Diktatoren im Roman
Die Mafia
Der Siegeszug der lateinamerikanischen Literatur
Das mythologische Monster – die Diktatoren
Juan Carlos Onetti empfängt in Madrid
Zitatnachweise
Kapitel 13 Verstädterung und Militärdiktaturen
Im Labyrinth von Buenos Aires
Bahianer, Paulistas und Cariocas
Das Militär ergreift die Macht
Der Flaneur: Spaziergang in Paris mit Julio Cortázar
Zitatnachweise
Kapitel 14 Guerillakriege und der Vormarsch der Drogen
Kolumbien
Peru
Venezuela
Der Vater des dokumentarischen Romans: Lesereise mit Tomás Eloy Martínez
Kapitel 15 Revolution und Bürgerkriege in Mittelamerika
Nicaragua
Bürgerkriege im Hinterhof
Flucht in den Norden
Die polnische Prinzessin: Elena Poniatowska
Zitatnachweis
Kapitel 16 Mexiko nach 1968
Subcomandante Marcos und die Rebellion der Indigenen
Mexiko zwischen Imperialismus und Korruption
Erdbeben und erstarkende Zivilgesellschaft
Violencia und Kartelle
Allmacht Droge
Cartagena de Indias: Junge Autoren und die literarische Reportage
Zitatnachweise
Ausblick Der schwierige Weg fragiler Demokratien im 21. Jahrhundert
Der Vormarsch Chinas
Die Armut der Indigenen
Die Macht der Evangelikalen
Flucht ins »gelobte Land«
Besser als Fiktion
Anhang
Dank
Bibliographie
Autorenregister
Nun fielen ihr die gelben Schmetterlinge ein,
die Mauricio Babilonias Auftritte begleiteten … Meme sah sie,
und ihr Herz machte einen Satz.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Hundert Jahre Einsamkeit
Das große mythologische Monster unserer Geschichte
ist der Beitrag Lateinamerikas zu den Gestalten der Weltliteratur.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Der Geruch der Guayave. Gespräch mit Plinio Apuleyo Mendoza
EinleitungRomane, die Geschichte schreiben
Damals stieg ich die Treppe der Erde empor
zwischen dem wüsten Gebüsch der verlorenen Urwälder
bis zu dir, Machu Picchu.
Hochgelegene Stadt aus stufigen Steinen
Heimstätte dessen, der das Irdische nicht versteckte.
PABLO NERUDA, Die Höhen von Machu Picchu
Mit Machu Picchu begann meine Faszination für Lateinamerika, genauer mit den Bildern aus den Filmen von Hans Domnick Panamericana – Traumstraße der Welt. Den ersten Teil hatte ich Ende der 1950er Jahre gesehen und war tief beeindruckt von den pracht- und geheimnisvollen Ruinen der Azteken und Maya in Mexiko und Guatemala. Der zweite Teil folgte 1962 – und als ich die grandiosen Bilder der 1911 wiederentdeckten Ruinenstadt Machu Picchu sah, stand fest: Da muss ich hin!
Fünf Jahre später, im Sommer 1967, konnte ich dank eines dreimonatigen Stipendiums nach Peru reisen. Es war ein in vieler Hinsicht entscheidendes Jahr für Politik und Literatur: Im Mai war der Roman Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez erschienen, die magische über sechs Generationen erzählte Saga der Familie Buendía aus Macondo. Dieses imaginäre Dorf spiegelt die Geschichte Kolumbiens wider, in nuce die des Kontinents. Eine nie zuvor erlebte Mund-zu-Mund-Propaganda machte das Buch zu einem Weltbestseller. Im Oktober wurde Che Guevara in Bolivien ermordet, was zu einem entsetzten Aufschrei auf dem ganzen Kontinent führte und weltweit kommentiert wurde. Im Dezember erhielt der Guatemalteke Miguel Ángel Asturias als erster Romancier Lateinamerikas den Literaturnobelpreis. Stolz und fassungslos erlebten die Lateinamerikaner diese unterschiedlichen Ereignisse, überall tobten heftige Debatten über Auswege aus den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Miseren hin zu einer besseren Zukunft.
Hundert Jahre Einsamkeit, das ich 1967 mühsam mit Hilfe eines Lexikons gelesen und nur unzureichend verstanden hatte, beschäftigte mich weiter, wie auch der gesamte mir unbekannte Kontinent. Daher wollte ich nach Ende des Studiums gerne darüber promovieren. Inzwischen lebte ich in Barcelona, der damaligen »Hauptstadt des Booms«. Die wichtigste Literaturagentin der neuen lateinamerikanischen Autoren, Carmen Balcells, hatte hier ihren Sitz, ebenso der Verlag von Carlos Barral, Erfinder des Premio Biblioteca Breve, der in den 1960er Jahren an so viele Lateinamerikaner (und einige Spanier) verliehen worden war. Die Stadt galt als Mekka des lateinamerikanischen Literaturbetriebs: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Salvador Garmendia, Sergio Pitol und zahlreiche jüngere Autoren wie Cristina Peri Rossi oder Óscar Collazos lebten hier, um ihr Glück zu suchen und publiziert zu werden. Andere wie Julio Cortázar, Carlos Fuentes oder Alfredo Bryce Echenique kamen regelmäßig zu Besuch. Der Journalist Xavi Ayén untersuchte 2014 in einer achthundertseitigen Studie die Bedeutung Barcelonas für die weltweite Verbreitung der neuen Literatur: Aquellos años del Boom: García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo.
In der Tat stand das literarische Leben in Spanien kopf. Es gab einhellige Bewunderung für die aufregenden Bücher, die aus Lateinamerika kamen und dem literarisch erstarrten franquistischen Spanien frische Impulse gaben. Und für mich galt das auch persönlich, denn die Reise 1967 nach Peru hat mein Leben radikal verändert. Ich las Erzählungen von Jorge Luis Borges, Gedichte von César Vallejo und Pablo Neruda, Essays des peruanischen Intellektuellen und marxistischen Kämpfers José Carlos Mariátegui und hörte von einer Vielzahl wunderbarer Romane, deren Verfasser mir alle unbekannt waren. Warum sollte ich weiter Romanistik und Anglistik studieren, mich in philologische Kleinarbeit vertiefen, wo ich doch eine großartige Literatur entdecken konnte? Das waren Meisterwerke, die mir zu politischem Bewusstsein, (kultur-)geschichtlichen Kenntnissen, Neugier auf den Kontinent und zu enormem ästhetischen Vergnügen verhalfen. Formal innovative Romane von Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa oder Carlos Fuentes erzählten nie zuvor gelesene Geschichten – die den Lesern ihrer Länder zudem neue Fakten über die ihnen oft unbekannte oder tendenziös verfälschte Geschichte vermittelten. »Die Literatur erzählt eine Geschichte, die die von den Historikern geschriebene Geschichte nicht zu erzählen weiß und nicht erzählen kann«, liest man bei Mario Vargas Llosa im Vorwort zu Die Wahrheit der Lügen.
Der Erfolg der neuen Romane beflügelte das Selbstbewusstsein der Lateinamerikaner, denn diese Werke, sogleich mit dem (fraglichen) Begriff »magischer Realismus« versehen, hatten bei europäischen und amerikanischen Lesern ein enormes Interesse und Bewunderung für die Autoren, Länder, Kulturen und die politischen Probleme des Kontinents geweckt. Bei mir lösten sie eine Art Goldgräberlust aus, dieses literarische El Dorado zu erforschen.
Mit einem weiteren Stipendium kam ich im Herbst 1970 für zwei Jahre nach Kolumbien, konnte vor Ort für die Dissertation über García Márquez recherchieren und die Schauplätze von Hundert Jahre Einsamkeit besuchen – den Geburtsort des Autors Aracataca, die Bananenplantagen, die Karibikstädte Barranquilla und Cartagena, in denen er gelebt hatte. Ich lernte die Flora und Fauna, die Geschichte des Landes und die politische Situation kennen. Alles war neu. In Bogotá besuchte ich diverse Literaturkurse und las ein paar Regalmeter älterer und neuerer Literatur. Meine Faszination steigerte sich kontinuierlich. Junge kolumbianische Romanciers und Lyriker, die ich in der Buchhandlung Buchholz kennenlernte, sorgten für die notwendige politische, kulturgeschichtliche und literarische Horizonterweiterung.
Mir wurde klar, dass Literatur und Politik im Lateinamerika jener Jahre untrennbar verbunden waren: Die Begeisterung für die kubanische Revolution wie auch die Wut über die vielen politischen Morde – wie die des jungen peruanischen Lyrikers Javier Heraud 1963, die des kolumbianischen Befreiungstheologen Camilo Torres Restrepo 1966 und des bewunderten Che Guevara 1967 – waren gewaltig, ständig wurde gestritten. Hauptthema war der verheerende Einfluss der USA auf die Entwicklung Lateinamerikas, denn ihre zahlreichen Interventionen hatten das eindeutige Ziel, die wirtschaftlichen Interessen und die Hegemonie Nordamerikas zu sichern und zu schützen. Deshalb halfen sie, willige Politiker, oft als Marionetten, zu etablieren. Man redete sich die Köpfe heiß über die Notwendigkeit revolutionärer Veränderungen, denn durchgreifende Reformen und demokratische Mechanismen, um endlich selbstbestimmt und frei leben zu können, schienen außer Reichweite. Verschiedene Guerillabewegungen kämpften bereits seit Beginn der 1960er Jahre in Peru, Bolivien und Kolumbien, seit den 1970er Jahren auch in Argentinien und Uruguay, um diese Illusionen zu verwirklichen. Monströse soziale Ungleichheiten, von den USA gestützte Diktaturen, die prekären Zustände in den durchweg labilen, vielfach grotesk ineffizienten Demokratien und der Mangel an Perspektiven machten aus Studenten und Schriftstellern politisch linksengagierte Rebellen. Letztere hatten gezeigt, dass Lateinamerika auf der Höhe der Zeit stand und nicht »unterentwickelt« war – jetzt verlangten seine Bürger auch von Politik und Wirtschaft den Sprung in die Modernität, wollten demokratische Verhältnisse, einen verlässlichen Rechtsstaat, das Ende der krassen sozialen Ungleichheit, eine Erziehung, die den Namen verdiente, sowie bescheidenen Wohlstand für alle.
Für mich war fast alles, was ich erlebte und sah, wunderbare Wirklichkeit. Weitere unvergessliche Eindrücke jener Jahre verdanke ich den Reisen nach Mexiko und Guatemala, nach Bolivien, Chile, Argentinien und Brasilien. Seitdem stehe ich im Bann Lateinamerikas, diesem an- und aufregenden Kontinent, der für mich noch immer eine Schatztruhe voller Geheimnisse ist. 50 Jahre später beschäftige ich mich unverändert mit seiner Literatur, Kultur, Politik und Geschichte: Lateinamerika hat mein Leben geprägt und reich gemacht, mit Leidenschaft und Neugier habe ich den Kontinent zu erkunden versucht. Reisen in nahezu alle Länder und zahllose großartige Bücher halfen mir dabei.
Dann hatte ich das Glück, eher zufällig einen Kontakt zu Siegfried Unseld, dem Verleger des Suhrkamp-Verlags, vermittelt zu bekommen. Er suchte nach verlässlichen Empfehlungen über wichtige Romane des Subkontinents. So entstand eine großartige Zusammenarbeit, die 1974 begann. Ich lebte weiter in Barcelona und beendete gleichzeitig die Dissertation über García Márquez und den neuen Roman Lateinamerikas, fand aber schnell heraus, dass mich die praktische Arbeit im Verlag weitaus mehr faszinierte als eine zuvor avisierte Tätigkeit an einer Universität. 40 Jahre lang konnte ich mich beruflich für eine bessere Kenntnis der lateinamerikanischen Literatur in Deutschland einsetzen – und habe dies leidenschaftlich gerne getan. Dieses Engagement lieferte mir die besten und schönsten Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des Kontinents. Ich lernte politische und literarische Wortführer des Kontinents kennen, habe mit vielen Autoren gearbeitet und von ihnen gelernt. Diese Gespräche und Begegnungen, ihre Anregungen und Erläuterungen lenkten meinen Weg: Eine wundervolle Hilfe, schließlich war ich in puncto Lateinamerika eine Autodidaktin.
Ein Erbe von dreißig Jahrhunderten
Lateinamerika ist mit Europa eng verbunden – durch die miteinander verwobenen Kulturen, die Geschichte und die Sprachen der Eroberer, durch Illusionen und Mythen, die die frühen Entdecker und Reisenden aus der Alten in die Neue Welt getragen haben: El Dorado, der Jungbrunnen, das Paradies auf Erden. Seit inzwischen mehr als fünf Jahrhunderten gibt es einen Dialog zwischen Europa und Lateinamerika: Mal zeugte er von größerer Verbundenheit, mal dominierten verletzte Hoffnungen und widersprüchliche Interessen, manchmal blieb man stumm.
Wie dieser Dialog geführt wurde und wird, welche Kenntnisse wünschenswert sind, um ihn endlich von Gleich zu Gleich zu führen, ist Thema des vorliegenden Buches. Es ist ein spannendes intellektuelles Abenteuer, und ich stütze mich dabei ausschließlich auf die literarischen Texte von Lateinamerikanern, auf Essays, Gedichte und vor allem auf Romane, die Geschichte geschrieben, und Romane, die Geschichte erzählt haben. So hoffe ich, einen Streifzug durch fünf abwechslungsreiche Jahrhunderte anzubieten, der dank der Stimmen der Autoren bessere Kenntnisse liefert und ihre Sicht auf den Kontinent spiegelt. Das ist die notwendige Voraussetzung für ein besseres Verständnis, erst dann kann man die eurozentrische oder US-amerikanische Perspektive erkennen und vielleicht auch den eigenen Blick »entkolonialisieren« und sich auf den anderen einlassen.
Lateinamerikanische Intellektuelle verfügen über ein breites Wissen der europäischen Kulturen, umgekehrt ist das leider nicht der Fall, da geistern statt Fakten (zu) viele Fehlinformationen und Klischees durch die Köpfe. Genau dies werfen uns die Autoren vor. Paz hielt lakonisch fest, dass er als lateinamerikanischer Lyriker in den 1950er Jahren in Paris kosmopolitischer war als die französischen Kollegen. Carpentier beklagte, dass die europäischen Leser keine Vorstellung von der Ceiba hätten, dem heiligen Baum, der zum Beispiel die Landschaft der Karibik prägt, während die Lateinamerikaner vertraut seien mit der schneebedeckten Tanne der Romantiker. In »Probleme des zeitgenössischen Romans in Lateinamerika« forderte er: »Unsere Ceiba, unsere Bäume, blühende und nicht blühende, müssen universal werden.« In seinem berühmten Nachwort »Über die wunderbare Wirklichkeit Amerikas« zum Roman Das Reich von dieser Welt von 1949 hielt er fest: »Der Lateinamerikaner schleppt ein Erbe von dreißig Jahrhunderten mit sich herum.«
Dreißig Jahrhunderte, von denen grandiose Tempelanlagen der Azteken, Maya und Inka übrig geblieben sind oder die spektakuläre Festungsstadt Machu Picchu, die 1911 offiziell von einer Expedition der Yale University unter Leitung von Hiram Bingham pressewirksam wiederentdeckt wurde. Pablo Neruda hat seinen Besuch der Ruinenstadt im Jahre 1946, der ihn nach eigener Aussage überwältigt hatte, in »Die Höhen von Machu Picchu« festgehalten, dem zweiten Zyklus aus Der große Gesang. Im gleichen Jahr stieß man auf Bonampak, die Ruinenstadt der Maya mit ihren grandiosen Wandmalereien, während das in Worten von Carpentier »staunenerregende Mitla« (so der Titel eines Artikels) mit seiner abstrakten zapotekischen Wandornamentik bereits länger bekannt war. Die Forschungen in Monte Albán, Teotihuacán, Uxmal und vielen anderen Tempelanlagen dauern an und liefern kontinuierlich neue Erkenntnisse über die präkolumbianischen Hochkulturen.
Neue Ausgrabungen im Zentrum von Mexiko-Stadt in den 1970er Jahren ergaben so reiche Funde, dass 1987 damit ein neues aztekisches Museum, Templo Mayor, gefüllt werden konnte. Gezeigt wird als einer der Glanzpunkte der 1978 wiederentdeckte Monolith Coyolxauhqui, der den Kampf des Sonnengottes Huitzilopochtli gegen die Mächte der Finsternis darstellt. Seinem Pendant, dem seit langem bekannten aztekischen Kalender, hat Octavio Paz im 584 Zeilen langen Gedicht »Sonnenstein« eine Hommage erwiesen. Diese fast 25 Tonnen schwere Basaltscheibe erläutert die mexikanische Kosmogonie und ihren Sonnenkult und zeigt die Genauigkeit wie auch die Komplexität des Kalenders. Zu sehen ist sie im Anthropologischen Museum im Parque Chapultepec: »Handschrift aus Feuer auf den Jadesteinen / Handschrift des Messers, auf Basalt geschrieben / Handschrift des Windes, in der Wüste lesbar / der Sonne Testament.«
2018 publizierte National Geographic die dank neuester Techniken gewonnenen Erkenntnisse über das guatemaltekische Tikal: Zehntausende Gebäude seien noch unter dem Dschungel verborgen, die bislang schon gut bekannte, autarke Maya-Stadt sei also deutlich größer gewesen. Bislang schätzte man das Maya-Volk auf etwa ein bis zwei Millionen Menschen, jetzt gehen die Forscher von rund 20 Millionen aus, das entspricht etwa der Hälfte der europäischen Bevölkerung im Jahrhundert der Entdeckung, und dies auf einer Fläche so groß wie Italien.
1492 lebten schätzungsweise 50 Millionen Menschen auf dem Kontinent – vor allem in Mexiko, Mittelamerika und der Andenregion. Mittlerweile verdichten sich die Vermutungen, dass auch das Amazonasbecken bevölkert war, dass sich auch dort Städte gebildet hatten – was einzelne Chronisten früh angedeutet haben und niemand glauben wollte. Möglicherweise müssen die bis jetzt angenommenen Bevölkerungszahlen bald korrigiert werden.
Um 1550 hatten eingeschleppte Krankheiten wie Pocken, Masern und Typhus, Vernichtungsfeldzüge und Hunger sowie die brutale Unterdrückung und Fronarbeiten die Einheimischen dramatisch dezimiert. Zwischen 1492 und 1650 ging die einheimische Bevölkerung um etwa 90 Prozent zurück – so lauten die jüngsten Schätzungen. Angeblich gab es 1650 nur noch vier Millionen Indigene. Die Kariben waren nahezu völlig ausgerottet, und der wegen seines Widerstands gegen die Spanier zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte Kazike Hatuey, ein Häuptling der kubanischen Taíno, erklärte seinen Schergen, er lehne ihren Gott ab, denn er versinnbildliche die besessene Suche nach Gold, und dafür würden seine Anhänger Mord und Totschlag verüben. Deshalb weigerte er sich auch, getauft zu werden, denn er wollte auf keinen Fall in einen gemeinsamen Himmel mit diesen grausamen Weißen. Der bald spürbare Mangel an indigenen Arbeitskräften führte dazu, dass die neuen Herren in den beiden nächsten Jahrhunderten etwa neun Millionen Sklaven aus Afrika importierten.
Aus der allmählichen Vermischung der drei Rassen, der Indianer, Weißen und Schwarzen und ihren Kulturen entstand in den vergangenen Jahrhunderten ein mestizischer Kontinent: Dies macht seine Einzigartigkeit aus. Heute erkundet man verstärkt das indigene und das schwarze Erbe, letzteres findet sich vor allem in den mitgebrachten Religionen, Bräuchen und der Musik, ersteres überrascht kontinuierlich mit neuen archäologischen Funden. Daneben stehen die Forschungen von Philologen, Historikern, Anthropologen und Linguisten, denen es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelang, bahnbrechende Fortschritte in der Erschließung literarischer Texte und Mythen in Nahuatl, Quiché, Aymara und Quechua vorzulegen. Das Popol Vuh, das heilige Buch der Maya (in Deutschland unter dem Titel Buch des Rates publiziert), faszinierte das literarische Paris, vor allem seine Poesie des Schöpfungsmythos. Paul Valéry verfasste ein schwärmerisches Vorwort zu den Legenden aus Guatemala, die Miguel Ángel Asturias 1930, gestützt auf diese Maya-Überlieferungen, veröffentlichte: »Diese Legenden haben mich ganz betrunken gemacht. Nichts ist mir ungewöhnlicher erschienen … als diese Geschichten-Träume-Gedichte … Welche Mischung aus glühender Natur, ausschweifender Botanik, eingeborener Magie … Meine Lektüre wurde mir zu einem Zaubertrank.«
Die Gedichte in Nahuatl, die zur Zeit der Eroberung Mexikos weit verbreitet waren, beeindrucken durch ungewöhnliche Bilder und eine originelle Blumen- und Naturmetaphorik. Schon Hernán Cortés und Bernal Díaz del Castillo, einfacher Soldat und der bedeutendste Chronist der Eroberung, erwähnen die Vorliebe Moctezumas für diese Gedichte wie auch die Existenz vieler Códices, die ihnen »wie Windeln zusammengelegter Bücher« schienen. Sie wurden in den Tempeln aufbewahrt. Dem mexikanischen Historiker und Anthropologen Miguel León-Portilla verdanken wir hervorragende Sammlungen und schöne Übersetzungen der altmexikanischen Texte, die er in jahrzehntelanger Arbeit mühsam zusammentrug, denn die Spanier hatten den Großteil der prähispanischen Zeugnisse als Teufelskram vernichtet und ganze Scheiterhaufen mit alten Texten angezündet. León-Portilla unterteilte die Texte in Poesie oder Prosa, erstere umfassen sakrale Hymnen, lyrische Gesänge über Blumen, den Frühling, die Trauer, intime Reflexionen über das Leben, den Tod und das Jenseits; letztere geben Auskunft über die eigene Geschichte und halten Kenntnisse, Überlieferungen und die Reden der Alten oder Weisen fest. Die Forschungen intensivierten sich in den 1960er Jahren, denn zuvor mangelte es an Neugier und Wissen, stattdessen dominierten Ignoranz und Verachtung für alles Indigene, das als minderwertig galt. Octavio Paz bekannte, dass er als junger Dichter kaum Zugang zur reichen altmexikanischen Poesie hatte, die ihn später faszinierte und die er in sein Schaffen einbezog. Inzwischen wird alles Prähispanische aufgewertet, gelehrt und weltweit bewundert, die Menschen sind stolz darauf, insbesondere in Mexiko und Peru.
Das Zusammenspiel von Archäologen, Anthropologen, Altamerikanisten, Historikern, Philosophen, Sprachforschern und Linguisten wird in den nächsten Jahrzehnten vermutlich für weitere erstaunliche Funde und Forschungsergebnisse sorgen, antike Schätze und literarische Kleinode ans Licht bringen. Noch immer sind nicht alle Hieroglyphen und Piktogramme der Maya-Stelen entziffert, noch immer nicht alle »Knoten« der Inka-Quipus gelöst. Die Geschichte und die Kulturen der ersten »dreißig Jahrhunderte« Lateinamerikas bleiben ein in weiten Teilen faszinierendes Geheimnis.
»Bevor es war, wusste Amerika bereits, wie es sein würde.«
Die Geschichte des Kontinents, so wie wir ihn wahrnehmen, begann am 12. Oktober 1492, als die Alte Welt die Neue »entdeckte«. Kolumbus und die ersten Eroberer legten ihre oft überaus phantasievollen »wahren Geschichten« vor, in denen sie die Vielfalt des unbekannten Neuen, von dem sie überwältigt waren, in Worte zu fassen versuchten. Immer wieder beklagen sie ihre Unfähigkeit, all das Wunderbare überzeugend für die Daheimgebliebenen wiederzugeben. Viele »Berichte« wurden nachträglich verändert, wie das Bordbuch von Kolumbus, desgleichen manche der detaillierten Darstellungen einzelner Mönche, die die Eroberer, von denen viele Analphabeten waren, begleiteten, wie zum Beispiel Francisco Pizarro.
Einige der berühmtesten Schilderungen stammen von Autoren, die nie einen Fuß nach Amerika gesetzt hatten und sich lediglich auf die Berichte zurückkehrender Spanier und die wenigen bekannten Texte wie die Briefe von Hernán Cortés an Kaiser Karl V. stützen konnten. Das bekannteste Beispiel ist die umfangreiche Chronik von Francisco López de Gómara, Hauskaplan von Cortés, in der er die Eroberung Mexikos farbig beschreibt. Die überragende Schilderung von Bernal Díaz del Castillo, einer der 517 einfachen Soldaten, die Cortés auf seinem Weg nach Mexiko-Tenochtitlan begleiteten, wurde zur Korrektur des selbstgefälligen Bildes des stolzen Eroberers: Cortés hatte Mexiko schließlich nicht alleine erobert, wie er vorgab, es war ein gemeinsamer Erfolg aller Soldaten. Die schillernde und spannende Wahrhafte Geschichte von Díaz del Castillo erschien allerdings erst mit sechzigjähriger Verspätung. Andere Chroniken, wie die beeindruckenden Wahrhaftigen Kommentare des Inka Garcilaso de la Vega, beunruhigten die spanischen Inquisitoren, weil der Verfasser die Errungenschaften des Inka-Reiches ausführlich würdigte – schließlich kannte er diese Welt aus erster Hand. »Er schildert die einstige Herrlichkeit des Inka-Reiches mit herzergreifender Wehmut«, so Carpentier. Sein Landsmann Guamán Poma de Ayala hingegen erhielt nie eine Antwort auf seinen langen Klagebrief an Philipp III., denn dieser Text blieb bis 1908 verschollen. Gefunden wurde er in der Bibliothek von Kopenhagen und 1936 endlich auch publiziert. Fray Bernardino de Sahagún arbeitete 60 Jahre lang mit mexikanischen Indianern und verfasste mit Hilfe ihrer Informationen eine illustrierte Enzyklopädie der aztekischen Welt in Nahuatl und Spanisch: Sie erschien erstmals 1827 in Mexiko, als das unabhängig gewordene Land sich für die eigene Geschichte zu interessieren begann.
Bartolomé de Las Casas, der erste Bischof von Chiapas, hielt die verheerenden Missstände und Schrecken der Eroberung in seinem Kurzgefaßten Bericht über die Verwüstung der Westindischen Länder fest. Der spanische »Indienrat«, der für den Schutz der einheimischen Bevölkerung zuständig war, erkannte die Sprengkraft dieser Schrift und belegte die Verbreitung mit drakonischen Strafen, konnte die Übersetzung in mehrere europäische Sprachen aber nicht verhindern: Der Text wurde zur Hauptquelle der »Schwarzen Legende«, mit der die rivalisierenden europäischen Mächte das »rückständige« Spanien bezichtigten, die Eroberungen brutal durchgeführt zu haben. Unermüdlich stritt Las Casas mit der spanischen Krone für eine Verbesserung der Lage der Indigenen, denen er durchaus eine Seele zuerkannte, während seine Gegner, insbesondere der Humanist Juan Ginés de Sepúlveda, sie ihnen absprachen. Sein Einsatz führte zum Erlass »Neuer Indiengesetze«, um die Einheimischen besser vor dem Frondienst in den Encomiendas, diesen kostenlosen Zuteilungen von riesigen Ländereien mit rechtlosen Arbeitskräften an spanische Siedler, zu schützen. Die Gesetze wurden in den unkontrollierbaren Weiten der Neuen Welt aber kaum befolgt. Sein Hauptwerk, die mehrbändige Historia de las Indias, an dem Bartolomé de Las Casas 37 Jahre bis zu seinem Tod gearbeitet hatte, wurde erst 1875 publiziert.
Das sind nur wenige Beispiele für die aleatorische Rezeptionsgeschichte wichtiger Chroniken und »wahrhaften Berichte«, die bis auf wenige Ausnahmen von Spaniern verfasst wurden. Die lückenhaften, phantasievollen und oft schöngefärbten Schilderungen und das verspätete Erscheinen ermöglichten keine neutralen Kenntnisse über die prähispanischen Hochkulturen, die die Kirche immer argwöhnisch verfolgt hatte, weil sie deren Religionspraktiken für Ketzerei hielt. Die Erfolge übersah man, wie z.B. die Tatsache, dass das Inka-Reich es geschafft hatte, alle seine Bewohner ausreichend mit Nahrung zu versorgen – ein Erfolg, den es seitdem nie wieder gegeben hat. Spätere Reiseberichte und wissenschaftliche Forschungen meist ausländischer Besucher verbesserten den Kenntnisstand über Geographie, Flora und Fauna, während die religiösen Überzeugungen der Vor- und Nachfahren der Indigenen in Mexiko, Guatemala oder Peru weithin unbekannt blieben oder geleugnet wurden. Die abenteuerreiche und abenteuerliche Geschichte der Entdeckung und Eroberung des Kontinents wird inzwischen kritisch bewertet: »Der amerikanische Kontinent war noch nicht einmal ganz entdeckt und doch schon getauft: Der Name, den sie uns gaben, verurteilte uns dazu, eine neue Welt zu sein, das Land der Verheißung, der Zukunft: Bevor es war, wusste Amerika bereits, wie es sein würde!« (Octavio Paz in Literatura de fundación)
Während der dreihundertjährigen Kolonialzeit wurde das indigene Erbe bewusst »vergessen«, seine Überbleibsel im Alltagsleben brutal unterdrückt. Und trotzdem behauptete sich vieles. Die Indianer passten sich scheinbar geschmeidig der neuen Religion an, wechselten aber das Kostüm: So wird in Mexiko zum Beispiel die Santa Muerte verehrt. Offiziell ist sie keine Heilige und von keinem Bischof geweiht, aber präsent wie seit Tausenden von Jahren. Die spanischen Vizekönige, der Klerus und die Beamten sowie die aufsteigenden Kreolen waren nur an ihrem maßlosen Reichtum interessiert, »wie Schweine« lechzten sie nach Gold und Silber. Einheimische mussten dafür schuften, ansonsten wurden sie nicht beachtet. Man leugnete einfach ihre Existenz – »ningunear« heißt das spanische Wort dafür, zu einem »Niemand« machen.
Während der ersten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts tobten langwierige Kämpfe um die Unabhängigkeit, die Simón Bolívar, José de San Martín und andere Befreier unter dem Eindruck der Französischen Revolution und der Erklärung der Menschenrechte anführten. Nach der Loslösung von Spanien folgten anarchische Bürgerkriege und endlose Diadochenkämpfe, daher spricht man von einem »Jahrhundert der Caudillos«, dem Fundament zahlloser Diktaturen. Die jungen Republiken übernahmen die vorgegebenen Kolonialstrukturen, oft strich man lediglich das Wort »Kolonial«, aber man hatte keine Visionen oder Pläne für eine gerechtere Gesellschaft. Die andauernden politischen Wirren, eine schwache Justiz, gespaltene Gesellschaften mit wenigen Reichen und einer erdrückenden Anzahl von Armen, fehlende ökonomische Strukturen: Das daraus resultierende Machtvakuum nutzten die rivalisierenden europäischen Großmächte Großbritannien und Frankreich und sicherten sich die wichtigen Rohstoffe und Ländereien. Vor allem die USA drangen machtvoll in den Kontinent ein und proklamierten 1823 die Monroe-Doktorin, »Amerika den Amerikanern«, mit der sie sich das Vorrecht auf dem Doppelkontinent sicherten. Sie nutzten ihre wirtschaftliche Stärke und etablierten unangefochten ihre Interessen, verstärkt nach dem Ende ihres Bürgerkrieges. Damit begann die nächste Fremdherrschaft, der US-Imperialismus, der nahezu zwei Jahrhunderte das politische und wirtschaftliche Leben vieler südamerikanischer Länder bestimmte und aus Mittelamerika sogar einen »Hinterhof« der USA machte. Überall mischten sich die USA rücksichtslos ein, und diese Praktiken sind bis heute nicht ganz überwunden: Der Koloss im Norden bleibt ein immenser, unumgänglicher Machtfaktor.
Das Erbe der Kolonialzeit war in nahezu allen Bereichen vernichtend und drückte die jungen Demokratien wirtschaftlich zu Boden, alle Staaten waren hochverschuldet. Darüber hinaus hatten die Kolonisatoren ihre Untertanen willentlich in Unwissenheit gehalten. Lesen und Schreiben war ein Privileg der reichen, meist spanischen Oberschicht. Die Kreolen – wie sich die auf dem Kontinent geborenen Nachfahren der Spanier nannten – erhielten nur allmählich Zugang zur Bildung. Der Buchimport von Romanen war streng untersagt, die omnipräsente Kirche und allmächtige Inquisition verfolgten jedes freie Denken: Sie hatten die potentielle Sprengkraft der Bücher erkannt. Es gab wenige »amerikanische« Intellektuelle, und eine eigene Literatur entwickelte sich nur mühsam: Der erste genuin amerikanische Roman, El periquillo sarniento von José Joaquín Fernández de Lizardi, erschien erst 1816 in Mexiko. Wie Octavio Paz in seinem Essay »Erkundung der lateinamerikanischen Literatur« festhält, ist »die gesamte lateinamerikanische Literatur ein Spätankömmling. Sie ist die jüngste aller westlichen Literaturen … Im 19. Jahrhundert tauchten zwei große Literaturen, die russische und die nordamerikanische, auf. Im 20. Jahrhundert spross die lateinamerikanische mit ihren beiden Zweigen, dem hispanoamerikanischen und dem brasilianischen, hervor.«
Paz’ These lautet, dass diese neue, also knapp einhundertjährige Literatur zum westlichen Kanon zählt. Die literarischen Ahnen heißen Cervantes und Camões, geschrieben wird spanisch und portugiesisch, auch wenn sich beide Sprachen dies- und jenseits des Atlantiks sowohl phonetisch wie lexikalisch weiter- und auch auseinanderentwickelt haben. In Lateinamerika sind sie reicher geworden, auch durch die Integration zahlloser Indigenismen. Auf den Antilleninseln wird Spanisch, Französisch, Englisch, Holländisch und Kreolisch gesprochen. Mexiko und Guatemala, Peru oder Bolivien verweisen in den letzten Jahren mit steigender Tendenz auf den Reichtum der indigenen Sprachen. Die Lateinamerikaner sind stolz auf ihr Mestizentum, das der mexikanische Erziehungsminister und Schriftsteller José Vasconcelos 1929 als »kosmische Rasse« gerühmt hatte. Der ganze Kontinent ist mestizisch, und nur »wenige Kulturen auf der Welt sind der unseren an Reichtum und Kontinuität vergleichbar«, so Carlos Fuentes in Der vergrabene Spiegel. »Unser kulturelles Erbe, das von den Steinen von Chichén Itzá und Machu Picchu bis zu modernen indianischen Einflüssen auf Malerei und Architektur reicht. Vom Barock der Kolonialzeit bis zur zeitgenössischen Literatur eines Jorge Luis Borges und eines Gabriel García Márquez. Von den mannigfachen europäischen Zeugnissen […] bis zur einzigartigen und leidensvollen schwarzafrikanischen Präsenz in Lateinamerika.« Lateinamerika ist ein eigenständiger Kontinent, nicht nur die »Neue Welt«. Dennoch lautet eine Grundüberzeugung der meisten Bewohner: Wir gehören dank gemeinsamer Kultur, Literatur und Geschichte zu Europa.
»Die Einheit des uneinheitlichen Hispanoamerika liegt in seiner Literatur.«
Die zeitgenössische, innovative Literatur Lateinamerikas wurde in den 1960er Jahren weltweit bekannt: Zunächst kam sie nach Spanien und wurde groß gefeiert, dann nach Paris, der heimlichen Hauptstadt und Sehnsuchtsort des Subkontinents, es folgten Italien, die USA und England, deutlich verspätet gelangte sie nach Deutschland. Sie begeisterte die Leser, wie die sechs- und siebenstelligen Verkaufszahlen beweisen, und sie machten die Lateinamerikaner zu leidenschaftlichen Lesern. Die internationalen Erfolge dieser neuen Romane, genannt der »Boom«, der jedes Jahr zuverlässig weitere überraschende Meisterwerke bekanntmachte, gepaart mit dem zeitgleichen Sieg der kubanischen Revolution, deren beeindruckende erste Maßnahmen das mediale Interesse auf die politischen Zustände lenkte, machten aus dem Kontinent einen Brennpunkt internationaler Aufmerksamkeit.
Plötzlich stand Lateinamerika also im Mittelpunkt, und auf diese unbekannte Situation mussten die Autoren reagieren. Sie betonten mit nur wenigen Ausnahmen ihre politische Verantwortung und verwiesen zugleich auf ihre literarischen Verpflichtungen. Letztere waren leicht zu präzisieren: gut schreiben, während erstere zu stürmischen Debatten, heftigen Polemiken und unüberbrückbaren Positionen führte. Viele Romanciers verfassten theoretische und häufig polemische Texte über »Literatur und politisches Bewusstsein in Lateinamerika« (Alejo Carpentier) oder »Über die Situation des Intellektuellen« (Julio Cortázar). Überall brachen die Gegensätze auf, der Kontinent bot kein einheitliches Bild, und so befand der politisch unermüdlich aktive Octavio Paz in der »Erkundung der lateinamerikanischen Literatur«: »Die Einheit des uneinheitlichen Hispanoamerika liegt in seiner Literatur.«
Große Verantwortung lag also auf den Schriftstellern, sie sollten den Traum des Befreiers Simón Bolívar und des kubanischen intellektuellen Widerstandskämpfers José Martí von einem geeinten Kontinent wiederaufnehmen und den Kampf für mehr Gerechtigkeit gegen Imperialismus, Korruption, tradierte Missstände und neue Herausforderungen fortführen. Das erwarteten die Lateinamerikaner von ihnen, und ihre Fragen und Forderungen wurden immer lauter: Warum haben wir so viele korrupte Politiker, unfähige Ökonomen, traditionelle Machtcliquen und die zum Himmel schreienden sozialen Ungerechtigkeiten, wenn unsere Autoren doch mühelos den Sprung von der Dritten in die Erste Welt geschafft haben? Warum können unsere Gesellschaften nicht Ähnliches leisten?
Wie also gehen und gingen die Autoren mit ihrer Geschichte und ihren literarischen und politischen (Selbst-)Verpflichtungen um? Das versuche ich zu erkunden, stütze mich dafür ausschließlich auf die literarischen Texte der letzten hundert Jahre, also seitdem es eine lateinamerikanische Literatur gibt, wie sie Octavio Paz definiert hat. Stärker noch beziehe ich mich auf die an- und aufregenden Romane, die lose oder fest zum »Boom« zählen oder ihm nachgefolgt sind. Natürlich ist es unmöglich, fünf (oder gar dreißig) Jahrhunderte in dieser Arbeit adäquat darzustellen, vieles musste ich stark komprimieren, anderes bleibt ausgespart. Ich habe lediglich 16 Schneisen gezogen, die vom Entdecker Kolumbus bis zur aktuellen Drogenproblematik auf dem Kontinent reichen. Sie vermitteln erste Einblicke, aber jedes Kapitel lässt sich zu einem eigenen Buch erweitern.
Immer wieder ist es überraschend zu sehen, wie intensiv sich die Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt, wie gründlich sie recherchiert und historische Fakten oder Persönlichkeiten neu interpretiert haben, kurzum, wie sie ihre »Geschichte« kritisch erzählen. Sie legen das notwendige Zeugnis ab, das in vielen Schulbüchern nicht zu finden ist. Dennoch bleiben weiße Flecken auf dieser literarischen Landkarte – vielleicht, weil die Schriftsteller für ein Thema zu wenige Unterlagen fanden oder einige Figuren ihnen zu blass schienen, manchmal vermutlich auch, weil sie ein Ereignis bewusst oder unbewusst verdrängt haben: Ich habe keinen mexikanischen Roman über Hernán Cortés gefunden, nur umfangreiche Biographien. Keine Straße der Hauptstadt oder Platz trägt seinen Namen, niemand wollte ein Denkmal aufstellen.
Selbstverständlich haben die Autoren alle nur vorstellbaren Themen aufgegriffen, aber die Fülle historischer Arbeiten ist auffällig – und es handelt sich nicht um das gängige Genre des »historischen Romans«, sondern um etwas Neues. Daher konzentriere ich mich auf solche Texte, denn für Sergio Ramírez »ist die Geschichte das Substrat der Literatur Lateinamerikas«. Und Carlos Fuentes behauptete, dass die Kunst die Wahrheit aus den Lügen der Geschichte zutage fördere. Für García Márquez »baut alle große Literatur auf einer konkreten Wirklichkeit auf«, so formulierte er es in La novela en América latina: Diálogo.
Viele Romanciers haben sich insbesondere mit den omnipräsenten Diktatoren, diesem endemischen, unausrottbaren Übel, auseinandergesetzt. Laut García Márquez sind sie »das große mythologische Monster unserer Geschichte«, der Beitrag des Kontinents zu den Gestalten der Weltliteratur. Die überwältigende Natur, die Suche nach der Identität oder die Revolutionen in Mexiko und Kuba nehmen breiten Raum ein im Schaffen der Autoren. Die Frauen leisten seit den 1980er Jahren auch endlich einen unübersehbar starken Beitrag, nachdem Isabel Allende mit Das Geisterhaus einen Welterfolg erzielt hatte: Zuvor waren sie in den Macho-Gesellschaften bis auf wenige Ausnahmen eher Paradiesvögel und vornehmlich ins Ghetto der »kleinen« Genres eingesperrt. Inzwischen stellen sie eine ernsthafte Konkurrenz dar, denn vor allem die Leserinnen lieben ihre Romane. Heute präsentiert sich die literarische Szene lebendig, vielfältig und modern, und die großen Romane sind im Kanon der zeitgenössischen (Welt-)Literatur verzeichnet: Mit Macondo hat sich die Literatur des Kontinents globalisiert.
Eine lateinamerikanische Besonderheit kann man unverändert in vielen Texten jüngerer Schriftsteller und Schriftstellerinnen finden: Wie ihre älteren Kollegen, die heutigen Klassiker, zeigen sie ein politisches und humanistisches Engagement, ein Gefühl besonderer Verantwortung für das eigene Land, wenn sie etwa von der Droge, der aktuellen biblischen Plage erzählen, deren verheerende Auswirkungen die ohnehin schwachen Demokratien des Kontinents dramatisch gefährden und eine gewaltige, die gesamte Gesellschaft zersetzende Wirkung ausüben: Ohnmächtige Regierungen, korrupte Staatsbedienstete und Privatpersonen, Kartelle, die mächtiger als jeder Staat sind, Verrohung und Willkür. Ganzen Generationen fehlt in vielen Ländern wie in Honduras oder El Salvador jegliche Perspektive auf ein besseres Leben: Sie emigrieren.
Die Literatur bringt uns das Denken und Fühlen Lateinamerikas näher
In den letzten Jahrzehnten entwickelten die Lateinamerikaner trotz aller ökonomischen und politischen Probleme ein neues Selbstbewusstsein gegenüber Europa, und mehr noch gegenüber der aktuell gesteigerten Arroganz der USA. Die Voraussetzungen für einen gedanklichen Austausch haben sich also geändert. Lange Zeit hat Lateinamerika sich darum bemüht, intellektuelle, wirtschaftliche und politische Beziehungen zu stärken und zu intensivieren. Vergeblich, Europa zeigte kein Interesse. In »Die Einsamkeit Lateinamerikas«, seiner Nobelpreisrede von 1982, beschwor García Márquez eine Gegenutopie zur Entwicklung der Menschheit auf ein Ende hin, inzwischen eine »schlichte wissenschaftliche Möglichkeit« und sagte, dass es noch immer nicht zu spät sei. »Die neue mitreißende Utopie eines Lebens, bei dem niemand – bis hin zur Art des Todes – über einen anderen entscheiden darf, eines Lebens, in dem Liebe wirklich wahr und Glück möglich ist.«
Ich bin davon überzeugt, dass die Literatur Südamerikas uns das Denken und Fühlen, die Kultur und Geschichte des Kontinents näherbringt, sie ist ein vortreffliches Instrument für ein besseres Verständnis. Mit wechselseitigem Wissen können Vertreter der Alten und der Neuen Welt, dies- und jenseits des Atlantiks, leichter einen beide Seiten bereichernden Dialog führen, »in dem die zu hundert Jahren Einsamkeit verurteilten Sippen endlich und für immer eine zweite Chance auf Erden bekommen«, so García Márquez in »Die Einsamkeit Lateinamerikas«. Lateinamerika und Europa im Gedankenaustausch und engem Kontakt in allen Bereichen: Das ist ein Desiderat und eine Notwendigkeit in unseren globalisierten Gesellschaften.
In den letzten Jahren, seit etwa 2000, schwand in Europa das Interesse für den Kontinent, die Neugier, junge Autoren aus Lateinamerika, die so anders aufgewachsen sind als ihre berühmten Vorgänger, zu lesen. Sie erzählen neue Geschichten und schildern ihre aktuelle Situation in harten, auch ästhetisch modernen Schreibstilen. Die Violencia ist längst omnipräsent und durchsetzt alles. Laut Carlos Fuentes ist sie der leicht erkennbare, universell verbreitete Pass des 20. (und bislang auch des 21.) Jahrhunderts, und »ist nicht länger nur ein bedauerliches Charakteristikum der zurückgebliebenen, natürlich ›braunen‹ Völker. Die Kinder von Beethoven, Jefferson und Montaigne haben sie in der technisch absolut perfekten Art praktiziert.« So schreibt der Autor in Valiente mundo nuevo. Wir befinden uns also im gleichen Boot.
Lateinamerika vertraut auf die Kraft seiner Kultur und den Reichtum seiner Literatur. Carlos Fuentes konstatiert im Essay Der vergrabene Spiegel: »Fünfhundert Jahre nach Kolumbus haben wir das Recht, Reichtum, Vielfalt und Beständigkeit unserer Kultur zu feiern.« Octavio Paz ist davon überzeugt, wie er im Aufsatz »Erkundung der lateinamerikanischen Literatur« schreibt, dass »die Geschichte unserer Literatur uns ein wenig über die Mutlosigkeit hinwegtrösten (könnte), die unsere reale Geschichte in uns bewirkt«.
Die Kultur feiern: Das versuche ich in dieser Arbeit, in der aber spannende Tendenzen und eine Reihe wichtiger Autoren (Adolfo Bioy Casares, Clarice Lispector, Sergio Pitol und so viele andere, die zu Recht vermisst werden) oder die erstaunliche Vielfalt »phantastischer Texte« des Rio de la Plata nahezu komplett ausgespart bleiben. Ich habe die vielen Bücher, die individuelle Probleme und Befindlichkeiten großartig erörtern, nicht berücksichtigen können. Für den Kontinent relativ neue Genres wie Science-Fiction, Graphic novels, Thriller und vor allem die Kriminalromane, die sich steigender Beliebtheit erfreuen, werden nur am Rande behandelt. Verzichten musste ich ebenfalls auf die so starke und beliebte Lyrik und die Fülle der ebenfalls hochgeschätzten, grandiosen Kurzgeschichten, um den Umfang nicht zu sprengen. Das ist kaum zu entschuldigen. Auch das Theater fehlt, während ich die wichtigen kulturwissenschaftlichen Essays einbeziehe.
Das vorliegende Buch möchte einige grundlegende Fakten aus der Sicht der Lateinamerikaner vermitteln, ist aber keine Kultur- oder Literaturgeschichte, keine historische oder akademische Studie, sondern Ergebnis meiner Lektüren und Reisen, die Erkundung einer neugierigen und engagierten Literaturliebhaberin. Es ist eine kleine Bestandsaufnahme, die zeigen möchte, wie die Lateinamerikaner ihre Geschichte verstehen und erzählen. Jeder Kenner wird Versäumnisse feststellen, denn es gibt eine unüberschaubare Fülle von wunderbaren Texten. Ich musste auswählen, habe mich aber bemüht, das breite Spektrum möglichst kompakt zu spiegeln. Eine große Herausforderung bestand darin, unentwegt kürzen, verdichten und streichen zu müssen. Persönliche Vorlieben sind vermutlich erkennbar, hoffentlich auch meine ungebrochene Faszination.
Den Autoren, die mich ihren faszinierenden Kontinent kennen- und lieben gelehrt haben, danke ich mit kurzen Hommagen, die persönliche Begegnungen wiedergeben.
Zitatnachweise
Carpentier, Alejo: Das Reich von dieser Welt; S. 118–138.
Carpentier, Alejo: »Das staunenerregende Mitla«. In: Ders.: Die Farben eines Kontinents; S. 98–100.
Carpentier, Alejo: »Probleme des zeitgenössischen Romans in Lateinamerika« und »Literatur und politisches Bewusstsein in Lateinamerika«. In: Ders.: Stegreif und Kunstgriffe; S. 9–49 und S. 50–66.
Cortázar, Julio: »Über die Situation des Intellektuellen«. In: Ders.: Letzte Runde; S. 256–275.
Fuentes, Carlos: Der vergrabene Spiegel; S. 11, 382.
Fuentes, Carlos: Valiente mundo nuevo; S. 292.
García Márquez, Gabriel: »Die Einsamkeit Lateinamerikas«. In: Ders.: Ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten; S. 31.
García Márquez, Gabriel/Vargas Llosa, Mario: La novela en América latina: Diálogo; S. 36.
Neruda, Pablo: »Die Höhen von Machu Picchu«. In: Ders.: Der große Gesang; S. 25–44. Hier übersetzt von Michi Strausfeld.
Paz, Octavio: »Erkundung der lateinamerikanischen Literatur«. In: Ders.: Essays 2; S. 108, 102, 110.
Paz, Octavio: »Literatura de fundación«. In: Ders.: Puertas al campo; S. 17.
Paz, Octavio: »Sonnenstein«. In: Ders.: Suche nach einer Mitte; S. 9–49.
Ramírez, Sergio: »Las garras de la razón ilustrada«. El País, 1.7.2017.
Valéry, Paul: Vorwort. In: Asturias, Miguel Ángel: Legenden aus Guatemala; S. 6ff.
Vargas Llosa; Mario: Die Wahrheit der Lügen; S. 14.
Vollständige bibliographische Angaben finden sich in der Literaturliste im Anhang. Alle Übertragungen aus nicht übersetzten Texten stammen von Michi Strausfeld.
Teil 1
Kapitel 1Kolumbus
Ich war am Rande des Paradieses,
ich stand unter einem hohen Himmel
und starrte in ein unbekanntes Firmament.
KOLUMBUS, Brief an Königin Isabella
Bevor Amerika von den Seefahrern entdeckt wurde,
hatten Humanisten und Dichter es erfunden!
ALFONSO REYES, Capricho de América
Eine der umstrittensten und unverändert geheimnisumrankten Figuren der Weltgeschichte ist Christoph Kolumbus – bewundert und verhasst, hat er die Phantasie zahlloser Autoren dies- und jenseits des Atlantiks zu den unterschiedlichsten Deutungen angeregt. Über ihn wurde eine Vielzahl von Büchern geschrieben, und dennoch bleibt er ein Rätsel. Niemand bestreitet, dass er ein genialer Seefahrer war, ein Abenteurer, desgleichen ein für die Zeit erstaunlich gebildeter Mann, wie seine Briefe, Tagebücher oder auch die Kommentare zu Senecas Medea beweisen. Die Bedeutung seiner Entdeckungsreise, eines der spektakulärsten historischen Ereignisse, erklärt die andauernde Polemik.
Von den Chronisten seiner Zeit gepriesen, stand sein Ruhm jahrhundertelang fest. »Kein dankbarer Spanier wird sich so großer Wohltaten entsinnen, wie sie sein Vaterland nach Gottes Willen und durch die Hand des ersten Admirals von Indien empfangen hat«, schrieb der Chronist Gonzalo Fernández de Oviedo in seiner Historia general y natural de las Indias Occidentales, islas y tierra firme del Mar Oceano (1535). Auch der so kritische Bartolomé de Las Casas war voll des Lobes: »Jener berühmte und große Kolumbus, dem wir wegen seiner Tüchtigkeit, seinem Geist, seiner Arbeiten, seinem Wissen und seiner Klugheit eine der vorzüglichsten göttlichen Taten« verdanken. Noch 1892, zur pompösen Vierhundertjahrfeier der Entdeckung, stand Spanien im Bann seiner Heldentat.
Der Deutsche Johannes Fastenrath gab 1895 in Dresden einen umfangreichen Band heraus, in dem er die spanischen Feierlichkeiten detailliert aufgelistet hat. In der Einleitung lesen wir über Kolumbus: »Der Schwärmer und Rechner, der Abentheurer und Mystiker, der als der Erste dahin gelangt, wohin noch keiner aus eigenem Antrieb gekommen, und der eine gewaltige Atlantis, die noch schöner als sie der Dichter geträumt, für alle Anderen, nur nicht für sich entdeckt hat.« Die Folgen für die einheimische Bevölkerung, die Dezimierung ganzer Völker und Kulturen durch eingeschleppte Krankheiten und Zwangsarbeit: All dies war 1892 kein Thema.
Das grandiose Fest, das 1892 in Madrid ausgerichtet wurde und dessen Vorbereitungen viele Jahre dauerte, sollte Spanien noch einmal als glanzvolles »Reich, in dem die Sonne nicht unterging« zur Schau stellen, denn noch waren Kuba und Puerto Rico seine Kolonien.
Kurioserweise enthält der Band von Fastenrath nicht die Ode »An Kolumbus« des Dichtergenies Rubén Darío aus Nicaragua, der als Einziger den Chor der Bewunderer mit kritischen Worten störte.
Das Gedicht beginnt mit der Zeile: »Unglückseliger Admiral! Dein armes Amerika – die Perle deiner Träume ist ein hysterisches Nervenbündel.« Dann beklagt Darío die Entdeckung: »Hätte es doch Gott gefallen, nie die weißen Segel in den zuvor unzerstörten Gewässern zu spiegeln, hätten doch die überraschten Sterne nie deine Karavellen am Ufer ankommen sehen.« Die letzte Strophe endet mit der Bitte: »Christoph Kolumbus, armer Admiral, bete zu Gott für die Welt, die du entdeckt hast.«
Das 20. Jahrhundert zeigt ein durchweg kritisches Bild von Kolumbus, vor allem in Lateinamerika. Bereits 1958 publizierte der mexikanische Geschichtsphilosoph Edmundo O’Gorman den bahnbrechenden Essay La invención de América, in dem er behauptet, der Kontinent sei nicht entdeckt, sondern erfunden worden. Diese These wirkt bis heute nach. Er interpretiert die Tat von Kolumbus als Beginn eines ideologischen Prozesses, denn die Eigenständigkeit Amerikas sei weder damals noch heute korrekt zur Kenntnis genommen worden. Etwa zur gleichen Zeit erläuterte der Kubaner José Lezama Lima, Dichter, Universalgelehrter und Romancier, in seinem Essay Die amerikanische Ausdruckswelt (1957) das unverwechselbar »Eigene« des Kontinents. Damals wie heute streitet die Fachwelt über O’Gorman, und in den Jahren vor der Fünfhundertjahrfeier 1992 wurde sein Buch in Spanien und Lateinamerika noch einmal heftig diskutiert. Man lobte oder verwarf, polemisierte und kritisierte, aber seine These bleibt lebendig: Der Titel wurde zum geflügelten Wort.
Was macht die andauernde Faszination von Kolumbus aus? Alles an ihm scheint widersprüchlich: Er war offensichtlich ein tiefreligiöser Mensch und zugleich ein fortschrittlicher Empiriker, er wollte unbedingt Gold und Reichtümer finden, zeigte sich aber überwältigt von der paradiesischen Landschaft und den »guten Wilden«. Dennoch wurde er zum Initiator ihrer Versklavung.
Bereits die ersten Chronisten Lateinamerikas, die Kolumbus noch persönlich gekannt, durch Augenzeugen von seinen Reisen gehört oder sich selbst nach Amerika begeben hatten, vertraten gegensätzliche Meinungen. Von Anfang an vermischte sich die Hagiographie (wie im Bericht seines Sohnes Fernando) mit der scharfen Verurteilung. Pietro Martire d’Anghiera, Gonzalo Fernández de Oviedo oder Francisco López de Gómara, um nur drei der bedeutendsten Zeitzeugen und Chronisten zu nennen, vor allem aber Fray Bartolomé de Las Casas, dem wir den furchteinflößenden Bericht über die »Verwüstung« der Indien und Gräueltaten der Spanier verdanken, beurteilten die »Entdeckung« von Kolumbus 1492 sowie die Folgen für Europa auf der einen und Amerika auf der anderen Seite höchst unterschiedlich: Die Polemik um die Neue Welt begann im 16. Jahrhundert.
In regelmäßigen Abständen wird sie aufgegriffen und variiert, stets gibt es neue Erkenntnisse. Vor den Fünfhundertjahrfeierlichkeiten 1992 schmälerte man das Verdienst von Kolumbus vehement, denn eigentlich sei der Kontinent vom Wikinger Leif Eriksson weitere 500 Jahre zuvor entdeckt worden, Kolumbus habe sein Wissen über die unbekannten Länder vom »anonymen Piloten« oder »unbekannten Seefahrer« erhalten, der ihm auf dem Sterbebett in Lissabon wichtige Unterlagen gegeben habe. Die Überlieferung dieser Legenden oder vielleicht Wahrheiten werden in einzelnen Texten immer mal wieder aufgegriffen, bejaht oder verworfen.
Kolumbus wird nicht heiliggesprochen
Der kubanische Romancier Alejo Carpentier publizierte 1979 Die Harfe und der Schatten, einen Roman, der den historisch verbürgten Versuch von Papst Pius IX. beschreibt, Kolumbus am Ende des 19. Jahrhunderts eine ausgefallene Ehre zu erweisen. Jener hatte nämlich die Idee, Amerika brauche einen Heiligen, der dies- und jenseits des Atlantiks akzeptiert werden könnte. Warum also nicht Christoph Kolumbus wählen, der Christus doch auf seinen Schultern in die Neue Welt getragen hatte? Carpentier gab in einem Interview Auskunft über die erstaunlichen Details, die er präzise recherchiert hatte: »Papst Pius IX. präsentierte der Heiligen Ritenkongregation eine erste Eingabe, Jahre später eine zweite, konnte jedoch nicht miterleben, ob der Fall verhandelt wurde oder nicht. Endlich machte Papst Leo XIII. am Vorabend des 400. Jahrestages der Entdeckung Amerikas einen dritten Anlauf, der von 850 Bischöfen unterstützt wurde. Diesmal versammelte sich die Ritenkongregation, es kam zum Prozeß, man prüfte alle Argumente pro und kontra. Aber die Richter verwarfen die Kandidatur von Kolumbus, er wurde kein Heiliger, und in meinem kleinen Roman erzähle ich warum.«
Was erzählt uns dieser Roman? Zunächst erfahren wir von den Überlegungen Papst Pius IX. (sein Pontifikat von 1846 bis 1878 war das längste in der Geschichte), wie der Prozess der Kanonisierung von Kolumbus stattfinden solle. Er hat das Aktenmaterial studiert, erinnert sich an seinen Werdegang vom Franziskanermönch zum Papst, vor allem aber an den Auftrag, einer Bitte des chilenischen Präsidenten Bernardo O’Higgins Folge zu leisten und die in Misskredit geratene Kirche im Land neu zu strukturieren. Als Kanonikus tritt er die Reise an, die Vorbereitungen erstreckten sich über Monate. Es folgt die lange Schiffsreise nach Buenos Aires und die mühsame Überquerung der Anden. Als die Reisegruppe ihr Ziel endlich erreicht, war O’Higgins bereits gestürzt worden und die entsandten Priester müssen, um den Unwillen der Bevölkerung angesichts der hohen Kosten nicht zu erregen, sofort nach Europa zurückkehren. In ihrer Hast umsegeln sie deshalb das gefährliche Kap Hoorn.
Aber die Eindrücke der grandiosen Natur und der liebenswürdigen Menschen blieben haften, der Kanonikus war tief beeindruckt und fasziniert von dem, was er in Argentinien und Chile erlebt hatte. Als Papst erinnert er sich vor allem an sein Erstaunen angesichts der gewaltigen Landschaften, der fremden Sitten, denkt aber auch über die potentiellen Gefahren nach, die von diesem Kontinent ausgehen könnten, falls er gefährlichen Ideen wie dem Freimaurertum oder gar dem Kommunismus anheimfiele. Daher gibt er eine Studie in Auftrag, das Leben von Kolumbus zu erforschen, um den Prozess der Kanonisierung »auf außerordentlichem Wege« einzuleiten, da er Lateinamerika fest in der katholischen Kirche verankern will.
Der Hauptteil des Romans ist eine fiktive Autobiographie von Kolumbus: »Ich will alles so berichten, wie es sich wirklich zugetragen hat«, und das ist selbstverständlich eine Lüge. Aber gestützt auf viele alte Quellen, vom Bordbuch bis zu den Chroniken der Zeitzeugen, entwickelt Carpentier allmählich das Bild: Der Abenteurer ist von seiner Vorstellung besessen, einen neuen Schiffsweg nach Indien zu finden, und da er auch ein Filou ist, glaubt er dem normannischen Meister Jakob und den Schilderungen des anonymen Seefahrers in den Tavernen von Lissabon, dass bereits die Wikinger um das Jahr 1000 ein fernes Land – Grünland oder Weinland – gefunden und darüber Wunderbares kundgetan hatten. Gestützt auf seine Lektüre der Klassiker, vor allem auf Seneca, der mehrfach die Existenz anderer Länder jenseits von Thule erwähnt hatte, aber auch auf die Prophezeiung der Bibel aus dem Buch Jesaja, schuf er sich ein präzises Bild von dem bevorstehenden Abenteuer, das ihm zur fixen Idee wurde. Für Carpentier steht außer Zweifel, dass Kolumbus wusste, was ihn am Ende der Reise erwartete: Land. Aber er verlor fast zwei Jahrzehnte damit, das notwendige Geld für die Expedition aufzutreiben und pflegte inzwischen alle Laster, »bis auf die Faulheit«. Er heiratete in Lissabon eine reiche Dame, wurde bald Witwer (was ihn wohl nicht betrübte), kehrte nach Spanien zurück und lebte im Kloster La Rábida unverheiratet mit einer Frau zusammen, trotz des gemeinsamen Sohnes: eine unverzeihliche Sünde nach katholischem Verständnis. Gab es vielleicht auch irgendeine nähere Beziehung zu Königin Isabella – Carpentier deutet es an –, die ihm schließlich das notwendige Geld gewährte? Möglicherweise stammte es von reichen Juden, die sich damit von der Verbannung freizukaufen versuchten.
Am 3. August 1492 stachen drei kleine Schiffe in See, die Santa María, die Pinta und die Niña. 70 Tage später, am 12. Oktober, erspähte Rodrigo de Triana endlich Land, die Insel Guanahaní. »Sie gehen nackend umher, so wie Gott sie erschaffen, Männer wie Frauen […] alle jene, die ich erblickte, waren jung an Jahren, denn ich sah niemand, der mehr als 30 Jahre alt war. Dabei sind sie alle sehr gut gewachsen, haben einen schön geformten Körper und gewinnende Gesichtszüge. Sie haben dichtes, struppiges Haar, das fast Pferdeschwänzen gleicht […] sie führen keine Waffen mit sich, die ihnen nicht einmal bekannt sind; ich zeigte ihnen die Schwerter und da sie sie aus Unkenntnis bei der Schneide anfaßten, so schnitten sie sich.« So lautet die Eintragung im Bordbuch des Kolumbus.
Nun begann die verzweifelte Suche nach dem Gold, das gefunden werden musste, weil es in Spanien so dringlich gebraucht wurde. Vergeblich. Kolumbus kehrte zurück mit einigen »Indios«, ein paar Papageien und goldenem Kleinkram, was keinerlei Begeisterung weckte. Carpentier breitet den prachtvollen Empfang bei den Katholischen Königen in Barcelona vor unseren Augen aus: »Und der Tag kam. Ein Festtag in ganz Barcelona. Wie ein Schausteller, der zu einer großen Vorstellung ins Schloss einzieht, zog ich in den Palast ein, wo ich erwartet wurde, gefolgt von meiner Truppe, den Darstellern des Retabels von der Wunderwelt Indiens – dem ersten Schauspiel dieser Art, das auf der großen Bühne der Welt aufgeführt wurde.« Und wenig später: »Auf breiten Silbertabletts – sehr breiten, damit die Muster zahlreicher wirkten – das GOLD: Gold in unbearbeiteten Stücken, fast von den Ausmaßen einer Hand; Gold in winzigen Masken, Gold in kleinen Figuren […] nicht so viel Gold in Wirklichkeit, wie ich gewünscht hätte.«
Obwohl der Hof enttäuscht war über die so bescheidenen Mitbringsel und Trophäen gelang es Kolumbus, die Mittel für drei weitere Reisen aufzutreiben. Keine brachte den verlangten Reichtum, und so verschiffte er schließlich die Indianer, die als Sklaven arbeiten mussten, bis einige Mönche heftig protestierten. Jahre später untersagten Königin Isabella und die Kirche diesen Menschenhandel.
Das Leben von Kolumbus und die Folgen seiner Entdeckung konnte man beim besten Willen nicht als »heilig« bezeichnen: Auf den karibischen Inseln herrschte Willkür. Die Spanier vergewaltigten, plünderten, töteten, die Einheimischen wurden in wenigen Jahrzehnten nahezu ausgerottet, wie besessen suchten die Eroberer nach Gold, Perlen und Gewürzen. Kolumbus log und betrog, um seiner Chimäre zu folgen. Die Entdeckung der gewaltigen Gold- und Silberfunde in Mexiko erlebte er nicht mehr: eine Ironie der Geschichte?
Der dritte Teil des Romans führt zurück nach Rom, und Carpentier lässt den Leser die Gespräche auf den Korridoren des Vatikans mithören, bei denen die geplante Kanonisierung kritisch diskutiert wird. Es folgt der eigentliche Prozess, bei dem ein Advocatus Diaboli alle Argumente schlagend entwaffnet. Jules Verne, Victor Hugo, Bartolomé de Las Casas oder Alphonse de Lamartine treten als Zeugen auf und äußern ihre Bedenken, während León Bloy unbeirrt zugunsten von Kolumbus interveniert. Dieser hört als »Unsichtbarer« alles mit an, und schnell steht fest, dass er sich nie im Leben vorbildlich verhalten hat – was er genau wusste. Ein anderer Unsichtbarer, Andrea Doria, tröstet den resignierten Kolumbus mit der Versicherung, es habe noch nie einen seefahrenden Heiligen gegeben.
Kolumbus bereute nie wirklich, sondern freute sich über sein Leben als erfolgreicher Entdecker und Frauenheld sowie über den erworbenen Ruhm. Allerdings beklagte er die Missachtung des Hofes und das materielle Elend seiner letzten Lebensjahre in Valladolid: Letztlich war er für Carpentier ein betrogener Betrüger. Ob er nach einem solchen Leben auf Vergebung seiner Sünden und Missetaten hoffen konnte, scheint unwahrscheinlich, denn »die Todesschinder verheerten die Inseln. Guanahani war die erste in der Geschichte der Todesmartern«, so Pablo Neruda im Gedichtzyklus Der große Gesang.
Carpentier verstand seine Arbeit an diesem Roman als die eines »Dichters, der eher ein Erfinder von Handlungen sein soll, denn wirklich Geschehenes kann zuweilen dem entsprechen, was wahrscheinlich und möglich gewesen wäre«, wie es Aristoteles in der Poetik formuliert hatte. Für ihn war Kolumbus ein wunderbarer Protagonist, jemand, der »ebenso kaschiert und unverfroren log wie Benvenuto Cellini in seiner Vita oder Rousseau in seinen Konfessionen. […] Daher habe ich den Satz von Aristoteles für mich variiert, daß der Romancier die Geschichte so arrangieren darf, wie sie hätte geschehen müssen oder können, so, wie er sich diese vorstellen kann«, sagte er im Interview von 1979. Der »Mythos« des grandiosen Entdeckers zerbröselte unaufhaltsam.
Gerne bezeichnete sich Carpentier als »neuer Chronist der Indien«. Die frühen Verfasser hätten eine gigantische Leistung vollbracht, an der sich jeder moderne Romancier messen lassen müsste. Schließlich hätten sie die richtigen Worte gefunden bzw. erfunden für Dinge, Tiere, Pflanzen und vieles mehr, die sie nicht kannten und nie zuvor gesehen hatten, und das alles den Spaniern in der Heimat vermittelt. Alle Chronisten hatten darüber geklagt, wie schwer es sei, das Neue glaubwürdig und verständlich zu machen. Gonzalo Fernández de Oviedo war sich bewusst, wie hoffnungslos es war, auch nur einen bunt gefiederten, unbekannten Vogel korrekt zu beschreiben und die passenden Worte zu finden. In dem aufschlussreichen Essay »Probleme des zeitgenössischen Romans in Lateinamerika« schrieb Carpentier, dass der Kontinent deshalb eine barocke Prosa braucht, »um ihm Kontur zu verleihen und ihn zu definieren«.
Bei García Márquez in Fantasía y creación artística liest sich das so: »In Lateinamerika und in der Karibik mussten die Schriftsteller nur wenig erfinden, vielleicht ist ihr Problem das genaue Gegenteil: Sie müssen ihre Wirklichkeit glaubhaft machen. Das war so seit unseren historischen Anfängen, bis zu dem Punkt, dass es in unserer Literatur keine unglaubwürdigeren und zugleich der Realität so fest verhafteten Schriftsteller gibt wie die Chronisten der Indien. Sie standen vor einer Wirklichkeit […], die ihre Phantasie um ein Vielfaches übertraf.« Auch er las begeistert die alten Texte und Chroniken, Kolumbus und andere Entdecker faszinierten ihn. In seinen Roman Der Herbst des Patriarchen integrierte er fast wörtlich übernommene Sätze aus dem Bordbuch. Dort liest man: »Herr General, es waren nämlich Fremde angekommen, die in einer durchtriebenen Sprache schwatzten […] und sie nannten die Guacamayas Papageien, die Kajaks nannten sie Flöße und die Harpunen Speere, und da sie gesehen hatten, daß wir zu ihrem Empfang um ihre Schiffe schwammen, kletterten sie auf die höchsten Masten hinauf und schrien einander zu, schaut, wie gut gewachsen sie sind, welch schöne Körper und gutgeschnittenen Gesichter sie haben und Haar fast so dick wie Pferdeschweife […].« Eine indirekte Hommage, vielleicht.
Kolumbus wird entmystifiziert
Im gleichen Jahr 1979 erschien auch der Roman El mar de las lentejas des Kubaners Antonio Benítez Rojo, der die überlieferte »wahre« Geschichte der Entdeckung mit vielen erfundenen Begebenheiten mischt. Die Bezeichnung »Linsenmeer« geht auf die erste Landkarte des französischen Geographen Guillaume Le Testu zurück, der »Antilles« als »Lentilles«, also Linsen verstanden hatte. Für den Autor ist die Karibik ein Meta-Archipel, der weder Grenzen noch ein Zentrum kennt.
In vier Erzählungen evoziert Benítez Rojo das erste Jahrhundert nach der Entdeckung, angefangen von der zweiten Reise von Kolumbus 1493–1496 bis zum Tod Philipps II. 1598. Er berichtet von einem (fiktiven) Soldaten, Antón Babtista, der Kolumbus 1493 begleitete. Thematisiert wird die Ausbeutung der leichtgläubigen Einheimischen, die man benutzt und danach wegwirft. Die Spanier schätzen fern von der Heimat vor allem die sexuellen Freiheiten und schrecken vor keiner Vergewaltigung zurück. Zuletzt lebt Babtista wie ein ehrenwerter Gast unter den Einheimischen und lässt sich von ihnen bedienen, so dass er immer dicker wird. Essen war für die Spanier so wichtig, weil der in der Heimat weitverbreitete Hunger viele Bewohner der Extremadura auf die Schiffe getrieben hatte. Er genießt den unbekannten Luxus, dennoch prägen Willkür und Launen sein Verhalten in diesem Paradies. Benítez Rojo spielt souverän mit den Tagebucheinträgen von Kolumbus. Hauptanliegen seines Werks ist es, eine kritische und dokumentierte Sicht über die Geschichte der Kolonisierung der Karibik durch die Spanier zu erarbeiten.
1983, also vier Jahre nach Die Harfe und der Schatten, erschien ein weiterer Kolumbus-Roman. Der Argentinier Abel Posse benutzte in Die Hunde des Paradieses Fakten, Orte und Zeiten völlig frei und legte mit seiner Interpretation der Entdeckung eine radikale Korrektur des Eurozentrismus vor, indem er die Hochkulturen Amerikas der europäischen Hybris gegenüberstellte. Bei ihm wähnt sich Kolumbus im Paradies, erlebt in der Neuen Welt eine Peripetie, will nur noch in der Hängematte leben, nackt wie die Eingeborenen – bis er schließlich festgenommen und in Ketten nach Spanien verschifft wird. Von seiner dritten Reise kehrte er 1500 tatsächlich als Gefangener zurück, wurde nach der Ankunft in der Heimat aber sogleich von der Königin begnadigt. Posse entmystifiziert Kolumbus, gestützt auf harsche Fakten: Seine Entdeckung habe dem Kontinent nur zum Schaden gereicht und unermessliches Leid und Unheil über die einheimische Bevölkerung gebracht. Während Kolumbus sich im Paradies wähnte, wie an der Mündung des Orinoco, befanden sich die Indigenen längst in einer alltäglichen Hölle. Auch Posse zitiert aus den Briefen von Kolumbus und seinem Bordbuch, und er stellt die Sanftheit der Einheimischen der Brutalität der Entdecker gegenüber. Das Ergebnis ist vernichtend: »Der Admiral verstand, daß Amerika in die Hände von Kommisshengsten und Rechtsverdrehern gefallen war, wie der Palast der Kindheit von Lakaien eingenommen wird, denen es gelungen ist, sich gewaltsam der Gewehre zu bemächtigen. Unbeirrt murmelte er: ›Purtroppo c’era il Paraiso!‹«
Abel Posse setzte sich so intensiv mit der Figur von Kolumbus auseinander, weil er deutliche Parallelen zwischen der Entdeckung im 15. Jahrhundert und dem Imperialismus der USA im 20. Jahrhundert