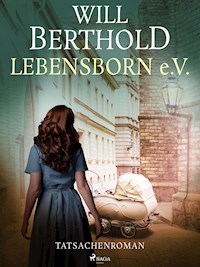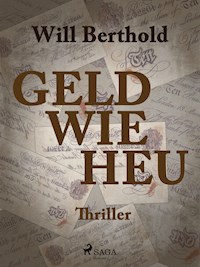
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kriegsende 1945: Eben erst aus der Falle von Triest ausgebrochen, finden drei tollkühne deutsche Fallschirmspringer tausende britischer Pfundnoten, die auf dem Toplitzsee treiben. Natürlich will jeder von dem überraschenden Geldsegen profitieren, der da die Enns hinunterschwimmt. Captain Robert S. Steel, einer der wenigen ausgebildeten Kriminalisten bei der CIC und Spezialist auf diesem Gebiet, klärt die Herkunft der Blüten schnell auf, fortan wird der Fall als "Operation Bernhard" in die Geschichte der Geldfälscherei eingehen. Doch dann tauchen einige Zeit später erneut Falsifikate auf. Wer steckt dahinter? Fälscher von damals, die Steel und seinen Kollegen durch die Lappen gegangen sind? Die Agenten, die die Blüten damals vertrieben haben? Eine Untergrundgruppe der Nazis? Ein atemloser Thriller voller überraschender Wendungen, kriminalistischer Finessen und erotischer Funkensprüherei!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Geld wie bell
Roman
SAGA Egmont
Geld wie Heu
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1982 by Goldman Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711727096
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Erster teil
Alarmzeichen
Dieser Mittwoch ist ein Tag, der sich auf dem linken Bein erhoben hat. Überraschend war über Nacht das Wetter gekippt, statt des vorhergesagten Sonnenscheins fällt dichter Dauerregen auf die Dächer von München. Der derzeitige Hausherr der beschlagnahmten Villa in Nymphenburg erwacht gegen zehn Uhr und überzeugt sich allmählich, daß er allein ist.
Er erhebt sich mühsam, tritt ans Fenster, betrachtet die Schäden, die der Sturm im Garten angerichtet hat: Meteorologie, die Lehre vom Zufall. Wenn es in Feldafing auch so aussieht, ist der Golfplatz mindestens für diese Woche ruiniert; er schüttelt sich. Dieser lustlose Morgen ist so unfreundlich und abweisend wie eine Nutte an ihrem freien Tag.
Captain Robert S. Steel streicht sich die Haare aus der Stirn; er trägt sie etwas länger als die meisten Amerikaner. Er stammt zwar aus Arizona, dem Land der Cowboys, aber zu dieser Stunde ist er nicht der strahlende Westernheld, der lässig das Lasso schwingt, sich in allen Sätteln zurechtfindet und mit einem Schuß gleich zwei erledigt.
Die nächste Überraschung kommt prompt. Im Badezimmer stellt der Captain fest, daß das Warmwasser ausgefallen ist. Auf die kalte Dusche verzichtet er. Er schneidet sich beim Rasieren; während er die Schnittwunde behandelt, betrachtet er sich kritisch im Spiegel. Er hat ein schmales, übermüdetes Gesicht, das einmal geordnet werden müßte. Es zeigt Spuren von Charme und Spuren von Whisky. Der Charme stammt von seinem Wiener Großvater, der noch im alten Jahrhundert in die Staaten ausgewandert war, der Whisky von der Party des gestrigen Abends. Highlife in Germany: vier Partys in fünf Tagen. Wie immer nimmt sich Robert S. Steel vor, sein Lotterleben einzuschränken, und wie meistens wird er beim Lunch schon wieder überlegen, wie sich der heutige Abend verbringen läßt.
Des Tages Ungemach setzt sich fort: Als der Captain mit dem fabrikneuen »Oldsmobile« starten will, springt der Motor nicht an, und er muß den »Chevy« aus der Garage holen. Er wird viel zu spät in sein Office kommen. Am Odeonsplatz ist eine Straßenbahn entgleist; er kann nicht vor und nicht zurück und versäumt so noch einmal zwanzig Minuten.
Er jagt durch die Prinzregentenstraße, die Kurven zum Friedensengel hoch, wo zur Rechten das Münchener CIC-Headquarter liegt, das Hauptquartier des Geheimdienstes der US Army, nur ein paar hundert Meter von Hitlers einstiger Privatwohnung entfernt.
Der Diktator ist schon seit drei Jahren tot, existent sind nur noch die Folgen seiner Politik, und das heißt, daß zur Zeit noch eineinhalb Millionen deutscher Soldaten in Kriegsgefangenschaft sind, daß fünfzehn Millionen Flüchtlinge ihre Heimat verloren haben und daß noch immer sechshunderttausend DPs, verschleppte Personen, vorwiegend in Lagern leben.
Steel stellt den Wagen ab, betritt die Dienststelle, in der er — der Falschgeldspezialist der Militärregierung und Verbindungsoffizier zur Property Control — eigentlich nur Gast ist. Er schüttelt den lästigen Leutnant Whistler ab, schickt Jutta, seine Sekretärin, zum Einkaufen in die PX und sieht die nächste Bescherung: Sein Büro ist unaufgeräumt, weil die Putzfrau erkrankt ist.
Das Telefon klingelt. Pausenlos. In seinem Vorzimmer. Diese verdammte Jutta, wo bleibt sie bloß? Genau genommen ist sie als Deutsche gar nicht berechtigt, seine Ration abzuholen, aber sie gibt sich alliierter als alle Alliierten zusammen, und der Captain ist in Besatzungszeiten ein kleiner Gott, und ein solcher tut, was er will.
Steel tritt ans Waschbecken, füllt ein Glas mit Wasser, wirft zwei Aspirin hinein. Der Trigeminusnerv setzt in seinem Kopf die Party von gestern fort. Zu seinem verdorbenen Magen kommt jetzt noch das Ohrensausen vom ständigen Telefongebimmel.
Leutnant Whistler steckt seinen Kopf herein. »Nehmen Sie nicht ab, Captain?« fragt er vorwurfsvoll.
»Shit«, erwidert Robert S. Steel. »Was ist denn schon wieder los?«
»Vielleicht eine Informantin«, entgegnet, der schlaksige Offizier. »Womöglich auch nur eine Verrückte.«
Mit angewidertem Gesicht greift der Offizier nach dem Hörer. »Captain Steel«, meldet er sich mit krächzender Stimme.
»Sind Sie der Chef?« fragt eine aufgeregte Frau.
»Ja«, antwortet der Mann mit dem Alkoholkater.
»Zuständig für Falschgeld?«
»Auch das.«
»Und Sie sprechen Deutsch?«
»Das hören Sie doch«, versetzt Captain Steel. »Und wer sind Sie?«
»Mein Name tut nichts zur Sache«, antwortet die Informantin schrill. »Aber ich gebe Ihnen eine Chance, den Dandy zu fassen und — «
»Wer ist der Dandy?« unterbricht sie der Captain.
»Das fragen Sie mich?«
Die Stimme am anderen Ende droht zu kippen.
Eine kleine Pause tritt ein. Der Captain weiß, daß seine Leute funktionieren. Das Gespräch wird mitgeschnitten und per Fangschaltung festgestellt, von wo die aufgeregte Frau anruft. Einen Moment lang fragt sich der Captain, wie sie wohl aussieht; er macht es zu einem Sport, aus dem Klang der Stimme auf das Aussehen der Sprechenden zu schließen. Die Unbekannte könnte dunkelhaarig sein; sie ist vielleicht der Typ, der ein wenig zur Korpulenz neigt, haltlos lacht und noch hemmungsloser weint, aber das sind nur zweifelhafte Vermutungen. Wie eine Frau aussieht, weiß man immer erst, wenn man ihr begegnet; welche Gefühle sie hat, erfährt man, wenn man sie umarmt; und welchen Charakter sie besitzt, stellt man fest, wenn sie einem das Geld aus der Brieftasche nimmt.
»Sie sind aber wirklich gut«, nimmt die Informantin das Gespräch wieder auf. »Bin ich hinter Falschmünzern her oder Sie?« Sie lacht kurz, es klingt schrill und blechern. »Damit Sie es nur wissen: Der Dandy ist der gerissenste Geldfälscher, den es je gegeben hat.«
»Man lernt nicht aus«, entgegnet der Captain sarkastisch, mit der linken Hand greift er sich ein Stück Papier. »Sagen Sie mir wenigstens, wie dieser Tausendsassa aussieht«, fährt er fort.
»Gut«, erwidert die Anruferin. »Viel zu gut.« Wieder läßt sie ihr grelles Lachen hören. » Als ich ihn kennenlernte, hieß er Ferdinand Allert. Aber er wechselt seine Papiere und seine Namen so häufig wie seine Freundinnen. Er hieß schon Fritz Kitzer, Georg Kriminel, Jean Perrier, Alan Davis und Peter Flott. Vielleicht kennt er seinen richtigen Namen selbst nicht mehr.«
»Und wo wohnt er jetzt?«
»Was weiß ich«, erwidert die Anruferin. »Bei mir ist er ausgezogen.«
»Wollen Sie denn nicht hierherkommen?« fragt der Captain. »Ich schick’ Ihnen einen Wagen.«
»Auf keinen Fall.«
»Ja, zum Teufel«, flucht der Captain, »warum wenden Sie sich dann überhaupt an uns?«
Wieder ist es ein paar Sekunden still in der Leitung.
»Weil ich ihn hasse«, sagt die Frau hart und deutlich; dann hängt sie ein.
Der Captain sieht einen Moment ins Leere. Er repetiert, trotz seines Hangovers, das Gespräch. Er ist bekannt für ein blendendes Gedächtnis, das selbst Nebensächlichkeiten speichert. Dandy, überlegt er, irgendwie hat er diesen Spitznamen schon einmal gehört, aber Dandys gibt’s wie Sand am Meer.
Diesmal läßt sich Leutnant Whistler nicht mehr aufhalten. Wie immer hat er ein paar Akten in der Hand und ein paar Falten im Gesicht. Er haßt seinen Job, er haßt den Captain, er haßt die Armee, er haßt alles, was ihm keine Punkte bringt, mit deren Hilfe er nach Cleveland in Ohio zurückkehren will, und zwar heute lieber als morgen.
Diese deutsche Trümmerlandschaft steht ihm bis obenhin, dieses armselige Land, in dem nur der Hunger satt wird. In den Zeitungen steht, daß die tägliche Kalorienzuteilung in der Bizone für den Normalverbraucher von 1181 auf 1550 erhöht wurde, aber Leutnant Whistler weiß, daß es zum Beispiel im Ruhrgebiet schon seit Wochen weder Fett noch Fleisch noch Kartoffeln gegeben hat.
»Der Anruf kam aus einer Telefonkabine am Marienplatz«, meldet er.
»Na ja«, entgegnet der Captain. »Eine verlassene Braut.«
»Manchmal sind verlassene Bräute unsere besten Mitarbeiter.«
»Manchmal«, brummelt der Captain, »aber Weihnachten ist öfter.«
»Ich würde der Sache nachgehen«, sagt Whistler.
»Nichts gegen einen guten Ratschlag, Leutnant«, erwidert der Captain. Er fläzt sich in den Stuhl, legt die Beine auf den Schreibtisch. »Haben Sie schon einmal etwas von einem Fritz Kitzer gehört?« fragt er.
»Nein.«
»Von Georg Krimmel?«
»Nein.«
»Von Alan Davis?«
»Nein.«
»Peter Flott kennen Sie auch nicht zufällig?«
»Zufällig nicht«, erwidert der lange Leutnant verärgert.
»Dann haben Sie vielleicht die Freundlichkeit, nach den genannten Herren fahnden zu lassen«, befiehlt der Captain. »Nehmen Sie Inspektor Gräbert von der hiesigen Kripo dazu, vielleicht ist der schlauer als wir.«
Die verdammten Aspirins helfen nicht, nicht die Bohne, eigentlich helfen sie nie und beruhigen höchstens die Nerven, die falschen natürlich, nicht den Trigeminus; aber Steel weiß, wie man die Sache abstellt, dafür hat er seine Patentmedizin. »Seven years old«, steht auf der Bourbon-Flasche: freilich hat ihr Inhalt keine Chance, auch nur einen Tag älter zu werden.
Zwar muß Robert S. Steel heute mittag zur Militärregierung in der Tegernseer Landstraße, die von den Münchenern »Bücklingsallee« genannt wird, und der Major haßt es, wenn seine Offiziere vor Sonnenuntergang schon eine Fahne haben.
Bis zur Rückkehr Juttas hat er schon viermal nach dem »Old Smuggler« gegriffen.
Der Captain ist kein Alkoholiker, doch ein Trinker. Dienstlich gesehen gilt er als Könner. Er leistet sich keine Vorurteile, nicht einmal gegenüber den Besetzten. Da er hier keine Verwandten verloren hat, braucht er weder nach verschollenen Menschen noch nach entschwundenen Vermögenswerten zu fahnden. Seine Mutter war eine Schweizerin aus Zürich, die sich nie so recht an Amerika gewöhnt hat, und so ist Steel zweisprachig aufgewachsen; er wurde bei der Kriminalpolizei ausgebildet, zur Army eingezogen und war einer der ersten Offiziere gewesen, die über die Brücke von Remagen das rechte Rheinufer erstürmten. Später entdeckte man seine berufliche Qualifikation, und da er auch noch fließend Deutsch sprach, landete er fast zwangsläufig beim »Counter Intelligence Corps« und hatte mit dem »Unternehmen Bernhard«, dem sogenannten Himmler-Geld, seinen ersten ganz großen Fall.
Er wurde einer der Chefspezialisten, die in aller Welt nach den Tätern und ihren Helfern fahndeten und im Ausseer Gebiet, dem Herzen der sogenannten Festung Alpenland, den Müllkübel des Dritten Reiches leerten. Obwohl die »New York Times« geschrieben hatte, Captain Robert S. Steel und seine Männer hätten das »Geschwür bis auf die Knochen ausgebrannt«, war die englische Regierung bei Kriegsende gezwungen gewesen, schlagartig die Zehn-, Zwanzig-, Fünfzig-, Hundert- und Tausend-Pfund-Noten aus dem Verkehr zu ziehen und durch neue Scheine zu ersetzen. Die im KZ Sachsenhausen hergestellten Blüten waren für Großbritannien gefährlicher gewesen als die V-Waffen.
Seitdem geht es um den Falschgeldspezialisten wesentlich ruhiger zu. Er untersteht direkt dem Hauptquartier des Generals Clay, das vor kurzem von Frankfurt nach Heidelberg umgezogen ist, um dem deutschen Zweizonenwirtschaftsrat Platz zu machen. Steel bewohnt zwei Villen und verfügt über einen privaten Fuhrpark von drei Autos. Zu einem Zeitpunkt, da viele andere US-Offiziere, wenigstens die jüngeren von ihnen, ziemlich häufig damit beschäftigt sind, ihre raren Dollars mit deutschen Fräuleins zu ver jubeln — auch um sich am Puritanismus ihrer amerikanischen Gattinnen zu rächen —, hatte Robert S. Steel es in einem bettelarmen Land zu enormem Reichtum gebracht, wie er sich so schnell nicht erwerben läßt, wenn man ehrlich bleibt, aber daran will er nicht denken. Von seinem Nummernkonto bei einer Züricher Privatbank wissen seine Vorgesetzten so wenig wie seine deutsche Freundin in München von ihrer Frankfurter Rivalin.
Jutta kommt zurück, gefolgt von dem Fahrer, der einen mächtigen Karton schleppt, vollgepackt mit Gamel-Stangen, Bourbon- Flaschen, Nescafe-Dosen, Schokolade und Candies. Jutta ist das exakte Gegenteil von Nutscherl; sie ist etwas kleiner als mittelgroß, hellblond, bestückt mit aggressiven Rundungen jeweils an den richtigen Stellen. Frech, hübsch und abgebrüht — Jutta weiß, wo Gott wohnt, der Gott, der Camels wachsen ließ. Und sie ist großzügig ihrem Freund gegenüber, vielleicht weil sie ab und Zu auch von der Fahne geht, aber als Deutsche hat sie, wie sie sagt, vorderhand genug von Fahnen.
»Nimm dir, was du brauchst«, sagt der Captain.
»Danke, Bob«, erwidert Jutta und bedient sich mit einer Stange Zigaretten, einer Flasche Whisky und einem Paket Süßigkeiten. »Du weißt ja, es ist für meine Mutter.«
»Hoffentlich kriegt deine Mutter keine Säuferleber«, erwidert der Amerikaner.
»Hoffentlich bekommst du keinen Leberschaden«, sagt Jutta, eine Nuance zu dreist. »Wenn du so weitersäufst, wirst du nicht einmal so alt, wie du aussiehst.«
»Shut up!« fährt er sie an, zündet sich eine Zigarette an, nimmt noch einen Schluck. Manchmal kann er auch Jutta gegenüber richtig zornig werden. Aber es hält nicht lange an. Sie zeigt ihm die Beine wie die Zähne, und beides ist makellos. »Wie alt sehe ich denn aus?«
»Es geht noch«, entgegnet Jutta und schiebt ihm Pfefferminzbonbons zwecks Atemreinigung zu. »Soll ich dir Kaffee kochen?« fragt sie.
»Gott bewahre«, erwidert Steel.
»Aber die Postmappe mußt du noch durchgehen.«
»Morgen«, entgegnet er.
Jutta bringt sie gleich an, fein säuberlich nach Buchstaben abgelegt.
»Ordnung muß sein«, faucht der Captain sie an. »Ohne Ordnung keine Bürokratie und ohne Bürokratie kein Faschismus.«
»Und alle Deutschen sind Faschisten«, versetzt Jutta.
»Poppycock«, antwortet er, und sie lachen beide.
Leutnant Whistler kommt zurück, Inspektor Gräbert im Gefolge.
»Zunächst einmal«, meldet der Leutnant, »ist der Mann, den wir suchen, in keinem Münchener Hotel abgestiegen.«
»Abgestiegen vielleicht schon«, korrigiert ihn der Captain. »Nur nicht gemeldet oder«, analysiert er weiter, »unter keinem der uns bekannten Namen.« Er sieht den begehrlichen Blick Gräberts und schiebt ihm ein Päckchen Zigaretten zu. »Wenn einer fünf Namen hat, kann er sich auch noch einen sechsten zulegen, am I right?«
Whistler nickt. Gegen die ätzende Logik seines Chefs kann er nicht mehr Vorbringen, als daß sie ihm auf den Wecker fällt.
»Wenn einer in einer Zeit, da die meisten nicht einmal einen Paß besitzen, gleich fünf oder sechs hat, sind sie gefälscht. Könnt ihr mir folgen, fellows?«
»Aber ja, Captain.«
»Wer so meisterhaft Pässe fälschen kann, kann sich natürlich auch an die Fabrikation von Falschgeld machen.« Steel schiebt Gräbert die Flasche zu. »One for the road?« fragt er.
Der Inspektor trinkt nur aus dem Glas.
»Also«, fährt Steel fort, »sucht gefälligst weiter, guys. Wie steht’s geschrieben? Sucht, und ihr werdet finden!«
»Vermutlich eine Alkoholikerin«, versetzt der Leutnant griesgrämig. »Ich hab’ das Band noch einmal abgehört, ganz laut gestellt, und dabei zwei Rülpser registriert.«
»Vielleicht waren es bloß Seufzer«, entgegnet der Captain. »Wir haben sowieso nicht viel zu tun.«
Den Satz sollte Robert S. Steel schon kurze Zeit später mehr als bereuen.
Geld gibt’s zur Zeit in Deutschland, so viel man will, nur kann man nichts dafür kaufen. Das Dritte Reich hatte die Reichsmarkpressen auf vollen Touren laufen lassen und die sowjetische Militärverwaltung dann das simple Verfahren gleich übernommen und viele Milliarden gedruckt — Papier ist geduldig. Nunmehr liegt die Reichsmark auf dem Totenbett. Neue Banknoten sind schon per Schiff unterwegs zum Bremer Hafen. Die Währungsreform wird über Nacht zum Wiederaufbausturm, der die Zigarettenwährung außer Kraft setzt: Statt fünfzig Mark kostet ein Glimmstäbchen nur noch fünfzig Pfennig. Die Auslagenscheiben füllen sich, frühe Waren bieten sich an wie späte Huren. Am 20. Juni 1948 haben in Deutschland einen Moment lang alle Menschen gleich viel Geld in der Tasche; Minuten später gibt es bereits wieder die ersten Bankrotteure und die ersten Millionäre.
Monate nach dem Währungsschnitt betätigt sich Robert S. Steel wieder einmal als Partytiger. Ein in die Staaten zurückfahrender Major gibt in Harlaching ein rauschendes Abschiedsfest. »Nur für wilde Zweier«, wie er bei der Einladung sagt.
Das Telefon hat es schwer, sich gegen den Lärm durchzusetzen, aber als sich Colonel Highsmith, die rechte Hand General Clays, der erst nach zwei Stunden Fahndung Captain Steel ausfindig machen konnte, um zwei Uhr morgens bei der Abschiedsparty meldet, wird die Musik leiser gestellt; der Gerufene steigt aus den Schwaden des Alkohols und wird in Rekordzeit wieder nüchtern.
»Steel, wo stecken Sie denn bloß?« poltert der Colonel, sonst sein Gönner. »Es brennt. Kommen Sie sofort nach Heidelberg.«
»Jetzt?« fragt der Captain ziemlich entgeistert.
»Sehen Sie zu, daß Sie eine Militärmaschine nach Wiesbaden erwischen. Ich schicke Ihnen einen Wagen zum Airport Erbenheim.«
»Was ist denn eigentlich los?« fragt Steel.
»Stellen Sie keine Fragen, sondern kommen Sie schleunigst hierher. Top secret übrigens!« Der Colonel muß sich erinnert haben, daß man Befehle zur Unzeit doch etwas höflicher erteilt. »Hängt mit Ihren Ermittlungen nach dem Einmarsch zusammen. Kommen Sie her und richten Sie sich darauf ein, daß Sie anschließend gleich nach Paris zu Interpol weiterfliegen.«
»Okay, Sir«, entgegnet der Captain und legt auf.
»Was ist denn los?« fragt Jutta.
»The party is over«, versetzt Robert S. Steel ärgerlich.
Als er am frühen Morgen auf dem Erdinger Militärflugplatz in die Maschine steigt, um ins Headquarter zu starten, ahnt er bereits, daß eine von ihm planierte Vergangenheit wieder aufgebrochen ist. Er Wehrt sich dagegen, aber er wittert bereits ihren üblen Geruch, auch wenn er noch nicht weiß, was auf ihn zukommen wird.
Der Autosalon steht im Freien. Das Eleganteste an ihm ist sein Name. Er ist nicht mehr als ein Parkplatz auf einem Trümmergelände mit siebzehn Autos, die ihre Vergangenheit hinter dem äußeren Glanz der Politur tarnen. Die meisten Fahrzeuge sind bis zum Zusammenbruch für den Sieg gerollt. Jetzt stehen sie, in Linie zu drei Gliedern sauber ausgerichtet, an der Münchener Hauptverkehrsstraße und warten auf die Käufer. Ihre Räder müssen rollen für die D-Mark.
Der Eingang zu dem Autosalon ist durch zwei einfache Holzstangen markiert. Es ist nicht viel los heute, drei Monate, zwei Wochen und zwei Tage nach der Währungsreform. Die Passanten hauchen kleine Frostfähnchen in die Herbstluft. Sie hüsteln schlechtgelaunt und geben unwirsche Antworten, wenn man sie anspricht. Die Verkäufer des Autosalons haben heute noch nicht das Salz in die Suppe verdient. Sie tragen Stutzerjacken mit Pelzkrägen. Sie wirken zurechtgemacht wie ihre Autos.
Unter dem Eingang bleibt ein etwa fünfunddreißigjähriger Mann stehen. Er ist groß und ungewöhnlich gut angezogen, fast ein wenig dandyhaft. Er hat glatte Haare, stahlgraue Augen und ein keckes Bärtchen auf der Oberlippe. Er sieht aus wie Clark Gable, nicht ganz so echt natürlich wie der Filmheld, aber dafür jünger. Er hat ein gestrafftes, gebräuntes Gesicht. Daß sein Kinn etwas zu kurz ausgefallen ist, pflegen die Frauen erst dann zu bemerken, wenn er sie verlassen hat.
»Ich möchte ein Auto kaufen«, sagt der junge Mann. »Ein schnelles, wenn Sie so etwas haben.«
»Darf ich Sie auf den grünen Mercedes aufmerksam machen?« sagt der Verkäufer und deutet auf eine Limousine, Baujahr 1934. »Ganz neuwertig, sehr wenig gelaufen. Das Auto gehörte einem Kreisleiter, der hat ja Zeit gehabt im Krieg, es schön zu pflegen.«
»Nein«, erwidert der Interessent. Er zeigt auf die drei amerikanischen Straßenkreuzer, die etwas abseits stehen, als wollten sie mit ihren ärmlichen deutschen Verwandten nichts zu tun haben.
»Da werden Sie Pech haben«, sagt der Verkäufer mißgelaunt. Er steckt beide Hände in die Hosentaschen und lächelt einen Augenblick geringschätzig. »Corinna«, ruft er dann, »komm doch mal her! Ein Interessent.«
Corinna ist eine Überraschung für jeden, der plötzlich ihren Weg kreuzt. Sie ist zweiundzwanzig Jahre alt und wirkt wie zwanzig. Sie ist gut entwickelt, hübsch, um nicht zu sagen bildhübsch. Ihre langen, rötlichen Haare stempeln sie zu einem Vamp, ihre wasserblauen, naiven Augen zu einem Kind. Sie ist weder das eine noch das andere. Sie ist Studentin der englischen Literatur und verdient sich ihr Geld als Gebrauchtwagenhändlerin, amerikanische Abteilung. Sie lächelt den Interessenten an. »Sprechen Sie Deutsch?« fragt sie.
»Ich denke schon«, entgegnet er. »Gestatten Sie«, stellt er sich vor, »Stefan Wollner.«
Corinna nickt. »Sind Sie Deutscher?« fragt sie.
»Warum?« entgegnet Stefan.
»Amerikanische Fahrzeuge können vorerst nur von Devisenausländern erworben werden.«
»Ich bin Devisenausländer«, behauptet Stefan Wollner.
Corinna sieht einen Augenblick überrascht auf den seltsamen Ausländer, der Deutsch spricht, als hätte er es unter Aufsicht eines niederbayerischen Oberlehrers gelernt.
»Deutschamerikaner«, erläutert er. »Meine Eltern stammen aus Deutschland. Sie sind nach Südamerika ausgewandert.« Er deutet auf einen himmelblauen Chevrolet. »Hat der Heizung?«
»Alle amerikanischen Autos haben Heizung«, erwidert Corinna.
»Natürlich«, kontert der Interessent. »Und alle US-Autos haben natürlich Radio. Man ist nur nicht immer sicher davor, daß sie nicht in Deutschland ausgebaut wurden.«
Corinna errötet leicht. Geschäftsmäßig fährt sie mit ihrer Erläuterung fort: »Der Wagen ist in einem ausgezeichneten Zustand. Er ist erst dreißigtausend Meilen gelaufen. Er gehörte einem amerikanischen Major, der sich vor ein paar Tagen erschossen hat, weil mit seiner Frau etwas nicht stimmte.«
»Immer dieser Ärger mit den Frauen«, erwidert Wollner lachend.
Corinna will nicht flirten, sondern verkaufen. »Ich weiß nicht, ob Sie wissen«, erläutert sie weiter, »daß der Wagen natürlich in Devisen bezahlt werden muß. Der Motor ist von uns nachgesehen. Beachten Sie bitte die Reifen: Der Wagen ist sechsfach neu bereift. Alles Weißwandmäntel, das Allerneueste. Sehr elegant. Der Wagen ist mit einem wunderbaren Zweitonstarkhorn ausgestattet.« Sie hält einen Augenblick inne, zieht eine Zigarette aus ihrem Etui, läßt sich von dem Kaufinteressenten Feuer geben. »Danke«, sagt sie. »Aber ich will Sie natürlich nicht beeinflussen, den Chevrolet zu nehmen. Der Studebaker nebenan ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Er hat die sportlichere Note. Trotzdem ist er etwas billiger.«
»Hat sich sein Besitzer auch erschossen?« fragt der Ausländer gutgelaunt; sein Interesse gilt mehr Corinna als den Autos.
Sie will ärgerlich werden, geht aber auf seinen Ton ein. »Nein«, erwidert sie. »Er verkauft ihn, weil er Geld für seine Hochzeit braucht.«
»Komisch«, antwortet Stefan, »daß die Amerikaner mit den Frauen immer Pech haben.« Er wirft seine Zigarette weg. »Ich nehme den Chevrolet«, sagt er unvermittelt. »Vom Motor verstehe ich sowieso nichts. Ich verlasse mich auf Ihre schönen blauen Augen. Und jetzt gehe ich rasch zur Bank.«
Corinna weiß nicht, ob Stefan Wollner im Spaß oder im Ernst redet, sie geht ein paar Schritte hinter ihm her und ruft ihm nach: »Wollen Sie denn nicht wenigstens wissen, was er kostet? Viertausendeinhundert Dollar!«
Corinnas Kollegen sind voller Spott. Sie wissen, daß ihre langhaarige Konkurrentin einem Angeber aufgesessen ist. In dieser Zeit wimmelt es in Deutschland von Deutschamerikanern. Die Großmutter aus USA ist ganz groß im Kommen. Autoverkäufer haben allen Grund, mit der Zeit unzufrieden zu sein. Wann gab es in dieser Branche schon einmal Frauen als Angestellte?
Der Käufer braucht nur sechsunddreißig Minuten, Vor der erstaunten Corinna packt er gemächlich aus seiner Aktentasche Quittungen, Bescheinigungen und einen brasilianischen Reisepaß aus. »Hier«, sagt er. »Bin ich nicht ein Musterschüler? Ich habe alles ganz richtig gemacht.«
Corinna lächelt. »Da brauche ich Ihnen also nur noch den Zündschlüssel zu geben und guten Start zu wünschen.«
»Das ist noch nicht alles«, erwidert Wollner. »Wenn man bei uns ein Auto kauft, trinkt man eine Flasche Sekt darauf.«
»Ich habe leider keinen hier«, entgegnet Corinna lächelnd. Ihr Gesicht ist gerötet, ihre Augen glänzen. Von der Verkaufsprovision kann sie, wenn sie sparsam ist, fast zwei Monate leben.
»Es braucht nicht hier zu sein«, drängt Stefan. »Ich dachte an heute abend. Untertags trinken doch nur Schieber.«
Corinna weiß, was sie dem Geschäft schuldig ist — und Adrian ist ohnedies schon wieder auf Reisen; er wird frühestens morgen zurückkommen. »Um zwanzig Uhr«, erwidert sie. »Ich wohne Corneliastraße acht, dritter Stock links, zweimal läuten.«
Am Abend macht sich Corinna zurecht. Viel Arbeit hat sie dabei nicht, aber endlich kann eine Frau wieder wie eine Frau aussehen, und das heißt hübsch sein.
Colonel Highsmith ist an die sechzig, graumeliert, alert und schlank. Schon optisch wirkt er wie ein Repräsentant des besseren Amerika, geradlinig und rechtschaffen, und das muß ein Mann auch sein, der ein herrenloses Vermögen von mehr als dreizehn Milliarden Friedensmark verwaltet. Diese Riesensumme, die unter Property Control steht, setzt sich aus dem beschlagnahmten Besitz von NS-Größen und Parteigliederungen zusammen. Strandgut des Krieges, über das sich die Belasteten ausschweigen, weil sie jeden Grund dazu haben, und die Unbelasteten nicht reden können, weil sie nichts darüber wissen. Unter diesen Umständen könnte Highsmith in die eigene Tasche wirtschaften und auf die Seite bringen, was er wollte, aber er gehört zu den US-Offizieren, die aus Germany ärmer wegfahren werden, als sie gekommen sind.
»Sit down, Bob«, begrüßt er Captain Steel. »Tea, coffee?«
»Coffee, please«, antwortet der Besucher; es ist nicht zu erwarten, daß ihm der Colonel vor Sonnenuntergang einen Bourbon offerieren wird, aber er hat den Eindruck, daß ihm Highsmith weit schärfere Sachen anbieten könnte.
»Guten Flug gehabt?« fragt Highsmith, aber es klingt wie: »Bereits aus genüchtert?«
Der Captain schweigt vorsichtshalber.
»Well«, beginnt die rechte Hand des US-Militärgouverneurs für Deutschland, »wir haben ein Problem. Vielleicht ist alles nur blinder Alarm, wenn es das aber nicht ist«, setzt er hinzu, und man hört seiner Stimme den Grimm an, »dann gnade uns Gott. Nach dem General sind Sie der dritte, der von der Sache erfährt.« Er wartet, bis die Sekretärin dem Gast Kaffee eingeschenkt hat: »Es riecht nach 1945.« Er öffnet seine Schreibtischschublade und holt zwei Geldscheine hervor.
Der Captain sieht mit dem ersten Blick, daß es sich um weiße Fünf-Pfund-Noten der Bank of England handelt, wie sie noch im Umlauf sind: knitterfreies Papier, komplizierte Gravuren, mit mindestens hundertsechzig spezifischen Merkmalen. Allein schon die verschnörkelte Schrift schützt weitgehend vor Nachahmung. Experten in aller Welt hielten die britischen Banknoten für unfälschbar — bis dann, bei Kriegsende, die peinlich geheimgehaltene Bombe geplatzt war und sich herausgestellt hatte, daß das Reichssicherheitshauptamt im KZ Sachsenhausen, mitunter auch Oranienburg genannt und in der Heide nördlich von Berlin gelegen, Millionen von Banknoten in Milliarden-Werten mit dem Erfolg gefälscht hat, daß man sie von den echten nicht unterscheiden konnte.
»Hier«, sagt Highsmith und breitet die beiden Fünf-Pfund-Scheine nebeneinander vor seinem Besucher aus. »Beide Banknoten sind vor fünf Wochen bei einem Züricher Bankhaus gegen Schweizer Franken umgetauscht worden. Innerhalb weniger Tage. Beide von Ausländern.« Der Colonel erhebt sich, tritt auf der anderen Seite des Schreibtischs hinter den Captain. »Nun raten Sie mal, Bob, was auf den ersten Blick auffällt.«
»Beide haben die gleiche Nummer«, antwortet der Experte.
»Richtig«, sagt Highsmith giftig. »Und nun zeigen Sie mir, welche von beiden die gezinkte Karte ist.«
Der Besucher starrt die Scheine an, zerreibt sie zwischen den Fingern, stellt fest, daß das Papier sich einwandfrei anfühlt. »Ich müßte sie im Labor untersuchen lassen, Sir«, erklärt er dann.
»Hab’ ich bereits getan«, versetzt der Colonel, geht wieder auf die andere Seite, greift erneut in die Schublade, wirft mit angewidertem Gesicht die Expertise auf den Tisch. »Sie brauchen sie gar nicht zu lesen, Bob, unsere Boys sind zur Ansicht gekommen, daß beide Scheine völlig identisch sind.«
»Wie damals«, entgegnet Steel. »Bei der Operation Bernhard.«
»Exakt«, erwidert der Colonel. »Ich habe bereits festgestellt, daß Sie der einzige von den damals an der Aufklärung beteiligten Offizieren sind, der sich noch in Europa aufhält. Wo befinden sich eigentlich die Akten?«
»Im CIC-Tresor«, antwortet der Falschgeldspezialist. »Die Aktion Bernhard wurde damals von uns einwandfrei aufgeklärt. Anschließend haben wir eine Empfehlung an die Bank of England gegeben, alle Pfundnoten einzuziehen und durch neue zu ersetzen.«
»Was auch geschehen ist.«
»Bis auf die Fünf-Pfund-Scheine«, stellt Captain Steel fest. »Es war damals technisch einfach nicht möglich — inzwischen müssen die Leute in London geschlafen haben.«
»Und das scheint sich jetzt zu rächen«, erwidert Highsmith. »Ich habe das Gefühl, daß eine ungeheure Schweinerei auf uns zukommt.«
Er braucht dem aus München nach Heidelberg befohlenen Offizier keine lange Erklärung zu geben: Solange es Banknoten gibt, wurde versucht, sie zu fälschen. Die Imitate waren mehr oder weniger gut; selbst die besten wiesen bei Farbe, Gravur und Wasserzeichen oder in der Zusammensetzung des Papiers einen oft nur winzigen Fehler auf. Diese kleine Abweichung ist gewissermaßen die Handschrift des Fälschers, wie bei einem Funker an der Morsetaste, den man beim Funken sofort an einer bestimmten Nuance erkennt. Die Handschrift der Fälscher des Reichssicherheitshauptamtes erkannte man daran, daß sie keine Fehler aufwies. Die raffiniertesten Geldfälscher, die in Europa aufzutreiben waren — zusammengekehrt in Zuchthäusern, Spelunken, Bordellen, ausgeliehen von Banken oder ausgebildet in SS-eigenen Fälscherwerkstätten —, hatten jahrelang die größte Schwindelaktion in der Geschichte des Geldverkehrs vorbereitet, bevor die erste Blüte auf den ahnungslosen Markt kam. Ihr folgten Hunderte, Tausende, Millionen.
Ein interner Kreis der britischen Regierung war gewarnt: Ende 1944 wurde ein deutscher Spion gefaßt, der mit einem Wasserflugzeug an der schottischen Küste bei Nacht und Nebel abgesetzt worden war. Bei seiner Festnahme fand man einen Koffer mit Pfundnoten aller im Umlauf befindlichen Werte. Eine Überprüfung der Bank of England ergab, daß diese Geldscheine — wenn auch meisterlich — gefälscht waren.
London war in der Klemme. Um die eigene Währung zu schützen, mußte das britische Schatzamt den Falschgeldumlauf verheimlichen. Noch während des Krieges wurde in aller Stille der Austausch der Banknoten vorbereitet. Bis dahin aber mußte Großbritannien für immense Summen geradestehen, die aus neutralen Ländern und aus Italien auf die Insel geschwemmt wurden. Erst nach Kriegsende wurde die Öffentlichkeit darüber allmählich und dürftig informiert.
Die Prinz-Albrecht-Straße, der Sitz des RSHA, hatte Mathematiker mit einer Analyse des komplizierten englischen Registriersystems beauftragt; man eilte mit der Numerierung ein wenig voraus, so daß die Kennziffern der Originale und der Blüten in kurzer Zeit übereinstimmten. Nur wenn — was äußerst unwahrscheinlich war — beim Rücklauf zufällig diese Zifferngleichheit entdeckt wurde, wußte man, daß einer der beiden Scheine falsch war — nur nicht, welcher.
»Wie gründlich habt ihr seinerzeit diese Falschgeld-Story aufgeklärt, Bob?«
»Nach menschlichem Ermessen nahezu hundertprozentig.«
»Was halten Sie vom menschlichen Ermessen?« fragt der Colonel.
»Das hängt davon ab, wer ermißt — «
»Zum Beispiel Sie, Captain Steel.«
»Ich war damals einer der wenigen ausgebildeten Kriminalisten bei der CIC. Die anderen haben sich redlich bemüht, waren aber vorwiegend zum militärischen Geheimdienst gekommen, weil sie die deutsche Sprache beherrschten. Wie Sie wissen, Sir, waren wir Amerikaner in geheimdienstlichen Dingen damals noch ziemliche Greenhorns, aber«, er erspart dem Colonel und sich weitere Erklärungen, daß und warum den Yankees die Branche von Lug und Trug nicht besonders liegt, »ich selbst habe seinerzeit die Namen von etwa hundertvierzig Auftragsfälschern festgestellt. Hundertvierunddreißig von ihnen haben den Krieg überlebt, waren aber bereits in alle Winde zerstreut. Ich habe sie einzeln aufstöbern und vernehmen lassen. Sie hatten damals nur einen Wunsch gehabt: nach Hause zu kommen, ein normales Leben zu führen, zu vergessen.«
»Könnten sie diesen Wunsch durch mitgenommene Geldpakete nicht ein bißchen vergoldet haben?«
»Durchaus, Sir. Nicht nur die ehemaligen Häftlinge. Das Geld lag auf der Straße, schwamm in Flüssen. Der Traunsee sah vor lauter weißen Pfundnoten aus wie mit Seerosen überzogen. Beim Einmarsch der amerikanischen Truppen war es im Ausseer Land geradezu ein Volkssport geworden, die Blüten aufzufischen. Ich bin jetzt noch sicher, daß in wasserdichten Behältern auf dem Grund des Toplitzsees ungeheure Summen liegen.«
»Nur haben wir sie nicht gefunden.«
»Wir nicht«, antwortet der Captain. »Aber vielleicht andere, Sir.« Er wiegelt ab: »Es ist noch lange kein Grund, in Panik zu geraten. Vergessen Sie bitte nicht, daß die Fünf-Pfund-Noten nur einen kleinen Teil der Fälscherkollektion ausgemacht haben und alle anderen Scheine, bis zu Tausend-Pfund-Noten, rechtzeitig und schlagartig entwertet worden sind.«
»Was ist eigentlich aus den Verteilern geworden?« fragt Highsmith.
»Auch deren Namen haben wir ziemlich lückenlos festgestellt. Der Hauptagent, ein Mann, der sich zuerst für einen SS-Offizier namens Kaffler, im Gefangenen-Camp für Major Krug ausgegeben hatte, tatsächlich aber Schwaiger hieß, ist ebenso verschollen wie der Sturmbannführer Krüger, der das Fälscherkommando angeführt hatte. Zwar hat die US Army, meiner Meinung nach zu früh, die Ermittlungen abgeschlossen und die Unterlagen unseren britischen Bundesgenossen übergeben, aber die Decknamen der meisten Falschgeld-Dealer in der Schweiz, in Italien, Spanien, Schweden und Portugal haben wir ausfindig gemacht. Ich selbst übergab dem Secret-Intelligence-Service-Major Thomson alle Informationen, einem Fachmann, der die Leute mit Verve und sicher nicht nur legal gejagt hat. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, daß der eine oder andere mit falschen Papieren in Südamerika untergetaucht ist — vielleicht sogar mit ganzen Koffern inzwischen wertloser Blüten.«
»Warum tauchen die Falsifikate erst jetzt auf, Bob?« fragt der Colonel. »Wer steckt hinter der Sache? Fälscher von einst, die uns entgangen sind? Die Agenten, die damals die Blüten vertrieben haben? Eine Untergrundgruppe der Nazis oder aber — «
»Das wäre noch nicht einmal das Schlimmste«, entgegnet Steel. Er hat bemerkt, daß der Colonel den gleichen Gedanken hat wie er. »Wie viele solcher Scheine mit identischer Nummer sind eigentlich aufgetaucht?«
»Eine ziemliche Menge«, antwortet Highsmith. »Sie können sich vielleicht vorstellen, welche Sorgen sich die Bank of England macht; sie ist zur Zeit damit beschäftigt, die Seriennummern zu überprüfen, eine recht mühselige Arbeit.« Das Gespräch beendend, erhebt er sich. »Fliegen Sie nach Paris, Bob. Sprechen Sie mit den Leuten von Interpol und — wenn möglich — auch mit den Engländern.« Er reicht dem Captain die Hand. »Sie haben jede Unterstützung und auch jede Vollmacht, die ich Ihnen geben kann. Und wenn Sie es wünschen«, setzt er hinzu, »ziehe ich auch noch Spezialisten aus den Staaten bei.«
»Soweit sind wir ja wohl noch nicht, Sir«, beruhigt ihn der Captain.
Als er eine Stunde später in der Maschine sitzt, die ihn von Wiesbaden-Erbenheim nach Paris bringt, ist Robert S. Steel längst nicht so optimistisch wie in Heidelberg beim Abschied. Immer wieder kommen ihm Namen und Erinnerungen. Er spürt die Gefahr, die nicht nur der Militärregierung der USA, den Deutschen und ganz Europa droht, sondern zunächst einmal ihm ganz persönlich, denn der Captain gehört zu den Offizieren, die Germany ungleich reicher verlassen wollen, als sie bei ihrer Ankunft waren.
Um zweiundzwanzig Uhr sind sie immer noch die einzigen Gäste in der Bar. Schlechte Zeiten für Nachtbetriebe. Die Mark hat wieder hundert Pfennige, und jeder zählt. Die neue Währung führt ein strenges Regiment. Ihre Scheine sind noch sauber und wenig zerknittert. Sie sind aus Amerika gekommen, wie die Trockeneier, die Virginiazigaretten und die Soldaten mit den olivgrünen Uniformen und den uniformierten Liebesbedürfnissen. So besteht um diese Zeit die Bestückung der Bar »Blaue Mühle« aus drei befrackten Kellnern, zwei hungrigen Bardamen, einem einheitlich gekleideten Musiktrio und einem sehr gut Deutsch sprechenden Ausländer in Gesellschaft Corinnas, die bei der zweiten Flasche angelangt sind. Die Musik spielt dezent, Importschlager, die Kellner sehen unausgesetzt auf die halbvollen Sektgläser, und die Bardamen streiten miteinander, wenn es niemand sieht.
»Werden Sie länger in München bleiben?« fragt Corinna.
»Zwei, drei Tage vielleicht noch«, erwidert der Mann, der sich Stefan Wollner nennt. »Es hängt von einem Anruf ab, den ich erwarte.«
»Sie sind geschäftlich in Deutschland?«
»Natürlich«, entgegnet er. »Aber reden wir doch nicht von Geschäften! Ist Ihnen schon ein Name für mein neues Auto eingefallen?«
»Nein«, sagt Corinna, »ich bin immer dafür, daß die Väter für ihre Kinder die Namen selbst finden.«
»Ich bin so phantasielos«, klagt der Gastgeber. »Außerdem fände ich es viel amüsanter, mir einen hübschen Namen für Sie auszudenken. Ich bin schon die ganze Zeit dabei.«
»Werden Sie bloß nicht komisch«, erwidert Corinna. »Ich muß Sie vor mir warnen. Ich trinke gerne Sekt, aber ich werde nicht berauscht davon. Ich geh’ gern mit Männern aus, aber ich lasse mich von ihnen nicht verführen. Ich flirte gerne, aber ich küsse selten. So gesehen«, sagt Corinna lächelnd, »bin ich für Sie eine außergewöhnlich schlechte Kapitalsanlage.«
»Warum sprechen Sie von Geld?« entgegnet Wollner wegwerfend. »Geld ist etwas, das man verachtet, wenn man es hat, und das man erstrebt, wenn man es nicht besitzt.«
Corinna spürt bereits den ungewohnten Sekt, sie wird lebhaft. Und sie wird aggressiv. »Ich muß Ihnen gestehen, daß ich reiche Männer nicht ausstehen kann. Erstens, weil sie meistens alt und dick sind und weil sie immer mehr wollen, als sie vertragen können. Geld ist ein notwendiges Übel, aber wer zu viel davon hat, ist übler, als es notwendig ist. Weiß man schon, woher es kommt?«
»Was durch zu viele Hände geht, wird meistens schmutzig«, erwidert der Mann mit dem brasilianischen Paß anzüglich. »Aber dafür hat man ja Wasser und Seife. Denn irgendwann, ob gern oder ungern, muß man ja doch wieder Geld anfassen und sich die Hände dabei dreckig machen.«
»Möchten Sie das Thema nicht wechseln?« fragt Corinna. »Oder wollen wir weiter über Soll und Haben philosophieren?«
»Ich bin Geschäftsmann«, versetzt Wollner. »Bleiben wir doch in meinem Fach.«
»Sie sind reich?«
»Das könnte ich behaupten«, entgegnet er.
»So?« fragt die Studentin. »Hat Ihnen eine Erbtante den Gefallen getan? Haben Sie in der Lotterie gewonnen? Oder wurde Ihnen das Geld von einer reichen Dame zur Hochzeit geschenkt?«
»Ich bin nicht verheiratet«, klärt er die zornige Angeheiterte auf.
»Ich habe immer eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie der Mann meiner Träume aussehen soll«, fährt Corinna fort. »Als Kind war es ein Lokomotivführer, weil ich glaubte, daß ich dann immer umsonst Eisenbahn fahren kann. Später war es mein Mathematiklehrer. Da war ich natürlich noch ein Teenager. Er hatte eine Brille auf seinem melonenförmigen Kopf und sah aus wie ein vegetarischer Schlachthof direktor. Heute habe ich meine endgültige Vorstellung: Der Mann, aus dem ich mir etwas machen könnte, dürfte vielleicht so groß sein wie Sie, er dürfte Ihre Augen haben und vielleicht sogar Ihren Mund. Er müßte einen Beruf haben, in dem er etwas leistet. Natürlich sollte er schon etwas erlebt haben im Leben. Und er dürfte nicht allzu viel verdienen. Denn Geld macht faul und überheblich… Prost! Hab’ ich Sie jetzt beleidigt?«
»Amüsiert«, erwidert Wollner; Corinna gehört nicht zu den Frauen seines üblichen Umgangs. Er genießt ihren Seltenheitswert. Sie hat nichts vom provokanten Sex oder auch der versierten Unschuld seiner unständigen Begleiterinnen. Er hat sie im Dutzend, weil sie den Wert des Geldes schätzen, und diese Studentin pfeift darauf, weil sie keine Dutzendware ist. »Danke für den Vortrag«, sagt er, »in dem das Geld geschmäht wird; er ist recht interessant. Aber jetzt will ich auch einmal aus der Schule plaudern. Die Frau meiner Wahl dürfte Ihre Größe haben, Ihre Augen, Ihren Mund und überhaupt noch möglichst viel von Ihnen. Sie dürfte so sprechen wie Sie, etwas zu schnell und etwas zu viel und etwas verrückt. Sie dürfte Corinna sein. Aber darüber hinaus müßte sie natürlich eine Frau sein. Eine richtige Frau mit Ansprüchen und Wünschen, die jeden Mann zum Erblassen bringen. Sie müßte sich jeden Monat ein neues Kostüm und alle Jahre einen neuen Pelzmantel wünschen. Sie müßte ängstlich darauf bedacht sein, immer die am besten angezogene Frau ihres Kreises zu sein. Sie dürfte von mir aus jeden Tag zwei Stunden bei ihrer Schneiderin und eine Stunde bei ihrem Friseur zubringen. Dafür ist sie ja schließlich eine Frau. Verstehen Sie mich?« Er winkt dem Ober, eine neue Flasche zu bringen.
»Eine schöne Modepuppe«, erwidert Corinna spöttisch. »Nichts im Hirn, aber viele Textilien außen rum. Ich hätte Sie für anspruchsvoller gehalten, Herr Wollner.«
»Das sehen Sie ganz falsch«, fährt der Mann fort. »Eine richtige Frau gibt immer Geld aus, ohne lange danach zu fragen, woher es kommt. Ein Mann, bei dem sie ist, hat einfach dafür zu sorgen, daß die Kasse stimmt. Sonst soll er die Finger von ihr lassen.«
Er reicht Corinna eine Zigarette, zündet sich selbst eine an, sieht ein paar Sekunden dem spiralenförmig gegen die Decke ziehenden Rauch nach. »Das wäre meine Vorstellung von der Idealfrau. Kein Mädchen mit Komplexen. Kein Mädchen, das sich einen kleinen Bankangestellten oder einen städtischen Beamten zum Mann wünscht, mit Pensionsberechtigung und solider Verdauung. Keine Frau, die Angst vor dem Geld hat. Denn Reichtum schändet nicht. Das werden Sie rasch bemerken, wenn Sie einmal reich sind.«
»Vielleicht«, erwidert sie, »vielleicht auch nicht.« Der Mann läßt nicht erkennen, ob er seine Worte ernst meinte oder sie nur weiter anstacheln wollte, um sich zu belustigen. In diesem Fall wäre sie seine Hofnärrin gegen ein Honorar von drei Flaschen Sekt.
Corinna sieht ihn an, stellt fest, daß er nicht einmal unsympathisch ist, aber er verliert, wenn sie ihn mit Adrian vergleicht, mit Adrian Stemmer, der sich als Heimkehrer nach sieben Jahren Krieg und anschließender Gefangenschaft im Frieden zunächst einmal verlaufen hat wie in einem Labyrinth. Jetzt ist er dabei, sich zurechtzufinden und mit seiner gierigen, erpresserischen Verwandtschaft, die seinen Vater aus der Baufirma gedrängt hat, abzurechnen.
Adrian ist daher viel zu sehr in Anspruch genommen, um genauer zu definieren, wie er zu Corinna, dem Flüchtlingsmädchen aus Elbing in Westpreußen, steht. Merkwürdig eigentlich, wie scheu notorische Kriegshelden — der hochdekorierte Fallschirmjägerhauptmann war in Kreta, Rußland und Italien insgesamt siebenmal verwundet worden — sein können; doch wenn einer vom Krieg etwas sagt, geht Adrian ohnedies in die Luft.
»Vergleichen Sie mich mit einem anderen?« fragt Stefan Wollner.
»Halten Sie sich für unvergleichlich?«
»Das nicht«, erwidert er. »Und wer siegt?«
»Kämpfen Sie denn schon?« fragt Corinna.
»Ich fange gerade an«, geht er auf ihren Ton ein.
»Schade um die Zeit«, versetzt sie. »Verstehen Sie — ich bin das Mädchen in unfesten Händen.« Sie lächelt mit mehr Ernst als Spott. »Bringen Sie mich nach Hause?« fragt sie.
Der Autokäufer ist sofort bereit dazu. Er winkt dem Kellner und zahlt mit drei nagelneuen Fünfzigmarkscheinen; er läßt sich nicht herausgeben, er muß wirklich unanständig viel Geld haben.
Wollner und Corinna fahren im neuerworbenen Chevrolet fast lautlos durch die schlecht erleuchtete Nacht. Er legt seinen Arm um sie. Corinna läßt es sich gefallen, sie lehnt ihren Kopf gegen seine Schulter, aber sie kämpft mehr gegen die Kohlensäure als gegen die Versuchung und lächelt dabei wie ein sorgloses Kind.
Vor ihrer Haustür zögert sie einen Moment mit dem Aussteigen. Auf einmal aber ist sie hellwach und schlüpft wie eine Katze aus dem Auto; er folgt ihr.
»Danke für den schönen Abend!« ruft sie, während sie den Haustürschlüssel sucht. Sie ist beschwingt und beschwipst, aber die frische Luft tut ihr gut. Jetzt begreift sie, daß der Schemen, der sich von der Hauswand löst, kein Schatten ist, sondern Adrian. »Schon zurück?« fragt sie überrascht.
»Wie du siehst — und gerade noch zur rechten Zeit!«
»Das ist Herr Wollner«, versucht Corinna vorzustellen. »Er hat bei uns einen teuren Wagen gekauft und — «
»Um diese Zeit schließe ich keine neuen Bekanntschaften mehr«, versetzt er. »Tut mir leid«, wendet er sich dann doch Corinnas Begleiter zu. »Schön, daß Sie meiner Verlobten Gesellschaft geleistet haben«, sagt er. »Aber jetzt verschwinden Sie bitte, Mann.«
»Sei nicht so unhöflich«, entgegnet Corinna. »Und seit wann sind wir eigentlich verlobt?«
»Seit jetzt«, erwidert Adrian, zieht sie an sich, und Corinna wundert sich, wie einfach alles ist, wenn man sich mag.
Schon auf der Landetreppe des Flughafens Orly sieht Captain Steel den am Rollfeld stehenden Kommissar Gaillard, den die Sûreté als Falschgeldspezialisten an Interpol ausgeliehen hat; er kennt ihn von Tagungen und Banketten her, die erfreulicher verlaufen waren, als die heutige Begegnung wohl werden wird.
Nach dem Krieg haben sich US-Dienststellen mit Vorliebe an der Seine angesiedelt, wie jetzt gerade die neue Marshall-Plan-Administration. Die Lichterstadt ist immer eine Messe wert, auch eine schwarze, aber für Robert S. Steel sind St. Germain des Prés, Montparnasse und Montmartre keine neuen Attraktionen mehr wie für die typischen US-Touristen; er kommt öfters dienstlich hierher. Der Captain reist überhaupt viel, auch in die Schweiz, woher seine Mutter stammte und wo in Zürich eine Geldanlage, deren Wert inzwischen auf weit über eine Million Dollar angewachsen sein dürfte, in aller Stille gepflegt werden muß.
An dieses Geld denkt der clevere Offizier gern, an die Art, wie er es erworben hat, weit unlieber. Obwohl er nicht eigentlich korrupt ist — viele Millionen von täuschend echten Falschgeldnoten gingen durch seine Hände, ohne daß er auch nur einen Schein in die Tasche gesteckt hätte —, hat er ein einziges Mal beherzt zugegriffen, und das könnte jetzt, Jahre später, enthüllt werden, wenn die Erde über den zugebaggerten Geschichten des Weltuntergangs von 1945 wieder aufgerissen würde.
»Ça va bien?« begrüßt ihn Jean-Louis Gaillard lachend. »Eigentlich hätten Sie sich die Reise nach Paris sparen können, Robert.«.
»So gut sieht es aus?« fragt Steel und reicht dem Kommissar die Hand.
»So wenig weiß ich bis jetzt«, entgegnet der französische Kollege.
Interpol war erst nach dem Krieg von Wien nach Paris verlegt und dort im Rekordtempo aufgebaut worden. Es gab eben doch Delikte, die nur durch eine zentrale Fahndung bekämpft werden konnten: Rauschgift, zum Beispiel, Mädchenhandel, vor allem aber Falschgeld.
»Aber ich habe meine Vermutungen«, sagt der Kommissar jetzt in Englisch, das er fließend beherrscht. »Und ich teile sie Ihnen gerne mit. Sie sind ja vom Fach, Robert, Sie wissen also, welcher Stellenwert Vermutungen zukommt.«
»Da Sie auch vom Fach sind, Jean-Louis«, erwidert der Captain für seine Verhältnisse ungewöhnlich höflich, »ein sehr hoher.«
»Merci, Robert«, entgegnet der Franzose. Erst als sie im Wagen sitzen, kommt er richtig zum Thema: »Ich weiß auch erst seit zwei Tagen von der Sache. Fragen Sie nicht, wie man mich zum Schweigen vergattert hat.« Er lächelt spöttisch: »Ich hätte Sie sonst angerufen, sozusagen außerhalb des Dienstweges, unter Kollegen — «
Steel nickt.
»Offiziell sind, wie Sie wissen, bis jetzt noch nicht sehr viele Scheine mit identischen Nummern aufgetaucht. Ich nehme aber an, daß es weit mehr sind und die Engländer nur weitere Informationen gesperrt haben, um die neue Falschgeldaffäre als Staatsgeheimnis auf höchster Regierungsebene abzuhandeln, was natürlich idiotisch wäre.« Er wartet, bis die Ampel von rot auf grün umschaltet. »Ich habe gute Beziehungen in die Schweiz und dort unter der Hand einige Nachforschungen anstellen lassen. Ganz diskret natürlich. Nach bisher unvollständigen Angaben meines Gewährsmannes sind in den letzten zehn Monaten enorme Bestände an weißen Fünf-Pfund-Noten bei einigen Privatbanken gewechselt worden, schätzungsweise an die fünf Millionen.«
»Alles Falsifikate?« unterbricht der Amerikaner bestürzt.
»Das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht wissen unsere Freunde an der Themse längst Bescheid und halten uns bloß zum Narren. Ich will Ihnen etwas sagen, Robert: Wäre die Sache in Ordnung, würden sie wohl nicht so zugeknöpft reagieren.«
»Prächtige Aussichten«, antwortet Steel.
»Na ja«, tröstet der Kommissar seinen US-Partner. »Es besteht ja noch die vage Möglichkeit, daß die Scheine echt sind und vielleicht nur von Steuerflüchtlingen einbezahlt wurden — «
»Lauter weiße Fünf-Pfund-Noten?« fragt der Captain.
»Das ist es ja«, erwidert Gaillard. »Wenn es sich dabei um Blüten handelt, wissen wir beide, wer sie hergestellt hat.«
»Sie meinen — diese KZ-Experten?«
»Wer denn sonst?« kontert der Franzose. »Die Handschrift wäre wohl deutlich genug. Jedenfalls müssen wir mit einer Wiederauferstehung eines Alptraums rechnen. Das ist die Lage, Robert. Wir können praktisch nichts tun, solange die britische Regierung uns mit ihrer Geheimniskrämerei die Hände bindet. Ich lasse jetzt — unter der Hand — wiederum bei französischen Banken feststellen, ob auch hier nennenswerte Beträge in Fünf-Pfund-Noten einbezahlt wurden.« Er überholt einen Lastwagen, weicht geschickt einem Fußgänger aus, der unvermittelt auf der Fahrbahn auftaucht. »In der Schweiz laufen weitere Recherchen, und wie ich Sie kenne, werden Sie das Gleiche in der Trizone veranlassen.«
»Darauf können Sie sich verlassen, Jean-Louis.«
»Bis wir ein Ergebnis haben, können wir nur hoffen und beten, daß die ganze Affäre wie eine Seifenblase platzt. Ich habe«, wechselt der Kommissar das Thema, »uns im Tour d’Argent einen Tisch reservieren lassen, wo wir uns ungestört unterhalten können, auch wenn unser Thema eigentlich schon beendet ist.« Er lächelt mit gallischem Charme. »Es geht Ihnen doch gut?«
Steel nickt.
»Und Colonel Highsmith?«
»Ebenfalls«, bestätigt der Captain und zeigt beim Lachen Zähne, um die ihn ein Filmstar beneiden könnte. »Wenn wir diesen Alptraum erst begraben haben, wird sein Blutdruck wieder auf Normalhöhe absinken.«
Paris ist so glanzvoll wie immer, das Essen im Nobelrestaurant superb, der Service so perfekt wie stets, der Burgunder von vorzüglicher Qualität, und um die beiden, die in einer gemütlichen Nische sitzen, dreht sich ein Reigen von Eleganz und Luxus, von frischer Jugend und geschöntem Alter; aber irgendwie zieht dieser Trubel, der Captain Steel sonst fasziniert, heute nicht. Es liegt sicher nicht an Paris, sondern an ihm oder an den Umständen, die ihn zu einem Blitzbesuch an die Seine gebracht haben.
Der Abend endet früh. Steel wohnt im »Ritz«. Gegen einundzwanzig Uhr ruft er in Heidelberg an und stellt fest, daß das US- Headquarter in heller Aufregung ist.
»Da sind wir hinter Geldfälschern im Ausland her«, tobt Colonel Highsmith, »und übersehen den Mist in der eigenen Zone.«
»Was ist denn los, Sir?«
»Die ersten DM-Blüten. Zwanzig-Mark-Scheine«, antwortet der Colonel.
»In großem Umfang?«
»Vermutlich«, erwidert Highsmith.
»Wie gut sind die Falsifikate?« fragt Steel schnell.
»Nicht ganz so gut wie damals die Pfundnoten, aber doch sehr gut.«
Einen Moment lang ist der Captain erleichtert: Andere Handschrift, andere Täter. Jeder Verbrecher ist ihm lieber als die Falschmünzer, die vom Staat, unter Einsetzung aller Hilfsmittel, jahrelang bis zur Meisterschaft ausgebildet worden sind.
»Der Verbreitungsschwerpunkt scheint in Süddeutschland zu liegen«, sagt Highsmith. »Kommen Sie schleunigst zurück, Bob«, befiehlt er seinem Captain.
Steel läutet die CIC-Dienststelle in München an. Whistler muß erst herbeigeholt werden. Zwanzig Minuten später meldet sich der Leutnant.
»Was wissen Sie von den Zwanzig-Mark-Blüten?« fragt ihn der Captain ohne Umwege.
»Nichts«, antwortet der Leutnant.
»Was wissen Sie überhaupt, Whistler?« fährt ihn der Captain gereizt an.
»Zum Beispiel kann ich Ihnen sagen, daß wir die Frau ausfindig gemacht haben, die uns den anonymen Hinweis auf den Mann mit dem Spitznamen Dandy gegeben hat. Sie erinnern sich ?«
»Aber ja«, antwortet Steel ungeduldig.
»Sie heißt Anita Sperber, siebenundzwanzig Jahre alt, brünett, verwitwet, stammt aus Berlin, wohnhaft in München, Thierschstraße.«
»Saubere Arbeit«, lobt der Captain. »Congratulations.«
»Dazu gibt es keinen Grund«, versetzt Whistler gallig. »Sie ist tot. Vergiftet mit Leuchtgas. Selbstmord. Vor einer Woche.«
»Und?«
»Handgeschriebener Zettel: ›Ich kann ihn verraten, aber nicht ohne ihn leben.‹ Eine ganz banale Eifersuchtstragödie.« Mit Wonne setzt der Leutnant hinzu: »Übrigens eine Alkoholikerin.«
»Sie Abstinenzler«, giftet der Captain. »Gräbert soll am Ball bleiben. Ich möchte alles über diese Anita Sperber wissen. Rekonstruieren Sie die geplatzte Liebesromanze in allen Einzelheiten.«
»All right«, bestätigt Whistler. »Aber ich denke, wir jagen Geldfälscher und nicht Heiratsschwindler.«
»Überlassen Sie mir, hinter wem wir her sind, Leutnant«, weist ihn Steel zurecht. »Noch etwas: Lassen Sie feststellen, welche Banken in der gesamten US-Zone in letzter Zeit englische Fünf- Pfund-Noten gewechselt haben. Weiße Fünf-Pfund-Noten. Aber sehen Sie zu, daß die Recherche absolut vertraulich über die Bühne geht. Nicht auszudenken, wenn eine Indiskretion an die Presse durchsickern würde. Well«, beendet er das Gespräch, »ich bin morgen wieder in München. So long, Whistler.«
Er legt auf, heute verzichtet er sogar auf einen Nightcup an der Hotelbar; er spürt, daß ein gewaltiger Ärger auf ihn zukommen wird. Die Kriminalistik ist ein einziger großer Wartesaal, in dem die abgehenden Züge nicht ausgerufen werden. Man muß spüren, wann sie abfahren, sonst ist man eine Fehlbesetzung.
Mit klarem Kopf und übler Laune sitzt der Captain in der Frühmaschine nach München. Bei seiner damaligen Suchaktion im Ausseer Land hatte er bei der Zivilbevölkerung, bei deutschen Kriegsgefangenen, bei alliierten Soldaten, bei Flüchtlingen, bei Durchreisenden Blüten im Nennwert von mindestens fünfzig Millionen Pfund eingesammelt und den Scotland-Yard-Beamten und Beauftragten der Bank of England übergeben. Es läßt sich nicht ausschließen, daß in der Übergangszeit, die vom Chaos regiert wurde, beträchtliche Summen von den Findern auf die Seite gebracht wurden und jetzt auch in Umlauf kommen.
Zu ihnen gehörten auch Soldaten der Roten Armee, die an den Ufern der Enns standen und den flußabwärts treibenden Geldsegen auffischten. Sie konnte der Captain nicht durchsuchen, über die sowjetischen Alliierten hatte er keine Befehlsgewalt.
Waffenbrüder sind sie heute längst nicht mehr.
Stalin ist auf Konfrontationskurs gegangen und hat den Kalten Krieg ausgelöst. Schon spricht man von einem dritten Weltkrieg. Im Januar dieses Jahres haben die USA und Großbritannien die den Russen überlassenen Kriegsschiffe zurückverlangt. Im März verließ der sowjetische Marschall Sokolowski den Alliierten Kontrollrat für Deutschland und legte ihn dadurch lahm. Im April demonstrierten amerikanische Superfestungen in einem in den USA gestarteten Nonstopflug ihre Präsenz in Europa, siebentausendvierhundert Kilometer, bewältigt in sechzehn Stunden. Im August hatte die US Air Force begonnen, ihre motorgetriebenen Jagdflugzeuge durch Düsenjets zu ersetzen. Der abgewählte Premierminister Churchill stellt auf dem Tory-Parteitag fest, daß »die Armeen der Demokratie im Sonnenglanz des Sieges dahinschmolzen, während die Streitkräfte des totalitären Despotismus in gewaltigem Ausmaß und für unbestimmte Zeit unter Waffen gehalten werden«.
Es kommt nach der Währungsreform zur Blockade Berlins, zur totalen Abschnürung, die zur Zeit durch die »Luftbrücke« kostspielig gebrochen werden muß. Täglich landen an der Spree hundertfünfzig »Rosinenbomber«, und erstmals werden viermotorige Maschinen des Typs »Globemaster C 74« eingesetzt, die zwanzig Tonnen Nutzlast schleppen können. Den Berliner Haushaltungen stehen täglich nur vier Stunden Strom — in zwei Raten — zur Verfügung. Die Situation ist mulmig. Niemand weiß, wie lange die Notversorgung Berlins noch aufrechterhalten werden kann und was die Sowjets noch alles im Schilde führen.
Geht die Fälschung der neuen Zwanzig-DM-Scheine auf ihre Initiative zurück? fragt sich Captain Steel. Haben sie sich womöglich Himmlers Fälscher unter den Nagel gerissen, wie die Amerikaner die vierhundertfünfundsiebzig deutschen Raketenforscher, die in Cap Canaveral für die US-Raumfahrt arbeiten ?
Die Amerikaner sind inzwischen mißtrauisch geworden, statt ihre Ausrüstung zu verschrotten, rüsten sie jetzt wieder auf, bis zum Dezember werden eineinhalb Millionen Soldaten unter Waffen stehen.
In München überrascht Captain Steel nach glattem Flug seine Mitarbeiter zu ungewohnt früher Stunde mit nüchternem Tatendrang; er hetzt sie herum und fährt selbst ins Polizeipräsidium, um sich beim Falschgelddezernat die eben aufgetauchten DM-Blüten zeigen zu lassen.
»Nur Zwanzig-Mark-Scheine?« fragt er den deutschen Beamten, während er die Falsifikate unter der Lupe betrachtet.
»Bis jetzt ja«, antwortet der Mann. »Die sind ja auch am leichtesten nachzumachen.«
Der Captain stellt erleichtert fest, daß Colonel Highsmith die Qualität der Fälschung richtig eingeschätzt hat: Entweder haben die Hersteller unter Zeitdruck gearbeitet, oder sie sind nicht durch die Meisterschule der SS gegangen. In diesem Fall handelte es sich um gewöhnliche Falschmünzer, und diesen kann man entschieden leichter das Handwerk legen.
Der Captain fährt zu seiner Dienststelle zurück; hier erfährt er, daß sich die Umfrage nach eingewechselten Fünf-Pfund-Noten, zumindest bei den Münchener Banken, als Mißerfolg erwiesen hat. Entweder wurden Bagatellmengen von Touristen oder Soldaten eingetauscht, oder es handelte sich um Scheine anderer Größenordnung. Die Autofirma Großer & Co. hatte vor kurzem über viertausend Dollars, den Erlös aus dem Verkauf eines US-Wagens, eingewechselt, Pfundnoten in diversen, meist höheren Nennwerten.
Am frühen Nachmittag meldet sich Gräbert, hechelnd und zappelig wie ein Jagdhund, der apportiert hat und auf seinen Leckerbissen wartet. »Weiß nicht, was Sie wollen, Captain Steel«, sagt er, »aber da gibt’s nicht viel aufzudecken. Anita Sperber hat einen ausländischen Freund, der sie im letzten Jahr mindestens dreimal besucht und bei ihr in der Thierschstraße gewohnt hat. Angeblich ein Südamerikaner; er muß ein ziemlicher Windhund sein, denn er war auch hinter ihrer Freundin her. Es kam zu ständigen Eifersuchtsszenen, die von der ganzen Nachbarschaft mitgehört wurden.«
»Und die Freundin kennen Sie auch schon?« fragt Steel.
»Dem Namen nach«, erklärt Gräbert. »Aber ich konnte mit ihr noch nicht sprechen. Ich denke, daß es heute abend klappt.«
»Haben Sie auch eine Beschreibung des angeblichen Südamerikaners?«
»Da weichen die Aussagen noch zu sehr voneinander ab«, antwortet der Kriminalbeamte. »Fest scheint nur zu stehen, daß der Mann sehr gut Deutsch spricht, etwa fünfunddreißig Jahre alt und eine Spur zu gut gekleidet ist.«
»Overdressed?« erwidert der Captain nachdenklich, und auf einmal spürt er eine unbestimmte Erinnerung, die sich gleich wieder verliert. »Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen, Gräbert«, entgegnet er. »Machen Sie weiter so.« Jetzt greift er doch nach dem Whisky, nimmt sich sogar die Zeit, zwei Gläser zu suchen, gießt ein, reichlich bemessen, reicht Gräbert ein Glas.
Sie trinken aus.
Und auf einem Bein steht man nicht.
Der Captain greift sich wieder den vertraulichen Bericht über den Verkauf eines Chevrolets. Es gibt keinen Grund, die Meldung nicht einfach abzulegen, aber da erhebt sich sein Warterauminstinkt wieder. Er ruft Jutta, die noch immer mit ihm schmollt, weil er ihr aus Paris nichts mitgebracht hat. »Wo ist denn Leutnant Whistler schon wieder?« fragt er.
»Er trinkt gerade Kaffee.«
»Hol ihn her.«
In fünf Minuten schafft es die Sekretärin.
»Fahren Sie in die Nymphenburger Straße, Whistler«, befiehlt ihm der Captain, »Autofirma Großer & Co. Nehmen Sie sich einen deutschen Beamten mit, und bringen Sie den Mann so schnell wie möglich hierher, der vor kurzem einem angeblichen Südamerikaner einen Chevy verkauft hat.«
Er wundert sich über sich selbst; er macht oft etwas, was sich nicht erklären läßt. Privat langt er damit meistens daneben, dienstlich fast nie; aber vielleicht raunt ihm diese Schmeichelei jetzt nur der Old Smuggler zu, den er gleich wieder wegräumt.
Am Nachmittag setzt in München wieder Regen ein, durchweicht die Passanten, die in dicken Trauben an den Straßenbahnen hängen, und ist tödlich für den Geschäftsgang der Autofirma auf dem Ruinengrundstück an der Nymphenburger Straße. Die Menschen hasten an diesem unfreundlichen Oktobertag in schier unbewohnbare Trümmerbehausungen, froh, ein geflicktes Dach über dem Kopf zu haben.
Trotz aller Unbilden und Ungerechtigkeiten sind die meisten Nachkriegsdeutschen nicht unzufrieden. Fast jeder hat die gleichen Sorgen, schuftet für zwei und arbeitet, zumindest nach Feierabend, noch in seiner oder des Nachbars Wohnung als Heimwerker. Es gibt noch keine Gammler, Rocker, Fixer, Chaoten, Punker, Sponties, Dealer, Aussteiger oder Hausbesetzer. Gleich Corinna, der US-Gebrauchtwagen-Verkläuferin und Literaturstudentin, sagt man in diesen miserablen Zeiten in neudeutscher Sprachprägung optimistisch: Okay. All right. In Ordnung.
Um sechzehn Uhr gibt Radio München, zum Entsetzen der Bank deutscher Länder, eine Meldung durch, die nicht in Ordnung ist: die erste Warnung vor gefälschten Zwanzig-Mark-Scheinen. Die Polizei wollte die Alarmnachricht unter Verschluß halten, aber durch die Indiskretion eines Bankinstitutes war sie durchgesickert, und so tritt sie die Flucht nach vorne an, läßt die Bevölkerung wissen, woran sie die Falsifikate erkennen kann. Zwanzig-Mark-Scheine, echte wie gefälschte, haben es von heute an schwer, an den Mann zu kommen, und vor allem an die Frau.
»Hast du das gehört, Corinna?« ruft ihr der Kollege zu. »Sei bloß vorsichtig mit deinen Moneten.«
»Keine Gefahr«, erwidert die Studentin lachend. »Die Straßenkreuzer, die ich feilbiete, kannst du nicht mit Zwanzig-Mark- Scheinen bezahlen, und privat habe ich doch nie so viel Geld in der Tasche.«
Sie sitzt auf einem selbstgezimmerten Hocker unter einem Vordach, das sie vor Nässe schützt; sie ist nicht unglücklich über den flauen Geschäftsgang. Erstens hat sie gerade eine für ihre Verhältnisse satte Provision kassiert, und zum zweiten findet sie so Zeit, über das Hauptereignis des gestrigen Abends nachzudenken, obwohl es eigentlich schon vorüber war, bevor es richtig begonnen hatte: einseitige Verlobung, Umarmung, Kuß. Minuten später ging Corinna ins Haus, allein, obwohl sie Adrian gerne mitgenommen hätte, aber in dieser Zeit, die wieder vieles erlaubt, bleiben Herrenbesuche im möblierten Zimmer einer Untermieterin ausgenommen.
Zu Adrian konnte die Studentin nicht gehen; er lebt in Schwabing, in einer notdürftig reparierten Mansardenwohnung, mit einem Freund zusammen, den er aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hat. In der Siegesstraße — der Teufel mag wissen, woher der Straßenname nach zwei verlorenen Weltkriegen seine Berechtigung herleitet.
Corinna kauert auf dem Hocker, starrt in den Regen, hält Ausschau wie Iphigenie auf Tauris, als der Mann, auf den sie wartet, ohne es sich einzugestehen, sich von der anderen Seite nähert und sie anspricht, bevor sie ihn gesehen hat.
Corinna rückt ein wenig beiseite. Der Hocker reicht für zwei, die Menschen der Nachkriegszeit sind abgemagert wie ihre Tageszeitungen.
»Schlechtes Geschäft heute?« fragt Adrian.
»Überhaupt keines«, entgegnet die Studentin. »Und du hast gestern noch den einzigen Kunden verscheucht, den ich in dieser Woche hatte.«
»Aber erst nach dem Kaufabschluß«, erwidert der Mann mit dem kühn geschnittenen Gesicht und den wachen Augen lachend, einer, der sich sehen lassen kann und sich nicht viel daraus macht.
»Und wie gehen deine Geschäfte?« fragt Corinna, leicht anzüglich.
»Besser«, versetzt er, die gute Laune selbst. »Um nicht zu sagen: hervorragend. Franz, die Kanaille, ist als Geschäftsführer wirklich eine Kanone.«
»Ich weiß«, versetzt Corinna und fragt, obwohl sie über ganz andere Dinge sprechen möchte: »Warum nennst du deinen Freund eigentlich immer eine Kanaille?«
»Schiller. ›Die Räuber‹«, antwortet Adrian wie aus der Pistole geschossen: »Schließlich muß ich die Reste meiner klassischen Bildung unter Beweis stellen. Und Franz ist der ehrlichste Räuber, den ich kenne.« Er sieht sich um, merkt, daß der andere Verkäufer verschwunden ist, legt schnell den Arm um Corinnas Schulter, zieht sie an sich. »Wie fühlt man sich als Braut?« fragt er.
»Du meinst, das wäre ich?«
»Nimm bloß nichts zurück«, entgegnet er erschrocken.
»Ich hab’ dir ja noch gar nichts zugestanden. Nicht böse werden«, sagt Corinna rasch und streichelt ihn so flüchtig wie zärtlich. »Aber du solltest mir vielleicht vorher doch noch ein paar Fragen beantworten.« Sie sieht ihn voll an. »Warst du eigentlich nüchtern, gestern abend?«
»Voll verliebt und stocknüchtern«, antwortet Adrian.
»Woher dieser plötzliche Ungestüm?« fragt sie. »Auf einmal keß wie ein Draufgänger.« Mit einem verzuckert-perfiden Lächeln setzt sie hinzu: »Verbal, wenigstens.«
»Seit gestern abend rollt ein klares Programm«, antwortet er und sieht auf seine Schuhspitzen. »Verliebt, verlobt, verheiratet.« Er bietet Corinna eine Zigarette an, gibt ihr und sich Feuer. »Bist du dabei?«
»Gut, daß du mich endlich fragst«, entgegnet sie. »Ich dachte schon, du äußerst dich rein abstrakt.«
»So konkret war ich noch nie«, erwidert Adrian. »Ich habe schon mit Franz gesprochen. Am nächsten Samstag steigt unser ganz großes Verlobungsfest. Mit Ring, Blumen, Gläserklang, Jubel, Trubel, Heiterkeit — und dann, in etwa sechs Monaten, der Einzug in unser gemeinsames Heim.«
»Einzug wohin?« fragt ihn Corinna.
»In unsere neue Wohnung.«
»Und die haben wir?« fragt sie.
»Wir werden sie bald haben«, behauptet Adrian. »Ich hab’ dir doch gesagt, daß Franz eine Kanone ist; er kommt übrigens gleich vorbei und holt mich hier ab.«