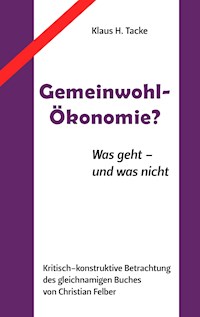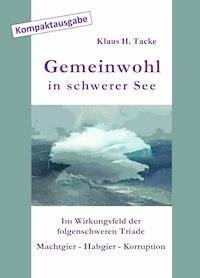
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Kompaktausgabe des gleichnamigen Buches (ISBN 978-3-8482-6024-9) übernimmt die wichtigsten Erkenntnisse. Somit kann auch hier gerechter Zorn aufkommen darüber, wie die Institutionen und Organisationen uns Bürger ausklammern. Ein gerechter Zorn ganz im Sinne des berühmten Menschenrechtlers und Publizisten Stéphane Hessel, der mit seiner Streitschrift "Indignez-vous!" ("Empört Euch!") 2011 die Welt aufhorchen ließ, indem er mit eindringlichen Worten zum friedlichen Widerstand gegen die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die Diktatur des Finanzkapitalismus und die Unterdrückung von Minderheiten aufrief. Die einzelnen Organisationen unserer Gesellschaft denken in erster Linie an sich und organisieren ihr Leben im Rahmen des fatalen Wirkungsfeldes, das sich auf Machtgier und Geldgier konzentriert und Korruption in jeder Form als Instrumentarium zum Erreichen der gesteckten Ziele einsetzt. Das sorgt unter anderem dafür, dass die Parteien, die laut Verfassung lediglich die Funktion haben, "bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken" (Art. 21 GG), sich mittlerweile zu einem sechsten Verfassungsorgan entwickelt haben, welches das Prinzip der Gewaltenteilung durch völlige Unterwanderung der Verfassungsorgane aufgehoben hat. Eine Vielzahl von Strategien und "systemstabilisierenden" Manipulationen gegen die Interessen der Bürger werden im Buch aufgezeigt und dokumentieren, dass es nicht mehr um uns Bürger geht, sondern dass die politische Klasse sich selbst zum Souverän unseres Staatswesens erhoben hat. Eins wird dabei erschreckend deutlich: Niemand außer uns Bürgern will eine Wiederherstellung der Gewaltenteilung. Wenn das den Leserinnen und Lesern bewusst wird, hat die Schrift ihr Ziel erreicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gemeinwohl in schwerer See
Teil I: Wir Menschen und unsere Gesellschaft- 01) Der steinige Weg bis zur Gegenwart- 02) Der Begriff des Gemeinwohls- 03) Das Wirtschaftssystem als Basis unserer ExistenzTeil II: Wir Menschen in diversen FunktionenA. Menschen in Verwaltung und Politik- 01) Die öffentliche Verwaltung- 02) Politiker - Die Repräsentanten des VolkesB. Menschen als UnternehmerC. Menschen in Interessengemeinschaften- 01) Die Gewerkschaften- 02) Die Finanzbranche- 03) Der Energiesektor- 04) Das Gesundheitswesen- 05) Die Medienverwaltung- 06) Kirchliche Institutionen- 07) Die freie Wohlfahrtspflege- 08) Wir und unser EigeninteresseTeil III: SchlussfolgerungenA. Was muss geändert werden, um die Systembrüche zu reparieren?- 01) Arbeit- 02) Vorsorge und Versorgung- 03) Nachwuchs- 04) Bildung- 05) Kosten- und Schuldenreduktion- 06) Förderung sozialer MitverantwortungB. Ist ein Systemwechsel die bessere Option?- 01) Die alten Sozialstrukturen gibt es nicht mehr- 02) Neue Konzepte für neue Sozialstrukturen- a) Das "Bedingungslose Grundeinkommen" (BGE)- b) Das Konzept des solidarischen Bürgergeldes (Althaus)- c) Vorteile und BedenkenC. Wie kommt das Gemeinwohl wieder ins Bewusstsein der Politiker?- 01) Ein Protest ist schwer zu präzisieren- 02) Mehr direkte Demokratie ist wichtig, aber schwer durchzusetzen- 03) Auf welchen Ansatzpunkten kann man aufbauen?Zum SchlussBenutzte LiteraturImpressumTeil I: Wir Menschen und unsere Gesellschaft
01) Der steinige Weg bis zur Gegenwart
02) Gemeinwohl als fundamentales Ziel unserer Gesellschaft
- 01) Der steinige Weg bis zur Gegenwart
Unsere Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir anfangs durchaus nicht darauf programmiert waren, unter Gleichberechtigten in größeren Gemeinschaften zu leben. Basis unserer geschichtlichen Entwicklung war das genetische Vertrauen in die Familie und das absolute Misstrauen gegenüber Dritten.
Noch im Mittelalter galten Regel und Ritterlichkeit nur zwischen Standesgenossen, die ihre Untergebenen als rechtloses Eigentum betrachten konnten.
Die Errichtung des Rechtsstaates mit Legislative, Exekutive und Judikative zählt ohne Zweifel zu den großen menschlichen Leistungen. Wesentlich für Stabilität ist jedoch das unbedingte Gleichgewicht der Institutionen (Angenendt 40).
In diesem rechtsstaatlichen Umfeld sucht das Individuum seinen Platz und seine Stellung, geleitet von dem Wunsch nach eigener Befriedigung.
Es bleibt nach wie vor das Problem, ob wir es schaffen, in einem fairen Entwicklungsprozess Gemeinwohl und Individualinteressen miteinander optimal in Einklang zu bringen.
Kooperation ist keine menschliche Grundeigenschaft. Sie nimmt erst Gestalt an, wenn eine weitere Komponente zutrifft, wie man sie z. B. in Dorfgemeinschaften oder Vereinen vorfindet, nämlich Identifikationswilligkeit, basierend auf Vertrauen. Man gehört gerne dazu und versucht, sich so zu verhalten wie die Gemeinschaft.
Joachim Bauer, Psychiatrieprofessor aus Freiburg, stellt fest, dass es für uns Menschen ungemein wichtig ist, als Person von Anderen Akzeptanz und Wertschätzung zu erfahren (Bauer 84).
Wir können somit feststellen, dass der menschliche Selbsterhaltungstrieb durchaus für andere Werte zugänglich ist als nur für persönlichen Vorteil. Es geht ihm vorrangig um Befriedigung, dabei kann die Quelle dieser Befriedigung so vielseitig sein wie der Mensch selbst (Losse 34).
Darin liegt die gute Nachricht, dass menschliches Handeln, auf andere Menschen bezogen und zu ihrem Wohl, mit diesem Denken und Streben nach optimaler Befriedigung durchaus vereinbar ist.
Die schlechte Nachricht bleibt hingegen, dass jedes Individuum in gleich welcher Funktion durch die Grundveranlagung zu seiner Überlebenssicherung dazu neigt, seine Situation zu stabilisieren und zu verbessern - gegebenenfalls auch auf Kosten anderer.
Diese Basisveranlagung müssen wir bei der Ausgestaltung unserer Gemeinschaft berücksichtigen, um gemeinwohl-schädliche Auswirkungen von Selbsterhaltungs-Aktivitäten zu verhindern oder zu erschweren.
Wer die generelle Unzufriedenheit unserer Gesellschaft auf das Versagen der Marktwirtschaft zurückführt, verwechselt Markt-Mechanismus und -Steuerung. Seit Menschengedenken ist ein Markt der Platz, wo sich alle Menschen treffen, die etwas anzubieten haben und alle diejenigen, die etwas suchen. Durch die Marktübersicht und die Möglichkeit kontinuierlicher Anpassung an die Wünsche der Interessenten können beide Seiten den optimalen Befriedigungsgrad erreichen. Für den Verkäufer bedeutet das, dass ein Gewinn beim Verkauf seines Produktes die Prämie darstellt, die ein Käufer bereit ist zu bezahlen, weil er beim Kauf dieses Produktes die optimale Befriedigung findet. Die Marktwirtschaft kann sehr vorteilhaft und effizient arbeiten, wenn man ihren Funktionsmechanismus respektiert. Fast alle gesellschaftlichen Institutionen neigen jedoch dazu, den Mechanismus in ihrem Interesse zu beeinflussen.
- 02) Der Begriff des Gemeinwohls
Der menschliche Entwicklungsprozess führte zu der Erkenntnis, dass man als Gruppe im Überlebenskampf wesentlich erfolgreicher sein kann als im Alleingang. Es lag also im eigenen Interesse, Zeit und Energie quasi als Opfer in eine Gemeinschaft einzubringen, weil es im Ergebnis zu einer höheren Befriedigung führte, als wenn jeder Einzelne die gleiche Menge von Zeit und Energie für sich selbst eingesetzt hätte.
Für das Individuum ist die Bilanz des Gemeinschaftsengagements dann positiv, wenn es im subjektiven Ergebnis mehr Befriedigungselemente von der Gemeinschaft zurückerhält, als es selbst geopfert hat.
Für jedes Mitglied der Gemeinschaft fällt die Gemeinschaftsbilanz aufgrund der individuellen, subjektiven Bewertungsmaßstäbe von Opfer und Leistung unterschiedlich aus. Insofern bleibt es schwierig, die Summe der individuellen Bewertungen zufriedenstellend in Zahlen zu fassen. Der Zufriedenheitsgrad der Gemeinschaftsmitglieder mit ihrer Verwaltung kann ein Indikator sein, der den Stand des Gemeinwohls andeutet.
Für die nachfolgenden Ausführungen soll folgende Definition für den Begriff Gemeinwohl zugrunde gelegt werden:
Gemeinwohl ist die subjektive Bewertung dessen, was wir von der Gemeinschaft materiell und immateriell zurückbekommen im Verhältnis zu dem Einsatz, den wir durch Hingabe von Geld (Steuern und Abgaben) und Energie geleistet haben.
Eine demokratische Verwaltungsform versucht, das Optimum in der Gesamtzufriedenheit der Gemeinschaft anzustreben. Nur so konnte Gemeinwohl und Eigenwohl zu einer akzeptablen Balance gebracht werden. Es bleibt aber der Urtrieb des Individuums, bei jeder sich bietenden Möglichkeit zu prüfen, ob man aus ihr nicht noch mehr für sich herausholen kann als das, was mit der Gemeinschaft vereinbart ist.
Während Korruption mittlerweile nach langem Zögern der Politik in einigen Tatbeständen einen Straftatbestand darstellt, sind die legalen Handlungsweisen von Politikern zum Zweck ihrer Wiederwahl oft als gemeinwohlschädlich anzusehen. Einen großen Anteil an einer Gemeinwohl-Beeinträchtigung verursachen die unzähligen Lobbygruppen, die in ihrer eigentlichen Funktion als Interessenvertreter unseren Volksvertretern ihre Ansicht zu bestimmten Maßnahmen vorstellen sollen. Die Praxis zeigt jedoch, dass in zunehmendem Maße diese Funktion dazu benutzt wird, einen von uns Bürgern nicht gewünschten Einfluss auf die Entscheidungen der Politiker zu nehmen. Im Folgenden soll, basierend auf der Formulierung von Harold D. Lasswell (Wiki), der Begriff wie folgt benutzt werden:
Korruption ist ein destruktiver Akt der Verletzung des allgemeinen Interesses zu Gunsten eines speziellen Vorteils.
Gemeinwohl ist nicht nur materiell zu sehen. Wesentliches Element für den Zusammenhalt ist die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls. Die Tendenz großer Verwaltungen, immer neue Regulierungen und Vorschriften zu erfinden, steht dem entgegen. Das nimmt uns immer mehr Möglichkeiten positiver Kommunikation. Man spürt immer seltener das Begegnungsgefühl, welches wichtige Voraussetzung für die gegenseitige Bestätigung der Gemeinschafts-Zugehörigkeit und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft darstellt.
- 03) Das Wirtschaftssystem als Basis unserer Existenz
Wichtigste Aufgabe jeder Gesellschaft muss die Sicherstellung der existentiellen Versorgung der Mitglieder sein - eine ökonomische Feststellung, die nur noch die Frage offen lässt, auf welche Weise das am besten erreicht werden kann.
Der Wirtschaftswissenschaftler Roland Baader weist auf die enorme wirtschaftliche Entwicklung der letzten beiden Jahrhunderte hin. Der Weg aus der Massenarmut war schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Was der Kapitalismus jedoch im 20. Jahrhundert an Wohlstand und Fortschritt erzeugt hat, ist ohne Beispiel in der gesamten Menschheitsgeschichte. HiTec-Medizin, enorm gestiegene Produktivität und technischer Luxus im Wohnbereich lassen uns länger leben in einem Komfort, wie er
noch vor wenigen Jahrzehnten nur den oberen Zehntausend vorbehalten war. (Baader, Geld 74f).
Mit technischem Fortschritt allein kann dieser kontinuierliche Aufschwung nicht begründet werden. Nichts belegt diese Tatsache eindrücklicher als die Ergebnisse der Spaltung der Deutschen (also von Menschen einer gemeinsamen Kultur) in zwei Hälften: in eine Marktwirtschaft im Westen und eine sozialistische Wirtschaft im Osten. Während Deutschland West zur bedeutendsten Automobil-Nation der Welt wurde, brachten fünfzig Jahre Ingenieurkunst in Deutschland Ost gerade mal den Trabi hervor (Baader, Geld 76).
Die soziale Marktwirtschaft ist sicher nicht perfekt. Aber sie hat sich in der Praxis als der optimale Kompromiss zwischen den beiden extremen Alternativen – Staatswirtschaft oder Laisser-faire Kapitalismus - bewährt. Alle zentral geführten Staaten Osteuropas haben in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts anschaulich gemacht, dass eine öffentliche Verwaltung zu schwerfällig ist, um marktwirtschaftliche Elastizität ersetzen zu können (Potthoff 305).
Wachstum ist ein ordnungspolitisches Konzept. Am Anfang steht die Freiheit, die jedem Mitglied der Gesellschaft eingeräumt wird, um sein Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten so einzurichten, wie es ihm gefällt. Aus der Möglichkeit, etwas anders zu gestalten, entsteht eine Veränderungsdynamik, ein Strukturwandel, und damit Wachstum. Wachstum ist zwingende Folge der freiheitlichen Ordnung und getragen von individuellen Entscheidungen, etwas anders zu machen als bisher (Hüther 19). Wer das als Wachstumsfetischismus bezeichnet, hat die Zusammenhänge zwischen der Freiheit der Individuen und den sich daraus ergebenden und möglichen Handlungsweisen nicht verstanden.
Für den Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger James M. Buchanan erbringt der Staat als Verwalter der Gemeinschaft öffentliche Leistungen, die er den Bürgern zur Verfügung stellt, und erhält von ihnen im Tausch als Gegenleistung einen Preis in Form von Steuern. Er unterstreicht die gegenseitige Abhängigkeit dieser Leistungen. Wenn der Bürger schon für eine Leistung bezahlt, sollte er auch eine zustimmungsfähige Leistung erhalten. Die Funktionsweise unserer heutigen politischen Entscheidungsmechanismen führt jedoch dazu, dass das Prinzip von Leistung und Gegenleistung nicht mehr gegeben ist. Für den Schüler von Buchanan, Lars Feld, liegt der Grund darin, dass der politische Prozess sich nicht mehr nur auf den Wahlakt reduziert, sondern er umfasst die Interaktionen der an ihm beteiligten Akteursgruppen. Jede am Entscheidungsprozess beteiligte Gruppe versucht, Argumente und Anreize zu finden, um bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt zu werden (Feld 26). Man muss sich von dem Gedanken trennen, dass Politiker am Gemeinwohl orientiert sind. Es gilt deshalb, mit Hilfe der Verfassung Regeln zu entwerfen, die eine Orientierung der Politik an den Bürgerinteressen sicherstellt. Dazu gehört unbedingt die permanente Beobachtung und Kontrolle der verfassungsgemäß zu bewahrenden Gewaltenteilung. Nur durch sie ist sichergestellt, dass ein Volksvertreter in der Form eines parteilichen Zusammenschlusses sich nicht allzu weit von der Verpflichtung auf sein Gewissen abweichen kann.
Die nachfolgenden Ausführungen sollen helfen zu verstehen, dass in erster Linie unsere menschliche Veranlagung Ursache dafür ist, dass Handlungsweisen und Reaktionen aller Beteiligten uns weit von der Effizienz unseres Wirtschaftssystems entfernt haben. Die Suche nach einer Lösung für unsere Zukunft muss in erster Linie diese Erkenntnis berücksichtigen, um die heutigen negativen Auswirkungen so weit wie möglich mithilfe einer verfassungsgerechten Verhaltensweise zu eliminieren.
Teil II: Wir Menschen in diversen Funktionen
A. Menschen in Verwaltung und Politik
B. Menschen als Unternehmer
C. Menschen in Interessengemeinschaften
Es gilt aufzuzeigen, wie es dem einzelnen Menschen allein oder in einer Gruppe gelingt, im Rahmen seiner offiziellen Tätigkeit zusätzliche Vorteile für sich oder seine Gruppe zu realisieren. Erst wenn diese grobe „Mängelliste“ bekannt ist, kann man gemeinsam überlegen, ob und wie man am wirkungsvollsten die jeweiligen Mängel beseitigen kann.
Die Beispiele werden drei Gruppen zugeordnet, die wesentlichen Anteil an der heutigen Situation unseres Gemeinwohls haben.
A. Menschen in Verwaltung und Politik Sie werden zusammengefasst als öffentliche Arbeitnehmer. Sie sind im Gegensatz zu privaten Arbeitnehmern in nicht gewinnorientierten Institutionen tätig.