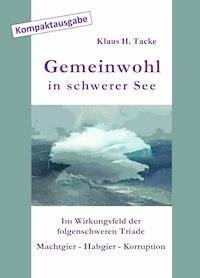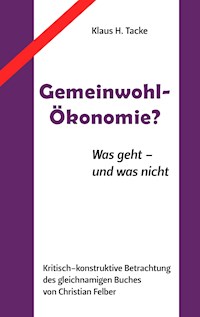
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch befasst sich vorwiegend mit der Gemeinwohl-Ökonomie des gleichnamigen Buches von Christian Felber. Seine Visionen sind faszinierend, aber erst erreichbar, wenn sie einerseits auf einem solideren theoretischen Fundament abgesichert werden und andererseits sich als erstes mit der Erneuerung der heutigen politischen und gesellschaftlichen Situation befassen. Wer sich realisiert, in welchem Ausmaße wir Bürger von den meisten uns umgebenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen ausgenutzt und abgezockt werden, verliert die Hoffnung, dass die Bürger sich jemals aus ihrer politischen Bedeutungslosigkeit befreien könnten. Erst wenn es gelingt, die folgenschwere Triade Machtgier, Habgier und Korruption zu zerschlagen, kann ein neuer Weg in die Zukunft führen. Der Weg ist das Ziel. Wer generell an der Gemeinwohl-Problematik interessiert ist, kann kostenlos eine Kompaktversion meines Buches 'Gemeinwohl in schwerer See' downloaden unter der ISBN 9783744833134.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
I. Einleitung
Gemeinwohl – ein Trümmerhaufen
II. Der Mensch – Sozialwesen oder Egoist?
1. Geborgenheit des Familienumfeldes – Misstrauen nach außen
2. Genetischer Selbsterhaltungstrieb – Egoismus – Befriedigung
3. Negative Auswirkungen begrenzen
4. Gemeinschaft wahrnehmen, erleben und gestalten
III. Adam Smith und der Markt
1. Der Markt als Handelstreffpunkt
2. Adam Smith
3. Konkurrenz bei Smith
4. Gerechtigkeit und Tugend bei Smith
5. Sympathie bei Smith
IV. Annahmen auf dem Weg zum Ziel
1. Kooperation oder Konkurrenz?
2. Wachstum – ein „Muss“ der Konkurrenzwirtschaft?
3. Würde ist der höchste Wert
4. Vertrauen gegen Effizienz?
V. Maßnahmen der Gemeinwohl-Ökonomie
1. Macht und Einkommen
a) Spekulation
b) Fresskonkurrenz
c) Dividenden und Zinsen
d) Machtbegrenzung durch Haftungselemente
2. Demokratische Bank
3. Vermögensbegrenzung
4. Demokratische Mitgift
5. Umpolung des Anreizrahmens zur Gemeinwohlbilanz
6. Soziale Sicherheit
a) Arbeitslosigkeit
b) Solidaritätseinkommen
c) Rentenproblematik
7. Demokratische Allmenden (Commons)
VI. Umsetzungsstrategie
1. Der Wille des Volkes
2. Transparenz und Haftung
3. Gemeinsam wird man stark
Schlusswort
Benutzte Literatur
Über den Autor
I. Einleitung
Gemeinwohl ist ein wesentlicher Faktor, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Eine aktuelle Bestandsaufnahme zeigt, wie wenig Beachtung es bei den meisten Organisationen und Institutionen unserer Republik findet. Verliert es seine Bedeutung, ist die Solidargemeinschaft ernsthaft in Gefahr.
Viele denken lobenswerter Weise darüber nach. Einige entwickeln revolutionäre Gedanken und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Horizont- Erweiterung unserer Überlegungen. Es ist dabei durchaus erlaubt, alles zunächst einmal über Bord zu werfen und von Null an ein neues Konzept zu entwickeln – es ist klassisches Brain-Storming, bei welchem man seinem Gehirn erlaubt, sich auszutoben und jede Art von Zusammenhängen zu bilden und zu überprüfen.
Ein typisches Beispiel für diese Art vorbehaltlosen Nachdenkens bietet Christian Felber, der mit seinem Buch „Gemeinwohl-Ökonomie“ (Felber 2012) ganz vorsichtig, aber konsequent, neue Türen aufgestoßen hat. Er hat faszinierende – wenn auch verwegene – Ziele vor Augen und tastet und schreibt sich an diese Ziele heran. Beim Lesen bildet sich zuerst ein Gefühl der Skepsis aus, welches Seite für Seite übergeht in ungläubiges Zweifeln, danach Erstaunen, und am Schluss werden die meisten zu der Überzeugung gelangt sein, dass man durchaus versuchen sollte, diese lebenswerte Zukunft intensiver zu studieren.
Felber selbst sieht sein Buch als einen Entwurf an, der Grundlage für weiterführende und präzisierende Gestaltung sein könnte.
Bestärkt hat ihn die Tatsache, dass zeitgleich mit dem Erscheinen der Erstausgabe seines Buches 2010 eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ergeben hatte, dass über 80% der befragten Bürger in Deutschland und Österreich sich eine neue Wirtschaftsordnung wünschten. Das ermutigt natürlich zusätzlich, zu neuen Ufern aufzubrechen.
Es versteht sich von selber, dass bei derartigen weitreichenden Gedankenspielen die durchaus in Betracht genommene Gefahr besteht, dass gelegentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Erst die weiterführende Diskussion wird zeigen, ob wirklich alles über Bord geworfen werden muss, was uns bisher als selbstverständlich erschien.
Ich hielt es für erforderlich, die Punkte, bei denen Christian Felber sich gegen den Mainstream der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften positioniert hat, etwas eingehender auszuführen, damit der Leser für seine eigene Beurteilung mehr Informationsmaterial zur Verfügung hat.
Nach dem Motto des bekannten Zukunftsforschers John Naisbitt (*1929) ist der zuverlässigste Weg, in die Zukunft zu sehen, das Verstehen der Gegenwart. (Naisbitt, 22 ff.)
Gemeinwohl – ein Trümmerhaufen
Mich selbst hat bei meiner Beschäftigung mit dem Gemeinwohl in erster Linie die gegenwärtige Situation interessiert, um zu erfahren, wie brüchig die Solidargemeinschaft mittlerweile geworden ist. Wir stellen seit langer Zeit fest, dass unsere Gemeinschaft von Jahr zu Jahr unzufriedener wird. Es bildet sich ein unbehagliches Gefühl, wie es denn weitergehen soll. Wer ist schuld an dem Debakel? Gibt es überhaupt einen Schuldigen, oder sind Demokratie oder Marktwirtschaft die falschen Organisationsformen einer Gesellschaft?
Die Hauptursache der heutigen Problematik ist fundamental darin begründet, dass die Parteien die demokratische Gewaltenteilung de facto abgeschafft haben, indem sie verfassungswidrig alle Institutionen unterwandern und somit ihre eigene Position sichern. Enge Verflechtungen mit Finanz und Wirtschaft führen zu Abhängigkeit und Lobbyeinflüssen von ungeahnten Ausmaßen. Das Blockieren eines umfassenden Korruptions-Strafgesetzes seit mehr als 14 Jahren, die Verhinderung von Volksbefragungen auf Bundesebene und die Ernennung von Parlamentariern nicht durch die Bürger, sondern durch die jeweiligen Parteimanager nimmt den Parlamentariern jegliche Motivation, Volksvertreter zu sein. Sie sind nur noch abhängig von ihren Parteichefs.
Das tragische Dreieck aus Lobbyismus, Korruption und Machtanmaßung der Parteien zerstört die Demokratie. Wenn im Gesundheitswesen Patienten bewusst benutzt werden, um daraus nicht gesundheitserforderliches Kapital zu schlagen, wenn die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen fast Monopolstellungen erreichen in Bezug auf die öffentlichen Zuwendungen jeder Art, wenn die öffentlichen Medien durch ihre Beaufsichtigung und Kontrolle durch Politik und Wirtschaft keine Möglichkeit mehr haben, uns aufrichtig und objektiv zu informieren, so sind das Folgen der vollständigen Vernetzung der Funktionäre, Wirtschaft und Organisationen. Selbst die Richter des Bundesverfassungsgerichtes, also des Kontrollorgans des Parlaments, werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Parlaments in kleinen Kommissionen zwischen den Parteien vorab ausgehandelt. Damit kontrolliert das Parlament seine Kontrollorgane selbst. (Spiegel Online, 14.07.2012)
Für mich bedeutet jeder gesellschaftliche Neuanfang – egal wie eine Person oder eine Organisation die Zukunft gestalten will – zunächst einmal die radikale Korrektur der derzeitigen Situation. Solange das genannte tragische Dreieck funktioniert, werden dessen Profiteure jeden Versuch einer Erneuerung, die zu Lasten des Machtkartells gehen könnte, zu verhindern wissen. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Eine Erneuerung kann deshalb nur gelingen, wenn alle politischen Strömungen, die diese Rückkehr der Macht zu den Bürgern wünschen, sich in diesem Punkt zusammenfinden und sich auf ein Wahlbündnis einigen könnten, welches in erster Linie die Problembeseitigung im Auge hat. Man muss schon mehr erreichen als die mindestens für den Bundestag erforderlichen 5% Stimmanteil, um Einfluss auf die Änderungsmöglichkeiten nehmen zu können. Sobald der gemeinsame Eintritt ins Parlament und die Rückgestaltung der Macht auf die ursprünglichen Machtverhältnisse erreicht sind, können die Abgeordneten des Wahlbündnisses ihre jeweiligen Schwerpunktinteressen dem Souverän vortragen. Und der Souverän, also wir alle, werden dann entscheiden, für welche der angebotenen Projekte wir uns besonders interessieren.
Es ist der Wunsch Felbers und der Gemeinwohl- Bewegung, die Zukunft von den Bürgern selbst festlegen zu lassen. Insofern ist der Weg zu einer freien Entscheidung und Abstimmung der Bürger über die erstrebenswerten Zustände das erste und wichtigste Ziel, dessen Erreichen Voraussetzung ist für jede weitere konzeptionelle Planung.
Unter diesem Aspekt ist auch der nachfolgende Kommentar verfasst worden. Er soll ein advocatus diaboli sein, der alle Punkte auf dem Weg zur Gemeinwohl-Ökonomie kritisch hinterfragt, damit im Vorfeld der Bewegung das Fundament gefestigt wird, auf welcher das Gemeinwohl-Ökonomie-Projekt weiter gebaut werden kann.
Ganz besonders geht es mir um die Zielsetzung des Konzeptes der Gemeinwohl-Ökonomie und um die Fragen
Ist der Mensch wirklich ein Gemeinwohl- Wesen?
Ist die Konkurrenz in der Tat so schlimm wie dargestellt?
Kann man das Ziel nicht auch auf einfachere Weise erreichen?
II. Der Mensch – Sozialwesen oder Egoist?
Der siebzehnjährige Karl Marx (1818–1883) kam in seinem Abituraufsatz (1835) „Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufes“ hinsichtlich der Einstellung des Individuums zu seiner Gesellschaft zu der Feststellung, dass das Hauptmotiv, von dem man sich bei der Standeswahl leiten lassen solle, das Wohl der Menschheit sein müsse. Dabei kommt es nach seiner Überzeugung durchaus nicht zu einem zu befürchtenden Interessenkonflikt, denn „die Natur des Menschen ist so eingerichtet, dass er seine Vervollkommnung nur erreichen kann, wenn er für die Vollendung, für das Wohl seiner Mitwelt wirkt.“ (Hochschule Augsburg, Bibliotheca Augustana)
Wenn Marx mit seiner Feststellung Recht gehabt hätte, wären die meisten der uns heute belastenden Probleme nicht existent. Die Spezies Mensch entspricht hingegen – wie wir alle wissen – nicht dieser Idealvorstellung. Unsere Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir anfangs durchaus nicht darauf programmiert waren, unter Gleichberechtigten in größeren Gemeinschaften zu leben. Im Gegenteil, da uns Menschen eine Gewalthemmung nicht angeboren ist, hatten wir die meiste Zeit unserer Geschichte damit zu tun, einen Weg zu suchen, trotz unserer Gewaltbereitschaft zu einer erträglichen Form des Zusammenlebens zu finden. Der Kirchenhistoriker Prof. Arnold Angenendt (*1934) hat in seinem umfangreichen Werk Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert (Angenendt 2007), dargelegt, dass die Lösung dieses Konflikts die menschliche Erstaufgabe darstellen musste. Nur der unbedingte Überlebenswunsch unserer Spezies sorgte dafür, dass an die Stelle angeborener Instinkte gewisse kulturelle Regeln eingeführt wurden, die das Zusammenleben außerhalb der Blutsverwandtschaft überhaupt erst ermöglichten. Die Blutsverwandtschaft selbst war ein geschützter Raum nach dem Prinzip des genetischen Eigennutzes. Misstrauen und Feindlichkeit galten nach außen, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Opfermut nach innen. Die Feindlichkeit gegenüber Außenstehenden war das größte Problem für die Entwicklung einer Gemeinschaft.
Noch im Mittelalter fehlten allgemein gültige Regeln für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und wenn es Regeln gab, dann galten sie nur zwischen den entsprechenden Standesgenossen. „Zur mittelalterlichen Kriegergesellschaft gehörte das Rauben, Plündern und Morden; zwar herrschte unter Standesgenossen Ritterlichkeit, aber Untergebene, Hörige, Bauern, Bettler konnte man verstümmeln, ihnen die Augen ausdrücken, sie sogar erschlagen, erst recht ihre Äcker, Ernten, Häuser und Höfe niedermachen und abbrennen.“ „Die Freude am Quälen und Töten anderer war groß, und es war eine gesellschaftlich erlaubte Freude.“ (Elias, 268)
Es war ein langer – im wahrsten Sinne des Wortes – mörderischer Weg von dem spätarchaischen Prinzip der Ahndung von Rechtsverletzungen nach dem Prinzip Wie Du mir, so ich Dir zu der heutigen Form des Rechtsstaates mit der institutionalisierten Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Exekutive. Nur ein dermaßen austarierter Staat kann das spezifische Ziel der Gleichheit aller Bürger vor dem Recht gewährleisten.
In den meisten Kathedralen West-Europas liegen Kirchenfürsten ehrenvoll begraben. Sie entstammen zum großen Teil einer Zeit, in der das Individuum noch keine Rechte und eigentlich keinen Wert besaß; in der von diesen klerikalen Funktionsträgern Inquisitionen und Hexenverbrennungen zu Tausenden veranstaltet und hilflose Opfer im Namen der heiligen Inquisition ermordet wurden. Das zeigt, dass wir, wenn wir keine Bestrafung zu befürchten haben, durchaus in der Lage sind, anderen, schwächeren Menschen unglaubliches Leid zuzufügen. Das Recht des Stärkeren wurde zunehmend durch die Aufklärung in Frage gestellt und in der französischen Revolution abgelöst vom Recht des Individuums auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Allerdings dauerte es Jahrzehnte, bis sich dieses Recht in den Demokratien verfestigt hatte (Tacke, 10 f.).
Erst in dem Augenblick, in dem es um die Rechte des Individuums ging, konnte die Demokratie anfangen, sich zu entwickeln. Ein mühsamer Prozess, der oft wieder zu einem Rückfall in die Ära der Ungleichheit führte, aber gleichzeitig aufzeigte, in welche Richtung sich die Menschheit entwickeln soll, wenn sie langfristig überleben und mit Respekt voreinander zusammenleben will. Bis zu dieser Zeit wurden die Grundrichtlinien durch die christliche Religion vorgegeben. Nächstenliebe wurde aber mit zunehmender Individualisierung in den Köpfen ersetzt durch die Erkenntnis, dass in einer Gemeinschaft jedes Individuum das Recht haben sollte, von der Gemeinschaft gestützt zu werden – zugleich mit der Pflicht, die Gemeinschaft zu stützen. Subsidiarität und Solidarität wurden zu Begriffen, die über die Vernunft Eingang in die Grundvereinbarungen der Gemeinschaft fanden.
Die Errichtung des Rechtsstaates zählt ohne Zweifel zu den großen menschlichen Leistungen. Aber ihm drohen zwei Gefahren. Ist er zu schwach, verlieren die Bürger das Vertrauen und greifen zur Selbstjustiz wie z. B. in Indien. Gerät das ausgewogene Verhältnis zwischen Legislative, Exekutive und Judikative aus dem Gleichgewicht, besteht die Gefahr von unerwünschter Machtkonzentration. Wer immer die Staatsspitze total vereinnahmt, Diktator oder Partei, vermag ob des Gewaltmonopols despotisch zu werden, denn angesichts der Waffenlosigkeit aller übrigen ist seine Gewalt unbeschränkt (Angenendt, 40).
In diesem rechtsstaatlichen Umfeld sucht das Individuum seinen Platz und seine Stellung, geleitet von dem Wunsch nach eigener Befriedigung.
Man muss sich einmal folgende Relation vor Augen führen, um uns als Menschen richtig einordnen zu können. Das Alter der Erde wird nach dem letzten Stand der Erkenntnisse mit ca. 4,5 Milliarden Jahren angenommen. Das Alter der Menschheit, basierend auf radiometrischen Datierungen der geologisch ältesten bekannten Knochenüberreste des echten Menschen, wird auf max. 2 Mio. Jahre geschätzt. Es bedurfte jedoch einer unvorstellbar langen Zeit bis zum Anfang der Zivilisationsgeschichte vor circa zehntausend Jahren. Die Zahlen sind für uns schwer vorstellbar – deshalb folgender Vergleich. Setzt man das Alter der Erde in Relation zu einem 90 Jahre alten Greis, dann wäre der Beginn der Menschheit erst vor weniger als drei Wochen passiert, als Zivilisation könnten wir erst seit wenigen Stunden wahrgenommen werden, und in diesem Zeitraum haben wir uns noch die meiste Zeit gegenseitig totgeschlagen.
Für uns ist heute die nächste Welt-Sekunde die wichtigste. In ihr wird sich entscheiden, ob wir es schaffen, die Stufe unserer Vernunftbegabung dazu zu nutzen, um auch zu einer von Vernunft gesteuerten Handlungsweise zu kommen, die Verständnis dafür entwickelt, dass wir nicht nur für uns leben, sondern dass wir das gemeinsame Interesse unserer Gesellschaft respektieren und berücksichtigen müssen. Es muss möglich sein, in einem fairen Entwicklungsprozess Gemeinwohl und Individualinteressen miteinander optimal in Einklang zu bringen. Voraussetzung dafür ist sicherlich, zunächst einmal das Bewusstsein für die vielen Fehlentwicklungen zu schaffen, denen wir uns erschrocken oder empört, aber offensichtlich hilflos, gegenüber sehen. (Tacke, 6 ff.)
1. Geborgenheit des Familienumfeldes – Misstrauen nach außen
Aus der Entwicklungsgeschichte der Menschheit lässt sich ablesen, dass wir nach wie vor bereit sind, dem engeren Familienumfeld Vertrauen und Hilfsbereitschaft entgegen zu bringen. Gegenüber der Außenwelt verbleibt unsere Skepsis, solange wir nicht festgestellt haben oder annehmen können, dass das Vertrauen gegenüber einer Gruppe gerechtfertigt ist. Im positiven Falle sind wir bereit, diesen Kreis in unserem Verhalten tendenziell in das Familienumfeld mit einzubeziehen.
Die Feststellung von Felber, dass wir grundsätzlich gemeinschaftsbezogene Wesen sind, die im Innersten veranlagt sind, alles für das Gemeinwohl zu tun, ist eine gewagte Aussage, wenn man von der Entwicklungsgeschichte ausgeht. Je größer der Kreis ist, umso unwahrscheinlicher ist die Gemeinsinn-Unterstellung. Sie berücksichtigt zu wenig, dass das Gemeinschaftsbezogene in erster Linie den Bereich der engen Familienbeziehung betrifft. Vertrauen nach außen setzt einen Prozess der Vertrauensbildung voraus durch persönliche Erfahrung mit Personen oder Gruppen.
Dazu ist es erforderlich, dass eine Gruppierung sich zunächst einmal bildet bzw. bewusst als Einheit wahrgenommen wird. Das wiederum setzt gemeinsames Erleben voraus – am besten zu erreichen bei gemeinsamen Interessenlagen. Kooperation ist keine menschliche Grundeigenschaft. Sie nimmt erst Gestalt an, wenn eine weitere Komponente zutrifft, nämlich eine Identifikationswilligkeit, die bei Clubs, Vereinen, Dorf- und Hausgemeinschaften gegeben sein können. In Städten dagegen ist der persönliche Kontakt in der Regel auf wenige Menschen beschränkt. Die meisten Menschen, denen man begegnet, sind einem fremd. Man fühlt sich ihnen nicht verpflichtet und hält es deshalb nicht für erforderlich, dass man den Fremden mit der gleichen sozialen Verbindlichkeit umsorgt wie ein Familienmitglied. Die christliche Aufforderung „Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst“ wird deshalb von den meisten als frommer Wunsch angesehen, der jedoch mit der Realität nichts zu tun hat. Man weiß aus Erfahrung, dass man von den anderen, den „Nächsten“, auch nicht erwarten kann, dass sie einem selbstlos zur Verfügung stehen, wenn man auf Hilfe angewiesen ist.
Nur der eigene Charakter eines Individuums entscheidet, ob man ohne Erwartung einer Gegenleistung bereit ist, einem anderen beizustehen und ihm mit Würde, d. h. gleichwertig zu begegnen. Man braucht sich nur Kriegszeiten ins Gedächtnis zurück zu rufen um zu erkennen, dass einerseits Leute, die mit keiner Strafe zu rechnen hatten, sich unmenschlich gegenüber Mitmenschen verhielten, während es gleichzeitig Personen gab, die unter eigener Lebensgefahr ihre verfolgten Nachbarn versteckten. Auch wenn dies ein Kriegsbeispiel ist, so lassen sich die unterschiedlichen Verhaltensvariablen durchaus auch auf Friedenszeiten übertragen.
Zieht man den sozialen Kreis noch größer, also z. B. um das Land oder die Nation, reduziert sich das Gemeinschaftsgefühl auf die paar Gelegenheiten, in denen die Nation als Nation spürbar ist, etwa bei Spielen der Nationalmannschaft oder sonstigen besonderen Ereignissen, bei denen man für die Nation hofft oder stolz auf sie ist.