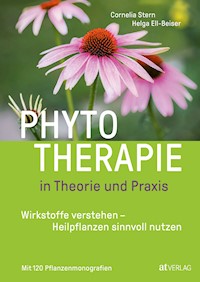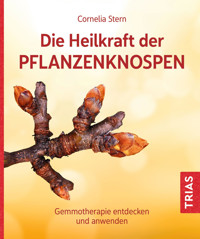71,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kleine Knospen – große Wirkung
Cornelia Stern gelingt es auf faszinierende Weise, die Heilkraft der Knospen, Schösslinge und Triebspitzen darzustellen. Sie zeigt, wie die Lebens- und Wachstumskräfte von Pflanzen als Regenerations- und Heilpotenziale nutzbar gemacht und zur Behandlung eingesetzt werden können. Und sie beschreibt, wie die Arzneien aus dem „Lebendigsten“ der Pflanze hergestellt werden – dem vegetabilen Embryonalgewebe.
Erweitern Sie Ihr phytotherapeutisches Repertoire:
- Einführung in die Gemmotherapie
- Zugriff auf 80 digitale Mindmaps: Indikation und Kombinationsmöglichkeiten von Gemmo-Einzelmitteln auf einen Blick
- Anwendung in der Praxis: 49 Knospenporträts mit Botanik, Wirkungen, Indikationen und konkreten Anwendungstipps
- Zwei Zugangswege zur erfolgreichen Anwendung: über die Knospe und über die Indikation
- Überarbeitung: Angaben zu Dosierung und Anwendung je Indikation differenzierter betrachtet
- Nach deutschen Pflanzennamen sortiert!
NEU in dieser Auflage: mehr Indikationen, mehr Therapievorschläge, mehr Knospenwissen. Inklusive Zugang zur Online-Plattform mit allen Mindmaps!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gemmotherapie
Grundlagen – Indikationen – Behandlung
Cornelia Stern
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
279 Abbildungen
Vorwort
Knospen sind in meinem Leben sehr wichtig. Als Dozentin für Phytotherapie und Heilpflanzenkunde bin ich viel in der Natur unterwegs. Aber immer Anfang November habe ich früher gemerkt, dass für mich eine Leere entsteht, wenn sich die Pflanzen zurückziehen und auf den Winter vorbereiten. Alles wird kahl, die Farbenpracht ist verschwunden, und so erwartete ich mit Sehnsucht den kommenden Frühling und das Erwachen des sichtbaren Lebens in der Natur. Mein Heilpflanzenjahreslauf dauerte von März bis November, und dann war ein Bruch, ein ungeduldiges Innehalten und Warten.
Seit ich mich mit den Knospen tiefer beschäftige und realisiert habe, dass sie nicht einfach unscheinbar kleine, langweilig braune Gebilde an den Ästen sind, sondern sich in ihrer Form- und Farbenvielfalt gegenseitig zu übertreffen versuchen, ist mein Gefühl von Leere verschwunden. Denn die Knospen für das nächste Jahr werden schon im Spätsommer gebildet und überwintern unbeeindruckt von Kälte, Schnee und Eis an den Ästen von Bäumen und Sträuchern. Somit war die dunkle Jahreszeit nicht mehr so leer. Ich bin unterwegs und beobachte und entdecke die Knospen. Mein Blick, der von Frühling bis Spätherbst eher Richtung Boden zu den Heilpflanzen gerichtet ist, erhebt sich in den Wintermonaten gen Himmel zu den Knospen. So sind die Knospenbilder für dieses Buch entstanden. Und das Schönste dabei ist, dass mein Heilpflanzenjahreskreis nun ohne Bruch, ohne Wartezeit rund und vollständig geworden ist!
Mit Knospen in Form von Heilmitteln beschäftige ich mich schon viele Jahre. Bereits nach meinem Pharmaziestudium bin ich an meiner ersten Arbeitsstelle, einer großen naturheilkundlich orientierten Apotheke in der Schweiz, in Kontakt mit den Gemmopräparaten gekommen. Zuerst war ich noch etwas skeptisch, warum neben Blüten, Blättern, Wurzeln, Kraut und Früchten von Pflanzen nun auch noch Knospen zu Heilmittel verarbeitet werden sollen und wie so kleine Knospen überhaupt solche Wirkungen vollbringen können. Doch ich wurde bald eines Besseren belehrt. Denn ich erlebte bei so vielen Patienten die schnell einsetzende und zusätzlich nachhaltig heilsame Wirkung der Gemmomittel, sowohl bei akuten Erkrankungen wie Erkältungen oder Heuschnupfen als auch bei langjährigen chronischen Leiden.
Wenn man die Knospen im Frühling kurz vor ihrem Aufspringen beobachtet, wenn man sieht, wie sie durch die aufsteigenden Säfte anschwellen und so schnell wachsen, dann ist rein intuitiv schon klar, dass sich darin eine unglaubliche Kraft befinden muss. Und diese in lindernde und heilende Arzneimittel zu übertragen, hat der Gemmotherapie zu einem festen Platz in der Naturheilkunde verholfen. Ein therapeutisches Arbeiten ohne Gemmotherapie kann ich mir heute kaum noch vorstellen!
Als ich 2009 als Apothekerin in Deutschland zu arbeiten begann, merkte ich bald, dass die Gemmotherapie so gut wie unbekannt war. Da das Verfahren zur Herstellung von Knospenpräparaten erst im November 2011 durch die Aufnahme ins Europäische Arzneibuch rechtlich zugelassen wurde, erstaunt dies wenig. Doch nun erlebe ich jedes Frühjahr in den Gemmoseminaren an der Freiburger Heilpflanzenschule, wie schnell aus dem ehemaligen Geheimtipp „Knospenmedizin“ eine große Begeisterung bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsteht und wie rasch sich das Wissen und die Anwendung weiterverbreiten.
Die vielen Rückmeldungen der Seminarteilnehmer beinhalteten sehr oft den Wunsch, sich eingehender mit der Heilkraft der Knospen zu beschäftigen und weitere Knospen mit ihren Wirkungen und Einsatzgebieten kennenzulernen. Das veranlasste mich dazu, ein zweites Buch über Gemmotherapie zu verfassen. Mein Erstlingswerk Die Heilkraft der Pflanzenknospen, erschienen im TRIAS Verlag, sollte das Interesse an dem Knospenthema wecken und als kleines Nachschlagewerk die ersten Schritte in die Gemmotherapie begleiten. 2016 war es jedoch an der Zeit, allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, intensiver in die Welt der Knospen einzutauchen und zu erfahren, was dieses besondere phytotherapeutische Heilverfahren therapeutisch zu leisten vermag. So entstand 2018 die 1. Auflage dieses Buches. Die Erwartung, dass die Gemmotherapie aufgrund ihrer Wirkweise und der einfachen und angenehmen Anwendung etwas bekannter wird, wurde übertroffen – die Knospen haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Und so wurde es Zeit, dieses Buch grundlegend zu überarbeiten und zu erweitern. In den letzten Jahren wurden weitere Knospen genauer erforscht und v.a. die Wirkungsbreite schon bekannter Knospen deutlich erweitert. Viele Indikationsbereiche sind neu dazugekommen, die sich nun in den ausführlichen Mind-Maps zeigen.
Bei der Auswahl der Knospen, die ich in den Knospenporträts ausführlich beschreibe, habe ich mich von meinen eigenen Erfahrungen leiten lassen. Zudem habe ich nur solche Knospen gewählt, bei denen die Indikationen und Wirkungen wissenschaftlich erforscht und gesichert sind, bei denen nicht nur ich, sondern viele Therapeuten dieselben Erfahrungen gemacht haben. Gestützt habe ich mich dabei auf Pioniere der Gemmotherapie wie Dr. Pol Henry, Dr. Max Tétau, aber auch Philippe Andrianne, Dr. Fernando Piterà, Dr. Frank Ledoux und Dr. Gérard Guéniot und viele weitere – ihnen gebührt für ihre bahnbrechende Arbeit mein größter Respekt!
Um den Überblick zu den meist vielfältigen Indikationsgebieten der einzelnen Knospenmazerate und ihren sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten zu erleichtern, habe ich Mind-Maps von jeder Knospe mit den jeweiligen Indikationen und Kombinationen erstellt. Zusätzlich finden sich jedoch auch Mind-Maps zu den häufigsten Indikationsgebieten und den dazu passenden Gemmopräparaten. Damit ist eine rasche und dennoch sichere Wahl des passenden Mittels möglich. Und wer sich vertiefend mit der Gemmotherapie beschäftigen möchte, erhält damit einen nützlichen Wegweiser zur Lösung von spezifischen Fragestellungen. Therapeutisch oder pharmazeutisch Tätige können schnell und sicher die geeigneten Knospenmittel oder sinnvolle gemmotherapeutische Kombinationen für ihre Patienten und Kunden zusammenstellen.
Mit diesem Buch verbinden sich nach wie vor zwei Wünsche: Zum einen möchte ich weiter zur Verbreitung des Wissens rund um die hochwirksame Gemmotherapie beitragen, zum anderen hoffe ich, dass sich viele Forscher und Therapeuten der Erschließung weiterer Knospen und deren Indikationen widmen. Ich bin mir sicher, dass in den Knospen unzähliger anderer Bäume und Sträucher, die bislang nicht oder ungenügend erforscht sind, noch viele verborgene Schätze zum Heil und Wohl von Patienten zu entdecken sind!
An dieser Stelle ist es mir auch ein Anliegen, all den Menschen zu danken, die mich in der intensiven Zeit des Recherchierens und Schreibens erneut unterstützt haben. An erster Stelle danke ich meinem Mann Joachim, der mir nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stand, sondern mir alle Wünsche von den Augen ablas und mich von allem Alltagsgeschehen so entlastete und fernhielt, dass ich ungestört in die Tiefen der Knospenmedizin eintauchen konnte. Des Weiteren danke ich Christian Böser vom Haug Verlag für die wertvollen Anregungen und meiner Lektorin Stefanie Teichert für ihr wachsames Auge und die konstruktive, angenehme und schöpferische Zusammenarbeit. Auch Bruno Vonarburg, mit dem mich eine tiefe Freundschaft verbindet, gebührt mein Dank, zum einen für das berührende Geleitwort, aber auch für seine langjährige Praxisarbeit mit der Gemmotherapie, die mich vor vielen Jahren zusätzlich anstachelte, mich mit den Knospen und ihren Heilkräften tiefer zu beschäftigen.
Besonders freut es mich, dass die Knospenzeichnungen in diesem Buch von Sara Eberhard aus Zürich gefertigt wurden. Ich lernte sie als Seminarteilnehmerin in Freiburg kennen und schätzen. Während des Unterrichts fertigte sie jeweils passend zum Thema viele kunstvolle Kreationen mit feinstem Pinsel an. Dass sie mir einen kleinen Ausschnitt ihres künstlerischen Talents in Form der Kohlezeichnungen anvertraut hat, ehrt mich sehr. Danke!
Und Ihnen, geneigte Leserin und geneigter Leser, wünsche ich nun viel Freude beim Eintauchen in die schier unendliche Welt der Knospen und beim Erfahren ihrer wunderbaren Kräfte!
Freiburg, im August 2024
Cornelia Stern
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Geleitwort
Vorwort
Teil I Grundlagen und Anwendungsprinzipien von Gemmomitteln
1 Von der Knospe zur Gemmotherapie – was bedeutet der Begriff „Gemmotherapie“?
2 Geschichte und Entwicklung der Gemmotherapie
3 Knospen als Heilmittel – der Unterschied von Knospen gegenüber anderen Pflanzenteilen
4 Knospenbotanik
5 Inhaltsstoffe der Knospen
5.1 Auxine
5.2 Gibberelline
5.3 Cytokinine
5.4 Abscisinsäure
5.5 Ethylen
5.6 Spezifische Oligosaccharide
5.7 Phytoproteine – embryonale Proteinkomponenten
6 Herstellung eigener Knospenpräparate
6.1 Ausziehen
6.2 Weitere Verarbeitung des Mazerats
7 Anwendung und Dosierung
8 Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Interaktionen
9 Gemmopräparate als Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinalprodukte?
10 Einzel- versus Komplexmittel
11 Integration in andere (naturheilkundliche) Therapien
Teil II Mind-Maps – Indikationen und Knospenporträts
12 Mind-Maps zur Differenzierung innerhalb der Indikationsgebiete
12.1 Atemwege
12.2 Augen
12.3 Bewegungsapparat
12.4 Blut und Blutkreislauf
12.5 Frauenheilkunde
12.6 Harnwege
12.7 Haut
12.8 Herz
12.9 Hormonsystem
12.10 Immunsystem
12.11 Kinderheilkunde
12.12 Leber
12.13 Lymphsystem
12.14 Männerheilkunde
12.15 Ohren
12.16 Psyche und Nervensystem
12.17 Stoffwechsel
12.18 Verdauungstrakt
13 Knospenporträts
13.1 Aufbau der Knospenporträts
13.2 Feld-Ahorn (Acer campestre)
13.2.1 Allgemeines
13.2.2 Botanik
13.2.3 Phytotherapie
13.2.4 Volksheilkunde
13.2.5 Knospenbotanik
13.2.6 Leitlinie
13.2.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.3 Besenheide (Calluna vulgaris)
13.3.1 Allgemeines
13.3.2 Botanik
13.3.3 Phytotherapie
13.3.4 Volksheilkunde
13.3.5 Knospenbotanik
13.3.6 Leitlinie
13.3.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.4 Hänge-Birke (Betula pendula)
13.4.1 Allgemeines
13.4.2 Botanik
13.4.3 Phytotherapie
13.4.4 Volksheilkunde
13.4.5 Knospenbotanik
13.4.6 Leitlinie
13.4.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.5 Moor-Birke (Betula pubescens)
13.5.1 Allgemeines
13.5.2 Botanik
13.5.3 Phytotherapie
13.5.4 Volksheilkunde
13.5.5 Knospenbotanik
13.5.6 Leitlinie
13.5.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.6 Brombeerstrauch (Rubus fruticosus)
13.6.1 Allgemeines
13.6.2 Botanik
13.6.3 Phytotherapie
13.6.4 Volksheilkunde
13.6.5 Knospenbotanik
13.6.6 Leitlinie
13.6.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.7 Rot-Buche (Fagus sylvatica)
13.7.1 Allgemeines
13.7.2 Botanik
13.7.3 Phytotherapie
13.7.4 Volksheilkunde
13.7.5 Knospenbotanik
13.7.6 Leitlinie
13.7.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.8 Edelkastanie (Castanea sativa)
13.8.1 Allgemeines
13.8.2 Botanik
13.8.3 Phytotherapie
13.8.4 Volksheilkunde
13.8.5 Knospenbotanik
13.8.6 Leitlinie
13.8.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.9 Stiel-Eiche (Quercus robur)
13.9.1 Allgemeines
13.9.2 Botanik
13.9.3 Phytotherapie
13.9.4 Volksheilkunde
13.9.5 Knospenbotanik
13.9.6 Leitlinie
13.9.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.10 Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
13.10.1 Allgemeines
13.10.2 Botanik
13.10.3 Phytotherapie
13.10.4 Volksheilkunde
13.10.5 Knospenbotanik
13.10.6 Leitlinie
13.10.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.11 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
13.11.1 Allgemeines
13.11.2 Botanik
13.11.3 Phytotherapie
13.11.4 Volksheilkunde
13.11.5 Knospenbotanik
13.11.6 Leitlinie
13.11.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.12 Feigenbaum (Ficus carica)
13.12.1 Allgemeines
13.12.2 Botanik
13.12.3 Phytotherapie
13.12.4 Volksheilkunde
13.12.5 Knospenbotanik
13.12.6 Leitlinie
13.12.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.13 Gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris)
13.13.1 Allgemeines
13.13.2 Botanik
13.13.3 Phytotherapie
13.13.4 Volksheilkunde
13.13.5 Knospenbotanik
13.13.6 Leitlinie
13.13.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.14 Ginkgo (Ginkgo biloba)
13.14.1 Allgemeines
13.14.2 Botanik
13.14.3 Phytotherapie
13.14.4 Volksheilkunde
13.14.5 Knospenbotanik
13.14.6 Leitlinie
13.14.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.15 Hainbuche (Carpinus betulus)
13.15.1 Allgemeines
13.15.2 Botanik
13.15.3 Phytotherapie
13.15.4 Volksheilkunde
13.15.5 Knospenbotanik
13.15.6 Leitlinie
13.15.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.16 Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
13.16.1 Allgemeines
13.16.2 Botanik
13.16.3 Phytotherapie
13.16.4 Volksheilkunde
13.16.5 Knospenbotanik
13.16.6 Leitlinie
13.16.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.17 Gemeine Hasel (Corylus avellana)
13.17.1 Allgemeines
13.17.2 Botanik
13.17.3 Phytotherapie
13.17.4 Volksheilkunde
13.17.5 Knospenbotanik
13.17.6 Leitlinie
13.17.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.18 Heckenrose (Rosa canina)
13.18.1 Allgemeines
13.18.2 Botanik
13.18.3 Phytotherapie
13.18.4 Volksheilkunde
13.18.5 Knospenbotanik
13.18.6 Leitlinie
13.18.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.19 Heidelbeerstrauch (Vaccinium myrtillus)
13.19.1 Allgemeines
13.19.2 Botanik
13.19.3 Phytotherapie
13.19.4 Volksheilkunde
13.19.5 Knospenbotanik
13.19.6 Leitlinie
13.19.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.20 Himbeerstrauch (Rubus idaeus)
13.20.1 Allgemeines
13.20.2 Botanik
13.20.3 Phytotherapie
13.20.4 Volksheilkunde
13.20.5 Knospenbotanik
13.20.6 Leitlinie
13.20.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.21 Holzapfelbaum (Malus sylvestris)
13.21.1 Allgemeines
13.21.2 Botanik
13.21.3 Phytotherapie
13.21.4 Volksheilkunde
13.21.5 Knospenbotanik
13.21.6 Leitlinie
13.21.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.22 Schwarzer Johannisbeerstrauch (Ribes nigrum)
13.22.1 Allgemeines
13.22.2 Botanik
13.22.3 Phytotherapie
13.22.4 Volksheilkunde
13.22.5 Knospenbotanik
13.22.6 Leitlinie
13.22.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.23 Dreispitzige Jungfernrebe (Ampelopsis veitchii)
13.23.1 Allgemeines
13.23.2 Botanik
13.23.3 Phytotherapie
13.23.4 Volksheilkunde
13.23.5 Knospenbotanik
13.23.6 Leitlinie
13.23.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.24 Berg-Kiefer (Pinus montana)
13.24.1 Allgemeines
13.24.2 Botanik
13.24.3 Phytotherapie
13.24.4 Volksheilkunde
13.24.5 Knospenbotanik
13.24.6 Leitlinie
13.24.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.25 Europäische Lärche (Larix decidua)
13.25.1 Allgemeines
13.25.2 Botanik
13.25.3 Phytotherapie
13.25.4 Volksheilkunde
13.25.5 Knospenbotanik
13.25.6 Leitlinie
13.25.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.26 Silber-Linde (Tilia tomentosa)
13.26.1 Allgemeines
13.26.2 Botanik
13.26.3 Phytotherapie
13.26.4 Volksheilkunde
13.26.5 Knospenbotanik
13.26.6 Leitlinie
13.26.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.27 Riesen-Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum)
13.27.1 Allgemeines
13.27.2 Botanik
13.27.3 Phytotherapie
13.27.4 Volksheilkunde
13.27.5 Knospenbotanik
13.27.6 Leitlinie
13.27.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.28 Mandelbaum (Prunus dulcis var. dulcis)
13.28.1 Allgemeines
13.28.2 Botanik
13.28.3 Phytotherapie
13.28.4 Volksheilkunde
13.28.5 Knospenbotanik
13.28.6 Leitlinie
13.28.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.29 Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra)
13.29.1 Allgemeines
13.29.2 Botanik
13.29.3 Phytotherapie
13.29.4 Volksheilkunde
13.29.5 Knospenbotanik
13.29.6 Leitlinie
13.29.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.30 Weißbeerige Mistel (Viscum album)
13.30.1 Allgemeines
13.30.2 Botanik
13.30.3 Phytotherapie
13.30.4 Volksheilkunde
13.30.5 Knospenbotanik
13.30.6 Leitlinie
13.30.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.31 Olivenbaum (Olea europaea)
13.31.1 Allgemeines
13.31.2 Botanik
13.31.3 Phytotherapie
13.31.4 Volksheilkunde
13.31.5 Knospenbotanik
13.31.6 Leitlinie
13.31.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.32 Schwarz-Pappel (Populus nigra)
13.32.1 Allgemeines
13.32.2 Botanik
13.32.3 Phytotherapie
13.32.4 Volksheilkunde
13.32.5 Knospenbotanik
13.32.6 Leitlinie
13.32.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.33 Morgenländische Platane (Platanus orientalis)
13.33.1 Allgemeines
13.33.2 Botanik
13.33.3 Phytotherapie
13.33.4 Volksheilkunde
13.33.5 Knospenbotanik
13.33.6 Leitlinie
13.33.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.34 Preiselbeerstrauch (Vaccinium vitis-idaea)
13.34.1 Allgemeines
13.34.2 Botanik
13.34.3 Phytotherapie
13.34.4 Volksheilkunde
13.34.5 Knospenbotanik
13.34.6 Leitlinie
13.34.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.35 Rosmarin (Salvia rosmarinus)
13.35.1 Allgemeines
13.35.2 Botanik
13.35.3 Phytotherapie
13.35.4 Volksheilkunde
13.35.5 Knospenbotanik
13.35.6 Leitlinie
13.35.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.36 Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)
13.36.1 Allgemeines
13.36.2 Botanik
13.36.3 Phytotherapie
13.36.4 Volksheilkunde
13.36.5 Knospenbotanik
13.36.6 Leitlinie
13.36.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.37 Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
13.37.1 Allgemeines
13.37.2 Botanik
13.37.3 Phytotherapie
13.37.4 Volksheilkunde
13.37.5 Knospenbotanik
13.37.6 Leitlinie
13.37.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.38 Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
13.38.1 Allgemeines
13.38.2 Botanik
13.38.3 Phytotherapie
13.38.4 Volksheilkunde
13.38.5 Knospenbotanik
13.38.6 Leitlinie
13.38.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.39 Speierling (Sorbus domestica)
13.39.1 Allgemeines
13.39.2 Botanik
13.39.3 Phytotherapie
13.39.4 Volksheilkunde
13.39.5 Knospenbotanik
13.39.6 Leitlinie
13.39.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.40 Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)
13.40.1 Allgemeines
13.40.2 Botanik
13.40.3 Phytotherapie
13.40.4 Volksheilkunde
13.40.5 Knospenbotanik
13.40.6 Leitlinie
13.40.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.41 Weiß-Tanne (Abies alba)
13.41.1 Allgemeines
13.41.2 Botanik
13.41.3 Phytotherapie
13.41.4 Volksheilkunde
13.41.5 Knospenbotanik
13.41.6 Leitlinie
13.41.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.42 Feld-Ulme (Ulmus minor)
13.42.1 Allgemeines
13.42.2 Botanik
13.42.3 Phytotherapie
13.42.4 Volksheilkunde
13.42.5 Knospenbotanik
13.42.6 Leitlinie
13.42.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.43 Gemeiner Wacholder (Juniperus communis)
13.43.1 Allgemeines
13.43.2 Botanik
13.43.3 Phytotherapie
13.43.4 Volksheilkunde
13.43.5 Knospenbotanik
13.43.6 Leitlinie
13.43.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.44 Walnussbaum (Juglans regia)
13.44.1 Allgemeines
13.44.2 Botanik
13.44.3 Phytotherapie
13.44.4 Volksheilkunde
13.44.5 Knospenbotanik
13.44.6 Leitlinie
13.44.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.45 Silber-Weide (Salix alba)
13.45.1 Allgemeines
13.45.2 Botanik
13.45.3 Phytotherapie
13.45.4 Volksheilkunde
13.45.5 Knospenbotanik
13.45.6 Leitlinie
13.45.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.46 Echte Weinrebe (Vitis vinifera)
13.46.1 Allgemeines
13.46.2 Botanik
13.46.3 Phytotherapie
13.46.4 Volksheilkunde
13.46.5 Knospenbotanik
13.46.6 Leitlinie
13.46.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.47 Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
13.47.1 Allgemeines
13.47.2 Botanik
13.47.3 Phytotherapie
13.47.4 Volksheilkunde
13.47.5 Knospenbotanik
13.47.6 Leitlinie
13.47.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.48 Libanon-Zeder (Cedrus libani)
13.48.1 Allgemeines
13.48.2 Botanik
13.48.3 Phytotherapie
13.48.4 Volksheilkunde
13.48.5 Knospenbotanik
13.48.6 Leitlinie
13.48.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
13.49 Zitronenbaum (Citrus × limon)
13.49.1 Allgemeines
13.49.2 Botanik
13.49.3 Phytotherapie
13.49.4 Volksheilkunde
13.49.5 Knospenbotanik
13.49.6 Leitlinie
13.49.7 Wirkungen und Indikationsgebiete
Teil III Anhang
14 Indikationen und zugehörige Knospenmittel
15 Bezugsquellen
16 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Access Code
Wichtige Hinweise
Nutzen Sie dieses Buch auch digital!
Schnellzugriff zum Buch
Impressum
Teil I Grundlagen und Anwendungsprinzipien von Gemmomitteln
1 Von der Knospe zur Gemmotherapie – was bedeutet der Begriff „Gemmotherapie“?
2 Geschichte und Entwicklung der Gemmotherapie
3 Knospen als Heilmittel – der Unterschied von Knospen gegenüber anderen Pflanzenteilen
4 Knospenbotanik
5 Inhaltsstoffe der Knospen
6 Herstellung eigener Knospenpräparate
7 Anwendung und Dosierung
8 Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Interaktionen
9 Gemmopräparate als Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinalprodukte?
10 Einzel- versus Komplexmittel
11 Integration in andere (naturheilkundliche) Therapien
1 Von der Knospe zur Gemmotherapie – was bedeutet der Begriff „Gemmotherapie“?
Botanisch gesehen sind Knospen nichts anderes als kleine pflanzliche Ausstülpungen, die sich in der kommenden Vegetationsperiode zu neuen Trieben, Blättern und Blüten entwickeln. Jede einzelne Knospe trägt das neue Leben der Bäume und Sträucher in sich, konzentriert das zukünftige Potenzial, um im Frühling mit den wärmenden Sonnenstrahlen aufzubrechen.
Gebildet werden die Knospen schon im Spätsommer des Vorjahres, um dann während des Winters, meist eingehüllt in schützende Knospenschuppen, Kälte, Schnee und Eis zu überdauern. Wenn die steigenden Temperaturen und der richtige Sonnenstand den Frühling ankündigen, die Säfte aus der Erde wieder in die Bäume, Sträucher und Stauden aufsteigen, dann ist die Zeit für die Knospen gekommen, zu neuem Leben zu erwachen.
An sich ist jede Knospe eine kleine Darstellung der gesamten Pflanze. Denn sie enthält die komplette genetische Information der Stammpflanze, d.h. die Information zu sämtlichen Geweben mit ihren verschiedenen Eigenschaften wie Stamm, Äste, Blätter, Blüten, Früchte und Wurzeln. So gesehen sind die Knospenzellen vor dem Aufbrechen undifferenziert. Eine Besonderheit ist, dass in diesem Zustand das gesamte Genom noch aktiv ist und komplett abgelesen werden kann. Erst beim Aufbrechen der Knospen werden die Gene abgeschaltet, die für die weitere Zukunft des jeweiligen Pflanzenteils nicht mehr gebraucht werden.
Die Zellverbände, die die gesamte genetische Information in den Knospen sowie in den kleinsten Wurzeln enthalten, werden Meristeme genannt. Meristeme sind Ausgangspunkte für das weitere Wachstum der Pflanzen. In jedem Meristem existieren verschiedene Zonen mit spezifischen Aufgaben und einer gemeinsamen Kommunikation. Das Resultat ist das „geordnete“ Wachsen der Pflanze.
Medizinisch werden undifferenzierte Zellen, auch Stammzellen genannt, besonders interessant, denn diese können sich zu verschiedensten Geweben weiterentwickeln. So zeigten Versuche mit Stammzellen aus der Nabelschnur Neugeborener, dass daraus beispielsweise Hautzellen gezüchtet werden können.
Pflanzliche Meristeme sind sehr ähnlich, auch sie können sich zu verschiedensten Geweben hin entwickeln. Man kann sagen, dass eine einzige Meristemzelle so omnipotent, ihr Genpool so aktiv ist, dass sie rein theoretisch fähig wäre, die gesamte Pflanze neu zu bilden.
Darüber hinaus können sich die Meristemzellen anpassen. Das bedeutet, dass sich aus ihnen Pflanzen unterschiedlich entwickeln – je nach Gebiet, Klima und Umweltbedingungen – trotz identischem Genpool. Wissenschaftler forschen intensiv, wie diese Zellen miteinander „kommunizieren“ und gemeinsame „Entscheidungen treffen“ – diese Gedanken über die „intelligenten“ pflanzlichen Zellen findet man interessanterweise auch schon in Goethes Schriften. Entwicklung und Anpassung – diese zwei Eigenschaften sind nicht nur in der Pflanzenwelt wichtig, sondern beeinflussen unser ganzes Leben.
Auf der Basis dieses Wissens ist es nicht erstaunlich, dass auch in der Naturheilkunde Interesse am Einsatz pflanzlicher Stammzellen in Form von Knospen, Trieben und Wurzelspitzen entstanden ist. Denn neben den vollständig aktiven Genen, der immensen Teilungsaktivität und einem für pflanzliches Gewebe recht hohen Anteil an Proteinen (v.a. embryonale Phytoproteine sowie Enzyme) enthalten diese viele sekundäre pflanzliche Inhaltsstoffe sowie Mineralstoffe und Vitamine.
Dr. Pol Henry, belgischer Arzt und Begründer der Knospenmedizin, beschäftigte sich intensiv mit diesen pflanzlichen Stammzellen und nannte diese Therapieform Phytoembryotherapie. Diese Bezeichnung beschreibt an sich schlüssig, um was es sich bei der Gemmotherapie handelt: um die medizinische Wirkung pflanzlicher Embryonalzellen bzw. Stammzellen. Dennoch stieß dieser Name nicht auf große Begeisterung, da der Begriff „embryonal“ mit zu vielen Emotionen verbunden ist. Der Vorschlag von Max Tétau, dem französischen Arzt und Freund Henrys, die Phytoembryotherapie doch besser Gemmotherapie zu nennen, entwickelt aus dem lateinischen Wort „gemma“ für Knospe, hat sich schließlich durchgesetzt und bis heute gehalten.
Allein die in diesem Kapitel genannten naturwissenschaftlichen Überlegungen sprechen schon für die Gemmotherapie. Wenn man jedoch im Frühjahr die Knospen von Bäumen und Sträuchern beobachtet, so spürt man auch intuitiv die immense Kraft, die in ihnen schlummert und nur darauf wartet, aufzubrechen und in Form von Trieben, Blättern und Blüten Gestalt anzunehmen.
Diese Kraft und Vitalität in den Knospen sowie die komplexen Eigenschaften der Meristemzellen in Heilmittel zu übertragen, um erkrankten Menschen zu helfen, ist Aufgabe und Ziel der Gemmotherapie.
2 Geschichte und Entwicklung der Gemmotherapie
Die Geschichte der Knospen als Heilmittel ist schon viele Tausend Jahre alt. Es waren v.a. die Alchemisten, die sich mit der Herstellung von Heilmitteln aus Knospen befasst haben. Ohne deren spezielle Inhaltsstoffe zu kennen, erschien es ihnen aufgrund der kraftvollen Signatur der aufbrechenden Knospen einleuchtend, dass daraus wirksame Arzneien entstehen müssen. Auch Hildegard von Bingen, die Äbtissin und Heilkundige, soll sich im Mittelalter mit Knospen von acht Bäumen und Sträuchern für Heilzwecke beschäftigt haben. Dennoch kann man bei den von Hildegard von Bingen verwendeten Knospen nicht von den Anfängen der Gemmotherapie sprechen. Denn ihre Auszüge stellte sie meist mit Weißwein her und nicht mit dem von Dr. Pol Henry ermittelten Lösungsmittelgemisch, das eine Resorption über die Mundschleimhaut ermöglicht.
Als weiterer Initiator gilt Johann Wolfgang von Goethe. In seinem Werk Die Metamorphose der Pflanzen (1798) finden sich lange Ausführungen zum Verständnis und zur Wichtigkeit von pflanzlichen Knospen, wenn auch nicht medizinischer Art.
Nach dem 2. Weltkrieg begann der belgische Arzt, Homöopath und Professor an diversen medizinischen Fakultäten Dr. Pol Henry (1918–1988) die arzneiliche Therapie aus Meristemgewebe zu entwickeln. Er verabreichte seinen Patienten Mazerate aus verschiedenen Knospen, Trieben und Wurzelspitzen, die mithilfe der Lösungsmittel Ethanol, Glyzerin und Wasser in definierter Zusammensetzung hergestellt wurden. In zahlreichen Untersuchungen konnte Henry belegen, dass das teilungsaktive embryonale pflanzliche Gewebe enorm viel Energie und Informationen für die Entwicklung des Organismus enthält. Gelangen diese Informationen in Form von Heilmitteln in den menschlichen Körper, so müsse es möglich sein – davon war Henry überzeugt –, fehlgesteuerte Information zu reparieren und zu regenerieren. Damit kann der eigentliche Heilungsprozess in Gang gesetzt werden.
1959 benannte er diese „neue“ Therapieform „Phytoembryotherapie“, da diese auf der Verwendung von embryonalem Gewebe verschiedener Bäume und Pflanzen beruhte.
1982 veröffentlichte Dr. Pol Henry sein erstes Werk über Knospen als Arzneimittel und seine Forschungsergebnisse: Phytoembryothérapie – Gemmothérapie: thérapeutique par les extraits embryonnaires végétaux – Therapie mit embryonalen pflanzlichen Extrakten. Darin beschreibt er, wie er mittels Elektrophorese (einer Labormethode, die die Auftrennung von Proteinen im Blut ermöglicht) die biochemischen Zusammenhänge der Proteinzusammensetzung im Blut von Patienten vor und nach Behandlungen mit Knospenpräparaten bestimmte und die physiologischen positiven Veränderungen auf diverse Organe beobachtete. Er war fasziniert, dass offensichtlich eine Korrelation zwischen den Erkrankungen und den biochemischen Veränderungen der Bluttests nach Gabe von Knospenextrakten bestand. Er konnte unter anderem belegen, dass der Knospenextrakt aus der Moor-Birke (Betula pubescens) die Makrophagen der Leber (Kupffer’sche Sternzellen) anregt und so eine entgiftende Wirkung zeigt. Zugleich beschäftigte er sich intensiv mit der Phytosoziologie, der Vergesellschaftung von Bäumen und Pflanzen. Für ihn war klar, dass beispielsweise das Knospenmittel aus dem Walnussbaum nicht mit anderen Knospenmittel kombiniert werden sollte. Denn der Walnussbaum vergesellschaftet sich auch nicht gerne mit anderen Pflanzen, sondern sorgt mithilfe des Wachstumshemmers Juglon in seinen Blättern, dass ihm nichts zu nahe kommt. Obgleich Henrys Vorgehen zu Beginn rein wissenschaftlich geprägt war, hat er später über Beobachtungen von Bäumen und Sträuchern einen weiteren Zugang zum heilsamen Einsatz ihrer Knospen erhalten.
Der Begriff „Gemmotherapie“ hingegen wurde von Dr. Max Tétau (1927–2012), der als Arzt, Homöopath und Universitätsprofessor in Paris lebte, geprägt. Als Vorsitzender der Société médicale de Biothérapie war er offen und interessiert an verschiedenen naturheilkundlichen Verfahren. Er lernte Dr. Pol Henry kennen, als Freund schätzen und begann wenig später, intensiv mit ihm zusammenzuarbeiten und schwerpunktmäßig die klinischen Aspekte der Knospenheilmittel zu erforschen. So entstand dann ein weiteres wichtiges Werk mit dem Titel Nouvelles cliniques de gemmothérapie – Klinische Neuigkeiten der Gemmotherapie – und etwas später dann zusammen mit Dr. Daniel ScimecaRajeunir nos tissus avec bourgeons, ein Leitfaden der Gemmotherapie für die Familienhausapotheke.
Ein weiterer wichtiger Mann für die Gemmotherapie ist Dr. Fernando Piterà (*1953). Ursprünglich aus Tschechien, studierte er Medizin mit Schwerpunkt Chirurgie an der Universität in Genua und wurde Professor an der Universität Mailand für Medizin und Chirurgie. Offen für Naturheilkunde engagierte er sich im Bereich der Homöopathie, der Phytotherapie und wenig später auch der Gemmotherapie. Als Mitglied der Fakultät für Homöopathie in Großbritannien und der Asociatia Romana de Gemoterapie si Homeopatie (ARGH), der rumänischen Gesellschaft für Gemmotherapie und Homöopathie, hielt er v.a. in Italien, aber auch im Ausland Seminare und veröffentlichte um die 300 Publikationen zu diversen naturheilkundlichen Themen.
1994 publizierte Dr. Fernando Piterà das bisher ausführlichste Werk über die Gemmotherapie, das Compendio di gemmoterapia clinica. Darin findet man erstmalig den Begriff der Meristemtherapie, der Behandlung mit pflanzlichen undifferenzierten Zellen. Piterà beschreibt auf über 800 Seiten exzellente klinische Erläuterungen über den Einsatz von Knospen. Dieses Buch ist in italienischer Sprache geschrieben und seit vielen Jahren vergriffen. Umso erfreulicher ist es, dass 2018 das Werk in die französische Sprache übersetzt wurde und unter dem Titel Précis de Gemmothérapie – Kompendium der Gemmotherapie erhältlich ist. Seinem Namen wird das Werk mehr als gerecht: auf 900 Seiten findet man geballte Informationen und 67 Monografien zu verschiedenen Knospen und Triebspitzen.
Ein weiterer Wegbereiter der Gemmotherapie ist Dr. Frank Ledoux, der 1982 an der Universität in Lille promovierte und sich dann in diversen naturheilkundlichen Therapieformen wie Homöopathie, Akupunktur, Phytotherapie und Aromatherapie fortbildete. Heute ist er Präsident und Dozent der Schule für Naturheilkunde, der Groupe de Recherche d’Etude et d’Application Thérapeutique (G.R.E.A.T.), sowie Dozent an verschiedenen anderen Ausbildungsstätten in Frankreich und Belgien. An der G.R.E.A.T. lernte er deren Begründer, den 2009 verstorbenen Dr. Gérard Guéniot, kennen und schätzen. Guéniot war aufgrund seiner Erfahrungen in der Arztpraxis ein überzeugter Anhänger der Gemmotherapie.
Mithilfe der Aufzeichnungen von Dr. Guéniot und seiner eigenen klinischen Erfahrung schrieb Dr. Ledoux 2012 das Buch La phytoembryothérapie – L’embryon de la gemmothérapie. Er ist in seiner Arztpraxis in Frankreich tätig und macht die Gemmotherapie mit seinen vielen Vorträgen im französischsprachigen Raum – auch im Internet – einem breiteren Publikum zugänglich.
Auch Philippe Andrianne gehört an dieser Stelle erwähnt. Er studierte botanische Wissenschaften an der Universität Liège (Lüttich) in Belgien. Danach arbeitete er einige Jahre in der naturheilkundlichen pharmazeutischen Industrie, die sich auf die Fertigung von Homöopathika spezialisierte. Dort war Andrianne zuständig für die Ernte und Weiterverarbeitung der pflanzlichen Ausgangsstoffe. Später gründete er seine eigene Firma, die sich um die Herstellung von Baumheilmitteln, insbesondere aus Knospen kümmerte. In dieser Zeit entstanden seine zwei wertvollen Werke: 2002 La Gemmothérapie – Médecine des bourgeons und 2011 Traité de gemmothérapie – la thérapeutiques par les borgeons.Später gründete er zusammen mit anderen Begeisterten der Knospentherapie in Belgien zuerst die Firma Herbalgem. Aus dieser Firma trat er aus und begann einen neuen Hersteller namens Alphagem zu beraten, mit dem Ziel, die Ideen Pol Henrys und v.a. die korrekte Herstellung der gemmotherapeutischen Präparate zu schützen. Als Naturheilpraktiker mit eigener Praxis ist er zudem auch Mitglied der beratenden Kommission der pflanzlichen Arzneimittel des belgischen Gesundheitsministeriums und Präsident der A.I.G (Association Internationale de Gemmothérapie).
Seitdem die Herstellung von Gemmotherapeutika im November 2011 als sogenannte Glyzerinmazerate Einlass ins Europäische Arzneibuch gefunden hat und damit rechtlich in allen europäischen Ländern solche Präparate auch als Arzneimittel hergestellt und vertrieben werden können, hat die Gemmotherapie einen weiteren Entwicklungsschub erhalten. Aufgrund der immer strengeren, aufwändigeren und damit massiv verteuernden Regularien der Arzneibehörden werden viele Gemmomittel nun rechtlich als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Eine Problemlösung, die nicht nur Gutes bringt. Denn von Nahrungsergänzungsmitteln ist weder die Herstellung noch deren Qualität definiert. Und da der Begriff „Gemmotherapie“ nicht geschützt ist, kann alles, was aus Knospen hergestellt wird, rein theoretisch als Gemmotherapie verkauft werden, egal ob die Herstellung mit dem von Dr. Pol Henry erforschten Lösungsmittelgemisch erfolgt oder eben auch nicht. Das macht das Ganze für den Patienten, der auf die versprochene Wirkung vertraut, immer undurchsichtiger und damit schwieriger.
Erfreulich ist, dass die Wirksamkeit und Einsatzgebiete vieler weiterer Knospen erforscht werden. Denn viele interessante Pflanzen sind bislang nicht oder nur unzureichend untersucht worden. So kann man gewiss sagen, dass diese Therapie eine große Zukunft vor sich hat – wir stehen trotz der vielen Erfolge der Knospenheilmittel erst am Anfang ihres unermesslichen Potenzials!
3 Knospen als Heilmittel – der Unterschied von Knospen gegenüber anderen Pflanzenteilen
Gemäß Dr. Pol Henry, dem Begründer der Gemmotherapie, gehört der Einsatz von Knospen als pflanzliche Heilmittel ebenso zur Phytotherapie wie Tees, Tinkturen und Trockenextrakte.
Und so ergibt sich daraus die Frage, wieso man unbedingt auch Knospen, das wertvolle Zukunftspotenzial der Bäume und Sträucher, zur Herstellung von Heilmitteln verwendet und nicht nur wie bisher die anderen Pflanzenteile, die die Zukunft der Pflanzen weniger beeinträchtigen. Gerechtfertigt scheint dies nur, wenn ein Unterschied zwischen den Knospen und beispielsweise den Blättern, Blüten, Früchten und Wurzeln bestünde – und genau das ist der Fall!
Knospen bestehen aus sogenannten Meristemzellen. Dies sind Zellen mit einer enorm hohen Teilungsaktivität, die deswegen viel genetisches Material enthalten und in denen folglich ein hoher Proteingehalt vorliegt. Denn Gene kodieren für verschiedene Proteine, die in der Zellflüssigkeit außerhalb des Zellkerns aus Aminosäuren zusammengefügt werden. Diese Proteine tragen so die übersetzten Informationen der Gene und können diese in andere Pflanzenteile transportieren. Sobald sich jedoch aus den Knospen die fertigen Pflanzenteile entwickelt haben, wird das Wachstum bzw. die Zellteilung eingestellt oder zumindest stark gebremst. Damit sinkt auch der Gehalt an Aminosäuren und Proteinen. Das bedeutet, dass in den Knospen der Gehalt an Aminosäuren und damit Proteinen mit speziellen Aufgaben wie embryonale Phytoproteine und Enzyme wesentlich höher ist als in den fertig ausgebildeten Pflanzenteilen.
Ein weiterer Unterschied besteht auf der Ebene des Genoms. Die Meristemzellen in den Knospen sind genauso wie menschliche Stammzellen omnipotent. Das bedeutet, dass rein theoretisch aus jeder Zelle die gesamte Pflanze reproduziert werden kann. Die gesamte Information in den Genen ist im Knospenstadium aktiviert und kann bei Bedarf abgelesen bzw. in Proteine transkribiert werden. Meristemzellen sind noch nicht spezialisiert auf das Sein und die Funktionen eines Blattes oder einer Blüte.
Sobald die Knospen jedoch aufspringen und die Differenzierung erfolgt, werden immer mehr Gene deaktiviert und können nicht mehr abgelesen werden. Diese abgeschalteten Gene werden für die weitere Entwicklung z.B. der Blüte oder des Blattes nicht mehr benötigt.
Zusammengefasst bedeutet das, dass die Knospenheilmittel einen deutlich höheren Aminosäuren- und Proteingehalt aufweisen als Präparate aus fertig ausgebildeten Pflanzenteilen wie Blättern, Blüten, Früchte etc. und zudem Informationen aufweisen, die die gesamte Pflanze darstellen. Aber genauso wichtig sind die für die Pflanze charakteristischen sekundären Inhaltsstoffe wie beispielsweise ätherische Öle, Flavonoide, Gerbstoffe, Bitterstoffe, die in kleinen Mengen auch in den Knospenmitteln enthalten sind, zusammen mit Mineralstoffen und Spurenelementen. Alle diese Inhaltsstoffe zusammen bestimmen die Wirkung jedes einzelnen Knospenpräparats!
Die Wirkung der Gemmopräparate fußt folglich auf folgenden beiden Säulen: einerseits den Knospen-spezifischen Proteinen, andererseits auf den pflanzencharakteristischen sekundären Inhaltsstoffen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Bei der Phytotherapie, die die fertig ausgebildeten Pflanzenteile wie Blätter, Blüten, Früchte etc. einsetzt, sind die charakteristischen sekundären Inhaltsstoffe vorhanden, aber der Gehalt an Proteinen und Aminosäuren fällt wesentlich niedriger aus. Dieser Unterschied macht sich bei den Wirkungen der Knospenmittel deutlich bemerkbar, wie folgende Beispiele zeigen:
Rosmarinknospen wirken wie in der Phytotherapie tonisierend und verdauungsfördernd bei dyspeptischen Beschwerden, aber ihr Schwerpunkt als Knospenpräparat liegt in der Beeinflussung des Leberstoffwechsels, und zwar in einer Intensität, die man sonst nur von dem konzentrierten Flavonoidgemisch Silymarin aus den Mariendistelfrüchten kennt. Das Rosmarin-Gemmomittel wirkt daher nicht nur cholagog (galletreibend), sondern schützt und regeneriert die Leberzellen.
Ein anderes Beispiel ist die Feige. Phytotherapeutisch kennt man sie nur als schwach wirksames Laxans, in der Gemmotherapie zählt die Feige zu den wichtigen Mitteln für die Magenschleimhaut, indem sie die Magenschleimhaut beruhigt und die Säuresekretion normalisiert.
Und so könnten noch viele Beispiele folgen.
Damit die Gemmopräparate alle wichtigen Inhaltsstoffe, insbesondere die Proteine enthalten, ist es wichtig, den richtigen Erntezeitpunkt der Knospen abzuwarten bzw. nicht zu verpassen. Die Knospen müssen aus dem Winterschlaf erwachen und mit dem Anschwellen durch den aufsteigenden Pflanzensaft beginnen, dann ist es Zeit zum Ernten. Sind jedoch schon Blattstrukturen aus der aufgesprungenen Knospe zu erkennen, ist der ideale Erntezeitpunkt verpasst, denn dann werden schon viele Gene deaktiviert und der Proteingehalt in der Knospe sinkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die korrekte Herstellung, damit sowohl die Proteine wie auch die pflanzenspezifischen Inhaltsstoffe in möglichst hoher Konzentration enthalten sind und das fertige Gemmomittel auch die physikalische Fähigkeit hat, über die Mundschleimhaut resorbiert zu werden.
4 Knospenbotanik
Sogar wenn die Bäume und Sträucher in ihrem grünen Blattkleid dastehen, ist es nicht immer ganz einfach, sie eindeutig zu bestimmen. Und im Winter denken viele, dass sie dies nie schaffen werden. Mit ein wenig Übung und dem aufmerksamen Blick in der Natur ist es jedoch gar nicht schwierig, Bäume und Sträucher anhand der Knospen zu bestimmen. Wichtige Anhaltspunkte sind ihre spezifischen Formen und Farben sowie ihre Stellung am Ast.
Sinnvoll ist es, sich schon während des Winters auf die Knospenpirsch zu begeben – die Knospen sind ja schon im Herbst für den kommenden Frühling angelegt und überdauern in dieser Form die kalte Jahreszeit. Ist man bei einem Baum oder Strauch unsicher, so merkt man sich seinen Standort und geht im späten Frühling wieder hin, um alles im grünen Kleid zu verifizieren. Zu Beginn fällt diese Bestimmungsmethode oft leichter. Der Nachteil ist jedoch – falls man selbst sammeln und herstellen möchte –, dass man bis zum darauffolgenden Frühling warten muss, um die Knospen kurz vor dem Aufspringen, dem richtigen Erntezeitpunkt, sammeln zu können.
Knospen sind so verschieden in ihrem Aussehen, dass es gar nicht so schwerfällt, sie zu unterscheiden und damit zu erkennen. Es ist nämlich nicht so, dass alle Knospen klein, rundlich und irgendwie braun gefärbt sind – ganz im Gegenteil! Allein ihre Größe unterscheidet sich erheblich, man denke an die winzigen Birkenknospen bis hin zu den dicken, schweren Rosskastanienknospen. Was ihre Form betrifft, so können Knospen kegel- oder eiförmig, rund, spindel- oder pyramidenförmig, spitz oder stumpf sein und ihre Farbpalette reicht von dunkel bis sehr hell gefärbt, von Rot, Grün, Violett bis Schwarz. Einige sind behaart, entweder auf der ganzen Knospenoberfläche oder nur am Rand der einzelnen Knospenschuppen, was ihnen ein Aussehen wie Wimpern verleiht, andere sind an der Spitze gekielt, wiederum andere glänzend und glatt, mit Wachspunkten geschmückt oder klebrig.
Die folgenden Abbildungen zeigen, was zu beachten ist und anhand welcher Merkmale die Bestimmung und das Verständnis für botanische Knospenbeschreibungen leichter fällt.
Abb. 4.1 Zweigaufbau ein- und mehrjähriger Triebe.
Viele Merkmale, die zur Bestimmung hilfreich sein können, sieht man nur an den einjährigen Trieben der Äste klar und v.a. eindeutig ( ▶ Abb. 4.1). Bei den älteren Zweigen sieht man den Gestaltungstrieb von Bäumen, sie beginnen mit ihren botanischen Merkmalen zu „spielen“: So können die spitz-eiförmigen Knospen plötzlich kugelig sein oder die streng zweizeilige Anordnung geht an einem älteren Trieb in eine quirlige Reihung über.
Daher ist es sehr wichtig, immer die einjährigen Triebe, die vordersten Abschnitte der Äste, zum Bestimmen zu verwenden. Und die Merkmale dürfen auch gerne an mehreren Ästen bestätigt werden. Zum Herstellen von Gemmopräparaten hingegen können selbstverständlich auch Knospen von älteren Astabschnitten gesammelt werden.
Der einjährige Zweigabschnitt ist der vorderste Teil eines sogenannten Langtriebs. Er reicht von der Knospe ganz vorne am Astende, der sogenannten Endknospe, bis hin zu der ersten Knospenschuppennarbe. Die Knospenschuppennarbe ist die Zeichnung auf dem Ast, die von der Endknospe des letzten Jahres noch übrig geblieben ist. Daraus hat sich der neue Jahrestrieb mit neuer Endknospe entwickelt.
Ein Langtrieb ist ein praktisch unbegrenzt wachstumsfähiger Seitentrieb eines Baums, der längere Abschnitte (Internodien) zwischen den einzelnen Knospen aufweist. Im Gegensatz dazu stellen die Kurztriebe ihr weiteres Wachstum schneller ein und deswegen sind ihre Internodien deutlich kürzer.
Als Nodien werden die verdickten Ansatzstellen der Knospen bezeichnet.
Abb. 4.2 Mögliche Stellungen von Seitenknospen am einjährigen Zweigabschnitt – von unten nach oben: Knospe anliegend, Knospe abstehend, Knospe sitzend, Knospe gestielt, Endknospe.
Seitenknospen heißen alle Knospen, die seitlich am Zweig stehen – im Gegensatz zu der Endknospe, die am Ende des Astes zu finden ist. Die Stellung der Seitenknospen ist ein weiterer wichtiger und hilfreicher Hinweis zur erfolgreichen Bestimmung ( ▶ Abb. 4.2). Und auch hier gilt: Immer den einjährigen Zweigabschnitt anschauen!
Eine seltene Erscheinung sind deutlich gestielte Knospen. Diese sitzen nicht direkt dem Zweig auf, sondern verfügen über einen Stiel zwischen Trieb und Knospe. Es sind nur Erlenknospen, die diese spezielle Eigenschaft aufweisen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass gestielte Knospen nicht mit endständigen Knospen von Kurztrieben verwechselt werden.
Das Gegenteil der gestielten Knospen sind die sogenannten sitzenden Knospen, die ohne irgendeine Zwischenverbindung direkt dem Zweig aufsitzen. Die allermeisten Baum- und Strauchknospen weisen dieses Merkmal auf.
Hilfreich ist deshalb, die Stellung dieser Knospen weiter zu differenzieren. Es gibt Knospen, die in einem rechten Winkel zum Zweig stehen, andere stehen vom Zweig ab und weitere liegen dem Trieb an. Dazu kommen noch Untervarianten, beispielsweise Knospen, die vom Zweig abstehen und mit der Knospenspitze sich wieder diesem zuwenden oder umgekehrt dem Zweig anliegen und mit ihrer Spitze von diesem abstehen.
Auch hier gilt: Die Stellung der Knospen immer an mehreren einjährigen Zweigen überprüfen. Denn keine Regel ohne Ausnahme gibt es auch in der Natur!
Aus der Stellung der Knospen zueinander lässt sich die Blattstellung eines Baums oder Strauchs ablesen, da die Knospen im Sommer in den Blattachseln gebildet werden und dort verbleiben, wenn die Blätter im Winter abfallen. Das heißt, bei einem Baum, dessen Blätter wechselständig an den Zweigen angeordnet sind, stehen auch die Knospen zwangsläufig wechselständig am noch kahlen Zweig im Frühjahr. Gleiches gilt für alle anderen Knospenstellungen. Diese Stellungen entsprechen zudem auch der Anordnung der Seitenzweige, da sich aus den Knospen nicht nur Blätter, sondern auch neue Seitentriebe bilden können ( ▶ Abb. 4.3).
Abb. 4.3 Stellung der Knospen zueinander – und damit auch der Blätter und Seitentriebe – von links nach rechts: kreuzgegenständig, schief kreuzgegenständig, wechselständig, zweizeilig.
Knospen werden gegenständig genannt, wenn sich immer zwei auf gleicher Höhe gegenüberstehen. Schaut man ganz genau hin, so befinden sich diese Knospen nicht exakt auf gleicher Höhe, sondern sind um wenige Millimeter verschoben. Der korrekte botanische Ausdruck lautet dafür schief gegenständig.
Sehr oft sind gegenständig stehende Knospen von einem Paar zum nächsten um 90 Grad verschoben. Schaut man von oben auf so einen Zweig, bilden die Knospen ein Kreuz, und man spricht in diesem Fall von kreuzgegenständigen Knospen.
Bei den wechselständig angeordneten Knospen findet sich immer nur ein Exemplar auf derselben Höhe, die nächste Knospe ist zu der unteren versetzt und schaut in eine andere Richtung. Folgt man den Ebenen von oben nach unten, ergibt sich ein Wechsel zwischen links und rechts, dann wieder links, dann rechts usw. Meistens sind diese Knospen jedoch nicht in einer Ebene angeordnet, sondern stehen mehr oder weniger quirlig um den Zweig.
Sehr selten sind die wechselständigen Knospen tatsächlich nur in einer Ebene zu finden. Das Beispiel dafür ist die Esskastanie, deren Knospen an ihren Langtrieben zweizeilig, an den Kurztrieben jedoch spiralig wechselständig angeordnet sind.
Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten sind die Formen der Blattnarbe und die Anzahl der darin sichtbaren Blattspurstränge ( ▶ Abb. 4.4).
Abb. 4.4 Blattnarben und Blattspurstränge – unten: über der Blattnarbe schief stehende Knospe, oben: über der Blattnarbe senkrecht stehende Knospe.
Blattnarben sind Trennschichten, die im Herbst zwischen Blatt und Zweig gebildet werden, damit sich der Blattstiel und damit das ganze Blatt ohne offene Verletzung des Zweigs ablösen kann. Da die Knospen des nächsten Jahres in den Blattachseln entstehen, sind die Blattnarben immer unterhalb der Knospen zu finden.
Blattspurstränge sind die ehemaligen Gefäße, die meist in Form von Bündeln vom Zweig in das Blatt führen und dieses mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Form und Größe der Blattnarben mit ihren Blattspursträngen sind unterschiedlich und können daher als weitere botanische Merkmale zur Knospenbestimmung herangezogen werden ( ▶ Abb. 4.5).
Abb. 4.5 Herzförmige Blattnarbe mit drei Blattspursträngen des Walnussbaums (Juglans regia).
Ein weiteres wichtiges botanisches Merkmal zur Knospenbestimmung sind die Knospenschuppen.
Bereits im Herbst ist in den Knospen, winzig zusammengefaltet, das Blätter- und teils das Blütengewebe für das nächste Jahr vorhanden. Damit dieses empfindliche Knospeninnere die kalten Wintermonate überlebt, bilden sich um die Knospen herum Nebenblätter, die sogenannten Knospenschuppen. Diese schließen zwischen sich und dem Knospeninneren Luft als Isolationsschicht zum Schutz gegen Winterkälte und Nässe ein.
Die Schuppen sind sehr unterschiedlich. Sie können ledrig, von Harz oder Wachs überzogen sein oder eine feine Behaarung aufweisen. Das Farbspektrum reicht von Hellgrün über sämtliche Rottöne zu Braun bis Violett und sogar Schwarz. Ebenso trägt die Anzahl der Knospenschuppen zur Bestimmung bei: Eine einzige Schuppe, die die ganze Knospe umschließt, haben nur die Weiden ( ▶ Abb. 4.6) und überhaupt keine Schuppen, was in der Pflanzenwelt nicht oft vorkommt, hat beispielsweise der Wollige Schneeball.
Die Knospenschuppen werden im Frühling beim Austreiben der Knospen, wenn der Schutz nicht mehr benötigt wird, abgestoßen.
Abb. 4.6 Knospen der Sal-Weide (Salix caprea) mit nur einer einzige Knospenschuppe von braunroter Farbe.
5 Inhaltsstoffe der Knospen
Aufgrund der spezifischen Inhaltsstoffe der Knospen wird deutlich, wieso Heilmittel aus Knospen oft andere Wirkungen aufweisen als Präparate aus Blättern, Blüten, Wurzeln und Früchten derselben Pflanze.
Der Unterschied liegt unter anderem in den verschiedenen Proteinen, die je nach Funktion Enzyme oder embryonale Proteinkomponenten genannt werden und in dieser Menge nur in den Knospen vorkommen.
Zudem finden sich in den Knospen auch Pflanzenhormone, die in kleinsten Konzentrationen (nmol-Bereich) das Wachstum, die Entwicklung und den Stoffwechsel beeinflussen.
Die Wachstumshormone sind in den Knospen besonders wichtig. Denn die Knospen werden zwar im Herbst mit ihren Strukturen im Miniaturformat angelegt, entwickeln sich aber erst im Frühling weiter. Sichtbar ist dieser Prozess durch ihr Anschwellen, das Aufbrechen und die Weiterentwicklung zu Trieben, Blättern oder Blüten. In dieser Phase sind viele Wachstumshormone vorhanden, in den fertig ausgebildeten Pflanzenteilen sind diese dann kaum noch nachzuweisen.
1926 wurde das erste Pflanzenhormon als wachstumsfördernde Substanz isoliert und später Auxin genannt. Danach wurden weitere Pflanzenhormone wie Gibberelline, Cytokinine, Abscisine und Ethylen entdeckt.
Phytohormone können an Zucker oder an Aminosäuren gebunden sein und zeigen eine multiple Wirksamkeit, d.h., sie regen verschiedenste Prozesse wie Wachstum, Differenzierung, Reifung und Alterung an.
Des Weiteren spielen spezifische Zuckerverbindungen, die Oligosaccharide, eine nicht zu unterschätzende Rolle in der komplexen Knospenentwicklung.
Und selbstredend sind auch schon die artspezifischen sekundären Inhaltsstoffe vorhanden, beispielsweise in den Lindenknospen ätherisches Öl und Flavonoide oder in den Eichenknospen Gerbstoffe.
Dieses Zusammenspiel zwischen den knospenspezifischen Phytohormonen, embryonalen Phytoproteinen und Zuckerbaustoffen und den pflanzenspezifischen Inhaltsstoffen führt dann zu den Wirkungen und Eigenschaften der Knospenheilmittel.
Nachfolgend werden die wichtigsten Phytohormone, die embryonalen Phytoproteine und die spezifischen Oligosaccharide besprochen.
5.1 Auxine
Abb. 5.1 Chemische Struktur von Auxin.
Etymologisch stammt der Begriff „Auxine“ von dem griechischen Wort „auxanein“ ab, was übersetzt „wachsen“ heißt. Sie gehören zu den Pflanzenhormonen, die in den 1920er-Jahren von dem niederländischen Botaniker Frits Warmolt Went und dem englischen Pflanzenphysiologen und Mikrobiologen Kenneth Vivian Thimann entdeckt wurden. Chemisch gesehen sind Auxine Derivate der Indol-3-Essigsäure ( ▶ Abb. 5.1).
Auxine werden in den Knospen von den Meristemzellen gebildet und brauchen Zink als Kofaktor. Auxine beeinflussen unter anderem die Wasseraufnahme und die Zellteilung. Daneben sind sie für das Längenwachstum verantwortlich, indem sie die Plastizität der Zellwände junger Zellen weich machen, sodass eine Zellstreckung möglich wird.
Auxine werden v.a. in den Triebspitzen produziert und hemmen so die Entwicklung von Seitentrieben. Dieses Phänomen bezeichnet man als Apikaldominanz.
Weitere Funktionen der Auxine sind folgende:
Stimulation der Wurzelbildung
Stimulation der Entwicklung des Keimlings
Erhöhung des Knospen-, Wurzel- und Stängelwachstums:
bei geringer Konzentration: Förderung des Streckungswachstum von Knospen, der Sprossachsen und der Wurzel
bei hoher Konzentration: Förderung des Wurzel- und des Sprosswachstums, da die Produktion von ▶ Ethylen gefördert wird.
Mitwirkung an der Differenzierung von Leitbündeln und Kontrolle des Blattfalls
Förderung des Aufbrechens von Knospen sowie des raschen Wachstums junger Triebe
Steigerung der Zellteilungsrate im Kambium (Wachstumsschicht in Baumstämmen) und damit Stimulation des sekundären Dickenwachstums
Verzögerung der Fruchtreifung
Abwehr von krank machenden Einflüssen durch Freisetzung von Oligosacchariden
5.2 Gibberelline
Abb. 5.2 Chemische Struktur von Gibberellin A1.
Gibberelline gehören ebenfalls zu den Wachstumshormonen. Chemisch gesehen sind sie tetrazyklische Diterpene ( ▶ Abb. 5.2).
Das erste Gibberellin (GA1) wurde 1926 von einem japanischen Wissenschaftler namens Kurosawa entdeckt. Er forschte an erkrankten Reiskeimlingen, die plötzlich viel schneller wuchsen als normal und dadurch ihre Standfestigkeit verloren und in den Reisanbausümpfen vor der Samenbildung einfach umknickten. Er fand auf den Reiskeimlingen den Pilz Gibberella fujikuroi. Dieser bildet eine Substanz, die dieses enorme Wachstum auslöst. Diese Substanz aus dem Pilz erhielt dann den Namen Gibberellin A1. Erst viel später entdeckte man in der Pflanzenwelt mehr als 100 verschiedene Gibberelline, die allesamt für das Wachstum durch Zellstreckung, aber auch Zellteilung verantwortlich sind. Je höher der Gibberellingehalt ist, desto schneller erfolgt das Wachstum.
Sobald der Chlorophyllstoffwechsel der Pflanze einsetzt, sinkt die Gibberellinkonzentration massiv ab und ist wenig später nicht mehr nachweisbar.
Weitere Funktionen der Gibberelline sind folgende:
Aktivierung des zellulären Stoffwechsels junger Triebe
Stimulation der Blütenknospen und Start des Erblühens
Stimulation des Wachstums junger Blätter
Stimulation des Keimens von Samen
5.3 Cytokinine
Abb. 5.3 Chemische Struktur von Zeatin.
1956 wurde das erste Cytokinin aus dem Mais (Zea mays), genannt Zeatin, isoliert ( ▶ Abb. 5.3) und ist bis heute das bekannteste der ungefähr 40 verschiedenen Cytokinine, die ebenfalls zu den Phytohormonen gehören. Chemisch betrachtet handelt es sich um Adeninderivate, die als freie Basen, Nukleoside (mit Zuckerrest) und Nukleotide (mit Zucker- und Phosphatrest) vorliegen.
Sie kommen in allen Pflanzenteilen vor, konzentrierter jedoch in den Meristemen von Knospen, Wurzelenden, jungen Sprossen und Samen. Ihre wichtigste Funktion betrifft die Zellteilung, v.a. in den Seitentrieben, und sie sind so für deren Längenwachstum verantwortlich.
Weitere Funktionen der Cytokinine sind folgende:
Kontrolle der Morphogenese undifferenzierter Zellen:
geringe Cytokinin- und Auxinkonzentration: Förderung der Wurzelbildung
hohe Cytokinin- und Auxinkonzentration: Förderung der Sprossmeristeme
Regulation der mitotischen Zellteilung
Verzögerung des Welkens, v.a. von Blättern
Förderung von Seitenknospen und Seitentrieben
Regulation der Proteinsynthese
Stimulation der Chlorophyllproduktion
5.4 Abscisinsäure
Abb. 5.4 Chemische Struktur von Abscisinsäure.
Abscisinsäure, veraltet auch Dormin genannt, ist ein monozyklisches Sesquiterpen ( ▶ Abb. 5.4), das 1963 entdeckt wurde.
Dieses Phytohormon hat im Gegensatz zu den bisher besprochenen Hormonen keine aktivierende, sondern eine hemmende Wirkung. Abscisinsäure ist verantwortlich für den Winterschlaf der Knospen und ist bei Kälte wie auch bei Trockenheit aktiv. So gesehen kann man die Abscisinsäure auch als adaptogenes Hormon ansehen, das dem Meristemgewebe eine Resistenz für trockene Perioden verleiht, sowie als „Antistresshormon“ bei Wasser- und/oder Ernährungsdefizit.
Weitere Funktionen der Abscisinsäure sind folgende:
Hemmung der Keimung von Samen
Induktion der Bildung von Speicherproteinen in Samen
Unterstützung der Bildung von Proteinase-Inhibitoren bei Verletzung der Pflanze
Unterstützung der Verteidigungsmechanismen der Pflanze
5.5 Ethylen
Abb. 5.5 Chemische Struktur von Ethylen.
Ethylen ( ▶ Abb. 5.5) ist das einzige gasförmige Phytohormon. Es kommt in sämtlichen Pflanzen vor und wird in den Zellzwischenräumen gebildet. Seine wachstumsfördernde Wirkung wurde 1901 belegt. 1935 wies William H. Crocker, Professor für Pflanzenphysiologie der Universität Chicago, auf Ethylen als Pflanzenhormon für die Fruchtreifung hin.
Ethylen ist an vielen Entwicklungsprozessen beteiligt, beispielsweise an der Bildung der Blattspreite, an der Blütenentwicklung sowie am Blattabwurf.
Am bekanntesten ist die Wirkung auf die Fruchtreife. So wird heute unreifes Obst künstlich mit Ethylen begast, um die Reifung nach der Ernte zu fördern.
Weitere Funktionen des Ethylens sind folgende:
Hemmung oder Förderung verschiedener Stoffwechselwege und Enzymaktivitäten
Beeinflussung der Proteinbiosynthese
Beeinflussung der Genexpression
Stimulation der Blütenöffnung
Stimulation von Blüten- und Blattalterung
Auslösen von Blatt- und Fruchtabwurf
Signalwirkstoff (Pheromon) bei Schädlingsbefall und Wunden
5.6 Spezifische Oligosaccharide
Oligosaccharide sind komplex aufgebaute Kohlenhydrate, d.h., sie bilden lange Zuckerketten aus mehreren gleichen oder verschiedenen Einfachzuckern, die durch glykosidische Bindungen miteinander verbunden sind. Sie haben in den Knospen eine regulatorische Funktion, indem sie einerseits das Wachstum, andererseits die Ausdifferenzierung von Knospenzellen zu fertigen Organen wie Blättern und Blüten etc. beeinflussen.