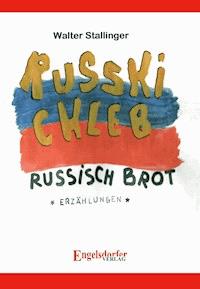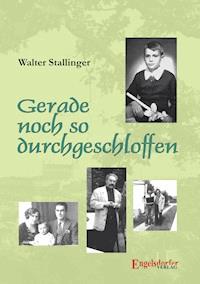
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
SEGMENTE – »Gerade noch so durchgeschloffen«. Ich nehm' mich an die Hand und geh mit mir spazieren. Wie Mitesser werden Erinnerungen aus der porösen und faltigen Haut der Gegenwart herausgequetscht. Sie leben in uns wie kaum bemerkte, aber lebensnotwendige Parasiten, unterschwellig, ungeliebt zuweilen, mit einem fast magischen Eigenleben. Reflexionen verschachteln sich, münden in Episoden, deren Inhalte nur aus dem Erleben einen vermittelbaren Sinn ergeben. Im scheinbaren Chaos von Nacheinander, dem Dazwischen und der Überlagerung von Gleichzeitigkeiten öffnet sich die Wiederholbarkeit von Erlebnissen, wenn sie in das passende Verhältnis zu den Lebensumständen rücken. Als ein ständiger Wechsel gewesener Ereignisse, schwankend zwischen Tatsachen, erhofftem Geschehen und wirklich gewordenen Möglichkeiten, können Erinnerungen kein getreues Abbild von Vergangenem sein. Immer mischt sich in hinterhältiger, aber unvermeidbarer Weise ein Abschnitt der Gegenwart ein. Eben ein Segment des persönlichen Lebens. Erinnerungen werden sortiert. Solche Rückblenden formen vergangene Tatsachen recht eigenwillig aufs Neue, verschlucken die chronologische Abfolge, vermengen Persönliches mit dem Allgemeinen. Sie werden intim, verdrängen, verleiten zum Fabulieren, Vertuschen und Erhellen, zerlegen wie ein Skalpell die gewesene Mannigfaltigkeit in wieder gegenwärtige Einzelheiten. Dabei ist das Gedächtnis manchmal barmherzig. Es lässt Lücken zu. Manchmal überspringt es im Zickzack die Zeit, oder man befindet sich in einer scheinbar wiederholenden Lebensschleife. Aber ist die präzise Chronologie überhaupt von Bedeutung? Unterliegen wir einem Detailzwang? Oder zählt mehr der Zusammenhang, aus welchem Wirkungen, Ergebnisse, Zustände und Schlüsse erwachsen? Fragen, die sich jeder Leser selbst beantworten mag. Auf jeden Fall: Immer »gerade noch so durchgeschloffen«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gerade noch so durchgeschloffen
von Walter Stallinger
Segmente- aus dem Leben von einem, der fast ein Taugenichts geworden wäre
Impressum eBook:
ISBN 978-3-86901-578-1
Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag
Impressum Printausgabe:
Engelsdorfer Verlag 2009
Bibliografische Information durch
die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86901-623-8
Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag
Hintergrund bei Cover und Rückseite nach einer
Fotografie von Miro Gregor gestaltet (1978)
Fotos: Privatarchiv
Rückseite: Originalzeichnungen von K. H. Frech, 1937
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Als Geleitschutz
Sehr geehrter Leser,
sollten Sie diese Texte aus nur Ihnen bekannten Gründen erworben haben, dann fangen Sie bitte nicht sofort zu lesen an.
Zum einen sind diese Blätter in meistens reformierter Weise geschrieben, zum anderen ist ein gewisses Zögern angebracht, denn eine Geld-zurück-Garantie wird nicht gewährt. Sie konsumieren auf eigenes Risiko, allerdings mit einer nur geringen Gefahr, sich in einer der erwähnten Personen oder einem der genannten Umstände wiederzufinden. Mögliche Ähnlichkeiten können nur zufällig sein, aber natürlich nicht ausgeschlossen werden. Es ist wie beim Arzt oder Apotheker in der Packungsbeilage. Bei näherer Betrachtung entdecken Sie jedoch Wahrscheinlichkeiten, so dass sich ein Gleichnis aufdrängen könnte. Darin liegt eben die Gefahr! Sie könnten sittlich moralisch bedrängt werden. Nun, bleiben Sie standhaft und suchen Sie keine Vergleiche anzustellen, geben Sie sich mit einem Patt zufrieden. Vox et preterae nihil, das heißt: Nur Worte, sonst nichts. Eines jeden Leben ist letzten Endes ein Kompromiss, mies oder nicht mies, jein oder na ja. Und warum der Rotfadenheld in der ersten Person beschrieben wurde? Die Ich-Person steht mir näher als alle anderen, das heißt aber nicht, dass diese Ich-Person in jedem Fall ich selbst sein soll, will, bin oder war. Das verhüte Gott, wenn es einen gibt und davor sei meine Seele bewahrt, wenn ich eine habe. Sehr frei nach Voltaire.
Besonders danke ich Konrad K., Harry M., Bernd A., Bernd S., Axel B., Willi R., den Herren Achim M., Thomas Sch., Rainer E., Friedheim K., Walter J., „Frieda“, Jürgen R., Heinz K., Gerd M., Thomas M. und anderen, die unwillkürlich, allein durch ihre Existenz dazu verhalfen, alles bunter und freundlicher zu gestalten. Ich danke einer Anzahl von ehemaligen Vorgesetzten, die mich zum Formulieren von bissigen Bemerkungen anregten. Um Entschuldigung bitte ich bei allen maßgebenden oder maßgeblichen? Beurteilern, Verurteilern, Besprechern und Beschwörern von Geschriebenem.
Ich habe es mir erlaubt. Freiwillig gebe ich zu, dass ich das erste Mal auf diese Weise Deutsch betreibe, und hatte dabei ursprünglich keine besonderen Vorbilder im Sinn, wie etwa Peter Schlemihl, Felix Krull oder Don Quichote. Und das sogar nur bis in die Jahre 1975/76!
Von den Besonderheiten bei Umbrüchen
Wenn es zum Leben einen Beipackzettel gäbe, würde niemand damit anfangen.
Johannes Gross im FAZ-Magazin
Als ein so besonderes Ereignis erwähnte meine Mutter den Einmarsch der Tschechischen Legion in Poszony, Pressburg oder Bratislava, wie die Stadt zuletzt und eigentlich zurecht hieß. Kelten, Römer, Slawen, Magyaren, Deutsche, Tataren, Türken, Russen, vor allem aber die Österreicher besiedelten, besetzten, überrannten, entsetzten, belebten, beherrschten diese alte Stadt an der Donau. Selbst die napoleonischen Franzosen schickten ihre Grüße über den Fluss in die Stadt, allerdings in der Form von Kanonenkugeln.
Als ein junges Mädchen von achtzehn 18 Jahren, hastete Mutter aus der Stollwerckfabrik gegen Abend nach Hause. In dieser Fabrik stand sie damals am Band und verpackte Süßwaren, hergestellt nach Kriegsrezepturen.
Unterwegs liefen ihr aufgeregte und sehr verängstigte Leute entgegen: „Alles in die Häuser!“, riefen sie, „die Legionäre kommen!“ Dieser Legion ging kein besonders guter Ruf voraus. Sie bestand vor allem aus Tschechen, die in Russland gekämpft, aber auch aus ehemaligen Fremdenlegionären, die unter Frankreichs Trikolore den Ersten Weltkrieg zu beenden geholfen hatten.
Die Legionäre marschierten in loser Kolonne, fuhren auf laut knatternden Lastkraftwagen oder waren beritten. Den Worten meiner Mutter zufolge schossen sie in die Luft, brüllten durcheinander oder sangen die jetzt erlaubte tschechische Hymne, in welcher die Frage gestellt wird, wo die Heimat liege. Gde domov muj? oder so ähnlich. Besorgte Ereignisbetrachter zogen meine Mutter in ein Haus nahe der Hurbankaserne. Johlend nahmen die Legionäre von der fast leerstehenden Kaserne Besitz. Der Krieg hatte schon vor längerer Zeit sein unrühmliches Ende gefunden, nur die Generalität war wieder ungeschoren davongekommen. Diese und ähnliche Erfahrungen prägten sehr stark die Haltung meiner Mutter dem Leben gegenüber. Es waren die Jahre des Ersten Weltkrieges, die Ausrufung der ersten tschechoslowakischen Republik, die Kämpfe in der Slowakei bis 1919, Inflation, Massenarbeitslosigkeit, und immer wieder die rigiden staatlichen Verhaltensweisen gegenüber allen Nichttschechen. Das so erfrischend und munter klingende Multi- Kulti- Miteinander ist und hat nichts Besonderes für mich. Meine Klavierlehrerinnen waren die jüdischen Damen Silberstein, unseren tschechischen Hausmeister riefen wir Pán Petrik, mein erster Schulfreund hieß Tibi Sóos, er war Deutsch-Ungar, meine Mutter hatte ungarische Schulbildung, in der Nachbarwohnung lebte die slowakische Familie Kovács und mein erster Schuldirektor stammte aus dem „Reich“: Hofstätter, Jochen.
Das beste Gemüse verkaufte ein bulgarischer Gemüsebauer beim Hochhaus Manderla und der Zigeunerbraten, ob von Roma oder Sinti verfertigt, das weiß ich wahrlich nicht, schmeckte mir am besten. Den echten türkischen Honig hatte ein naturalisierter Türke, der Soliman auf dem Markt vor den „Barmherzigen Brüdern“. Er trug immer einen Fes mit ellenlangen Fransen, an denen wir als Kinder zupfen durften, natürlich erst nach dem Kauf seiner Ware. So wuchs ich hinein in eine verwirrende Vielfalt von Sprachen, Gebräuchen, Meinungen und ungeschriebenen Regeln, wie sie nur eine Gesellschaft verschiedener Völker besitzen kann. Die kleinen Dinge des Lebens wurden um die Ecke beim „Juden“ gekauft. Dort war es zwar nicht moderner, aber billiger und persönlicher. Außerdem durfte man anschreiben lassen und die Kinder bekamen immer ein „Zuckerl“, ob die Eltern die Rechnung bezahlt hatten, oder ob nicht. In einem Hause wohnen, in einer Straße leben, das hieß schon immer, miteinander auskommen können und müssen. Niemand glaubte ernsthaft, dass Zigeuner blonde Kinder stehlen und einem Sultan im Orient verkaufen, obwohl davon unter vorgehaltener Hand und mit angstgroßen Augen geflüstert wurde. Niemand glaubte ernsthaft, dass Juden in der Judengasse um Mitternacht grausige Rituale an Christenmädchen vollzögen, obgleich von Erwachsenen darüber ebenso verstohlen und mit lüsternen Augen gezischelt wurde. Sektengräuel und die Erinnerung an die Türkenzeit hatten sich in einen verderblichen Alltagsaberglauben verwandelt. Zum Glück wandelte sich dieser Aberglauben nur selten in Untaten oder Abertaten um. Es sei denn, es war im Interesse der Landesherren oder -frauen, wie die Geschichte aller europäischer Völker, und wohl auch anderer, vielfältig beweist. Die Großväter waren Teil meines kindlichen Vorbewusstseins, Teil meiner Kindheit und ersten Erfahrungen. Der Vater meiner Mutter, ein mit schweren Verwundungen von der italienischen Isonzo-Front 1917 heimgekehrter Kriegsgegner und Führerverächter(vom Offizier aufwärts war alles suspekt), ein Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn, Maurerpolier und für die damalige Zeit ungewöhnlich gebildet, schaukelte mich oft auf seinen Knien und konnte es nicht erwarten, bis ich zur Schule käme. Als Invalidenrentner und Witwer bewahrte er sich bis zur letzten Stunde die persönliche Unabhängigkeit, wollte zu keiner seiner beiden Töchter ziehen und beobachtete mit scharfen Sinnen die Veränderungen bis zum Jahre 1938, seinem Todesjahr. Anstatt Märchen zu erzählen, erklärte er mir die Weltlage: Was dieser Anstreicher Hitler über die Welt bringen und wie das „Reich“ noch mit allen umspringen wird... Ich lauschte mit großen, verständnislosen Augen.
Meine Mutter wandte uns dann oft den Rücken zu, mein Vater schwieg, ob aus Achtung oder stillem Einverständnis, das war unklar. „Opapa“, meinte die Mutter, „erzähl ihm doch was Schönes, nicht diese garstigen Sachen.“ „Nix da“, knurrte er am Pfeifenstiel entlang, „er soll nur die Welt kennen lernen, wie sie ist.“ Die tiefen Narben im Gesicht des Mutter-Großvaters, Folgen eines Schrapnellgeschosses, bewirkten bei mir eine ängstliche Scheu. Auch der fehlende linke Arm beeinträchtigte die von ihm stets gesuchte Nähe zu mir, seinem vierten Enkel. Er brachte mir heimlich die Buchstaben bei und wahrscheinlich habe ich ihm die erste Lust und Liebe zum Buch und zum Fabulieren zu danken, denn die Eltern fanden erst viel später den Zugang zur eigentlichen Literatur, und da besonders meine Mutter. Sein Tod, ein Jahr vor Ausbruch des nächsten Weltkrieges und ein Jahr vor meinem ersten Schultag, riss, ungeachtet mancher Zurückhaltung, eine tiefe Lücke in mein kindliches Lebensbild. Lange stand ich vor seiner Bahre und betrachtete das narbige Gesicht, erwartete immer noch, dass die Muskeln zuckten. Mutter zog mich energisch dem Ausgang der Kapelle zu, dabei schluchzte sie verhalten in ihr Taschentuch. Meine Tante Grete hingegen weinte ungehemmt ihren Schmerz hinaus, schließlich war es ihr leiblicher Vater gewesen.
Lange danach erfuhr ich beiläufig, dass meine Mutter aus der ersten Ehe der Großmutter stammte und deshalb manchmal ein gespanntes Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihrer Stiefschwester Grete herrschte. Die Schwiegersöhne, dass heißt, mein Vater und Onkel Stefan, Pista gerufen, zeigten sich gebührlich ernst, wie mir schien, aber ohne besondere Bewegung. Ihnen gegenüber hatte der Großvater seine eigenen Ansichten behauptet. Er war und blieb bis zu seinem Tode ein „Radikaler vom Bau“. Die damaligen Gewerkschafter waren für ihn Hosenscheißer. Und damit traf er meinen Vater empfindlich, der längere Zeit für die Gewerkschaft tätig gewesen war, aber auch Onkel Pista, weil dessen liebster Saufkumpan ein im tschechischen Staatsteil geborener christlicher Gewerkschafter deutscher Nationalität mit ungarischer Schulbildung in einer Fabrik mit slowakischen Arbeitern war. Diese Mischung war bemerkenswert, fiel aber nicht ins Gewicht, weil dieser Kollege angeblich oft auch die Rechnungen der Heurigenausflüge beglich. Nach Meinung von Tante Grete war das gut so. Mutter sah das anders, denn öfter borgte die Tante Geld bei ihr, damit der Kaufmann bezahlt werden konnte. Für meine Eltern war das unverständlich, wo doch Onkel Pista ein „sehr gutes Einkommen“ hatte.
Die dem Menschen eigene Unzulänglichkeit verführt einfache Gemüter dazu, deren Umfeld auch vereinfacht zu filtern. Nationalitäten werden in Schubfächer eingeordnet, gewissermaßen nach deren angeblichen Besonderheiten. So wären Deutsche sauber, ordentlich und diszipliniert, Juden wären demzufolge reich, listig und geldgierig, die Ungarn ein wenig schlampig, unbeherrscht aber sangesfreudig, Tschechen wurden als hochmütig, kaltherzig und herrschsüchtig angesehen und Slowaken als ungehobelt, gutmütig und simpel. Daraus begann alltagsgeschichtlich eine sehr unheilige Dreifaltigkeit zu wuchern. Es war, ist und bleibt ein übles Gesellschaftsspiel, in welchem nach Lust und Bedarf mit „nationalen“ Eigenschaften jongliert wird. Auf dem Sumpfboden solcher Zuordnungen gedeihen alle bösartigen „Ismen“ und treiben ihre Verderben bringenden Blüten. Langsam aber sicher wird das Zusammenleben vergiftet und es kommt dann sogar zur Gewalt, wenn der Alltagsverstand auf der Strecke bleibt. Die Vernunft gerät besonders dann ins Hintertreffen, wenn die Obrigkeit mit Stimmungen und Meinungen Politik macht, die Tatsachen mit Sehnsüchten und Hoffnungen vermengt, wenn Rathaus und Kanzel ein unrühmliches Zweckbündnis eingehen, um ihre Macht zu halten oder um an die Macht zu gelangen. Dann fegen die manipulierten Gefühle alle rationalen Barrieren beiseite. Scheinbar hilflos und bestürzt werden von den „Großkopfeten“ im Nachhinein alle Ausschreitungen, sozialen Ausgrenzungen, Verfolgungen oder Pogrome bedauert und betrauert. Es muss dann wieder ein Volkszorn herhalten, um die eigene Gier nach Ruhm und Macht bemänteln zu können. Die einen sind betroffen, die meisten werden es. Rattenfänger von Hameln gab und gibt es nicht nur im Märchen, sie sind eine erbärmliche Tatsache. So entstanden aus Klavierlehrerinnen „Jüdinnen“, aus dem Hausmeister wurde „der Tscheche“, die Kovács´ verwandelten sich in „Slowaken“, mein Freund Tibor in „den Ungarn“, aus dem Gemüsehändler ergab sich „der Bulgar“ und der Honigmann Soliman war plötzlich „ein Asiate“. Selbst der unscheinbare Trödler, ein Chinese oder Japaner in der Donaugasse, bedrohte uns als „Gelbe Gefahr“. Besonders deutschbewusst zeigten sich immer aufdringlicher meine Lehrer an der Volksschule und später am Gymnasium. Nur gering erscheint mir der Abstand zwischen politischem Unsinn und politischem Wahnsinn. Da bleibt wenig Platz für Verständnis, Toleranz und Menschlichkeit.
An den Großvater väterlicherseits erinnere ich mich besonders seiner Patriarchenart wegen, aber auch, weil seine lange, nach unten geschwungene Porzellanpfeife so beißend nach kaltem Tabak roch. Der Pfeifenkopf war ein kleines Wunder slowakischer Porzellanbemalung. Kleine Pferdchen zogen einen Hochzeitswagen und hinter dem Fahrzeug sprangen Kinder in der slowakischen oder mährischen Volkstracht einher. Einmal versuchte ich, mir diese Malerei genau anzusehen. Großvater wehrte nur ab: „Dos verstehst eh´ net!“ Beleidigt gab ich es auf. Mit Kindern, Enkeln oder gar Urenkeln hatte er nicht viel im Sinn. Im gepolsterten Lehnstuhl sitzend, betrachtete er aus der Ecke am Fenster der kleinen Küche das häusliche Treiben. Jeden Tag trank er seine zwei Liter Heurigen. Beeindruckend war der riesige Schnauzbart, eine ständige Mahnung an den Weihnachtsmann und eine Warnung, mich still zu verhalten. Aber mein Drang, alle möglichen und verfänglichen Fragen zu stellen, war nicht zu bremsen. Immerhin verhalf ihm die Wortkargheit dazu, dass er vier Systeme mit zwei Weltkriegen überlebte. Er starb hochbetagt mit 98 Jahren und bei vollem Verstand. Meine beiden Großmütter dagegen kannte ich nur vom Hörensagen. Entgegen der allgemeinen Annahme vom Wesen einer Großmutter sollen beide sehr streng und unnachgiebig gewesen sein. Die Ursachen dafür suchten meine Eltern übereinstimmend in den Wirren der Zeit.
Die ersten Versuche, meine biologische Entstehung zu ergründen, wurden mit der Erzählung abgetan, dass ich schon bei der Taufe durch mein Geschrei den Pfarrer so erschreckt habe, und mir ein unüblich großer Schwapp des heiligen Wassers ins Gesicht geraten sein soll. Demnach, so schlussfolgerte ich nicht unlogisch, war das Taufbecken mein Ursprung. Und vielleicht auch eine gewisse Wasserscheu, wie meine Mutter es ausdrückte, wenn ich mich morgendlichen oder abendlichen Waschungen zu entziehen versuchte. Die Dreifaltigkeitskirche am Postplatz habe ich jedenfalls bewusst oder unbewusst seitdem nach Möglichkeit gemieden. Später war ich sogar bemüht, mich vor dem Religionsunterricht zu drücken, wann immer es ging. Die Tante Mini meinte in sehr gebrochenem Deutsch, denn sie war eine eingewanderte Ungarin, das wäre ein „Haide“, der da heranwachse. Meinem Vater waren solche Bemerkungen gleichgültig, aber Mutter waren diese Feststellungen recht unangenehm.
So ließen mich meine Eltern mit den Fragen nach meiner Herkunft, Entstehung und dem biologischen Ursprung geschickt im Dunkeln. Ein besonderes Erlebnis waren für mich die Montage. Des öfteren bummelte meine Mutter, mich an ihrer festen Hand, an solchen Tagen über den Gemüsemarkt, gleich neben dem Hospital der „Barmherzigen Brüder“. Das Stimmengeräusch und die kreischenden Straßenbahnen, das Handeln und Feilschen, das Gewimmel von Erwachsenen, die in verschiedenen Sprachen ihren Wünschen mehr oder weniger starken Nachdruck verliehen, das war eine Kulisse, die mich anzog und gleichzeitig verunsicherte. Wenn bei anderen Kindern der Melonensaft von den Lippen tropfte, dann tropfte mir nur der Zahn, denn vom Genuss der „bösen“ Wassermelonen bekäme man Typhus oder die Cholera, so meinte Mutter. Als Zugabe erhielt ich einen mütterlich liebevollen und strafenden Blick. Auch der türkische Honig sei schädlich, er „gehe auf die Zähne“. Dabei verzog sich ihr Gesicht ziemlich wehleidig. Ich erschauerte voll düsterer Vorahnungen. Nur selten gelang es mir, sie zu einer Portion Zigeunerfleisch zu bewegen, „denn man weiß nie, was die mit dem Fleisch gemacht haben“. Dann über die Straße und hinein in die Markthalle. Ein Paradies der Fliegen nahm uns auf. Mit zusammengekniffenem Mund untersuchte meine Mutter fachfraulich die Hinterteile der wie in einem Massengrab ausgerichteten toten Hühner-, Enten- oder Gänsevögel. Bei dieser Gelegenheit lockerte sich manchmal der mütterliche Haltegriff, und ich machte mich selbstständig. Einmal verirrte ich mich und stand mutter- und seelen- allein vor dem Hochhaus Manderla, außerhalb der Markthalle. Das gefiel mir zunächst sehr, aber dann wurde es langweilig.
Ich begann, die Passanten näher zu betrachten und fragte mit weinerlicher Stimme, wo meine Mutter bliebe... Bald hatte sich eine kleine Menschentraube gebildet, welche in verschiedenen Sprachen, aber lautstark und mitfühlend das Verhalten dieser Rabenmutter analysierte, die es fertig brachte, mich allein zu lassen. Alle wollten erfahren, wie alt ich sei, wo ich wohne, und die zu mir herabgesenkten Gesichter der Erwachsenen umgaben meinen Blickwinkel wie eine Mauer. Ich fühlte mich wohl sehr bedrängt, also verstärkte ich die Tonlage und ging zum Gebrüll über. Auch ein herbeigerufener Marktpolizist konnte an meiner tiefen Verstimmung nichts ändern. Erst als sich das verstörte Gesicht meiner „leichtsinnigen Rabenmutter“ in den Kranz der mich umgebenden Gesichter drängte, beendete ich mein Solo und das Publikum verlief sich. Nicht, ohne mehr oder weniger brauchbare Ratschläge zu hinterlassen, wie man in diesen unruhigen Zeiten Kinder zu erziehen habe. Ob sie, die Ratschläge, auf fruchtbaren Boden gefallen sind, das wage ich nicht zu beurteilen, weil ich ahnte, dass meine Mutter da so ihren eigenen Kopf hatte. Zunächst spürte ich nur ihre Hand und landete fest verbandelt im Sportwagen. Die später eingeführten sonntäglichen Ausflüge, wie es hieß, wegen meiner angegriffenen Gesundheit, verloren bald den Reiz des Besonderen. Mit Rucksack, Schirm und Wanderkleidung gerüstet, strebte unsere Angestelltenfamilie (ich auf dem Dreirad) ins Grüne, in die Engerau, zum Eisenbrünnel oder auf den Gemsenberg. Als Erinnerung an diese Ausflüge blieben der einfache, aber köstliche Kartoffelsalat im Gedächtnis, die für mich weniger köstlichen Fleischklopse, das Faschierte also, ein gewaltiger Wolkenbruch an der March/Morava in der Nähe von Theben/Devin, ein paar Fotos und immer wieder Ameisen, in der Hose, auf der Decke, im Salat. Wie sich meine Eltern beim Picknicken verhielten, das blieb mir unverständlich. Sie sprachen wenig, aßen genussvoll und achteten ununterbrochen darauf, dass ich auch aß, nicht herumtollte und vor allem in Blickweite blieb. Wogegen ich sehr ungern aß und ungelenkt die Gegend erkunden wollte. In diesem Wettstreit der Absichten blieben meine inneren und äußeren Widerstände jedes Mal auf der Strecke. Auf dem Dreirad erstrampelte ich mir manchmal einen scheinbaren Abstand, aber der Hauch von Freiheit wurde durch die Ermahnungen meiner Mutter schnell gedämpft. „Fahr nicht so schnell, atme durch die Nase, pass auf den Weg auf, bleib stehen.“ Nur wenn mein Cousin Robert mit uns „ausflog“, dann waren die mütterlichen Zügel gelockert. Dafür musste ich den älteren Robert recht häufig auf mein geliebtes Dreirad lassen, oder er knuffte mich nach Jungenart kräftig in die Oberarme, natürlich nur dann, wenn meine Eltern nicht zu mir schauten. Ich konnte die Lage betrachten wie ich wollte, sie blieb eine Einschränkung. Ich bockte und maulte zwar, aber ich war immer die Minderheit. Die Jahre bis zur Einschulung 1939 war meine Zeit der häufigen Kränkeleien. Einmal Husten, dann Mittelohrentzündung oder Angina, Lungenentzündungen, die Anfänge einer Tuberkulose – und die Verwandtschaft zweifelte schon daran, ob ich überhaupt kräftig genug wäre, die ungeheure Belastung der Schule zu ertragen. Das spornte meine Mutter zu noch größerer Aufmerksamkeit und Fürsorge an: essen, wandern, Mittagsschlaf, Lebertran und Eisenwein, Obst- und Gemüseverzehr bestimmten den Tagesablauf. Ich muss jedoch eingestehen, gerade dieses harte Training könnte bewirkt haben, dass die späteren Hungerjahre nach dem Krieg keine bleibenden Auswirkungen auf mich hatten.
Mein einziger Spielgefährte wurde Katiza, ein rundum gelber Kanarienvogel, der sich schnell an mich gewöhnt hatte. Mit ihm besprach ich alle Dinge, die mich bewegten und seine Antworten, kunstvoll gerollt oder einfach gepiept, stellten mich immer zufrieden.
Er oder sie war immer einverstanden. Schon im Hausflur empfing mich oft ein Trällerkonzert, wenn ich die vier Treppen zu unserer Wohnung hoch stürmte. Gleichaltrige kannte ich wenig. „Straßenkinderkameraden“ lehnte meine Mutter (meist weniger berechtigt) ab. So blieben wohl oder übel ein Kanarienvogel, Erwachsene und Bücher meine geistigen „Sparringspartner“. Bekamen wir Besuch, versuchte ich mit glänzenden Augen in die Geheimnisse der Erwachsenengespräche einzudringen und war dabei ziemlich vorlaut. Verstand ich etwas nicht so richtig, unterbrach ich einfach die Gespräche und fragte danach.
Viele Male wurde ich zurechtgewiesen, bis meinem Vater einmal die Geduld ausging und er mir vor allen Leuten eine, nach seiner Meinung, sehr leichte Backpfeife verabreichte. Nicht mein einsetzendes Gebrüll verschreckte den Besuch, sondern die erbosten Worte meiner Mutter über einen „Rabenvater“. Ungeniert unterbreitete sie öffentlich, welche gegensätzlichen Erziehungsmethoden in unserer Familie gepflegt würden. Leider profitierte ich davon wenig. Mein Vater mengte sich eigentlich kaum in die Erziehung ein und nur in sehr wenigen, wohl begründeten Ausnahmen, bekam ich seine Hand zu spüren. Mutter hingegen war schneller „bei der Hand“, wie man so sagt. Bevor ich in die Schule kam, konnte ich lesen. Stockend zwar und mit Pausen, aber beharrlich kämpfte ich mich durch lange Straßennamen, Firmenschilder, Aufschriften, Überschriften und vor allem durch die deutschen Heldensagen, meiner Lieblingslektüre in der Folgezeit. Oft bat ich meine Mutter, mir daraus vorzulesen, schaute ihr dabei über die Schulter und verfolgte gespannt, welcher Buchstabe zu welchem Laut gehörte, wie ein Wort zusammengezaubert wurde.
Besonders dieser Dietrich von Bern faszinierte meine Phantasie und beflügelte mich zu geistigen Wundertaten. Den Verräter Hagen von Tronje dagegen verabscheute ich zutiefst. Hätte er Siegfried von vorne ermordet, dann hätte ich es wahrscheinlich als unvermeidlich hingenommen, aber hinterrücks und dazu noch bei einer Quelle, an welcher Siegfried sich durstig niederkniete, das war zuviel für meine kindhafte Vorstellung von Wahrheit und Tapferkeit. Die mehr oder weniger erzieherischen Volks- und Hausmärchen bewegten mich dagegen nicht besonders. Drachen, Hexen, Zauberer fanden keinen tieferen Zugang in die Welt meiner Vorstellungen und Träume, zum Bedauern meiner Mutter, denn sie liebte Märchen sehr.
Nur wenn sie alte Sagen aus meiner Geburtsstadt wiedergab, lauschte ich ihr aufmerksam, denn sie konnte hervorragend und sehr gefühlvoll vortragen. Mit geheimnisvoll gesenkter Stimme erzählte sie mir die Sage von der Donaunixe, die Fischer aus der Weidritz, einem Stadtteil von Bratislava, ins Wasser zog. Erschauernd stellte ich mir vor, wie die armen Fischer danach unter Wasser keine Luft bekommen konnten und jämmerlich absaufen mussten.
Unsere Familie zog recht häufig um, entweder war die Miete zu hoch oder es war eine neue Dienstwohnung, die mein Vater als Angestellter der tschechoslowakischen Staatsbahn zugewiesen bekam. Der erste bewusste Umzug erfolgte für mich aus der Eisenbahnergasse in die Größlinggasse, nahe der Eisenbahndirektion. Mitte der 30er Jahre wurde Vater Angestellter in dieser Direktion und das erleichterte unser Leben außerordentlich. Zum ersten Mal in ihrer Ehe musste meine Mutter nicht jeden Heller zweimal umdrehen, brauchte nicht mehr für alle möglichen Damen Kleider und Faschingskostüme zu nähen und mein Vater saß nicht mehr bis in die Nacht hinein, um Bücher für einen Rechtsanwalt zu führen oder Werbedias für mehrere Kinos zu zeichnen. Er fuhr nun auch mit einem neuen Fahrrad zum Dienst, kehrte mittags für eine Stunde zum Essen nach Hause und schloss regelmäßig jeden Tag um sechs Uhr abends den Keller auf, um das Fahrrad sorgfältig unterzustellen.
Bevor ich 1939 in eine deutsche Volksschule gehen konnte, musste eine solche zunächst vorhanden sein. Bis dahin gab es in slowakischen Schulen nur deutsche oder ungarische Parallelklassen, was immer wieder zu beträchtlichen Verwirrungen führte. Die Lehrer in deutschen Klassen waren oft Ungarn, die ein sehr austrisches Deutsch lehrten oder Slowaken, die zwar ausgezeichnet Umgangsdeutsch beherrschten, aber von Grammatik, Rechtsschrift und originaler deutscher Literatur unbeleckt geblieben waren.
Nach einer Verfügung der neuen slowakischen Regierung wurde den deutschen Einwohnern die Möglichkeit gegeben, alte Schulgebäude aus der K.- und k.- (der Kaiserlich und königlichen) Österreich-Ungarn-Monarchie mit eigenen Kräften und Mitteln her- oder vorzurichten und auf diese Weise deutsche Schulen zu schaffen. Besonders, weil auch deutsche Lehrkräfte aus dem „großen Reich“ erwartet werden durften. So wurde die alte, neue Rosenthaler Schule meine erste Grundschulbildungsstätte und die Eltern zeigten mir am ersten Schultag, an welchen Stellen sie selbst Hand angelegt hatten, damit der Unterricht beginnen konnte. In der alten Aula der Schule, in welcher kaum die Hälfte der Anwesenden einen Sitzplatz bekam, hielt denn auch die Eröffnungsrede ein Vertreter der deutschen Volksgruppe, aber danach, erst slowakisch und dann deutsch sprechend trat sofort ein Pater in Erscheinung, dessen langatmige Rede in tiefem Dank für diese göttliche Großzügigkeit und auch gegenüber der slowakischen Regierung gipfelte. Endlich wurde der neue Direktor vorgestellt. Er war aus dem „Reich“ gekommen, zunächst für ein Jahr. Meine künftige Klassenlehrerin, Fräulein Herbst, imponierte mir mehr, schon deshalb, weil sie als Pensionärin wieder in den Schuldienst trat, als Aushilfe gewissermaßen. Sehr bald spürten wir, dass sie ein unnachgiebiges Regime in der Klasse einführte, und wir aufs Wort zu gehorchen hatten. Ich stand immer in der ersten Reihe, weil ich sonst übersehen würde, so meinte mein Fräulein Herbst mit verkniffenem Mund und zog mich am Ohr. Da ich einen selbstverschuldeten Bildungsvorschub besaß, interessierte mich der Schulbetrieb nicht sonderlich und ich nützte meine Überlegenheit weidlich aus. Kopfnüsse, Rempeleien und Boxhiebe waren der Lohn meiner Mitschüler für diese Aufschneiderei, wie sie es nannten. Hinzu kam, dass meine Mutter, in ständiger Sorge über meinen Gesundheitszustand auf meine „ schwächliche Konstitution“ hinwies und Fräulein Herbst bat, ein besonderes Auge auf mich zu haben. Das hatte sie denn auch, und so wurde ich absichtlich oder unabsichtlich zum Muttersöhnchen abgestempelt. Das wollten meine Schulkameraden mit Nachdruck ändern. Besonders auf dem Heimweg von der Schule begannen dann im allgemeinen die ersten „Umerziehungsversuche“ und so lernte ich das Rennen und das Sprinten am schnellsten und am besten. Die Male aus den deutschnationalen und später auch internationalen Überzeugungsbemühungen trug ich mit wenig Stolz und viel Kummer. Dem Zwang gehorchend, kannte ich sehr bald alle möglichen Schleichwege zwischen Nationaltheater und Filialbahnhof. In der zweiten Klasse besserte sich für mich die Lage und ich wurde allmählich in die Vorbereitung schulischer Streiche einbezogen. Auch zum Auskundschaften erschien ich nun geeignet, weil ich ziemlich fließend slowakisch und recht gut ungarisch sprach. Es lag einfach an der Verwandtschaft und am Haus, in dem wir wohnten. Das verriet ich jedoch nicht und behielt deshalb lange Zeit den Ruf eines Sprachkünstlers. Von den politischen Umwälzungen verspürte ich wenig, nur, dass eines Tages neben dem Präsidenten Tiso auch ein Hitlerbild hing, dass nicht mehr Jesus Christus am frühen Morgen gelobt, dafür um so häufiger ein „Hitler geheilt“ wurde. Der Direktor erschien jetzt auch in schwarzer Uniform, mit silbernen Totenköpfen und knarrenden Langstiefeln. Mit durchdringender Stimme eröffnete er uns in der zweiten Klasse, dass in nächster Zeit bedeutsame Veränderungen an der Schule erfolgen werden. Dafür würde er sorgen. Schließlich herrscht draußen Krieg, jawoll,*) und uns allen ginge es dank einem Führer im großen deutschen Reich unverdientermaßen sehr gut: Keine Lebensmittelkarten, keine Rationierungen und so fort. Ich war verstört und erschrocken. Oh, Reich! Wie war ich doch zum Glück noch unerreichbar für dich...
*) Einige Schulappellanten kicherten respektlos, denn wir kannten dieses neue Wort „jawoll“ nicht. Bei uns hieß es ganz zivil JA oder NEIN. Außerdem ähnelte dieses neue Wort einem slowakischen Ausruf, der nichts anderes bedeutete als: „Ich Ochse!“
Kriegereien 1
Für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit wird mehr von der Dichtung als von der Geschichte geleistet.
Schopenhauer
Den Ausbruch des Krieges, der später der Zweite Weltkrieg genannt werden sollte, bemerkte ich durch drei Ereignisse: Einen besonderen und besonders langweiligen Schulappell, die rotgeweinten Augen meiner Mutter und ein neues „Blaupunkt“-Rundfunkgerät. Fast ein oder zwei Jahre hatten wir nur von „Grenzboten“-Informationen gezehrt, weil die tschechisch-slowakische Regierung 1937/38 alle Rundfunkgeräte beschlagnahmt hatte. Nur diese deutschsprachige Zeitung war erlaubt. Mutter legte Vorräte an und sortierte alle Familiendokumente.
„Für alle Fälle“, sagte sie leise. Vater war jetzt in der Eisenbahndirektion, war höherer Beamter und die Tätigkeit in der Signalwerkstatt als Lagerverwalter gehörte der Vergangenheit an. Und ein Klavier kam ins Haus! Mit viel größerer Zurückhaltung als vorher wurde jetzt erwähnt, dass mein Vater Anfang der dreißiger Jahre für vier Jahre in Prag gewesen sei, als Vertreter der christlich-sozialdemokratischen Eisenbahnergewerkschaft, oder fließend tschechisch sprechen und schreiben konnte und überhaupt, obgleich Mutter darauf immer stolz gewesen war, trotz der Trennungszeit und der damals schwierigen Wohn- und Lebensverhältnisse. Nach Erzählungen meiner Mutter wohnten die Eltern zunächst, noch ohne mich, in einem ausgebauten alten Wasserturm nahe der slowakischen Hauptstadt, in Cseklész, direkt an der ungarischen Grenze, abseits, aber billiger. Sehr einsam war es wohl und meine Mutter hatte ständig Angst, so abgeschieden von der Stadt zu leben. Diese Angst war gut zu verstehen, denn es waren unruhige Zeiten. Die Spannungen zwischen den Nationalitäten und Staaten über den Grenzverlauf oder über das Bildungs- und Sprachrecht schufen eine dauernde Atmosphäre der Bedrückung und Unsicherheit bei den Menschen in jener Region.
Ein Ereignis mag als Beispiel dienen: Im September ’39, kurz nach meiner Einschulung, fuhren meine Eltern und ich mit einem der neuen Oberleitungsbusse zum Hotel „Carlton“ in der Nähe des Nationaltheaters. Eine unüberschaubare Menschenmenge sog uns auf. In meiner kindlich-kleinen Optik schien es, als ob ich auf dem Boden eines Schachtes wäre, dessen Begrenzung von ungeheuer großen und fremden Erwachsenenleibern gebildet wurde. Vater hob mich auf seine Schultern und ich bemerkte, dass auf dem Balkon des Theaters allerlei Vertreter von Volksgruppen und des nunmehr „freien“ slowakischen Staates standen. Flaggen wedelten, Lautsprecher krächzten, und ich erblickte Uniformgruppen, die, teils bewaffnet, das Theater säumten. Blaue, braune, schwarze, khaki-farbene Mützen, mit und ohne Schirm, wogten hin und her. Über der Menge lauerte eine bedrohliche Stimmung. Da und dort ertönten unvermittelt Gesänge oder Sprechchöre, das „Hej, slovácy!“ (Auf, Slowaken!) oder „Tiso, Tuka naša ruka!“ (Tiso und Tuka, das ist unsere Hand, also unser Willen), „Piros, fehér, zöld- az van a Magyar föld!“ (das Rot – Weiß – Grün, also die ungarischen Nationalfarben, das ist ungarische Erde) und die „Heim-ins-Reich“-Parole der Deutschen.
Ich konnte nichts verstehen und begreifen, schließlich, nach dem Auftritt eines Herrn mit markiger Stimme, brachen die Massen in Gebrüll aus und die Menge begann sich wie unwillig in Seitengassen und -plätze zu zerstreuen. Meine Eltern schwiegen, grüßten da und dort und Mutter hielt meine Hand krampfhaft fest. Wir gingen in Richtung der Donau, als ein mir unbekannter, sogar blonder Slowake in der dunkelblauen Uniform der Hlinkagarde meinen Vater aufhielt. Mutter zog mich weiter.
„So a Schlawiner, jetzt isser oben!“, zischelte sie verächtlich. Vater holte uns am Donaukai ein und sprach zunächst kein Wort. Der nun folgende Dialog blieb mir fotografisch im Gedächtnis: „Und, was war denn?“, fragte die Mutter.
Vater leise: „Szilagyi ist weg.“
„Na so was. Wieso?“
„Juden dürfen nicht mehr in der Direktion sein.“ Dabei beschleunigte Vater seine Schritte.
„Renn doch nicht! Der Bub kann nicht so schnell gehen!“, erwiderte die Mutter, „aber er war doch so ein feiner Mensch und so gebildet.“ Ich stolperte zwischen ihnen nach Hause.
Die Gedanken tasten sich in die Vergangenheit. Sie werden wieder lebendig für den Schreiber oder den Erzähler, aber ihre Ordnung wird verändert. Eine brave Chronologie der Vorgänge wird durch Gefühle, durch den persönlichen Rückblick gebrochen. Schließlich kapituliert die wehrlose Vergangenheit vor der unduldsamen Gegenwart und beruft sich dabei auf die zeitliche Entfernung, wenn sie Klarheit und Schärfe vermissen lässt. Trotzdem kann man mit Erinnerungen nicht hadern oder schachern. Sie können nicht bilanziert werden wie ein Warenbestand, hie gut, da böse, hie Recht, da Schuld. Dennoch lauert im Labyrinth der Erinnerung ein persönlicher Minotaurus.
Ich klimperte auf dem Flügel umher, probierte die Pedale aus und solche Disharmonien beschleunigten Mutters Suche nach einem Klavierlehrer. Zu bemerken wäre vielleicht, dass ich die erste Klasse zur Zufriedenheit aller Unbeteiligten, unbeschadet an Körper und Geist bewältigt hatte. Meine Ansprüche an die Schule waren gering geblieben.
Eines Sonntags eröffnete mir Mutter beim Mittagessen: „Morgen um drei kommt deine Klavierlehrerin. Das ist eine pensionierte Professorin, also blamier uns nicht.“ Bald haspelte ich die kleinen Etüden mühelos mit mehr oder geringerer Akustik herunter und das ausgerechnet immer am Sonntag, weil am Montag wieder Klavierstunde angesagt war. Das genügte zunächst, aber meine Professorin merkte das sehr bald und überhäufte mich mit Aufgaben. Also war ich gezwungen, wenigstens alle zwei Tage zu üben, was mir ganz und gar nicht behagte.
Im gleichen Maße, wie meine Begeisterung verflog, nahm die meiner Mutter zu. Sie fühlte sich angeregt, ihre verschütteten Kenntnisse auszugraben und wir spielten vierhändig, allerdings oft mit verschiedenen Tempi. War ich zu schnell, war sie zu langsam, tönte ich forte, tönte sie piano. Auch beim Gebrauchen des Pedals gab es selten eine Gemeinsamkeit, denn ich liebte den Nachhall. Es kam, wie es kommen musste. Verstehen sich die Schüler untereinander schlecht, dann ist eben der Lehrer schuld. Die Professorin beschwerte sich über meine hinterhältige Art, ihren Anweisungen justament zuwider zu handeln. Da ich in Mutters Augen ein verkanntes Genie war, hatte die unpädagogische Musikpädagogin keine Chance und meine Mutter suchte sofort einen neuen Klavierlehrer. Man darf annehmen, dass unsere Nachbarn die Ruhepause genossen haben, denn Frau Kovàcs lächelte mir wieder freundlich zu, wenn ich die Treppe hinabpolterte und auch der Hausmeister grinste breit, weil er nicht mehr aus seinem Nachmittagsschlaf aufgestört wurde. Da kam meiner Mutter der Zufall zu Hilfe. Sie erfuhr beiläufig, dass ein paar Häuser weiter die beiden älteren Damen Silberstein wohnten und die geben auch Unterricht im Klavierspiel, erkundete sie. Ich ahnte, dass meine Zeit des süßen Nichtspielens vorbei war. Ohne Vorwarnung ging meine Mutter mit mir zu den beiden Damen. Nach mehrmaligem Klingeln öffnete sich zögernd die mit Schnitzereien versehene Eingangstür und als Folge einiger leiser Erklärungen meiner Mutter durfte ich an den Flügel.
„Zeig uns, was du schon kannst!“, meinten beide Damen freundlich und es zeigte sich, was ich nicht konnte, nämlich mit Gefühl spielen. Dann knabberten wir Gebäck, tranken schwarzen Tee und sahen Fotos der beiden Damen an, die in jüngeren Jahren als Künstlerinnen aufgetreten waren. Budapest, Brünn, Prag und Wien waren Stationen ihrer Laufbahn gewesen. Meine Mutter war entzückt und sie wechselte begeistert ins Ungarische, das ich nicht so gut verstand. Es war beschlossene Sache: montags und freitags je eine Stunde Unterricht bei den Damen in der Wohnung. Immer wurde ich liebenswürdig begrüßt, bekam eine Tasse Kakao oder Tee und stopfte mich voll mit „Pogatschen“, einem würzigen Fettgebäck, welches die Damen immer vorrätig hatten.
So ging es bis zum Jahre 1942. Immerhin zwei Jahre belästigte ich unsere Hausbewohner ausgiebig mit Läufen, Harmonien und Dissonanzen auf dem Klavier. Jedem Besuch wurden Etüden oder Volkslieder angeboten, die mit mehr Höflichkeit als Interesse verdaut wurden. Es war eine schöne Zeit, besonders für meine Mutter. Ehrgeizig und stolz sah sie in mir schon einen künftigen Virtuosen. Mein Vater betrachtete die Sache mit verständnisvollem Lächeln. Er war wenig für Musik dieser Art zu begeistern, dafür zeichnete und malte er sehr gut. Bald entdeckten meine Eltern, dass die väterliche Fertigkeit auch bei mir durchkam, und Mutter meinte, wenn es keine Musikakademie würde, dann eben eine Malerakademie. Meine Zeichenkünste waren stark vom Zeitgeist geprägt. Auf den Bildern beschossen sich Spitfires mit Focke Wulffs oder Ratas mit Messerschmidts, dazwischen Panzer, U-Boote, Drachen und gehörnte Siegfriede, Hunnenreiter oder Dietrich von Bern. Auch der Zwergenkönig Laurin oder Alberich mit seiner Tarnkappe hatte es mir jetzt angetan. Diese Tarnkappe regte mich zu den verwegensten Phantasien an, zum Beispiel Mädchen zu erschrecken, dem Direktor ein Bein zu stellen, Essen verschwinden zu lassen oder so. Meine Kunstwelt beim Zeichnen war recht einfach. Sie teilte sich in Kreuze und Sterne, das heißt deutsche Hakenkreuze, slowakische Hlinkakreuze, ungarische Pfeilkreuze oder in Sowjetsterne und Davidsterne, manchmal auch Kokarden.
Das hing vor allem mit den Symbolen zusammen, die entweder als Kennzeichnung für die Flugzeuge bekannt waren oder in den Zeitschriften auftauchten. Diese Bündnisse oder Feindschaften auf dem Papier spielten im Schulalltag keine bedeutende Rolle. Deutsche, slowakische oder ungarische Schüler setzten sich auf dem Heimweg von der Schule ohne jede Bündnistreue schamlos und handfest auseinander. Man zeigte deutlich und spürbar, was man als Bundesgenosse voneinander hielt. Das meinte jedenfalls unser Schuldirektor in den Einzelgesprächen, die unweigerlich auf solche Prügeleien folgten.
Nach meinen Beobachtungen waren wir, wie dort üblich, von katholischer Konfession, obgleich wir keine besonderen Kirchgänge pflegten. Am Sonntagmorgen folgten wir unserem Glauben öffentlich, indem wir in die nahegelegene Blaue Kirche der Heiligen Theresia spazierten oder gar die Taufkirche meiner Mutter und auch die meine, die Dreifaltigkeitskirche, aufsuchten, nicht ohne meinen schüchternen Widerstand. Mein Vater ging mehr aus Anstand mit, denn er bezeichnete sich selbst als gottgläubig, sprich ungläubig. Interessanter für uns, meinte er, wären seine nebenberuflichen Sonntagsarbeiten, er zeichnete immer noch, jetzt allerdings mehr aus Freude, mit Tusche und wasserfesten Farben Werbedias für ein Kino und wir konnten dafür auch mal einen Film umsonst ansehen. Einmal gelang es mir sogar, mich zu einem damals nicht jugendfreien Film, den Film vom Lügenbaron Münchhausen hineinzuschmuggeln, dank einer jungen slowakischen Platzanweiserin, der ich wohl sympathisch war, weil ich mit ihr slowakisch sprach.
Leider war es bei diesem Glücksfall geblieben. Gerade deshalb beschäftigten mich die Szenen im Harem außerordentlich und noch lange danach. Im lebhaften Gedankenaustausch mit neiderfüllten Klassenkameraden suchten wir dabei auch der weiblichen Anatomie auf die Spur zu kommen. Aber keines der „weiblichen Subjekte“ in der Klasse war bereit, uns, mich eingeschlossen, diesbezüglich mit einschlägigen Informationen zu beliefern oder als Studienobjekt zu dienen, obgleich ich, dank Rominka in Sered an der Waag später doch einen gewissen Vorlauf erhalten hatte.
Mit zehn Jahren wurde ich bei der sporadisch absolvierten Flüsterbeichte bereits nachdrücklich ermahnt, keinen sündigen Gedanken nachzuhängen oder gar solche sündhafte Taten zu begehen, wie Blicke auf entblößte Beine von Mitschülerinnen zu werfen, Ärztebücher zu betrachten oder, wie zu Ohren gekommen, Mädchen während der Verdunkelung zu erschrecken, mit Taschenlampen zu blenden, an die Brust oder unter die Röcke zu fassen, Liebespärchen in Hauseingängen zu belauschen oder, die Beichtvaterstimme wurde ätzend scharf, sich am Ende „DORT“ selber anzufassen.
Das meiste begriff ich nicht so ganz aus dem Sündenregister, aber ich nickte oder verneinte ergeben, je nach erwartetem Bedarf. Dafür gab es schon im Voraus ein paar Vaterunser zu beten, sozusagen auf Vorrat. Auch hier herrschte der Grundsatz: „Trau, schau, wem“. Kommunion und Firmung waren Höhepunkte, die vor allem die Verwandtschaft genoss, aber bis auf die Schweizer Uhr, die ich geschenkt bekam, bei mir nichts Sonderliches hinterließen. Damals ahnte ich nicht, dass sie drei Jahre später die Hand eines tschechischen Partisanenveteranen zieren würde, eingetauscht für eine große Salami. Immerhin. Und doch: Die Firmung hinterließ einen Eindruck, aber einen besonderer Art. Es waren die Sieberts aus Sered, einer kleinen Stadt an der Waag, die für den Firmungseindruck verantwortlich waren. Die erwachsenen Kinder dieser Familie Siebert, der flotte Herr Leopold, der sein Studium in Wien als Untermieter bei uns vorbereitete und dessen ebenso lebenslustige Schwester Gerti, die ihm als Nachmieterin oder Nachuntermieterin in unsere Wohnung folgte, waren für mich ein Hauch der großen weiten Welt im tristen Schüleralltag. Der blonde und oft weinselige Poldi, wie er sich selbst nannte, berührte mich in keiner Weise, höchstens akustisch durch sein Schnarchen, das durch das Mauerwerk in mein kleines Zimmer drang. Aber Gerti, deren Parfüm durch die ganze Wohnung schwebte, die ungerührt vor mir ihre Seidenstrümpfe hoch- und abrollte, deren weiblich erregender Duft mich verlegen machte, wenn sie über meine Schulter sah und die Hausaufgaben prüfte, das war schon etwas anderes.
Ich erinnere mich lebhaft an Mutters missbilligende Blicke, wenn Gerti im für damals recht offenherzigen und taillen-betonten Kleidchen abends noch einmal „spazieren ging“, wie sie sagte und mir dabei neckisch lächelnd anbot, sie zu begleiten, was natürlich nicht in Frage kam, das wussten alle. Trotz Verdunkelung oder vielleicht gerade deshalb herrschte in Pressburg/Bratislava immer noch ein lebhaftes Kaffeehausleben. Und Gerti trank gerne Kaffee. Manchmal durfte ich sie doch begleiten, wenn sie sonntags am Ufer der Donau eine Bank suchte, um sich für die nächste Woche zu „präparieren“, wie sie es nannte.
Heute hege ich den Verdacht, dass ich mehr als Schutzschild dienen musste, um sie vor aufdringlichen Landsergesprächen zu bewahren, denn das Donauufer war die Flaniermeile von Soldaten, Soldatenbräuten und solchen, die es noch werden wollten. Auf dem Rückweg sollte ich sie unterhaken oder an der Hand halten, quasi geschwisterlich. Wie ihr Bruder, so studierte sie später an der Wiener Universität und wir verloren uns aus den Augen. Als Dank für die Unterbringung ihrer Kinder boten die Sieberts an, mich für vier Wochen auf ihr Gut nach Sered zu holen, damit die „Landluft mich stärke“. Das Angebot wurde erfreut angenommen und ich erfuhr so, dass die Milch nicht im Geschäft wächst, dass es Maulbeerbäume gibt, dass Dackel eine kinderfreundliche Hunderasse sind und dass man in der Waag auch schwimmen lernen kann, trotz aller Untiefen und reißender Wirbel. Endlich durfte ich auch mit Gleichaltrigen herumtoben, wenn auch unter den recht kritischen Blicken von Herrn Siebert, meinem Wohltäter und Treuhandgutsverwalter.
Trotzdem war einiges den Aufsichtsaugen meines Gastgebers entgangen. Rominka, ein etwas älteres Mädchen auf dem Gut, klärte mich mit sehr einfachen Worten und noch einfacheren Handlungen darüber auf, wie und wodurch sich Mädchen und Jungen unterscheiden. „Beim Probieren kann nix passieren“, meinte sie. Mutter wäre entsetzt gewesen, hätte sie das je erfahren. Zur Verzweiflung meiner Mutter veranstaltete ich jedoch nach diesem Sommeraufenthalt in unserer Stadtwohnung, noch dazu auf dem Küchentisch – ein Maden-Wettrennen, wie geübt und für bemerkenswert befunden, als ich an der Waag mit gleichaltrigen slowakischen und ungarischen Jungen Wetten darüber abschloss, welche Made die schnellste sein wird.
Ich puhlte aus vermadeten grünen Erbsen deren weißliche Proteinbewohner sorgfältig heraus und sortierte sie auf dem Tisch. Dort hatte ich mit Mutters Schneiderkreide drei Laufbahnen gezogen, in welche ich diverse Knöpfe, Papierknäuelchen oder abgebrannte Streichhölzer als Hindernisse aufgebaut hatte. Ich suchte aus der Madenschaft drei flinkere heraus und balancierte sie behutsam auf einem Stück Papier in ihre Startlöcher. Den Rest der krabbelnden Madentierchen sperrte ich in eine leere Streichholzschachtel. Und los ging’s: Made gegen Made.
Damit sie ihre Richtung beibehielten, stupste ich sie mal links, mal rechts behutsam an. Die „Mädchen“ krümmten und streckten sich ihrem „Ziel“ entgegen. Das Ziel war das Ende der Tischplatte, an der sie allerdings hinunterfielen. C´ est la vie. Mutter freute sich über die Ruhe und die Aufmerksamkeit, die ich ihrer Meinung nach irgendwelchen Zeichenspielen schenkte. Als sie näher kam, schrie sie angeekelt auf. Maden waren ihr in jeder Form verhasst. Die roten Pflaumenmaden ebenso wie die kleinen Erbsenmaden mit den schwarzen Köpfen. Sie stürmte aus der Küche und kehrte mit Besen, Schaufel, Wischeimer und Wischtuch zurück. Dann fegte sie meine Renn-Maden rücksichtslos zusammen und äußerte dabei in wenig feiner Weise ihren Widerwillen, Abscheu und was dergleichen Gefühle sie beherrschten. Ich wurde ins Bad gesteckt und von oben bis unten abgeschrubbt. Die Tischplatte des Küchentisches ebenso. Ein Unterschied bei dieser Entmadungsaktion existierte nicht. Gnadenlos säuberte sie uns gründlichst. Gleiche Hygiene für alle. Als ich noch einmal ein Raupenrennen mit meinem Cousin Robert bei einem Parkspaziergang organisieren wollte, wurde dieses Vorhaben schon im Vorfeld durch energisches Einschreiten von Mutter unterbunden. Zornig zerstampfte sie mit ihren Schuhen unsere grünen oder braunen Rennraupen, zerrte uns zu einer Parkbank, wo wir irgendetwas anderes „spielen“ sollten. Da war aber nichts zu spielen. So beobachteten wir eben mit großem Interesse, wie meine Mutter ihre aufkommende Übelkeit heldenhaft hinunterzwang. In Abwesenheit von Mutter wurde nie wieder ein Maden- oder Raupenrennen erwähnt oder gar möglich.
Ärger mit dem neuen Reich – 1940/41
Dieser Jesus war doch ein echter Glückspilz;
fließt dem statt Blut Rotwein durch die Adern.
Kein Wunder, dass sie ihn gekreuzigt haben.
Kathleen Ferguson, Die Haushälterin