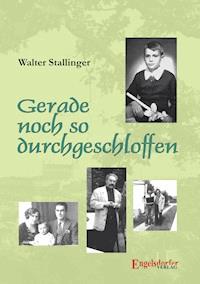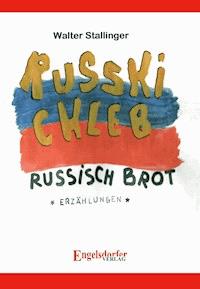
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
RUSSISCH BROT, ein bezeichnender Name, für eine Art trockenes, glaciertes Keksgebäck, bei Zubiss zerbröselnd, der Geschmack irgendwie unbestimmbar, doch erträglich, aber eben erst nach dem Zerstörthaben der Buchstabenkost, am besten unter Zugabe von Trinkbarem: Schwarztee soll am optimalsten auf den Geschmacksnerv wirken, berichten Kenner, selbsternannte, denn die RBL (Russisch Brot Liga) harrt noch ihrer Gründung und UNesken Anerkennung. RUSSISCH BROT, der Titel für eine Sammlung Erzählungen aus kürzlich vergangenen Tagen, pittoresk, komisch, manchmal absurd und traurig, immer wieder spannend und erinnernd, dass wir es waren, die als Figuren in diesem Spiel »Sozialismus und Wende genannter Übergang – zu wohin?« auf dem Spielbrett des Lebens geschoben wurden und auch selbst schoben. Geschichten aus dem Alltag hier und dort, im Osten Deutschlands und in der ebenfalls verschwundenen Sowjetunion, erzählt von einem, der von sich behaupten darf: Ich bin dabei gewesen – Walter Stallinger!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Walter Stallinger
RUSSKI CHLEB -
RUSSISCH BROT
Erzählungen
Engelsdorfer Verlag
Bibliografische Information
Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Copyright (2011)
Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte bei Walter Stallinger!
Hergestellt in
Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Die Recherchen von Herrn Dr. Quendt aus Dresden über Wesen und Herkunft des Artikels Nummer 08105 besagen, dass der Dresdener Bäckermeister Ferdinand W. Hanke die Rezeptur für dieses Gebäck vor rund 150 Jahren aus St. Petersburg nach Dresden brachte. Schon vor hundert Jahren stellten die Gebrüder Hörmann, Deutschlands größte Waffelfabrik mit ca. 1000 Beschäftigten, Russisch Brot in vielen Varianten her und exportierten das Gebäck in die Welt. Worin besteht nun die Besonderheit dieses Gebäcks? Es ist einerseits locker und daher andererseits leicht zerbrechlich.
Es ist spröde in der Struktur und darf nicht gedrückt oder geworfen werden.
Dieses Gebäck kann vor allem zum Tee serviert werden, denn es hat eine glatte Oberfläche, die aber in Verbindung mit schwarzem Tee zu einer herb-süßen Masse zerläuft. Eigentlich müsste das russische oder kyrillische Alphabet das Muster für diese besonderen Buchstabenkekse abgeben, aber aus wer weiß welchen Gründen entschieden die Gebrüder Hörmann und alle Nachfolger anders. So bekommen wir „Russisch Brot“ mit lateinischen Buchstaben.
Vielleicht findet der aufmerksame Leser manches in meinen Geschichten wieder, was vom Russischen Brot kommt: Die Lockerheit und Zerbrechlichkeit, Oberflächen, die anders scheinen, als sie sind, die Herbheit und Süße wie auch Sprödheit, oder ein pikantes Aroma.
Es ist so wie im Leben, wie bei uns, so auch in Russland ...
Ein Friedhof in St. Petersburg
Als mich 1993 Gennadij nach St. Petersburg - Petrograd - Leningrad und jetzt wieder St. Petersburg einlud, dann war es vor allem deshalb, weil er mir unbedingt „verborgene, aber unvergleichlich schöne Winkel“ dieser Fünfmillionenstadt an der Newa und Ochta zeigen wollte. Kaum die Reise von Berlin-Lichtenberg nach Petersburg bewältigt, stieg ich in den altersschwachen Lada und Gennadij fuhr mich auf recht abenteuerlich anmutenden Schlaglochstraßen in den Norden der Stadt. „Du siehst Dir mal unseren Piskarjowskoje-Friedhof an. In einer Stunde oder zwei hole ich Dich wieder ab“, so Gennadij. Er müsse inzwischen zum „Babylon“, dem niederländischen VerkaufsAldi, etwas für Irinas Geburtstag besorgen. „Überraschung“ zwinkerte er mit verschmitztem Grinsen, zwängte sich in den wackeligen Lada hinein und rumpelte davon.
Nun sind Friedhöfe, Krankenhäuser, Pflegeheime, Seniorentreffs oder Fünfuhrtee-Tänzchen in Veteranenklubs nicht gerade meine bevorzugten Besuchsorte, aber was solls, sagte ich mir, dieser Friedhof wäre etwas Besonderes, erinnerte ich mich an Gennadijs Worte während der Fahrt, etwas Historisches ...
Auf der anderen Seite des breiten „Prospekts der Unbezwungenen“ – ein sehr heroischer Straßenname, bemerkte ich im Stillen, war der Eingang zum Friedhof. Ganz und gar nicht heroisch. Kein Triumphtor, kein Pantheon, keine heldischen Kämpfergruppen, sondern schmucklos und einfach. Die breite Straße, es war eben ein Prospekt, wenig befahren.
Mit ruhigen Schritten begann ich die 30 oder 40 Meter zu überqueren, näherte mich schon dem schmalen, rechteckigen Eingang, da preschte ein silbergrauer AltMercedes heran, in dem eine illustre „kompanija“, eine Gesellschaft neureicher auf jugendlich getrimmter Dämchen und Herrchen saß oder besser gesagt, zu den Fenstern hinauslümmelte.
Es schien, als ob sie mich allen Ernstes auf die Hörner, sprich den Mercedes-Kühler nehmen wollten. Mit schätzungsweise 80 Sachen bäumte sich der Silberpfeil über die Schienen der Straßenbahn.
Weder vor- noch zurückzugehen hätte mir geholfen, also blieb ich einfach stehen und starrte auf die näher kommende Kavalkade.
Der ältliche Fahrer war anscheinend gewöhnt, dass vor einer solchen Mercedes-Gewalt die Fußgänger nur so beiseite spritzen. Unverschämt, dass ich stehen blieb. Wenige Meter vor mir schrilles Kreischen der Räder, Ächzen und Knirschen der schrottigen Karosse und - knapp vorbei, ist auch daneben. Gejohle, Pöbeleien und Drohgebärden begleiteten dieses wilde Ausweichmanöver, welches selbst einem bekannten Ferrari-Rennjäger alle Ehre gemacht hätte. Vielleicht hätte auch er Probleme gehabt mit den Petersburger Straßen ...
Zittrig in den Knien erreichte ich die andere Seite. „Piskarjowskoje Memorialnoje Kladbischtsche“ (Piskarjowski-Gedenkfriedhof) las ich beim Hineingehen.
Ein großes Gelände tat sich auf, durchzogen mit schnurgeraden Plattenwegen, die von Bordsteinen gesäumt wurden. Alles umgrenzt von Birken und Pappeln, einzelnen Sträuchern und Gehölz. Im Hintergrund der parkähnlichen Fläche erhob sich der eigentliche Blickfang: Von einer Granitmauer umgeben die Bronzefigur einer jungen Frau. Sie stand dem Eintretenden zugewandt auf einem Sockel, die Arme einladend geöffnet und über beide Hände ein Lorbeergebinde gelegt.
Ihr Blick ging weit über den Platz. Dieser Haltung fehlte das bedrängende Pathos, welches solchen Gedenkfiguren oft eigen ist. Ein memento mori besonderer Art ging von dieser einsam stehenden, schmucklosen Frauenskulptur aus; nichts war fordernd oder erwartend, eher bittend ...
Rechts und links des Hauptweges im Abstand von mehreren Metern waren flache Granitplatten im Rasen eingebettet, versehen mit Jahreszahlen und mit dem Signum einer untergegangenen Großmacht, dem roten Fünfzackstern mit Hammer und Sichel.
1941, 1942, 1943, 1944 ...
Keine Grabsteine, keine Grabhügel, keine Kreuze oder Steine, nur Grabplatten.
Niemand weiß bis heute genau, was sich im einzelnen während der erbarmungslosen Blockade von 1941 bis 1943 in dieser Mehrmillionenstadt am Finnischen Meerbusen ereignet hat. Waren es eine Million oder mehr oder weniger, die der Umklammerung des Todes zum Opfer fielen? Wie viele konnte die „Straße des Lebens“ über den Ladogasee retten? Mag es auch ein Leben voller Angst und Schrecken, voller Hilflosigkeit oder ein vom Mut der Verzweiflung oder Ausweglosigkeit gezeichnetes Überleben gewesen sein ... Aber eben noch kein Tod.
Von den Zerstörungen waren in Petersburg kaum noch Spuren zu sehen – Plattenbauten wurden häufig auf die von Ruinen geräumten Flächen gesetzt; das meiste an zerbombten und zerschossenen Häusern mit historischem Charakter restauriert und im alten Glanz wieder hergestellt.
Die Narben des Krieges waren geglättet.
An der Granitmauer im Hintergrund las ich in Stein gemeißelt, dass unter dieser Erde Leningrader Bürger, Männer, Frauen, Kinder neben Soldaten liegen, die alle ihr Leben für diese Stadt gegeben haben. Die Namen können nicht genannt werden, so viele sind es, dem Betrachter wird jedoch versichert, dass niemand und nichts vergessen ist.
So bewegend und ergreifend diese Worte auch gewählt waren, nur wenige vertrocknete kleine Blumensträuße am Sockel der Frauenfigur bestätigten dieses Versprechen.
Meine Augen suchten nach weiteren Zeichen des Gedenkens. Nichts.
Unerwartet stutzte ich, als ich doch eine Art Gesteck vor der Statue erblickte.
Neugierig trat ich näher. Über einen aus Tannenzweigen bestehenden Kranz legten sich zwei weiße Schleifen mit dem üblichen Trauerrand. Ich beugte mich über das Gebinde, immer näher, weil ich meinen Augen nicht trauen wollte. Da stand es schwarz gedruckt auf dem weißen Stoff, zwischen dem die Totenblumen hervorschimmerten:
„Den Opfern der Kriege“ und „Veteranen der ehemaligen Waffen-SS 1993“.
Ich drehte mich langsam um und ging.
Bis heute bin ich mir nicht gewiss, worin der Sinn dieser Aktion gewesen sein konnte: In purer Geschmacklosigkeit, in dümmlicher Verkennung der tatsächlichen Geschichte oder in der Verhöhnung der Opfer, denen der Friedhof gewidmet war ...
Die Sprache der Politiker – und das gilt für alle Parteien,
von den rechtesten Konservativen bis zu den linkesten
Anarchisten – ist darauf aus, Lügen glaubhaft und Moral
respektabel erscheinen zu lassen und dem reinen Wind
Substanz zu geben.
George Orwell
Die alte Frau und der Hund
Gennadij zupfte mich am Ärmel: „Los, Mann, es gibt viele von denen in der Stadt. Da kann man nichts machen ...“ Aber ich wollte es wissen!
Schwül war es in der Stadt am neunten August des Jahres1993. Ein spärliches Lüftchen wehte von der Newa-Mündung her. Hastig drängten sich die Petersburger in die Metro, die ein wenig Kühlung versprach, denn dort funktionierten die Lüftungsanlagen immer.
„Wie sprichst du sie an?“, dachte ich, „ist das nicht vielleicht würdelos, eine alte Frau zu befragen, wer sie ist, wo sie wohnt, wie sie lebt? Oder ist es gar beleidigend für sie, auf solche Fragen zu antworten ...?“ Verunsichert, aber getrieben von meiner Neugier, ging ich auf die Metrostation Narwskaja zu, wo sie einsam im Gewühl, entgegen dem Menschenstrom, an einer Hauswand lehnte und den Hund betrachtete, der vor ihr auf dem Gehweg umher schnüffelte.
„Entschuldigen Sie“, begann ich ...
Sie hieße Olga Iwanowna Kulikowa, sei 85 Jahre, Veteranin des Vaterländischen Krieges, Orden trage sie nicht mehr, bemerkte sie beiläufig, sie habe die Blockade von 1941 bis 1943 überlebt, aber auch die Kinder, den Mann und alle Verwandten, sie wohne in der Baltischen Straße 24, in der 5. Etage, der Aufzug ginge schon 2 Jahre nicht mehr, flocht sie ein, ihr einziger Zugehöriger wäre Pascha, der Mischlings-Spitz mit dem schwarzen Fleck auf dem rechten Ohr. Mit dem Kinn deutete sie auf den Hund, der sich jetzt vor sie hingesetzt hatte und hechelte.
Gennadij hatte sich etwas entfernt und starrte in den wolkenlosen blauen Himmel, als ob es dort etwas zu sehen gegeben hätte. Ihm war die Sache recht unangenehm, so schien es mir. „Verzeihen Sie, wenn ich frage ...“, setzte ich fort. „Frag nur, Söhnchen“, meinte Sie mit ihrer gar nicht brüchigen Altfrauenstimme gelassen, „Fragen ist keine Schande.“ Wie sie lebe, wollte ich wissen.
18.000 Rubel Rente und 18 Rubel Veteranenzuschlag hätte sie im Monat. Schnell überschlug ich: Das waren knapp 40 DM damals. „Gute alte Freunde helfen mir. Und manchmal kaufen sie für mich ein, oder die Nachbarn“, ergänzte sie unbefangen. Gleichmütig und freundlich lässt sie ein Foto von sich machen. Der Hund beäugt misstrauisch, wie ich mit dem Fotoapparat hantiere. „Das ist mein Pascha“, ergänzt sie noch einmal, „der weiß, wo’s langgeht heutzutage.“ Jetzt blickten mich ihre Augen zum ersten Mal offen an. Graue Pupillen musterten mich, lebhaft und glänzend. Das Gesicht von Falten des Alters, der Einsamkeit, des Kummers vielleicht, gezeichnet, aber keineswegs von Ergebenheit in ein unabwendbares Schicksal. Irgendwo in den Augenwinkeln steckte eine Art aufmüpfiger Widerstand gegen diese neue Zeit, welche ihr die zustehende Achtung, den gebührenden Anstand und die altersgerechte Existenz entweder nicht gewährt oder sogar abspricht. Die noch vollen weißen Haare unter ein Kopftuch gezwängt, leicht gebeugt, den „Einkaufsbeutel für alle Fälle“, die „Awosska“, fest in beiden Händen, betrachtete sie mich eingehend. „Und was bist du für einer?“, fragte sie bedächtig, „warum willst du das alles wissen?“
„Ich bin Deutscher, zu Besuch hier, bei Freunden“, antwortete ich, verblüfft über die Direktheit der Frage.
„Ja, ja“, erwiderte sie freundlich, „ein Deutscher also. Ich kenne die Deutschen. Es ist schon lange her, da war ich noch jung und kräftig. Sie haben uns ihre Grüße in die Stadt geschickt: Bomben und Granaten. Tag und Nacht. Aber nichts für ungut, Jungchen, das ist vorbei, das ist Geschichte. Eigentlich haben wir den Krieg verloren und nicht ihr. Na ja, so ist das Leben. Wer weiß, was morgen ist. Bleib gesund, Söhnchen.“ Sie wandte sich langsam ab und folgte ihrem Hund Pascha mit bedachtsamen kleinen Schritten, wobei sie den Wölbungen und Vertiefungen im Asphalt des Bürgersteigs vorsichtig auswich. Ich, und jetzt auch Gennadij, sahen ihr nach.
„Sei nicht ungehalten. Alte Leute verstehen die neue Zeit nicht“, sprach Gennadij auf mich ein. Er glaubte wohl, sich für alles entschuldigen zu müssen. Ich schwieg und dachte: Ja, die Geschichte ist ein heißes Eisen. Leicht verbrennt man sich daran die Zunge, aber was einmal geschehen ist, das kann man sich nicht wegwünschen ...
Gennadij, Gena, wie er von Freunden genannt wurde, der selbst ernannte „bisnjesmen“, der es aber bisher in keinem business zu etwas gebracht hatte, schien nicht viel begriffen zu haben. Es war nicht allein die Historie der alten Frau, die mich veranlasst hatte, von ihr unbemerkt, 20 DM in den Beutel zu schmuggeln. Nur Pascha und Gennadij haben es gesehen. Der eine hatte leise knurrend die Zähne gefletscht, der andere belferte dafür um so lauter: „Bist du verrückt? Wot jeschtscho! Das fehlte noch! Oder bist du Millionär?!“
Vielleicht begreift er es einmal, dachte ich, trotz der „neuen“ Zeit.
Ich hoffe es für ihn.
„Im gesellschaftlichen Leben muss man maßvoll in dem sein, was man anderen anvertraut.
Es gibt viel mehr Wahrheiten, die besser ungesagt bleiben müssen, als kleine Wahrheiten, die sich zur Veröffentlichung eignen.“
Casanova
Hamburg – Astrachan
Gennadij hatte ich in den Achtzigern kennen gelernt. Er war Raketenoffizier auf dem Flugplatz Neuenburg gewesen. Ein paar Mal getroffen, gefeiert, dann war er mitsamt Familie weg. Einfach so, über Nacht quasi. Die Jahre vergingen, sie „wendeten“ sich, plötzlich ein Brief: „Lieber Freund- wie hast Du eure Wende überstanden – ist noch alles gesund und munter – ha, ha – ich bin jetzt in Petersburg – bin demobilisiert – mache in Business – komm doch mal nach „Piter“.
Nimm den Zug – ich hol dich ab – wohnen kannst du bei uns – wir haben eine sehr schöne Neubauwohnung – wirklich ganz neu – natürlich ist auch deine Frau eingeladen. So etwa der Brief, wie aus heiterem Himmel.
„Du fährst erst mal allein“, meinte der Familienrat.
Und ich hatte schon das Schlimmste angenommen, nämlich, dass dem immer etwas linkischen, aber sehr gutmütigen Gennadij die Mudjaheddins in irgendeinem – STAN – (Turkwort für Gebiet, Land) das Fell über die Ohren gezogen hätten. Er wäre ja nicht der Erste gewesen. Kurz entschlossen nahm ich die Einladung, beantragte das Visum auf dem Kickerlingsberg der Stadt L., kaufte die Fahrkarte und machte mich auf den Weg.
Der Sommer 1992 war ein richtiger Urlaubssommer: blauhimmelig, wasserlos und heiß.
Pakete und Päckchen, Koffer und Taschen unter den gestrengen Aufsichtsaugen der Zugbegleiterin verstaut. Nach 5 DM „Fahrgastbeitrag“ zum geringen Lohn der Zugbegleitung durfte ich sogar in einen nicht belegten Raum umziehen. Das sei die eiserne Reserve, d.h., wenn es jemandem schlecht wird, eine Entbindung etwa oder so ansteht, dann müsse ich das Abteil leider verlassen. Aber, so versicherte sie mir, ihre Kontrollaugen hätten nichts bemerkt, was werdenden Müttern in ihrem Wagen ähnlich sehe. Später kam dann doch ein älterer Pole, der hatte möglicherweise 10 DM geboten, welcher leidlich Deutsch konnte und in Warschau wieder ausstieg.
Dort stieg ein junges litauisches Pärchen zu. Danach verbrachte ich bis Vilnius die meiste Zeit in Gesellschaft des halboffenen Zugfensters oder in Gesellschaft mit der redseligen Zugbegleiterin. Sie erklärte mir des Langen und Breiten ihre Erfahrungen mit verliebten Pärchen, für die sie volles Verständnis aufbringe. Ich solle es ihr nicht verübeln, dass sie die beiden Litauer eine zeitlang in mein Abteil geschickt habe. „Aber was soll man machen?!“, schloss sie mit leidvollem Seufzer. „Ja, die Jugend heute ...“
Nachdem erneut 5 DM den Besitzer gewechselt hatten, bekam ich den Tee von ihr sogar mit Milch und Zucker serviert und einige Stücke selbstgebackener Obstkuchen fanden sich auch für mich. Ein Schurke, wer Schlechtes dabei denken will ....
Mittags dann im Speisewagen. Ich überflog das Angebot. Es war so dünn wie die Suppe, die am Nebentisch in einer Suppentasse hin und her schwappte. Dafür waren aber auch alle Suppenbestandteile sehr überschaubar: Ein verkümmertes, gekochtes graugelbes Hühnerbein, 3 Kartoffelstückchen, eine hellrote halbe Möhre, ein Lorbeerblatt und 2 oder 3 Pfefferkörner in Gesellschaft von einigen Nudeln. Der Borschtsch war ohne Zweifel etwas dicker, aber eben nicht durchschaubar. Die rote Bete überdeckte alle anderen Einlagen. Hie und da lugte ein vorwitziges Bröcklein fetten Rindfleisches hervor. Also entschloss ich mich für das graugelbe Hühnerbein. Bezahlt wurde in europäischer Währung, d.h. in deutscher Mark, französischen oder Schweizer Franken, in englischen Pfunden oder natürlich in Dollar der USA. Keinesfalls in Rubel, obwohl das Wechselgeld entsprechend dem Tageskurs in Rubel ausgezahlt wurde. Zu diesem Zweck stand auf der Theke des Speisewagens der bekannte Holzkugel-Kalkulator, mit welchem richtige Russen in verblüffender Geschwindigkeit alle möglichen Rechnungen (meist richtig) bewältigen. In das Klappern des Bestecks mischte sich das Klappern der Holzkugeln, wenn diese mit gekonntem Schmiss hin oder her geschleudert wurden auf dem sogenannten „Abakus“.
Während ich die mit Schreibmaschine geschriebene, schon etwas gebraucht aussehende Speise(zettel)karte noch einmal betrachtete, erschienen 2 Figürchen auf der Bildfläche: ein recht junger Mann mit einem mindestens ebenso jungen Mädchen an seiner Seite. Ein großes Wörterbuch in einem Umhängebeutel aus Leinen wurde sichtbar, als sich der junge Mann zaghaft meinem Tisch näherte, sich höflich verbeugte und auf die noch freien Plätze wies. „Noch frei?“ fragte er. Ausgerechnet mich trifft’s wieder, dachte ich, wo ich mich doch gerade entschlossen hatte, wieder einmal 5 DM zu opfern, um mir eine deftige „jaitschniza“, ein Rührei also, vom KochServierer und Kellner in einer Person zubereiten zu lassen. Das stand nämlich nicht auf der Speisekarte, aber Eier sind schließlich immer in der Vorratskammer. Mit den 5 DM hätte ich ihm die Rühreier schon herauspressen können, aber in Gesellschaft der beiden nunmehrigen Tischgäste war mein Plan nicht mehr so einfach zu verwirklichen. Meine 5 DM-Methode hatte sich wohl herumgesprochen, denn wie von Zauberhand erschien vor mir eine Tasse Tee mit Zucker, mit einem Teelöffel und – ich wollte es nicht glauben – mit einem Gläschen Warenje, der speziellen russisch-ukrainischen Konfitüre. Verlangend starrte das schmalgesichtige und auch sonst schmale Mädchen auf den Tee. Den Eindruck von Hilflosigkeit verstärkte die John-Lennon-Brille und der traurig herunter hängende Pferdeschwanz ihrer aschblonden Haare. Sie starrte also auf das Teeglas und flüsterte unüberhörbar: „Klaus! Ich habe wahnsinnig starken Durst. Die Coke ist schon lange alle. Bestellst Du mir auch so was zum Trinken?!“ Ihr Begleiter Klaus blätterte verbissen im Wörterbuch vor und zurück. „Klaus!! Mach doch, ich habe so starken Durst“, quengelte das Mädchen und versuchte inzwischen die Speisekarte zu lesen. Sie drehte den Zettel mal nach oben, dann nach unten, bewegte buchstabierend ihre Lippen und gab auf. Die Tücke des Speisezettels bestand darin, dass die angebotenen Gerichte und Getränke zwar in lateinischer Schrift geschrieben, aber nicht übersetzt waren. Soljanka (säuerliche Suppe) war eine Soljanka geblieben, Borschtsch (Gemüsesuppe) war Borschtsch, Jaizo (Ei) war Jaizo und auch die kurinnij sup (die Hühnersuppe) wagte sich nicht auf das internationale Sprachparkett, blieb also unübersetzt. Um das Dilemma noch zu vertiefen: der Servier-Kellner-Koch verstand kein deutsches Wort, wie er mir in Russisch klarmachte. Russischkenntnisse wurden bei den Mitreisenden vorausgesetzt!
„Bestell doch endlich Tee“, sagte das Mädchen schon recht ungehalten. Der junge Mann wies mit dem Zeigefinger auf mein Teeglas und rief zum Servier-Kellner: „Bitte, dwa glasa tschai!“ Der Kellner wandte sich schmunzelnd ab und begann zu kichern. Das verstärkte die Peinlichkeit noch mehr. Übersetzt klang es für den Kellner, als ob jemand „zwei Augen Tee“ bestellen wollte, was, wo immer in der Welt, nicht möglich ist.
Das Mädchen hatte endlich etwas im Riesen-Wörterbuch gefunden. Sie rief „Poschalitza, dwe tschaja!“ Mit viel gutem Willen hörte man heraus, was sie wollte. Kurz darauf standen zwei Gläser Tee auf dem Tisch, mit Zucker zwar, aber ohne Löffel und natürlich auch ohne Warenje.
Ich konnte das Unglück nicht länger mit ansehen. „Sie brauchen einen Reiseführer, kein Wörterbuch. Im Reiseführer steht immer auch die deutsche Erklärung und die richtige Aussprache.“
„Oh“, entgegnete der junge Mann selbstbewusst, „wir haben ja das Wörterbuch. Das genügt. Wir müssen nur etwas mehr üben. Sagen Sie mal, Sie sind wohl Deutscher?“
Ich bejahte seine Frage und ergänzte nur, dass ich zufriedenstellend Russisch spreche. „Wir kommen aus Hamburg“, mischte sich das Mädchen ein, „und sind nach Astrachan unterwegs. Zu Freunden. Die sprechen aber Deutsch.“
„Wir dachten mit Englisch kommt man schon durch, aber ...“, und der junge Mann klappte das Wörterbuch zu.
„Haben Sie keinen Hunger?“, fragte ich.
„Oh ja, sehr, aber wir wissen ja nicht, was das alles auf dem Zettel heißt und was da drin ist“, klagte das Mädchen.
„Mach nicht so einen Aufstand. Wir haben noch paar Kekse, Bananen und Apfelsinen. Das langt schon“, schnauzte der junge Mann ungehalten.
„Wann werden Sie denn erwartet?“, setzte ich das Gespräch fort.
„Übermorgen früh um 6 Uhr. Heute Nacht von Petersburg nach Moskau. Nach ein paar Stunden Aufenthalt geht es durch bis Astrachan!“, erklärte mir das Mädchen.
Und der junge Mann fügte hinzu: „Wir brauchen nicht viel und das Bisschen, was wir benötigen, kaufen wir mit Schecks.“
„Haben Sie denn kein Bargeld mit?“, erkundigte ich mich.
Beide sahen mich befremdet an. „Ein paar Dollar haben wir schon eingesteckt.“
„Wissen Sie denn nicht, dass gegenwärtig aus den verschiedensten Gründen keine Euro-Schecks angenommen werden, mit Ausnahme in internationalen Hotels, in welche Sie aber nicht kommen, weil Sie keine Zeit haben“, setzte ich den Aufklärungsunterricht in russischer Wirklichkeit fort.
„Ach was“, überspielte das Mädchen die eingetretene Pause, „dann gehen wir eben an den Automaten!“
„An welchen Automaten denn?“, wunderte ich mich über die Naivität dieser Russlandfahrer.
„An einem Bankautomaten, einem Geldautomaten eben. Der ist an jeder Bank. Den gibt es doch überall“, belehrte mich der Student.
„In Russland gibt es keine oder noch keine“, berichtigte ich ihn gelassen.
„Das glaub ich Ihnen nicht“, ereiferte sich das Mädchen, „die gibt es doch auch in Russland. Herr Jelzin hat die ganz bestimmt sofort eingeführt“, schloss sie triumphierend.
„Woher wollen Sie das so genau wissen?“
„In Hamburg hat man uns sehr gut informiert“, kommentierte ihr Partner.
„Vielleicht für American Express oder VISA“, bemerkte ein uns gegenüber sitzender älterer Herr in fast akzentfreiem Deutsch, der schon geraume Zeit unserem Gespräch gefolgt war.
„Wir haben aber nur EC-Karten“, sagte das Mädchen jetzt recht leise.