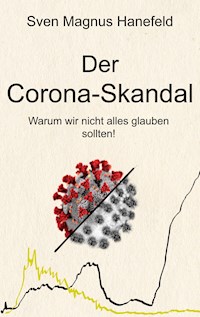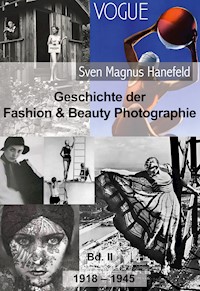
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschichte der Fashion & Beauty Photographie
- Sprache: Deutsch
Ein Handbuch zur Geschichte der Photographie in Bezug auf Fashion und Beauty im 20. Jahrhundert. Der 2. Band behandelt die Zeit von 1918 bis 1945. Bis heute das erste Werk dieser Art, einzigartig und unentbehrlich für alle, die das Studium der Photographie unter diesen Gesichtspunkten vertiefen und an ihre Wurzeln gehen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einführung
Kapitel I
Der Beginn einer neuen Ära
Der neue Berufsstand des Modephotographen – Adolph de Meyer
Kapitel II
Amerikanische Moderne
Straight Photography
Vom Ende der Photo-Secession und einem Pas de Deux
Parallele Entwicklungen
New York Dada – Man Ray
Die Photographen der West Coast – Die Gruppe f/64
Kapitel III
Die »Goldenen Zwanziger«
Akt- und Erotikphotographie
Paris
New York
Pulsierendes Leben in Berlin
Porträtphotographie der 20er im Wandel der Zeiten
Mode- und Gesellschaftsphotographie in Berlin und Paris
Kapitel IV
Die neuen internationalen Modephotographen
Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Cecil Beaton und Man Ray
Avantgarde in den 20ern – František Drtikol, Man Ray und Umbo
Kapitel V
Glamour-Photographie aus Hollywood – 20er und 30er Jahre
Der Hollywood-Stil
Das Studio Harcourt in Paris
Kapitel VI
Die 30er Jahre
Modephotographie in den 30ern – Zwischen Innovation und Kontinuität
Das Element der Bewegung
Komponist der sinnlichen Eleganz – Horst P. Horst
Die ersten Modelagenturen
Kapitel VII
Farbe, Surrealismus und Schnappschuss-Ästhetik – Die Moderne erfindet sich neu
Die Entwicklung in Deutschland
Kapitel VIII
Die Akt-Photographen
Fine Art- / Nude-Photographie
Die Künstlerischen – Fernand Fonssagrives, Paul Outerbridge, Man Ray
Deutschland
Frivoles für die Massen
Kapitel IX
Realismus in der Porträtphotographie
Kapitel X
Die Kriegsjahre 1939-1945
Modephotographie
Deutschland – ein düsteres Kapitel
Paris
Großbritannien
New York
Akt und Erotik
Kapitel XI
Kamera- und Studiotechnik
Kameras
Farbphotographie
Blitztechnik
Studio- und Lichttechnik
Drucktechnik
Bildlegende
Tabelle
Bibliographie
Register
Einführung
In einem ersten Band wurde bereits die Geschichte der Photographie in Bezug auf die Sujets Fashion & Beauty des 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs behandelt. Wir hatten es bereits in dieser Zeit mit einer Vielfalt der Stile zu tun, obwohl das Medium der Photographie recht neu, die technischen Möglichkeiten noch begrenzt und die offene Darstellung der weiblichen Schönheit gesellschaftlich tabuisiert waren. Insbesondere unternahm der Piktorialismus den Versuch, die Photographie als Kunst zu begreifen, weshalb sie sich an künstlerischen Stilrichtungen wie dem Naturalismus, Impressionismus und Symbolismus orientierte. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen neue Kunstrichtungen wie der Expressionismus und Fauvismus auf, allerdings hatten diese zunächst wenig Einfluss auf die Photographie. Zu sehr war diese mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Anspruch der Beweiserbringung, sie sei Kunst, und vielleicht fiel es ihr genau deshalb so schwer, sich von ihren Wurzeln zu befreien und ebensolche Wege zu beschreiten. Dessen ungeachtet gelang es der Kunst- und Amateurphotographie-Bewegung, beflügelt durch den technischen Fortschritt, den Umgang mit dem ehemals sperrigen Medium einer breiten Öffentlichkeit zuteil werden zu lassen.
Der Erste Weltkrieg stellte in jeder Hinsicht eine Zäsur dar. In dieser Zeit wollen wir den zweiten Band beginnen lassen. In der Photographie zeigte sich dies am deutlichsten in der Abwendung von der Unschärfe als künstlerischem Gestaltungsmittel. Nach dem Krieg hielten in der Photographie einige Photographen noch am Piktorialismus fest, doch tat sich längst Neues auf. Viele neue avantgardistische Strömungen wie der Dadaismus und die Neue Sachlichkeit versuchten Antworten auf die neue Zeit zu finden. Bürgerliche Kunstauffassungen und traditionelle Wertvorstellungen wurden radikal abgelehnt. Die neuen Entwicklungen fassten die Historiker unter dem Begriff der künstlerischen Moderne zusammen. Diese zeigte sich gleichsam in der Photographie, sowohl in den avantgardistischen Tendenzen als auch in der Mode- und Aktphotographie.
Einige Photographen haben wir bereits im ersten Band kennengelernt, zum Beispiel Adolph de Meyer, der von vielen als der erste Modephotograph betrachtet wird, am Stil des Piktorialismus allerdings festhielt. Ebenso kennen wir Edward Steichen und Alfred Stieglitz aus dem ersten Band. Diesen herausragenden Künstlern begegnen wir nun wieder, ihnen widmen wir gebührenden Raum. Wir behandeln die goldenen Zwanziger Jahre, in denen immer mehr Modephotographen in Erscheinung traten.
Die Photographen der West Coast, unter denen Edward Weston herausragte, entwickelten einen eigenen Stil, der unter dem Begriff der Straight Photography bekannt wurde. Des Weiteren beschäftigen wir uns eingehend mit der Glamour-Photographie aus Hollywood in den 30er Jahren. Hier ragte George Hurrell heraus.
Einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung der Modephotographie hatten die zeitgenössischen Lifestyle-Magazine. Condé Montrose Nast kaufte die Vogue im Jahr 1909. Edna Woolman Chase war von 1914 bis 1952 die Chef-Redakteurin. 1932 platzierte die Vogue das erste Farbbild auf ihrem Cover. Die photographische Vorlage stammte von Edward Steichen. Die bis dahin üblichen Illustrationen wurden in den 30er Jahren nach und nach durch Photographien ersetzt. Bis 1936 gab es auch die Vanity Fair. 1942 starb Nast. Beim Harper’s Bazaar zeichnete sich seit 1934 Alexei Brodowitsch als Art-Direktor verantwortlich. Er leitete das Magazin bis in die 50er Jahre. In seiner Ägide bildete er den spezifischen Stil dieser Zeitschrift aus und beeinflusste das Schaffen vieler Modephotographen.
Die wichtigsten unter ihnen hießen George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Martin Munkácsi, John Rawlings, Toni Frissell, George Platt Lynes und Erwin Blumenfeld. Unter den Aktphotographen waren es Paul Outerbridge und Brassai, die künstlerisches Oevre entwickelten.
Ein Kapitel widmet sich den Geschehnissen in Deutschland während der 30er und 40er Jahre, das mit der Hitler-Diktatur immer mehr ins gesellschaftliche Abseits geriet. Die bekanntesten deutschen Photographen hießen Karl Ludwig Haenchen, Hubs Flöter und Sonja Georgi. Mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust an den Juden und politisch Verfolgten brach für die Menschen die nächste Katastrophe des Jahrhunderts herein. Die Modephotographin Yve kam im Konzentrationslager ums Leben. Die Einnahme von Paris bedeutete für viele radikale Künstler und Intellektuelle die Flucht über den Atlantik. Gisèle Freund schaffte es mit einem der letzten Dampfer nach Südamerika, Man Ray ging zurück nach New York.
Dieser zweite Band der Geschichte der Fashion & Beauty Photographie bildet die Geschehnisse dieser turbulenten Zeit zwischen den Weltkriegen ab. Wie auch der Erste Weltkrieg stellte auch der Zweite Weltkrieg einen tiefgreifenden Einschnitt dar. In einem weiteren Band soll es um die Zeit danach gehen.
Es konnten in dieser kurzen Einleitung nicht alle wichtigen Photographen genannt werden. Weitere kommen im Innenteil des Buches zur Sprache. Ihre Biographien werden in den meist in Dekaden eingeteilten Kapiteln geschildert, wodurch immer nur zeitlich begrenzte Abschnitte behandelt und die Lebensläufe dann gegebenenfalls im jeweils folgenden Kapitel fortgeführt werden.
Sven Hanefeld
1 ADOLPH DE MEYER. Gertrude Vanderbilt Whitney, American Vogue, 1917
Kapitel I
Der Beginn einer neuen Ära
Der erste Weltkrieg war ein einschneidendes Ereignis, welches auf soziokulturellem und künstlerischem Terrain die Moderne und somit eine neue Ära einleitete. Nicht nur die Mode veränderte sich revolutionär, auch auf photographischem Gebiet fanden wir neben Althergebrachtem neue Ausdrucksformen. Es war nicht weiter ungewöhnlich, dass am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts immer mehr Modephotographien erschienen, die in einschlägigen und berühmten Modemagazinen wie dem Harper’s Bazar (USA seit 1867) oder der Les Modes (Paris, 1901–1937) veröffentlicht wurden. Es etablierten sich selbstständige Ateliers, die sich auf Modephotographie spezialisierten, hauptsächlich in den europäischen Hauptstädten. Diese kamen meist aus dem Bereich der Porträt- oder Theater-Photographie. 1909 wurde in New York City das bereits seit 1892 bestehende Magazin Vogue von dem amerikanischen Verleger Condé Montrose Nast übernommen. Als erster Photograph, der beruflich für Modemagazine tätig war, und daher heute als der erste Modephotograph par excellence bezeichnet wird, trat Adolph de Meyer in Erscheinung. Während dieser, wie auch andere Photographen, beispielsweise Arnold Genthe, dem Piktorialismus als Kunststil treu blieben, wandten sich die meisten modernen Photographen, stellvertretend sei Edward Steichen genannt, vom malerischen Stil ab. Avantgardistische Kunstrichtungen wie zum Beispiel der Dadaismus und die Neue Sachlichkeit traten an seine Stelle.
Der neue Berufsstand des Modephotographen – Adolph de Meyer
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es kaum Photographien in den Modemagazinen. Zwar wurde bereits 1881 das Halbtonverfahren patentiert, das es ermöglichte, diese zu drucken. Die Zeitschrift La Mode Practique nutzte es 1892 zum ersten Mal, um Mode zu zeigen. Hauptsächlich gab es aber Illustrationen in den Magazinen und Photographien waren die Ausnahme. 1911 bestellte Art et Décoration dreizehn Steichen-Photos von Poiret-Kleidern für einen Bericht mit dem Titel „The Art of the Dress”. Nur sehr luxuriöse Magazine wie Les Modes konnten es sich leisten, Modephotos der größeren Ateliers zu veröffentlichen. Es gab einige berühmte, alteingesessene Photostudios wie das der Reutlingers in Paris, das von Madame d’Ora in Wien und später ebenfalls in Paris oder die von Alexander Binder und Maurus Wilhelm Willinger in Berlin. Sie photographierten die Damen und Herren der feinen Gesellschaft, die es sich leisten konnten zum Photographen zu gehen, sowie Schauspieler/-innen, Tänzer/-innen, etc. Vor allem blühte das Geschäft mit den Postkarten, insbesondere mit Bildern im Ansichtskartenformat. Die Photographen entwickelten eine Bildsprache, die vom Jugendstil beeinflusst war. Die Bilder wurden zum Teil koloriert und als Photomontagen gestaltet. Einige der Ateliers beziehungsweise Photographen sollen kurz behandelt werden.
Léopold-Émile Reutlinger (1863–1937), in Peru geboren, war der Sohn von Émile Reutlinger und Enkel von Charles Reutlinger. Er übernahm das historische Studio in Paris von seinem Vater bereits im Jahr 1890 (siehe Bd. I) und machte Aufnahmen von populären Schauspieler/-innen und Opernsänger/-innen sowie Mode- und Werbeaufnahmen. Auch photographierte er die Damen im Moulin Rouge und Les Folies Bergère. Unter den Prominenten, die er porträtierte, waren Mata Hari, Cléo de Mérode, Sarah Bernhardt, Léonie Yahne, Anna Held und Lina Cavalieri. 1930 verlor er bei einen Unfall mit einem Champagnerkorken ein Auge, was ihn bei seiner Arbeit erheblich beeinträchtigte. Doch er führte das Atelier bis zu seinem Tod 1937 weiter.
1907 eröffnete Dora Kallmus (1881–1963) zusammen mit dem Photographen Arthur Benda (1885– 1969) ein Atelier in Wien. Seit 1908 nannte sie sich Madame d’Ora. Sie inszenierte die Damen in weichen Stoffen, Pelzen, Abendmänteln, Schals und Hüten und orientierte sich, was Pose und Komposition anging, an Gemälden von Gustav Klimt. Seit 1915 gab es wieder eine größere Anzahl an Photographien von Schauspielern. 1913 machte sie in ihrem Berliner Studio Aufnahmen von Anna Pawlowa und begeisterte sich für die neue moderne Tanzbewegung. Im Jahr 1916 photographierte sie die Krönung von Karl I. zum König von Ungarn und stellte eine Porträtserie der gesamten kaiserlichen Familie her. 1927 gab sie das Atelier d’Ora an Arthur Benda ab und zog nach Paris, wo sie stilistisch die Mode der Zeit in ihren Bildern aufnahm. Ihre Modephotographien repräsentierten die großen Designhäuser einschließlich Patou, Rochas, Chanel, Lanvin, und Worth. Sie porträtierte in ihrem Freundeskreis Coco Chanel, den Schauspieler Maurice Chevalier und die Sängerin Mistinguett. Ihre Bilder von der Tänzerin Josephine Baker, der Malerin Tamara de Lempicka und der amerikanischen Schauspielerin Anna May Wong blieben unvergessen.
1913 eröffnete Alexander Binder sein erstes Photoatelier am Kurfürstendamm Nr. 225 in Berlin. Neben Porträts bekannter Berliner Persönlichkeiten machte er vor allem Star- und Modeaufnahmen. Während der Dreharbeiten zum Film „Die freudlose Gasse” porträtierte er Greta Garbo. Binder starb 1929. Nach Binders Tod befand sich das Atelier am Kurfürstendamm Nr. 205.
Maurus Wilhelm Willinger, geboren in Budapest, war seit 1902 in Berlin ansässig. Von 1909 bis 1918 betrieb er dort eine Photoagentur. Nach dem ersten Weltkrieg leitete er eine Agentur in Wien. 1940 emigrierte er nach Shanghai, wo er das Atelier Willinger & Co Shanghai betrieb.
1909 wurde in New York City das bereits seit 1892 bestehende Magazin Vogue von dem amerikanischen Verleger Condé Montrose Nast übernommen und umstrukturiert. Es war von vornherein mehr als nur ein Modemagazin und enthielt Artikel über Gesellschafts- und Sportnachrichten, Gesundheits- und Schönheitsratschläge, Reiseberichte und Leitartikel und richtete sich an eine gehobene Oberschicht. Nast gestand von Anfang an freimütig, dass er kein kreativer Mensch sei – dafür aber ein Verkaufsgenie. Er erfand mit dem wirkungsvoll gestalteten Cover ein völlig neues Verkaufskriterium und verhalf damit einem ganzen Berufszweig zu ungeahnter Blüte – den Modezeichnern.
2 MADAME D’ORA. Anna Pawlowa, 1913
3 MADAME D’ORA. Elsie Altmann-Loos, 1922
Die besten ihres Fachs wurden zu Stars. Diese Rolle wurde erst später von den Photographen übernommen. 1913 gründete Nast die Zeitschrift Vanity Fair, darüber hinaus publizierte er die House & Garden und die Jardin de Modes. 1916 folgte die britische Vogue. Somit hatte Nast das erste interkontinentale Verlagshaus weltweit gegründet. Ebenfalls 1916 ließ Nast das erste hauseigene Photolabor einrichten. Es war neu, dass Verlagshäuser eigene Photostudios betrieben.(1) Seit 1914 bekleidete Edna Woolman Chase die begehrte Position der Chefredakteurin und behielt diese bis 1951. Sie war die dritte von sieben Frauen, die seit 1892 an der Spitze der Vogue standen.(2) Im gleichen Jahr stellte Nast den Photographen Adolph de Meyer exklusiv für das Magazin ein. 1923 kam Edward Steichen hinzu, 1928 Cecil Beaton, in den frühen 30er Jahren Horst P. Horst und Toni Frissell und 1938 André Durst.(3) Seit 1925 wohnte Nast in der Park Avenue 1040, einer Luxuswohnung mit 30 Räumen. Für die luxuriöse Ausstattung hatte er Elsie de Wolfe (Lady Mandl) beauftragt, eine bekannte amerikanische Innenarchitektin. Sie liebte den französischen Stil, insbesondere Louis-quinze-Möbel; der Stil der Régence und des Rokoko inspirierten sie, aber auch Chinoiserien fanden reichhaltig Platz. Der Tanzsaal war mit Chieng Lung Tapeten ausgestattet. Ein Wintergarten beherbergte eine Blumenpracht, lud zum Verweilen ein und bot einen Ausblick über die Park Avenue. Schlaf- und Aufenthaltsräume im Untergeschoss waren über eine schmale Treppe erreichbar. Nast veranstaltete in seinem Luxus-Apartment zwei Partys pro Monat. Die High Society, die hier verkehrte, lieferte genug Stoff für seine Magazine, und die Räumlichkeiten dienten ebenfalls als Kulisse für photographische Events.(4)
Als Mitbewerber zur Vogue erschien das Magazin Harper’s Bazar, welches bereits 1867 gegründet wurde. (Harper’s Bazar schrieb sich noch immer ohne das zweite „a”, welches erst 1929 dazukam) 1913 kaufte William Randolph Hearst die Zeitschrift.(5) Insbesondere seit dieser Übernahme bestand eine Rivalität zwischen den Magazinen auf allen Ebenen. 1915 wetteiferten sie um die 100000ste Auflage. Der Harper’s Bazar hatte zwar schon früher Photographien neben Illustrationen verwendet, auch war der Stil der Illustrationen realistischer, allerdings kam der erste Photograph, der fest verpflichtet wurde, mit Martin Munkácsi erst in den 30er Jahren. 1932 wechselte Carmel Snow von der Vogue zum Harper’s Bazaar. 1935 wurde sie deren Herausgeberin und ließ das Magazin komplett neu gestalten. Alexei Brodowitsch wurde neuer Art Director, der der Zeitschrift ein neues Layout zukommen ließ, und die Society-Lady Diana Vreeland wurde Moderedakteurin.
In Deutschland wurde 1911 die Zeitschrift Elegante Welt gegründet und erschien wöchentlich im Verlag Dr. Eysler & Co. GmbH.
Adolph de Meyer (1868–1946) (auch Adolf oder Adolphe) war einer der ersten, dem man die Berufsbezeichnung des Modephotographen zuspricht, da er in späteren Jahren ausschließlich in dieser Branche tätig war und vor allem auch für Magazine arbeitete. Er wurde nach der Heirat mit Olga Caracciolo im Jahr 1898 geadelt und ist seither auch als Baron de Meyer bekannt.(6) (siehe auch Bd. I) Das Ehepaar wohnte bis 1913 im modischen Cardogan Gardens in London. Hier hatte de Meyer wohl über die Kontakte Olgas den König Edward VII. porträtieren können. Seither machte er dann vor allem Aufnahmen von den Damen und Herren der High Society. Constance Gladys, bekannt unter dem Namen Lady de Gray, gehörte zum erlesenen Freundeskreis, ebenfalls Mrs. Deacon und ihre hübschen Töchter, sowie viele andere. Es entstanden Portraits von der bezaubernden Rita de Acosta Lydig, kurz bevor Boldini das berühmte Gemälde von ihr machte. In den Sommermonaten mieteten sie regelmäßig einen Palazzo in Venedig. Die Aufnahmen von der Marchesa Casati entstanden dort im Jahr 1912. Adolph berichtete: „Die Marchesa Casati, die bei Sonnenuntergang in Tigerfelle gehüllt in ihrer Gondel liegt, während sie ihren Lieblingsleoparden streichelt, ist ein Anblick, den man nur in Venedig sehen kann.” Immer wieder photographierte er auch seine elegante Frau Olga, die bereits in früheren Jahren den Malern Helleu, Boldini und Whistler Modell gesessen hatte.(7)
4 ADOLPH DE MEYER. Olga, 1910
5 ADOLPH DE MEYER. Portrait der Marchesa Luisa Casati, 1913
Bereits im Jahr 1903 war Adolph das erste Mal nach Amerika gereist und hatte Bekanntschaft mit Alfred Stieglitz gemacht, mit dem ihn zeitlebens eine Brieffreundschaft verband. Adolph photographierte im piktorialistischen Stil und wurde auch Mitglied der Photo-Secession sowie der Brotherhood of the Linked Ring. 1907 und 1912 stellte er in der Galerie 291 in New York City aus.
1910 starb Edward VII, der die de Meyers bis dahin in seiner Funktion als eventueller Vater Olgas wohl auch finanziell unterstützt hatte. Die de Meyers begleiteten seit 1910 die Tanztruppe um Vaslav Nijinsky auf ihrer Tournee und Adolph photographierte die Premiere von „L’Après-midi d’un faune” im Jahr 1912. Die offenkundig sexuellen Anspielungen und die unkonventionelle Choreografie des Stückes empörten damals das Publikum. 1914 veröffentlichte de Meyer 30 Photographien, gedruckt auf Japanpapier, in einer luxuriösen handgefertigten Publikation. In dieser Zeit reisten die de Meyers auch in die Türkei, wo sie ein sogenanntes Yali am Bosporus mieteten.(8) Dann verbrachten sie einige Zeit in Tanger, Marokko. Aufgrund ihres luxuriösen Lebensstils, der aufwendigen Reisen und ihres mysteriösen Reichtums wurde vermutet, dass die de Meyers Spione sein könnten. Als nun im August der erste Weltkrieg ausbrach, riet ein Astrologe den beiden, andere Namen anzunehmen und in die USA auszuwandern. Olga hieß fortan Mhrada und Adolph nahm den Namen Gayne an. Seither waren sie unter diesen Pseudonymen bekannt, auch in den Publikationen der Vogue oder Vanity Fair. Sie bewohnten ein Haus in Manhattan, NY, in der East Street Nr. 18, Ecke 54th Street, das sie ›Gayne House‹ nannten.
6 ADOLPH DE MEYER. Gertrude Vanderbilt Whitney, American Vogue, 1913
Bereits während de Meyers Ausstellung in der Galerie 291 im Jahr 1913 wurde Edna Woolman Chase, Redakteurin der Vogue auf ihn aufmerksam und de Meyer begann als erster hauptberuflicher Modephotograph für das Modemagazin zu arbeiten. Zuvor steuerte die Photographin Ira L. Hill einige Photos bei, sie hatte aber keinen vergleichbaren Vertrag mit dem Magazin. Seit de Meyers Erscheinen gab es von ihr keine Veröffentlichungen mehr. Er verdiente 10000 Dollar pro Woche und war somit der bestbezahlte Photograph seiner Zeit. Bei der Photographie von Gertrude Vanderbilt Whitney, in dem sie in einem Jugendstil-Kleid des Malers und Kostümbildners Leon Bakst posierte, handelte es sich um seine erste Veröffentlichung in der amerikanischen Vogue. De Meyer photographierte die reiche Mäzenin noch öfter.(9) Die Photographie versinnbildlicht die sozialen und ästhetischen Sehnsüchte der Leserschaft des aufstrebenden Magazins. Die schlanke Whitney steht majestätisch vor der Kamera, etwas schräg, die linke Hand auf der Hüfte abgestützt, während der rechte Arm auf einem undeutlichen Möbel Halt findet. Ihr Kinn ist nach oben geneigt. So schaut sie herunter auf den Betrachter, wodurch sie ihre gehobene Stellung und Herkunft heraushebt. Gleichzeitig weist die bestechende Exotik ihres Kleides auf eine bohemische Moderne hin und bricht mit der Konvention. Der fokale Punkt liegt nicht im Gesicht, sondern auf der Kette, was dem Gebrauch einer Pinkerton-Smith-Linse geschuldet ist, die das Bild zum Rand hin unscharf abfallen lässt.(10)
De Meyer hatte in dieser Zeit eine äußerst kreative Phase. Die Bilder waren noch ganz dem Piktorialismus verschrieben, der den Versuch unternommen hatte, Photographie als Kunst zu etablieren. Es handelte sich um eine Übergangszeit, die das Zeitalter Edward VII., einer Ära, die kunstgeschichtlich mit dem Jugendstil gleichgesetzt wird, ablöste. Der Piktorialismus war am Schwinden, was sich bereits 1910 mit der internationalen Ausstellung in der Albright Art Gallery in Buffalo, New York, ankündigte, auch wenn Stieglitz einige Bilder von de Meyer beifügte.
Andere Schönheiten, die der Baron photographierte, waren die Broadway-Schauspielerinnen Ann Andrews und Martha Hedman, die Schauspielerin Beatrice Beckey, der Hollywoodstar Elsie Ferguson, die belgische Schauspielerin Berthe Bovy, die englische Aristokratin und Kunstmäzenin Lady Ottoline Morrell, die Ziegfeld-Follies-Tänzerinnen Marylinn Miller und vor allem Kathleen Rose, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Dolores bzw. Rose Dolores.
Dolores hatte ihre Wurzeln in London. Sie war mit der britischen Modedesignerin Lady Duff Gordon (Geschäftsname Lucille) als eines ihrer Mannequins nach Amerika gekommen, wo sie im Modehaus an der Fifth Avenue als „Living Model” auf den Shows lief. Zusätzlich arbeitete sie als Girl bei den Ziegfeld Follies, für die Lucille häufig die Kleider lieferte. Dolores wird als das erste Supermodel der Modewelt angesehen, die den Präsentationsstil und -ausdruck folgender Generationen mitprägte. Sie lächelte während ihrer Modepräsentationen selten, auch war neu, dass sie auf der Bühne nichts vortrug, nur die Kleider für sich sprechen ließ. Ihre Bewegungen waren langsam und ihr Gang hatte statueske Züge. Der Stil wirkte arrogant, ausdruckslos und kühl (engl. blank hauteur), kam jedoch beim Publikum an und wurde zum allgemeinen Vorbild für Fashion Models. Elspeth H. Brown sieht in der prätentiösen Körpersprache und dem elitären Auftreten der weißen Mannequins die bewusste Abgrenzung zum nicht-kaukasischen Kulturkreis.(11)
De Meyers überladener Vogue-Stil ist geprägt von einer Fülle an Blumen, Stoffen, Mustern, Perlenketten, Juwelen und anderen Objekten. Dieser Stil der Überladung und Überfrachtung hatte seine Vorbilder in der Malerei, aber auch in den zeitgenössischen Tendenzen des Jugendstils. Er kann als Revolte gegen die Rationalität einer Zeit gedeutet werden, die von der zweiten Phase der Industrialisierung geprägt war, welche einherging mit neuen Technologien, der Massenproduktion und Fließbandarbeit, die einen entsprechenden Einfluss auf dass Leben der Bürger hatten. De Meyer, frei von den üblichen Zwängen des Lebens, schuf sich eine Gegenwelt und favorisierte einen Stil der reichhaltigen Fülle und des Gefühlsüberschwangs. Es war aber auch der Ausdruck des mondänen Lebensstils, sich abzuheben und seinen Reichtum zu zeigen. Der Piktorialist suchte nach emotionalem Ausdruck in größerem Maße als nach der Wirklichkeit. Es lässt sich hervorragend ablesen, wie die Zeit das visuelle Vokabular der modernen Fashion-Photographie umbildete.
7 ADOLPH DE MEYER. Das Pfauenkostüm, Rose Dolores, 1919
Im Aufsatz „De Meyer at Vogue: Commercializing Queer Affect in First World War-era Fashion Photography” versuchte Elspeth H. Brown eine moderne Analyse dieser revolutionären Tendenzen in der Fashion Photographie. Sie sieht in der Ästhetik de Meyers eine ›queere‹ transatlantische Gegenkultur unter Bezugnahme auf seine Homosexualität. Auch wenn der Piktorialismus bereits am Schwinden war, dieser wie auch die Kunstphotographiebewegung bahnten den Weg zu klaren Linien und einem geschulten Auge. Und so trug auch die opponierende andersgeartete Gefühlswelt zu diesem Übergang bei. De Meyers Beitrag spielte eine wichtige Rolle für die Transformation zur modernen Modephotographie. Wie Brown feststellte, war er Teil eines effeminierten ästhetischen Zirkels, zu dem auch Carl van Vechten und andere Kreative gehörten. Ein Ölgemälde von Florine Stettheimer aus dem Jahr 1923, in welchem sie den Photographen selbst in der Rolle eines Models mit weiblichen Attributen zeigt, mag dies verdeutlichen.
8 FLORINE STETTHEIMER. Adolph de Meyer. 1919
Beeinflusst von der Kunstphotographie-Bewegung, die das Gefühl höher bewertete als den Realismus, gab es also eine Art ›queeres‹ Zartgefühl, das von einem Gefühlsüberschwang durchdrungen war, den José Esteban Muñoz mit ›affective excess‹ umschrieb. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch de Meyers gewähltes Pseudonym „Gayne“, welches wohl vom Wort ›gay‹ inspiriert war, was in der Zeit ›fröhlich‹, ›vergnügt‹ hieß, aber im übertragenen Sinn auch ein Codewort für ›ausschweifend‹ war. Er wurde im 19. Jahrhundert vor allem von Frauen verwendet. Die moderne Bedeutung ›homosexuell‹ kam erst später auf.
Zum anderen zeigte sich eine Kommerzialisierung der ästhetischen Gefühle, die eine zentrale Rolle in der Modephotographie zu spielen begann. In diesen Bildern kündete sich aber ebenso ein moderner Stil an, der den Piktorialismus überwand. In einigen zeigte sich bereits ein Verzicht auf die sonst übliche barocke Verspieltheit.
De Meyer hatte sich inzwischen ein fundamentales Wissen in Bezug auf Lichtsetzung, tonale Abstufungen und Bokehs angeeignet, um die gewünschten Emotionen in ästhetische Photographien umzusetzen. Er nutzte eine ausgefeilte Technik, unter anderem ein Gegenlicht, um die Wangenknochen herauszuformen, und ein Halo für das Haar. Er experimentierte mit künstlichen Lichtquellen, Flutlichtern, Reflektoren, Spiegeln, und einem Unterlicht, um mit der Technik atmosphärische Innenporträts und Stillleben zu erreichen. Als Edward Steichen 1922 de Meyer als Condé Nasts Chef-Hausphotographen ersetzte, war dieser überwältigt von dem aufwendigen Equipment, das ihm der Chef-Assistent James McKeon überließ. Steichen hatte zuvor nur mit natürlichen Lichtquellen gearbeitet.(12)
9 ADOLPH DE MEYER. Rose Dolores (Ziegfeld Girl), 1919
10 ADOLPH DE MEYER. Lady Ottoline Morrell, 1919
11 ADOLPH DE MEYER. Ann Andrews, Vogue 1921
12 ADOLPH DE MEYER. Irene Castle, 1921
13 ADOLPH DE MEYER. Charlie Chaplin, 1921
14 ADOLPH DE MEYER. Gloria Swanson, 1921
Meist ging es de Meyer nicht primär um Modephotographie, sondern vielmehr darum, ein Ideal von weiblicher Schönheit zu kreieren, einen Inbegriff von Sanftheit, Luxus und Romantik. Darüber hinaus machte er Porträts von prominenten Charakteren wie John Barrymore (1918), Charles Chaplin (1920), Anna Pavlova, Jeanne Eagles (1921), Eugene O’Neill sowie dessen Frau Carlotta Monterey (1929).
1922 nahm Adolph de Meyer ein Angebot des Harper’s Bazaar an und ging zurück nach Paris, wo er dessen Chef-Photograph wurde. Die de Meyers kauften ein großes Haus in der Faubourg Saint-Germain und pflegten den Kontakt zur Pariser High Society. Unter anderem freundeten sie sich mit dem Comte Ètienne de Beaumont an, auf dessen berühmten Bällen sie geladene Gäste waren. Sie machten Bekanntschaft mit Misia Edwards und Coco Chanel. Insbesondere aber auch mit Prinzessin Eugène Murat, die eine Yacht besaß. Häufig lud sie Adolph und Olga zu gemeinsamen Seereisen ein. Des Weiteren pflegten sie Kontakt mit Eugène de Rothschild. Reisen führten sie nach Indien, Ägypten und Tunesien. Hier verbrachten sie einige Zeit mit ihrem Freund Georges Sébastian, der sich dort in Hammamet einen Palast im Stile von Tausend und einer Nacht erbauen ließ. Zweimal im Jahr war der Baron in New York City und hielt sich über die Wintermonate in Palm Springs auf. 1923 wurde sein Gehalt bei Harper’s Bazar verdreifacht. 1927 machte er Werbeaufnahmen für Elisabeth Arden.
15 ADOLPH DE MEYER. Coco Chanel, 1923
16 ADOLPH DE MEYER. Comte Étienne de Beaumont, ca. 1923
17 ADOLPH DE MEYER. Natica Nast Warburg, Tochter von Condé Nast, circa 1925
In den 30er Jahren jedoch wurde ihm bewusst, dass es ein Fehler gewesen war, die Vogue für den Bazar verlassen zu haben, da Hearsts Unternehmen von der Großen Depression getroffen wurde und Einsparungen tätigen musste. Die jungen Photographen, die ihn dort ersetzten, hatten modernere Ansichten, waren nicht wie er in esoterischer Spiritualität befangen, sondern hatten den neuen Zeitgeist verinnerlicht, die Straight Photography auch im Bereich der Modephotographie umgesetzt. Sie waren vom Symbolismus und Surrealismus beeinflusst. Die ästhetische, aristokratische Welt galt als überholt. Die de Meyers waren schon über fünfzig und konsumierten regelmäßig wie auch andere Vertreter der Bohème gemeinsam mit Freunden Opium, die Modedroge, welche sich in den Zwanziger Jahren etabliert hatte. Vielleicht wollten sie sich eine Welt der Illusion erhalten, in der die Jugend ewig zelebriert wird. Ihr Leben vernebelte sich mehr und mehr und Olgas Wesen veränderte sich. Zwar war sie schlank und elegant wie immer, aber man bescheinigte ihr Gehässigkeit. Zum Freundeskreis der de Meyers zählte auch Maxine Elliott, die in früherer Zeit häufig als die schönste Frau der Welt bezeichnet wurde. Sie trafen Cocteau, der dem Kokain zugetan war und Romaine Brooks, die sich in einer lesbischen Beziehung mit Natalie Barney befand. Das Leben der Bohème bekam den de Meyers nicht. Im Jahr 1931 starb Olga mit neunundfünfzig Jahren an einem Herzinfarkt in einem österreichischen Krankenhaus während eines Drogenentzugs.(13) Die Karriere des Barons war am Schwinden. Die legendäre Chefeditorin Carmel Snow bemerkte, dass de Meyers photographischer Stil überholt war und kündigte ihm im Jahr 1932. Geld stellte nicht das Problem dar, es war nach wie vor reichlich vorhanden. 1932 mietete der Baron ein Haus an der Riviera, zog sich aber nicht aus dem öffentlichen Leben zurück. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1938 zog de Meyer erneut in die Vereinigten Staaten. Er starb in Los Angeles im Jahr 1949. Einige seiner Aufnahmen überstanden die Kriegszeiten, die meisten wurden zerstört. Diejenigen, die überliefert wurden, blieben im kollektiven Gedächtnis. Cecil Beaton nannte Adolph de Meyer später den Debussy der Photographie.(14)
18 BARON ADOLPH DE MEYER. Werbung für Kosmetik von Elizabeth Arden, 1929.
19 BARON ADOLPH DE MEYER. Mrs. Eugene O’Neill, Carlotta Monterey, 1929
1 Vogue – Die Illustrierte Geschichte des berühmtesten Modemagazins der Welt, Einleitung XIX.
2 Ebenda, S. 22.
3 Ebenda, S. 59.
4 Caroline Seebohm: The Man who was Vogue – The Life and Times of Condé Nast, S. 1-3.
5 Vogue – Die Illustrierte Geschichte des berühmtesten Modemagazins der Welt, S. 28.
6 Olga wurde 1871 in London als Olga Maria Beatrice Caracciolo dei Duchi di Castelluccio geboren. Sie war, wie sich später herausstellte, eine nichteheliche Tochter des britischen Königs Edward VII. Ihr erster Mann war der Aristrokrat Mariano di Brancaccio.
7 Luisa Casati (1881 – 1957) war eine italienische Erbin, Muse und Mäzenin der Künste im Europa des frühen 20. Jahrhunderts. Als Berühmtheit und Femme Fatale dominierten und erfreuten die berühmten Exzentrizitäten der Marchesa die europäische Gesellschaft fast drei Jahrzehnte lang. Sie veränderte ihr Aussehen dramatisch, um eine bezaubernd schöne Figur aus einem bizarren Märchen zu werden. Sie trug lebende Schlangen als Schmuck und war berüchtigt für ihre Abendspaziergänge; nackt unter ihren Pelzen, während sie Geparden an diamantbesetzten Leinen zur Schau stellt. Nackte, mit Blattgold vergoldete Diener begleiteten sie. An ihrem Esstisch saßen bizarre Wachsfiguren als Gäste, von denen einige angeblich die Asche vergangener Liebhaber enthielten. Ohne Frage war die Marchesa die skandalöseste Frau ihrer Zeit. Sie wurde eine Muse für italienische Futuristen, fesselte Künstler und Literaten und ließ zahlreiche Porträts von verschiedenen Künstlern malen und modellieren. Sie posierte für Photographien von Man Ray, Cecil Beaton und Baron Adolph de Meyer. Viele von ihnen bezahlte sie, um „ihre eigene Unsterblichkeit in Auftrag zu geben”. Sie ist berühmt für ihren Ausspruch: „Ich möchte ein lebendiges Kunstwerk sein”.
8 Hierbei handelt es sich um ein Holzhaus, welches auch die Pashas als Sommerresidenzen nutzten.
9 Gertrude Vanderbilt war eine bedeutende amerikanische Bildhauerin und Kunstmäzenin und Enkelinvon Cornelius Vanderbilt, einem der erfolgreichsten und reichsten Unternehmer der Vereinigten Staaten. Im Alter von 21 Jahren ehelichte sie den reichen Kaufmann und Sportler Harry Payne Whitney. Auf einer Parisreise im Jahr 1900 lernte sie Auguste Rodin kennen, bei dem sie die Bildhauerei erlernte. Sie unterhielt schließlich je ein Atelier in Paris und eines in Old Westbury, Long Island, New York. Später stiftete sie das Whitney Museum of American Art in New York City. Ihr Vater, der einflussreiche Millionär und Geschäftsmann Cornelius Vanderbilt, hatte im Jahr 1892 die Entstehung der Vogue gefördert, worauf zurückzuführen ist, dass ihr Photo ausgewählt wurde.
10 Elspeth H. Brown: De Meyer at Vogue: Commercializing Queer Affect in First World War-era Fashion Photography, S. 259.
11 Ebd., S. 267.
12 Penelope Niven: Steichen – A Biography, S. 513.
13 Vgl. Philippe Julian: De Meyer. In: Robert Brandau: De Meyer, S. 46.
14 Eine ausführliche Biographie über Adolph de Meyer schrieb Boris von Brauchitsch.
20 ALFRED STIEGLITZ. Georgia O’ Keeffe, circa 1916
Kapitel II
Amerikanische Moderne
Es entwickelte sich eine photographische Moderne, und das Interesse der Öffentlichkeit verlagerte sich auf schärfer fokussierte Bilder. Einige bedeutende Photographen des 20. Jahrhunderts begannen ihren künstlerische Karriere als Piktorialisten, wechselten jedoch in den 20er und 30er Jahren zu einer scharf fokussierten Photographie. Sie nutzten Stilmittel wie Abstraktionen, harte Kontraste sowie Nah- und Detailaufnahmen. Der Begriff der Straight Photography kam erstmals auf.
Zunächst beschäftigen wir uns mit Alfred Stieglitz in seiner Spätzeit. Die Photo-Secession ließ er hinter sich, nachdem sich einige Künstler von ihm abgewandt hatten. Stattdessen widmete er sich verstärkt der Aktphotographie. Mit der Künstlerin Georgia O’ Keeffe verband ihn eine innige Freundschaft, sie diente ihm als Model für seine Studien.
Dann widmen wir uns Clarence Hudson White. Er hatte in Kanaan, Connecticut mit der Clarence H. White School of Photography einige Photographen ausgebildet. Unter ihnen war zum Beispiel Paul Outerbridge. Auch werden Margaret Watkins, Arnold Genthe und Nickolas Muray behandelt. Andere Wege beschritten die Photographen Edward Weston und Imogen Cunningham an der West-Coast. Zuletzt gehen wir auf den Künstler Man Ray ein, der sich mit dem New York Dada zwar nicht im Bereich Fashion und Beauty Photographie betätigte, hier aber der Vollständigkeit halber mit behandelt wird. Erst später in seiner Pariser Zeit tritt er als Modephotograph in Erscheinung.
Straight Photography
Die Straight Photography versucht eine Szene oder ein Motiv möglichst scharf und detailliert wiederzugeben, und zwar in Übereinstimmung mit den Eigenschaften der ihr inhärenten Technik, die sie von anderen visuellen Medien, insbesondere der Malerei, unterscheidet. Sie bezog sich auf alle Sujets, wie beispielsweise die Landschaft- und Aktphotographie. Der bereits 1904 entstandene Begriff wurde vom Kritiker Sadakichi Hartmann in der Zeitschrift Camera Work zum ersten Mal verwendet und später von ihrem Herausgeber Alfred Stieglitz in Bezug auf den Piktorialismus als eine reinere Form der Photographie beworben. Insbesondere Stieglitz und Paul Strand machten die Straight Photography populär. In den 30er Jahren wurde sie dann zu einem Markenzeichen der Künstler der sogenanntem West Coast Photographic Movement.
Vom Ende der Photo-Secession und einem Pas de Deux
Wie bereits in Band I beschrieben, betrieb Alfred Stieglitz (1864–1946) zusammen mit Edward Steichen seit dem Jahr 1905 in New York eine kleine Photogalerie, die Little Galleries of the Photo-Secession, die spätere legendäre Galerie 291, in der die beiden anfangs die bekannteren Photographen und Mitglieder der Bewegung ausstellten, unter anderem Robert Demachy, Constant Puyo and René Le Bégue, Gertrude Käsebier, Clarence H. White, sowie sich selbst. Die Galerie war zunächst sehr erfolgreich. Vierteljährlich erschien das aufwendig gestaltete Magazin Camera Work. 1906 zog Steichen nach Paris und betätigte sich fortan als Art-Scout. Von ihm stammte die Idee, nicht nur Photographen, sondern allgemein moderne Kunst zu zeigen und eine Rodin-Ausstellung zu arrangieren. Zwischenzeitlich schob Stieglitz eine Ausstellung von Pamela Colman Smith ein; einer Künstlerin, die sich auf okkulte Malerei spezialisiert hatte und unter anderem Tarotkarten gestaltete. Dies war realiter die erste nicht-photographische Ausstellung. Das verzieh ihm Steichen zeitlebens nicht, denn nun sah es so aus, als wäre der Richtungswandel zur Kunstgalerie der Moderne mit Smith erfolgt und somit Stieglitz’ Verdienst.(1) Es folgte dann zwischendurch wieder eine Photoausstellung mit Adolph de Meyer. Die Ausstellung mit erotischen Zeichnungen von Rodin im Jahr 1907/08 schockierte die amerikanische Öffentlichkeit. Diverse Mitglieder der Photo-Secession waren mit der Umstellung auch auf Exponate der progressiven bildenden Kunst nicht einverstanden. Einige kündigten das Magazin Camera Work. 1908 erhöhte dann auch noch der Eigentümer die Miete der Galerie um das Vierfache und verlängerte die Vertragslaufzeit. Stieglitz sah sich deswegen gezwungen, die Galerie zu schließen. Nur mit Hilfe von Paul Haviland, der die Rodin-Ausstellung gesehen hatte, wurde sie in einem kleinen Raum direkt gegenüber der alten Galerie neu eröffnet. Es folgten Ausstellungen von Matisse (1908), Henri Rousseau (1910), Cézanne, Picasso (1911), Picabia (1913) und Brâncuși (1914). In Konkurrenz zu Stieglitz’ Photo-Secession gründete Clarence Hudson White im Jahr 1910 die Seguinland School of Photography in Maine und dann ab 1914 die Clarence Hudson White School of Photography in New York. Die Abspaltung von Day, White, Käsebier und Coburn enttäuschte Stieglitz stark. Hinzu kam, dass die Ehe mit Frau Emmy, mit der er seit 1893 verheiratet war, schon immer kriselte. Sie teilte seine Begeisterung für Kunst und Kultur nicht. Auch wenn sie sich bemühte, ein Interesse für Alfreds Arbeit zu zeigen, waren diese Anstrengungen nicht von Erfolg gekrönt. Da sie ihm nicht genug beistand, verachtete und bestrafte er sie, in dem er mit jeder hübschen Frau flirtete, die seinen Weg kreuzte. Auch Alfreds Beziehung zur Tochter Kitty war kompliziert. Als Modell für sein Langzeitprojekt eines photographischen Tagebuchs wollte sie ihrem Vater nicht weiter zur Verfügung stehen. Sie sah ihn nur selten und favorisierte ihre Mutter. Alfred nahm dies seiner Tochter übel. Eines Tages kam Agnes Ernst in die Galerie. Sie war 21 Jahre, jung und schön, arbeitete als Reporterin für die New York Morning Sun. Es erschien ein sehr guter Artikel über Stieglitz, der sie fortan das Sun Girl nannte.(2) Mit der Malerin und Feministin Katharine Rhoades und der Malerin Marion Beckett wurde Agnes als „die drei Grazien” des Alfred-Stieglitz-Kunstkreises bekannt. Sie standen Modell für die Photographien von Stieglitz und Steichen.(3)
21 Künstler am Mount Kisco, von links nach rechts: Paul Haviland, Abraham Walkowitz, Katharine Rhoades, Emmy Stieglitz, Agnes Meyer, Alfred Stieglitz, John Barrett Kerfoot, John Marin, 1912
Im Gedicht „One Hour Sleep – Three Dreams”, hat Stieglitz sein Beziehungsdilemma thematisiert.(4) Im ersten Traum hieß es: „Ich sollte begraben werden. Die ganze Familie stand über mir. Ebenfalls hunderte Freunde...Eine Tür öffnete sich und eine Frau kam herein. Ich stand auf und meine Augen öffneten sich.” Bei der Frau handelte es sich um Katharine Rhoades. Im Porträt, das Alfred im gleichen Jahr von ihr machte, schaut sie den Photographen sehnsüchtig an, während sie den Türpfosten erotisch berührt, als würde sie seinen Körper sanft liebkosen. Stieglitz war verliebt in sie, aber gleichzeitig durch ihr Wesen eingeschüchtert.
22 ALFRED STIEGLITZ. Katharine Rhoades, 1915
Im zweiten Traum heftete eine andere Frau ihren Blick auf ihn, eventuell handelte es sich um die mysteriöse Miss S.R., die er in früheren Jahren in Europa kennengelernt hatte und fragte, ob er wirklich tot sei und beerdigt werden würde, aber er konnte nicht antworten. Er hatte Angst, nun seine Chance auf ein neues Leben verpasst zu haben. Im dritten Traum erzählte eine nicht identifizierbare Frau von ihrem verzweifelten Leben und einer unerfüllbaren Liebe zu einem Mann. Sie küsste ihn, weinte und schrie verwirrt: „Warum bist Du nicht er, sag es mir. Du bist er. Und wenn nicht, Dann werde ich Dich töten, da ich Dich geküsst habe.” Dann nahm sie ein Messer und stach ihm ins Herz. Als sie sich umdrehte, stand an der weißen Wand in blutroten Lettern geschrieben: „Er tötete sich selbst. Er hat die Küsse verstanden.” In dem Moment wachte Stieglitz auf. Er sah sich wieder mit der Realität konfrontiert.(5) Auch entstanden einige Porträts von Marie Rapp. Sie war Alfred Stieglitz’ Sekretärin in seiner Galerie 291.
23 ALFRED STIEGLITZ. Marie Rapp, 1915
Steichen kam aus Europa mit Drucken von Matisse zurück, die dann im Jahr 2010 ausgestellt wurden. Die Presse zeigte sich schockiert angesichts der Zeichnungen von weiblichen Körpern.(6) Auch Gertrude Vanderbilt Whitney, die vermögende amerikanische Bildhauerin und Kunstmäzenin, besuchte die Ausstellung. Sie hatte eine Galerie in Greenwich Village. Stieglitz war zeitlebens nicht gut auf sie zu sprechen, da sie ihm die Skulptur Serf von Matisse nicht abgekauft hatte.(7) Später gründete sie den luxuriösen Whitney Studio Club, den Stieglitz missbilligte, obwohl einige seiner Freunde dort durchaus verkehrten.
Stieglitz hatte nicht nur tolle Stadtansichten photographiert, er war auch ein hervorragender Porträtist. Von Künstlern, die in seiner Galerie ein und aus gingen, machte er oft aus einer spontanen Laune heraus eine Photographie. Francis Picabia, Charles Demuth, Marsden Hartley, Marcel Duchamp, Sherwood Anderson, Waldo Frank, John Marin, Arthur Dove – alle standen vor seiner Kamera. Als ihm sein Freund Frank Crowninshield, der seit 1914 beim Vanity Fair als Editor tätig, bot ihm an, jeden Monat eines seiner Porträts zu publizieren. Stieglitz lehnte ab und verwies auf Adolph de Meyer.(8)
24 ALFRED STIEGLITZ. Marsden Hartley, 1915
In dieser Zeit faszinierte Stieglitz zunehmend die modernere visuelle Ästhetik der Photographie und ließ sich unter anderem vom Maler Charles Sheeler und vom Photographen Paul Strand beeinflussen. Ihm wurde bewusst, was sich in der avantgardistischen Malerei und Bildhauerei abspielte, und kam zum Ergebnis, dass der Piktorialismus nicht länger die Zukunft darstelle, sondern der Vergangenheit angehöre. In den letzten fünf Jahren der Galerie stellte er nur drei Photographen aus. Baron de Meyer (1911), sich selbst (1913) und den schon genannten Paul Strand (1916).(9)
Während des Ersten Weltkriegs wurde die Galerie 291 zum wichtigsten Forum der europäischen Avantgarde und zur sprichwörtlichen Triebfeder des internationalen Dadaismus. Man kann sagen, dass sich Stieglitz neu erfand. 1915 schlugen Haviland, Agnes E. Meyer, de Zayas und weitere Mitarbeiter der Galerie vor, ein avantgardistisches Kunst- und Literaturmagazin herauszugeben. Haviland wurde als treibende Kraft einer der Herausgeber und Autoren des Magazins, das wie die Galerie 291 betitelt wurde.
25 FRANCIS PICABIA. Ideal –Here, this is Stieglitz here / faith and love, 1915
Picabia porträtierte de Zayas, Haviland und Stieglitz als Maschinen und nannte sie mechanomorphische Porträts. Stieglitz erhielt das Aussehen einer Kamera-Konstruktion. Es handelte sich um eine Art Apparat mit einer Art Funktionsstörung, denn es gibt in der Zeichnung keine Verbindung des Balgens mit der Linse. Vielmehr bog er sich um 90 Grad nach links. Auch hatte der Apparat Ähnlichkeit mit einem Auto, ein roter Hebel könnte einen Schaltknüppel darstellen. Picabia war Autoliebhaber. Auch ein schweres Baufahrzeug könnte hineingesehen werden. Über der Linse stand das Wort IDEAL. Das ist dasjenige, was eingefangen werden soll, jetzt aber auf etwas anderes zeigt. Der Balgen fängt etwas anderes ein. Stieglitz sympathisierte mit dem Gedanken, dass Maschinen eine neue moderne Welt schaffen. In seinen Photos hatte er stets die frühe Moderne im Umbruch festgehalten. Thematisch hatte er sich vielleicht aber bereits auf etwas Neues eingestellt. Eine Kombination aus rätselhaften Untertiteln lautete „Ici, c’est ici Stieglitz / foi et amour (Hier, das ist Stieglitz hier / Glaube und Liebe)”. Die Zahl 291 verweist auf die Galerie, das Ende wurde von Steichen vorausgesagt. Die Ausgabe 7–8 zeigte Stieglitz’ Photo The Steerage mit Kommentaren über die Bedeutung von Maschinen. Die Zusammenarbeit der Künstler zerbrach jedoch schon bald wieder, als diese sich von ihm abkoppelten und die Modern Gallery in der 500 Fifth Avenue eröffneten. Stieglitz war hierüber sehr verärgert.
Sowohl Stieglitz als auch Strand nutzten eine 4x5 Inch Graflex und eine 8x10 Inch View Camera für aufwendigere Aufnahmen und machten Platin und Palladium Abzüge. Später kamen Silber Gelatine Prints hinzu. Das Model musste drei bis vier Minuten stillhalten. Das Verfahren ist sehr aufwendig und umständlich. Die modernen Zeiten brachten einfachere Möglichkeiten für Photographen. Dennoch hielt Stieglitz lange an seinem herkömmlichen Workflow fest.
26 ALFRED STIEGLITZ. Ellen Koeniger am Lake George, 1916
Im Sommer 1916 machte Stieglitz am Lake George eine Photoserie mit Ellen (Koeniger) Morton in einem nassen Badeanzug. Sie war die Nichte von Frank Eugene. Stieglitz liebte es, junge Frauen zu photographieren. Diese Aufnahmen waren Schnappschüsse. Von Ellen machte er gleich eine ganze Serie. Ihr schwarzer Badeanzug schmiegte sich ihrem Körper an. Die Aufnahmen sind gewagt, enthüllend und geben alles preis, der Körper wird hier zum Objekt, die Sprache ist radikal. Ellen wirkt sehr athletisch. Stieglitz nahm diese Bilder in seine Ausstellungen auf. Sie hatten für ihn eine Seele, waren modern, beziehungsweise straight. Stieglitz Begeisterung für die Moderne zeigte sich unter anderem in seiner Bewunderung für Maschinen. Auch Kameras waren solche Maschinen. Stieglitz und seine Freunde diskutierten viel darüber, was für eine Funktion diese Maschinen hätten, in welchem Verhältnis sie zum Menschen stünden, und auch Fragen der Männlichkeit und Potenz wurden in diesem Zusammenhang gestellt. In einem Brief an O’Keeffe schrieb Stieglitz: „Maschinen haben großartige Seelen. Ich weiß es, hab es immer gewusst. Aber man muss ihnen die Chance geben, sich zu zeigen. Menschen stören zu sehr und haben keinen Glauben.”(10)
Auch wurden diese Diskurse im Kontext der aufblühenden Psychologie um Freud geführt. Die Kamera galt ihnen als Teil bzw. Verlängerung des Körpers, als phallisch, und sie würde sogar Gefühle haben. Die Metapher der Impotenz nutzte er, um eigene Fehldrucke oder misslungene Photos zu beschreiben.(11) Ob er dabei auch an solche Bild wie die von Ellen Koeniger dachte, führte er nicht näher aus. Dies vermutete jedoch der Photohistoriker Weston Naef. Laut diesem setzte Stieglitz in Anlehnung an Freud die Seele auch mit der Libido gleich, um seiner Sehnsucht nach Photographien junger Frauen in den Momenten der Stille während der Besuche am Lake George Ausdruck zu verleihen.(12)
In diese Zeit im Frühjahr 2016 fiel die Bekanntschaft mit Georgia O’Keeffe. Mit ihrer Freundin Anita Pollitzer hatte sie an der Columbia University in New York Kunst studiert. Anita zeigte Stieglitz ein paar von Georgias Kohlezeichnungen. Dieser war begeistert und stellte sie neben denen zweier anderer junger Künstler aus. Eines Tages erschien Georgia in der Galerie. Ihre schlanke Erscheinung fiel sofort auf. Sie trug ein einfaches schwarzes Kleid mit weißem Kragen. Mit einer Art Mona-Lisa-Lächeln auf den Lippen, so Stieglitz, stellte sie sich vor und verlangte, ihre Bilder von der Wand zu nehmen. Dieser meinte daraufhin, sie hätte genauso wenig Recht dazu, die Bilder zurückzuhalten, wie wenn sie ein Kind vor der Welt verstecken würde, welches sie geboren hätte. Er lud sie daraufhin zum Lunch ein und überzeugte sie, die Kunstwerke hängen zu lassen und auch weitere zu schicken, worauf sie sich dann auch einigten.(13)
Stieglitz hatte einige Briefe an Georgia geschrieben, die zu dieser Zeit in Amarillo, Texas war, wo sie als Kunstlehrerin arbeiten wollte. Auch schickte er ihr Bücher sowie Ausgaben seines Magazins Camera Work. Zeitweise fand sie sein Eindringen in ihr Leben sehr beängstigend.(14) Sie schickte aber dennoch wie versprochen weitere Arbeiten von sich und im Frühjahr 1917 hatte sie ihre erste Einzelausstellung in der Galerie. Zeitgleich fand die Big Show im New Yorker Grand Central Palace statt, organisiert von der neu gegründeten American Society of Independant Artists, bei der 2000 Kunstwerke ausgestellt wurden. Unter Pseudonym wurde dort ein auf einem Sockel liegendes Urinal eingereicht, signiert von R. Mutt. Die Jury lehnte das Objekt allerdings ab, mit der Begründung, es würde sich nicht um ein Kunstwerk handeln. Daraufhin trat Duchamp, der sich später als Urheber des Werkes ausgab, aus der Vereinigung aus. Man Ray und Duchamp beförderten das Ready Made in Stieglitz Galerie, – O’Keeffes Ausstellung lief noch–, und stellten es vor ein Gemälde von M. Hartley. Alfred Stieglitz persönlich photographierte das Exponat. Duchamp äußerte sich in Bezug auf das Werk, welches unter dem Namen Fountain bekannt wurde, mit den Worten: „Schönheit ist überall dort, wo Du sie entdecken möchtest”, und Stieglitz bemühte sich, diese Schönheit der Form photographisch einzufangen. Das so entstandene Photo wurde später in dem Magazin The Blind Man gedruckt.
O’Keeffe war unterdessen aus Texas angereist, um bei ihrer eigenen Ausstellung anwesend zu sein. Als sie in New York ankam, waren ihre Bilder jedoch bereits abgehängt. Über Stieglitz machte sie viele neue Kontakte. Zu Paul Strand entwickelte sie eine besondere Sympathie. Ein weiterer Freund von Stieglitz, Henry Jacques Gaisman hatte die Autographic Camera erfunden. Indem man eine kleine Tür auf der Rückseite des Kameragehäuses öffnete, konnte man Aufnahmedaten wie den Namen oder das Datum direkt auf den Film schreiben. George Eastman hatte ihm das Patent 1914 für 300000 $ abgekauft. Gaisman fuhr Stieglitz, O’Keeffe und Strand zum Vergnügungspark nach Coney Island. Am Abend teilte Stieglitz mit, dass er seine Galerie schließen müsse.
Während der nächsten Woche machte Stieglitz die ersten Porträts von Georgia in der Galerie vor einem ihrer großen Aquarelle, die er für sie kurzzeitig wieder an die Wand gebracht hatte. Auch photographierte er ihre Hände. Vielleicht war es sein Wunsch, dass sie ein strenges schwarzes Kleid mit weißem Kragen trug, der Kombination, die ihn seit seiner Kindheit so entzückte. Die junge Lehrerin aus der Provinz guckt in zwei der überlieferten Bilder direkt in die Kamera. In dem einen lächelt sie, im anderen ist sie nachdenklich. Mit der eng anliegenden Helmfrisur sieht sie aus wie eine amerikanische Joan d’Arc, die soeben von ihrer Berufung erfahren hat.(15)
27 ALFRED STIEGLITZ. Georgia O’ Keeffe, 1917
Ein paar Tage später kehrte sie nach Texas zurück. Ihrer Freundin teilte sie mit: „Ich musste einfach gehen, Anita – es gab keinen anderen Ausweg – und ich bin froh, dass ich ging.”(16) Ihre Gefühle waren noch nicht so ausgeprägt, aber Alfred war bereits verliebt. Er schickte ihr die Aufnahmen.
Mit Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage. Die Galerie musste er nun aus finanziellen Gründen schließen. Satt dessen mietete er für mehrere Monate einen Raum im Stockwerk unter den nunmehr verlassenen Ausstellungsräumen an, den er die Gruft nannte. Das Magazin Camera Work wurde eingestellt. Die kostspieligen Gravuren, die von dem in Deutschland ansässigen Goetz gefertigt wurden, konnten nicht mehr geliefert werden. Die letzten 1000 Exemplare des Magazins verbrannte Stieglitz, da sich keine Käufer mehr fanden. Er musste sich umorientieren. Den Sommer über verbrachte er wie immer am Lake George, hatte jedoch keine produktive Phase. Die Arbeit der letzten 20 Jahre war an einem Endpunkt angelangt. Hinzu kamen wie immer die Probleme mit seiner Frau Emmy. Außerdem belastete ihn der Krieg psychisch, da dieser die Amerika gegen die Deutschen aufwiegelte. Stieglitz hatte aber deutsche Vorfahren und seine Ansichten waren eher pro-deutsch, was ihn in der Künstlerszene zusätzlich isolierte. Zu seinem jetzigen Freundeskreis zählten nun vor allem diejenigen, die sich aus der politischen Ebene heraushielten oder Pazifisten waren. Steichen, der in der Abteilung für Luftaufklärung in der US Army tätig war, wandte sich von Stieglitz ab. Stieglitz’ Ruhm in New York gehörte der Vergangenheit an. In dieser Zeit verstärkte er die Korrespondenz mit O’Keeffe. Diese schrieb ebenfalls mit Strand Briefe. Auch sie litt zunehmend an einer depressiven Verstimmungen. Im Vorjahr war ihre Mutter verstorben. Anfang des Jahres 1918 erkrankte Georgia zudem noch an der Spanischen Grippe, die in Amerika tobte. Gemeinsam mit einer ebenfalls erkrankten Freundin, die in Texas wohnte, wollte sie die Krankheit auskurieren. Stieglitz schickte Strand, um sie nach New York zu holen mit dem Vorschlag, ihr ein Atelier einzurichten, in dem sie malen könne. Auch hatte Elizabeth, Alfreds Nichte, einen Brief an O’Keeffe geschrieben, in dem sie ihr mitteilte, was Stieglitz für sie empfände und dass sie doch kommen solle. Strand blieb gleich einen ganzen Monat in Texas. Im Juni 1918 dann kamen die beiden mit dem Zug. Sie wohnte zunächst in Elizabeths Studio in der East Fifty-Nineth Street Nr. 114 und war noch sichtlich von ihrer Krankheit geschwächt. Noch im gleichen Monat machte Alfred von ihr Aufnahmen. Das Verhältnis zu seiner Frau Emmy hatte nun ebenfalls einen Endpunkt erreicht. Sie warf Alfred aus der gemeinsamen Wohnung in der Madison Avenue Nr. 1111 hinaus.(17) Hier hatten sie bereits seit 1898 sie gewohnt. Auch sein Studio befand sich dort. Er transportierte dann seine Habe in Elizabeths Studio, der Tochter von Alfreds Bruder Leopold (Lee), der Physiker war. Jenes befand sich in der East 59th Street Nr. 114, wo auch Georgia untergekommen war. Elizabeth hatte ebenfalls Kunst studiert. Hier wurden die Shootings mit Georgia fortgesetzt. Während sich Georgia selbstbewusst der Kamera präsentierte, wurde ihre Person auf Film gebannt. Es war nicht klar, wer die Pose bestimmte, Georgia oder Stieglitz. Sie liebte es, sich die Bilder anzuschauen und sich dabei selbst zu entdecken.(18