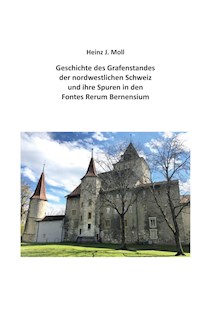
Geschichte des Grafenstandes der nordwestlichen Schweiz und ihre Spuren in den Fontes Rerum Bernensium E-Book
Heinz Moll
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Grafen in der Schweiz? Aber sicher! - Obwohl das Bestreben nach einer Demokratie und damit nach der Abschaffung von ständischen Hierarchien vor allem in den Stammlanden der Schweiz schon sehr früh einsetzte, gehörte noch lange Zeit praktisch alles den fürstlichen Magnaten und ihren Amtsträgern: Die Landleute hatten absolut nichts zu sagen und schon gar nicht mitzubestimmen. Von ehemaligen Beamten zu Fürsten empor-gestiegene Gaugrafen übten zweitweise eine besonders weitgehende Macht aus und machten sich dabei die Dienste von Ministerialen (Dienstadligen) zu Nutze, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig waren. Weil es den Rahmen einer gesamtschweizerischen Darstellung sprengen würde, beschränkt sich das vorliegende Werk auf das Gebiet der nord-westlichen Schweiz (BE, BL, FR, JU, NE, SO). Verschiedene Autoren haben die Geschlechter und Familien der seiner-zeitigen Grafen in der Schweiz schon vor langer Zeit in der Fachliteratur beschrieben. Das vorliegende Werk zitiert unter anderem Publikationen, die - wenn überhaupt - nur noch in wenigen Bibliotheken zu finden und wegen ihres Alters grösstenteils in Vergessenheit geraten sind. Ausgewählte Stellen aus Publikationen zum vorliegenden Thema weisen die Interessierten auf weiterführende Literatur hin, wo detaillierte Informationen in Wort und Bild zu finden sind. Lehrpersonen von Sekundar- und Fachmittelschulen sowie von Gymnasien möchte ich animieren, auf der Grundlage dieses Buches die Geschichte des Mittelalters, insbesondere der nordwestlichen Schweiz, zu thematisieren: Durch Exkursionen zu den nahen gelegenen Stätten der damaligen Burgen, Schlösser und Herrschaftshäuser, die teilweise nur noch als Ruinen zu sehen sind, kann der Geschichtsunterricht direkt vor Ort und damit sehr anschaulich durchgeführt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank
Allen Personen und Institutionen, die diese Publikation unterstützt haben, spreche ich hiermit meinen herzlichen Dank aus.
Ittigen b. Bern, im August 2021 Dr. Heinz J. Moll
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1.
Aarberg
2.
Bechburg
3.
Buchegg (-Kyburg)
4.
Falkenstein
5.
Hasenburg - Fenis
6.
Hasenburg - Olti(n)gen
7.
Froburg
8.
Greyerz
9.
Homberg-Thierstein
10.
Laupen-Sternenberg
11.
Neuenburg-Valangin
12.
Nidau
13.
Romont
14.
Soyhières (Saugern)
15.
Strassberg
16.
Grafschaft Bargen
17.
Grafschaft Härkingen
Literatur- und Quellenverzeichnis
Übersichtskarte der Standorte
[Karte: swisstopo]
Abkürzungen:
A.
Aussteller (einer Urkunde)
Anh.
Anhang
Ausg.
Ausgabe
BBB
Burgerbibliothek Bern
Bd.
Band
Fontes Rerum
Bernensium (FRB)
Quellensammlung zur bernischen Geschichte, die mit antiken Quellen zum heutigen bernischen Raum beginnt und vor allem mittelalterliche Urkunden bis ins Jahr 1390 enthält.
Jb.
Jahrbuch
Jh.
Jahrhundert
LIDAR
Light Detection And Ranging (eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Parameter)
Pfennig
Pfund
β
Schilling
Schlacht
Schw. /schw.
Schweizerischer / schweizerisch
StA
Staatsarchiv
Fotografien:
Sämtliche Fotografien, bei denen kein anderer Quellenverweis gemacht wird, stammen vom Autor.
Titelbild:
Schloss Nidau; Nordwestfront
Vorwort
Grafen in der Schweiz? Aber sicher! - Obwohl das Bestreben nach einer Demokratie und damit nach der Abschaffung von ständischen Hierarchien vor allem in den Stammlanden der Schweiz schon sehr früh einsetzte, gehörte noch lange Zeit praktisch alles den fürstlichen Magnaten und ihren Amtsträgern: Die Landleute hatten absolut nichts zu sagen und schon gar nicht mitzubestimmen. Nur wenige alteingesessene Familien hatten überhaupt die Möglichkeit, das politische Geschehen über ein Stimm- und Wahlrecht zu beeinflussen. Von ehemaligen Beamten zu Fürsten emporgestiegene Gaugrafen übten zweitweise eine besonders weitgehende Macht aus und machten sich dabei die Dienste von Ministerialen (Dienstadligen) zu Nutze, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig waren: Meine bereits erschienenen Werke betreffend die Geschichte des Ritter- und des Freiherrenstandes, die sich jedoch auf den Kanton Bern konzentriert haben1/2, zeigen deren Einfluss und Bedeutung im mittelalterlichen Bern auf.
Weil es den Rahmen einer gesamtschweizerischen Darstellung sprengen würde, beschränkt sich das vorliegende Werk auf das Gebiet der nordwestlichen Schweiz: Darunter werden in diesem Buch folgende Kantone (in alphabetischer Reihenfolge) subsumiert: Baselland, Bern, Fribourg, Jura, Neuenburg und Solothurn.
Verschiedene Autoren haben die Geschlechter und Familien der seinerzeitigen Grafen in der Schweiz schon vor langer Zeit in der Fachliteratur beschrieben. Das vorliegende Werk zitiert unter anderem Publikationen, die - wenn überhaupt - nur noch in wenigen Bibliotheken zu finden und wegen ihres Alters grösstenteils in Vergessenheit geraten sind.
Die Namen der gräflichen Familiengeschlechter werden nach einer kurzen Einleitung in alphabetischer Reihenfolge behandelt. - Die Aufzählung der gräflichen Familiengeschlechter erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die aus der Quellensammlung zur bernischen Geschichte („Fontes Rerum Bernensium») gezeigten Ausschnitte halten die zeitliche Abfolge ein. Wo die Titel der jeweiligen Urkunde quasi für sich sprechen, ist jeweils kein weitergehender Kommentar angefügt.
Ausgewählte Stellen aus Publikationen zum vorliegenden Thema weisen die Interessierten auf weiterführende Literatur hin, wo detaillierte Informationen in Wort und Bild zu finden sind.
Lehrpersonen von Sekundar- und Fachmittelschulen sowie von Gymnasien möchte ich animieren, auf der Grundlage dieses Buches die Geschichte des Mittelalters, insbesondere der nordwestlichen Schweiz, zu thematisieren:
Durch Exkursionen zu den nahen gelegenen Stätten der damaligen Burgen, Schlösser und Herrschaftshäuser, die teilweise nur noch als Ruinen zu sehen sind, kann der Geschichtsunterricht direkt vor Ort und damit sehr anschaulich durchgeführt werden.
Ich hoffe, mit diesem Beitrag das Interesse für die ausserordentlich komplexe und interessante mittelalterliche Geschichte Schweiz im Allgemeinen und deren nordwestliches Gebiet im Besonderen wecken zu können.
Der Autor
Abb. 1 Ruine der Burg Neu-Falkenstein über dem Weiler St. Wolfgang (Balsthal SO)
1 Moll Heinz, Geschichte des Freiherrenstandes im Kanton Bern (2020)
2 Moll Heinz, Geschichte des Ritterstandes im Kanton Bern (2020)
Einleitung
Einteilung des Adels im Spätmittelalter
Nach der allgemeinen Auffassung der ständischen Verhältnisse des Mittelalters waren die durch das Konnubium (Verbindung zwischen ursprünglich voneinander abgegrenzten gesellschaftlichen Gruppen durch Heirat, beispielsweise zwischen Adeligen und gesellschaftlich aufgestiegenen Bürgerlichen) auf eine Stufe gestellten Gruppen des Hochadels, die Grafen und Freiherren, streng vom niederen Adel, der Ministerialität, geschieden. Der Grund hierfür liegt in der freien Herkunft der ersten Gruppe und der unfreien der Ministerialen. Man hat diesen Unterschied urkundlich ganz klar nachweisen können.
Man hat jedoch auch erkannt, und zwar hauptsächlich an den folgenden angegebenen drei Merkmalen, dass die Kluft zwischen Hochadel und Ministerialität, also zwischen freiem und unfreiem Adel mit der Zeit allmählich ausgeglichen worden ist, dass sogar im Spätmittelalter grössere Verschiebungen stattgefunden haben aus dem niederen Adel in den hohen und umgekehrt.
Zu erkennen ist der Unterschied,
an der scharfen Trennung der Hochadeligen von den Ministerialen in den Zeugenreihen der Urkunden,
an der Bevorzugung der gräflichen und freiherrlichen Geschlechter bei der Rekrutierung der sogenannten „freiherrlichen" Klöster, Stifter und Domkapitel und schliesslich
an der Exklusivität des hohen Adels bei den Heiraten. Er hatte kein Konnubium mit den Ministerialen, d. h. wenn ein Freiherr die Tochter eines Ministerialen heiratete, so, galt das als eine "Missheirat". Die dieser Ehe entstammenden Kinder waren nicht dem Vater ebenbürtig, sondern folgten der Mutter in ihren Stand.
Eine allgemein anerkannte Art der Standesbestimmung
Am einfachsten und sichersten ist die Titelmethode. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Zeugenreihen der mittelalterlichen Urkunden grundsätzlich nach dem Stand der Zeugen angeordnet sind, so dass die Kleriker und die vornehmsten Zeugen an der Spitze stehen, die Ministerialen und Bürger am Ende. Ausserdem sind fast in sämtlichen Zeugenreihen die einzelnen Standesgruppen scharf getrennt und mit dem Standestitel gekennzeichnet. Es kommen da allerdings verschiedene Kombinationen vor, die nicht alle die gleiche Beweiskraft besitzen.
Sehr häufig sind die Zeugenreihen aber leider unklar. Oft fehlen die Bezeichnungen gänzlich oder zum Teil. Trotzdem kann man sie auch dann noch vielfach verwerten.
Einige Verwirrung ist durch das Ritterwesen und durch den Ehrentitel „dominus" in die Zeugenreihen hineingekommen. Da die Ministerialen ebenso wie die freien Herren die Ritterwürde erlangen konnten, kam es oft vor, besonders in späteren Zeiten, als die Ritterwürde an Bedeutung gewann, dass die Urkundenaussteller das Hauptgewicht auf die Unterscheidung zwischen Rittern und Nichtrittern - später „domicelli" genannt - legten und nicht zum Ausdruck brachten, ob ein Zeuge freier oder unfreier Herkunft war. Trotzdem wird auch da die Rangfolge meistens noch eingehalten. Fast jede einzelne Zeugenreihe aber hat wieder ihre Eigentümlichkeiten, so dass man hier schlecht eine Einteilung vornehmen kann.
Bleibt die Frage, wem die Bezeichnung "nobilis" gebührte: Diese ist im Prinzip leicht zu beantworten. Es war die charakteristische Standesbezeichnung für die freien Herren. - Nur in Ausnahmefällen könnte man dazu kommen, den Titel „nobilis vir" bei flüchtiger Durchsicht der Urkunden auch für Niederadelige in Anspruch zu nehmen.
Schliesslich ist zu bemerken, dass im Text der Urkunden selbst die Bezeichnungen nicht immer ganz genau sind. Es kommt vor, dass freie und unfreie Herren zusammen aufgezählt werden, denen der Gesamttitel „nobiles domini" oder „nobiles viri" vorangeht. Dann sind wohl „nobiles viri" als eine blosse Höflichkeitsformel aufzufassen, die etwa durch „die achtbaren, ehrenwerten oder vornehmen Herren" zu übersetzen wäre.3
Die Heerschildordnung
Abb. 2 zeigt ein Schaubild, welches idealtypisch die Lehns- oder sogenannte Heerschildordnung verdeutlicht, welche uns der um 1200 niedergeschriebene 'Sachsenspiegel' überliefert.
Ursprünglich bedeutete der 'Heerschild' (clipeus militaris) das Heeresaufgebot, danach die Lehnsfähigkeit, also die Fähigkeit ein Lehen zu empfangen oder zu geben, und schliesslich die Lehnsgliederung (Heerschildordnung) und zugleich die Stufe innerhalb dieser Gliederung. Im weiteren Sinne bestimmte die im Sachsenspiegel überlieferte Heerschildordnung den Rang eines Adligen, der sich aus seiner Einstufung in das Geflecht er lehnrechtlichen Abhängigkeiten ergab. Zugleich bildete er ein Regelwerk, das angab, was man seinem Rang schuldig war und wie man ihn erhielt oder verlor.4
Abb. 2 Die Heerschildordnung. – Man beachte die dritte Stufe mit den Grafen und Freiherren.4/5
Von der Frankenherrschaft zur Feudalherrschaft – Aufstieg der Grafen
Die Alemannen gerieten im Jahr 496 unter die Herrschaft der Franken und anno 532 traf auch die Burgunder dasselbe Schicksal. Dadurch verloren die beiden Volksstämme ihre Selbstständigkeit und wurden Teile des mächtigen Frankenreiches. Dessen bedeutendster Herrscher, Karl der Grosse, teilte sein Reich in Gaue ein. Die heutige Schweiz umfasste sieben bis acht Gaue.
Die Aare schied den Aargau (Gebiet zwischen Reuss und Aare) vom Pipinensergau (Comitatus Pipinensis). Letzterer zerfiel später in zwei Gaue. Die Gaugrafen und ihre Dienstleute haben ihre Macht gegenüber dem Volk zum Schaden desselben zu erhöhen vermocht. Gleichzeitig wussten sie sich auch gegenüber dem Kaiser selbständig zu machen. Die Grafenwürde wurde erblich und so zu einem Familienbesitz. Dadurch stieg der Gaugraf vom Beamten zum Fürsten empor, und seine Grafschaft wurde, je mehr die Macht des Kaisers sank, zu einem selbständigen Fürstentum. Unter den Nachfolgern Karls des Grossen entwickelten sich die Dinge sehr rasch in diese Richtung. - Mächtige Grafen haben in der Folge andere unterjocht und so ihren Besitz vergrössert. In der deutschen Schweiz vermochte um 900 ein Graf Burkhardt das ganze Gebiet zwischen Bodensee und Aare unter seine Herrschaft zu bringen.6
Der Begriff Grafschaft wurzelt im Amt des comes. Dieser übte in der römischen Kaiserzeit als Beamter und Berater des Kaisers gerichtlichen, fiskalischen oder militärischen Funktionen aus. Im Frankenreich der Merowinger sind vom 7. Jh. an (um 610 Abelenus und Herpinus, Grafen im pagus Ultrajoranus) auch im Gebiet der Schweiz Grafen bezeugt. Sie waren dem König oder dem Herzog untergeordnete Amtsträger mit Aufgaben im Gerichtswesen, in der Kriegführung und der Verwaltung des Königsguts (Fiskus), die sie meist in bestimmten, als pagus (Gau) bezeichneten Gebieten erfüllten.
Vom 8. Jh. an führten die Karolinger die Grafschaftsverfassung in weiten Teilen des Frankenreichs ein, so um 806 in Churrätien, bis um 816 in fast ganz Alemannien. Bald zeigten sich bei den Grafen Ansätze zur Bildung von Dynastien. Um der Gefahr entgegenzutreten, dass Grafen ihre Ämter als vererbbaren Besitz betrachteten, wandelten die Könige der späteren Karolingerzeit die Grafschaften in Amtslehen um, womit deren Inhaber zu königlichen Vasallen wurden. Zwecks besserer Kontrolle verliehen die Ottonen, Salier und Rudolfinger Grafschaftsrechte auch an kirchlichen Institutionen (Rudolf III. von Burgund z.B. 999 dem Bischof von Sitten, 1011 dem Bischof von Lausanne).
Vor dem 11. Jh. bildeten die Grafen (Comites) noch keine Adelsstufe; sie waren ernannte Beamte der Kaiser oder Könige. Gewöhnlich wurden sie aus der höchsten Adelsklasse unter dem Fürstenstand gewählt Unter Konrad dem Salier (911—919) wurde die Grafenwürde und mit ihr das damit verbundene Amt erblich, und mit dieser Erblichkeit wurden die Grafen zu einem Stande erhoben, der sich zwischen denjenigen der Fürsten und den bisherigen höchsten Adel, die Freiherren, hineinschob.7
Im 11. und 12. Jh. folgte eine Zeit des Umbruchs: Alte Gaubezeichnungen und Grafschaften verschwanden, andere fanden ihre Fortsetzung in den Landgrafschaften. Hingegen bauten neue Adelsgeschlechter (Adel) im Zug der hochmittelalterlichen Binnenkolonisation Gebietsherrschaften auf und erlangten unter oft unbekannten Umständen Grafschaftsrechte (in der westlichen Schweiz z.B. die Greyerzer).
Gemeinsames Merkmal der hochmittelalterlichen Grafschaften war, dass ihre Inhaber in einem bestimmten geografischen Raum die hohe Gerichtsbarkeit und die Regalien als Reichslehen innehatten. Damit besassen die Grafen in der Regel eine reichsunmittelbare Stellung und die Grundlage zum Ausbau einer Landesherrschaft (Territorialherrschaft).
Unter den Königshäusern der Salier und Staufer schufen sich im Gebiet der Schweiz namentlich die Grafen von Genf, Savoyen, Neuenburg, Lenzburg, Zähringen, Habsburg und Kyburg Landesherrschaften, die mehrere Grafschaften und auch Reichsvogteien in möglichst geschlossener Lage vereinten. Manche dieser Dynastien erlangten später Herzogs- und Königswürden. Ihre Grafschaften hatten den Charakter von königlichen Amtslehen verloren. Sie waren vielmehr Territorien, in denen die Grafen ihre Herrschaft weitgehend autonom ausübten und weitervererbten. Die eigentlichen Grafschaftsrechte (Regalien, Hochgericht) delegierten sie nicht. Verwaltungsaufgaben hingegen übertrugen sie Dienstadligen, die einzelnen Ämtern oder Kastlaneien vorstanden.
Die Eidgenossenschaft organisierte dann später ihre Herrschaftsgebiete nicht mehr in Grafschaften, sondern in Vogteien. Als Grafschaften bestehen blieben Greyerz (bis 1555) und Neuenburg (1643 Umwandlung in ein Fürstentum). Dann verschwand mit der Helvetischen Revolution die Bezeichnung ‘Grafschaft’ für Gebietsherrschaften in der Schweiz. An ehemaligen Grafschaften erinnern nur noch einzelne Orts- oder Landschaftsnamen.8
Landgrafschaften
Landgrafschaften waren Verwaltungsbezirke bzw. reichslehnbare Ämter, die im Südwesten des Heiligen Römischen Reichs - vom unteren Oberrhein bis zum Bodensee und in der heutigen Deutschschweiz (Buchsgau, Sisgau, Frickgau, Aargau, Zürichgau, Thurgau) - z.T. in der Nachfolge karolingischer Grafschaften im späten Mittelalter geschaffen wurden zur Vertretung der Reichsinteressen, zur Sicherung des Landfriedens und als Standesgerichte für Freie (Gerichtswesen).
Die Landgrafschaften waren ab Mitte des 13. Jh. als feste Organisationen in der Hand von Hochadelsfamilien, u.a. der Grafen von Neuenburg-Nidau, Frohburg, Kyburg, Habsburg, Rapperswil und Toggenburg. Sie führten den Grafentitel als Namen und Standesbezeichnung neben dem Amtstitel Landgraf(langravius). Ende des 13. Jh. waren die ursprünglichen Lehnsämter vererbbar geworden. Weitgehend privatisiert, fielen die Landgrafschaften schliesslich der Überschuldung des Adels zum Opfer und wurden wie das Familiengut verpfändet, geteilt und verkauft. Nutzniesser waren v.a. expandierende Städte wie Bern und Zürich.7
Im Raum Oberaargau-Westschweiz entstanden anstelle früherer karolingischer Grafschaften (Bargen-, Uf-, Aar-, Oberaargau usw.), aber nicht in deren Nachfolge, die Landgrafschaften Burgund (ze Búrgenden) und Burgundia circa Ararim (Burgund jenseits der Aare), wohl erst nach Auflösung des zähringischen Herzogtums und burgundischen Rektorats nach 1218. Sie dienten zur Wahrung von Reichsgut, zur Sicherung des Landfriedens und waren Standesgericht für Adel, Geistliche und freie Bauern.
Landgrafschaften Burgund
Als Landgrafen in Burgundia circa Ararim, das die Gebiete links der Aare zwischen Stockhornkette und bis zur Siggern umschloss, wirkten ab 1276 die Grafen von Nidau, ein Zweig des Hauses von Neuenburg. Nach deren Aussterben 1375 kam die Grafschaft, später Grafschaft Nidau genannt, mit der Herrschaft Nidau 1388 bzw. 1393 an Bern. Das Landgrafenamt in Burgund übte spätestens ab 1239/1240 der Graf von Buchegg aus, erstmals 1252 als lancravius, 1286 als langravius Burgundie bezeichnet. 1313 erzwangen die Herzöge von Österreich (von Habsburg) den Verzicht zugunsten der Grafen von Neu-Kyburg (von Kyburg). Der Landgrafentitel lag anfangs beim ältesten Sohn, später gleichzeitig bei verschiedenen Trägern.
Die Landgrafschaft Burgund reichte rechts der Aare vom Berner Oberland bis zum Jurafuss und umfasste den Oberaargau und das Napfgebiet. Sie zerfiel in die Blutgerichtsbezirke bzw. Landgerichte Äusseres Amt Thun, Ranflüh (Emmental), Konolfingen, Zollikofen und Murgeten (Murgenthal). Jedes Landgericht zählte verschiedene Dingstätten (Gerichtsorte), wohin im Wechsel der Landgraf die Bewohner des Bezirks zum Landtag (Blutgericht) einberief. Der Landgraf urteilte über todeswürdige Kriminalfälle wie Raub, Mord, Totschlag oder Brandstiftung. Grenzen und Kompetenzen der Landgerichte sind aus Offnungen (1387-1409) bekannt.
Abb. 3 In den FRB9 findet sich eine Liste mit den frühen Trägern von Grafentiteln.
Im 14. Jh. gewannen die Landgerichte auf Kosten der Landgrafschaft an Gewicht. Sie gingen 1406-1408 zusammen mit der Landgrafschaft als begehrte Rechtstitel an Bern über, nachdem die Stadt bereits im Burgdorferkrieg Teile der neu-kyburgischen Herrschaftsgebiete erworben hatte. Auf den Landgrafschaften Burgund und Burgundia circa Ararim baute Bern seine Landvogteiverwaltung auf und zog allmählich alle Rechte der Landesherrschaft (Blutgericht, Steuerrecht, Heerbann, Jagd, Fischfang, Hochwälder usw.) in beiden Territorien an sich. Obschon die Landgrafschaften ab dem 15. Jh. ihre Funktion als Reichsämter verloren hatten, diente ihr Besitz Bern bis ins17. Jh. zur Stützung von Ansprüchen der Landesherrschaft.10
Waitz Georg sagt in seiner Deutschen Verfassungs-Geschichte11: «Allgemein fallen Grafschaft (comitatus) und Gau (pagus) zusammen und abwechselnd ohne besonderen Unterschied wird der eine oder andere Ausdruck gebraucht. Die Gesetze Karls des Grossen sprechen häufiger von Grafschaften, während in den Urkunden der Zeit zur Bezeichnung der Lage von Orten vorzugsweise die Gaue genannt und unter Karl nur einzeln, häufiger unter den späten Karolingern auch die Gebiete der Grafen wohl daneben aufgeführt werden. Mitunter benennt man die Grafschaft selbst mit dem Namen des Gaues, dem sie entspricht, während sie in andern Fällen nach der Person des Inhabers bezeichnet wird. Da unter ‘Pagus’ manchmal grössere Gebiete verstanden werden, so kommt es vor, dass mehrere Grafen oder Grafschaften in einem Gau sich finden, auch wohl, dass ein alter Gau in Abteilungen zerfällt.»12
3 Schweikert Ernst, Die Herren von Oberhofen-Eschenbach, in: Die deutschen, edelfreien Geschlechter des Berner Oberlandes bis zu Mitte des XIV. Jh., S. 3ff (1911)
4studylibde.com; Geschichte / Weltgeschichte / Mittelalter; III. Adel, Herrschaft und Dienst
5 Moll Heinz J., Geschichte des Freiherrenstandes im Kanton Bern, S. 15 (2020)
6 Hunger Felix, Geschichte der Stadt Aarberg, S. 13 (1930)
7 Eggenschwiler F., Zur Geschichte der Freiherren von Bechburg. 1. Teil, in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Solothurn, S. 11 (1902)
8 Schibler Thomas, ‘Grafschaften’, im HLS, Bd. 5, S. 593f (2006)
9 FRB Bd. 1 S. 248
10 Dubler Anne-Marie, Landgrafschaften, im HLS, Bd. 7, S. 592f (2008)
11 Waitz Georg, Deutsche Verfassungs-Geschichte Bd. 2, 2. Ausg., S. 378 (1870)
12
1. Aarberg
Abb 4. Das Wappen derer von Aarberg: In Rot goldener Pfahl mit drei schwarzen Sparren.13 - In Gold schwarzer Zickzackbalken14, auch in der Variante in Schwarz silberner Zickzackbalken vorkommend.15
Graf Rudolf, dritter Sohn des Ulrich von Fenis hatte einen Sohn namens Ulrich (II.), der seinerseits drei Söhne hatte: Berchtold, Rudolf und Mangold. Rudolf wiederum hatte einen Sohn namens Ulrich (III.). - Dieser hatte dann drei Söhne: Rudolf, Berchtold und Ulrich IV. - Rudolf erhielt Neuenburg und wurde Stammvater der Linie Welsch-Neuenburg. Ulrich IV. erhielt die deutschen Gebiete (Nidau, Aarberg und Strassberg) und Valangin und die Grafenwürde.
Ulrich IV. hatte zehn Kinder. Von seinen Söhnen erhielten Rudolf Nidau, Berchtold Valangin und Ulrich V. Aarberg und Strassberg. - Ulrich V. seinerseits gab seinem Sohn Johann Valangin und dem älteren Sohn Wilhelm die Herrschaft Aarberg.
So wurde Wilhelm Stammvater der Dynastie Aarberg, deren Herrschaft aber schon bei seinem Sohn Peter ein Ende nahm.
Die Besitzungen der Grafen von Aarburgund-Neuenburg wurden durch Teilung so zerstückelt, dass die einzelne Herrschaft nur einige wenige Dörfer umfasste. Die Herren so kleiner Gebiete hatten es nicht nötig, noch kleinere Teile einem Ministerialen zur Verwaltung zu übergeben. Aus diesem Grund ist im Seeland der niedere Adel wenig zahlreich geworden und nur Vereinzelten gelang es, sich zum Freiherrenstand aufzuschwingen.17
Abb. 5 Stammtafel des Ulrich, Graf von Fenis, nach P. Aeschbacher16
Abb. 6 Weitere Varianten des Wappens derer von Aarberg: In Gold Querbalken, geschacht von Silber und Rot, besetzt von wachsendem, roten Löwen15, bei Tschudi13, ohne Löwen.
Das Land, auf dem die Stadt Aarberg entstand, gehörte nach der Entstehung des deutschen Kaisertums weder zu Aarburgund noch zu Kleinburgund, sondern es war Reichsland. - Weshalb? Reichsland blieb einmal solches Land, das nicht angebaut wurde, also unbewohnte, wertlose Einöden. Der Kaiser konnte aber auch bewohnte Gebiete, z. B. feste Plätze, von der Belehnung an einen Grafen ausnehmen, damit sie unmittelbarer unter seiner Herrschaft ständen.
Hat einer dieser beiden Umstände dazu geführt, dass dieser Flecken Erde reichsfrei blieb, oder haben andere Umstände dies bewirkt? Die Grafen von Neuenburg-Aarberg wurden jedenfalls in der Folgezeit vom deutschen Kaiser mit dem Gebiet von Aarberg belehnt. Wann und unter welchen Umständen dies geschah, ist unbekannt. Ein neuenburgischer Chronist berichtet, der Platz Aarberg und die nächste Umgebung seien von Herzog Berchtold V. von Zähringen (als kaiserlichem Statthalter von Burgund) seiner Nichte, der Gräfin Yolantha von Urach, bei ihrer Verheiratung mit Ulrich IV. von Neuenburg geschenkt worden.
Beweise für die Richtigkeit dieser Angaben fehlen. Feststehend bleibt deswegen doch, dass etwa um diese Zeit die Grafen von Neuenburg das fragliche Gebiet vom Kaiser zu Lehen trugen.
Die strategische Bedeutung des Flussüberganges bei Aarberg hat dazu beigetragen, dass hier ein befestigter Ort entstand. Die Beherrschung des Flussüberganges bedeutete einen grossen Machtfaktor. Zu dessen Sicherung war aber die Erstellung einer festen Anlage nötig. Diese Erwägung veranlasste auch die Grafen von Neuenburg, den Ort Aarberg zu einer befestigten Stadt zu machen.18
Abb. 7 Der Burghubel von Aarberg; Blick von Südosten Richtung Nordwesten.
Die Gründung der Stadt Aarberg
Die Handveste (Stadtordnung) von Aarberg nennt als Erbauer der Stadt jenen Ulrich IV., dem durch Teilung die deutschen Teile der Herrschaft und Valangin zugefallen waren. Da Graf Ulrich IV. 1225 das Zeitliche gesegnet hat, muss die Gründung der Stadt vor diesem Jahr erfolgt sein. Die Burg Aarberg war ohne Zweifel schon lange vor der Stadt da19, obwohl erst der Enkel des Stadtgründers in Aarberg ständigen Wohnsitz nahm. Im Schutz der Burgmauern entstanden wohl etwelche Wohnsitze. Das Gründungswerk des Grafen bestand nun darin, dass er den Ort mit einer schützenden Mauer umgab. Wallgräben gab es keine, denn an ihrer Stelle schützten die beiden Arme der Aare die Stadt vor feindlichen Angriffen. Durch gewaltigen Erdaushub wurde dem östlichen Aarearm ein Bett quer durch den Höhenzug gegraben, um die beiden Aarearme wieder zu vereinigen und Aarberg so zu einer Insel zu machen. Auch dieser Aarearm wurde überbrückt und der Brückeneingang durch einen Torturm bewehrt.18
Die Stadt muss von Anfang an ihre besondere Organisation und eine gewisse Selbständigkeit besessen haben. Schon an einer Urkunde von 1249 legte sie neben dem Grafen ihr eigenes Siegel an, ebenso an einer Urkunde von 1251. - Eine eigentliche Handveste oder Stadtordnung erhielt Aarberg von Ulrich V., dem Sohn des Erbauers der Stadt. Ulrich V. stellte die Handveste am 1. Mai des Jahres 1271 aus. Sie ist, wie alle wichtigeren Dokumente jener Zeit, in lateinischer Sprache geschrieben. Erstmals ins Deutsche übersetzt wurde sie bei der Bestätigung durch die Berner im Jahre 1368.20
Die Handveste enthält ausführliche Bestimmungen über das Gemeindewesen, die Wahl der Behörden, das Gerichtswesen, die Nutzung der Gemeindegüter, aber auch über zivilrechtliche Verhältnisse.
Abb. 8 Rekonstruktionszeichnung der Burg Aarberg um 1100 aus Südwesten21
Der Graf schenkt „dem Ort und allen Bürgern desselben Orts die Weiden, Flüsse, Wasserrunsen, Wasser, Wälder und Gesträuche, auch ihre Allmend, dass sie solche frei gebrauchen". Ferner verzichtet er darauf, irgendwelche Steuer für die Kriegstruppen zu fordern, ausser wenn er auf königlichen Befehl zum königlichen Heerzug über die Gebirge ziehen muss.22
FRB, Bd. 2, S. 295f, 278. (1249) - An der Urkunde hängen die Siegel: 1) des Ulrich (V.) von Aarberg mit der Umschrift: + SIGI... VM. VOLRICI. DOMINI. STRAZPERC; — 2) der Stadt Aarberg, mit: + SIGILLVM. BVRGENSIVM. DE. ARBERC; — 3) der Stadt Murten, mit: S. ADVOCATI. . . B... GENSIVM. DE. MVRATH.; — 4) des Schultheissen von Murten, mit unleserlicher Umschrift; — 5) des Cuno von Capellen, mit: + . . . NONIS. DE. CAPELL. S.
Graf Ulrich, der Aussteller der Aarberger Handveste, starb 1276. Zuvor machte er noch verschiedene Vergabungen an die Kirche. 1270 erscheint er mit seinen Brüdern als Mitunterzeichner einer Vergabungsurkunde der Abtei Erlach. Er nennt sich darin Ulricus dominus de Aarbergi (d. h. ‘Herr’ von Aarberg), also nicht mehr ‘Graf’.
FRB, Bd. 2, S. 340f, 315. (1251) - Am Original hängt das Siegel Ulrichs mit der Umschrift: + S. VLRICI DOMINI STRA. ET ALBERC.
FRB, Bd. 2, S. 342, 317. (1251) - Von beiden Siegeln hängt bloss noch dasjenige des Bischofs von Basel, mit der Umschrift: + S\ BERCHTOLDI. DEI. G. PL BASILIENSIS.
FRB, Bd. 2, S. 344f, 320. (1251) - Es hängen die Siegel 1) des Grafen Rudolf, mit der beschädigten Umschrift: + S. COMITIS - RI; 2) des Ulrich von Aarberg mit: + SIGILLVM VLRICI DOMINI STRA. ET ALBERC (N° 315); 3) der Stadt Aarberg mit: + SIGILLVM BVRGENSIVM DE ARBERG (N° 278).
Nun erhielt Wilhelm, der älteste Sohn Ulrichs, die Herrschaft Aarberg. Dazu gehörten ausser Burg und Stadt nur noch die Dörfer Bargen, Kappelen, Lyss und Busswil. Von Wilhelm kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass er meist in Aarberg gewohnt hat. Allerdings trug er auch vom Grafen Ludwig von Savoyen die Herrschaften Illingen und Ergenzach zu Lehen.
FRB, Bd. 2, S. 361, 334. (1253) - Ergenzach (FR) ist das heutige Arconciel südlich von Fribourg.
FRB, Bd. 2, S. 504, 482. (1260) - Roche und Treyvaux befinden sich heute beide im Kanton Fribourg.
FRB, Bd. 2, S. 749f, 695. (1270) - In dieser Urkunde werden einige familiäre Bande klar sichtbar.
In Bezug auf den Titel war Wilhelm trotz seines kleineren Herrschaftsgebietes weniger bescheiden als sein Vater. Er nannte sich schon zu dessen Lebzeiten „her Wilhelm, Graf ze Arberch". Aus nicht ganz klar ersichtlichen Gründen übergab Wilhelm seine Herrschaft dem Grafen von Savoyen und empfing sie als Lehen von diesem zurück.23 Eine ähnliche Situation findet sich für Erlach bei den Nidauer Grafen.
FRB, Bd. 2, S. 779f, 720. (1271) - Beide Siegel hängen nicht mehr.
FRB, Bd. 3, S. 21f, 24. (1272) - Es hängt das nur wenig beschädigte Siegel des Grafen Wilhelm von Aarberg, mit der Umschrift: + S\ COMITIS. WIL . . . MI. DE. ARBERC.
FRB, Bd. 3, S. 64, 61. (1273) - Es hängen die Siegel 1) des Grafen Rudolf von Neuenburg, mit der Umschrift: + S\ COMITIS. RODOLFI. NO... CAST . . . — und 2) des Grafen Wilhelm von Aarberg, mit: + S’. COM. LLELM . . . E. ARBERC.
FRB, Bd. 3, S. 93f, 92. (1274) - Das Siegel ist abgefallen.
FRB, Bd. 3, S. 165f, 169. (1276) - Bei Illingen handelt es sich um das heutige Illens (Gde. Gibloux FR).
Wilhelm war sehr auf die Stärkung seines Hauses bedacht, und es scheint, dass er dabei gar leicht geneigt war, mit den Waffen in der Hand sein Ziel zu erreichen. Er verfeindete sich mit seinen nächsten Verwandten, den Herren von Neuenburg. Schon zu Lebzeiten seines Vaters führte er gegen sie eine langwierige Fehde, die erst 1270 zu Ende ging. Wie aus dem Friedensvertrag hervorgeht, handelte es sich auch in diesem Streit u. a. um die Aufnahme von Burgern24. Die Feindschaft flammte später neu auf. Um 1290 schlossen die Herren von Neuenburg unter sich und mit der Stadt Freiburg ein Bündnis gegen Wilhelm. Dieser erhielt seinerseits Unterstützung von seinen Brüdern, insbesondere von seinem Bruder Johann von Valangin. Ob es zu kriegerischen Ereignissen kam, ist nicht bekannt.
Abb. 9 Siegel des Wilhelm von Aarberg (1299) und des Peter von Aarberg (1313 und 1367) [v.l.n.r.]25
FRB, Bd. 3, S. 168f, 172. (1276) - Neyruz (FR) ist die Nachbargemeinde von Hauterive. Deren deutsche Bezeichnung ‘Rauschenbach’ wird schon längere Zeit nicht mehr verwendet.
Im Jahre 1292 gewährte Wilhelm für sich und seine Brüder der Stadt Freiburg einen Waffenstillstand. Als aber Bern im Jahre 1298 mit den Herren von Neuenburg und mit Freiburg im Krieg lag, da beteiligte sich Wilhelm auch daran und zwar auf Seite der Berner, weil er in Bern verburgert war. lrgendwelche Verständigung muss dann zwischen den Herren von Neuenburg und Wilhelm von Aarberg um 1304 doch zu Stande gekommen sein. Wenigstens erklärt Graf Rudolf, dass er in den Zwistigkeiten zwischen ihm und seinem Oheim einerseits und den Brüdern Wilhelm, Ulrich, Johannes und Dietrich. von Aarberg anderseits, den Schiedsspruch von Johannes von Joux und Peter von Blonay anerkenne.
FRB, Bd. 3, S. 205f, 214. (1277) - ‘Marlie’ entspricht dem heutigen Marly (FR).
FRB, Bd. 3, S. 206, 215. (1277) - Bemerkenswert ist die Verurkundung der Einholung der Zustimmung aller namentlich genannten Geschwister: Ein Verhalten, das immer wieder beobachtet werden kann.
FRB, Bd. 3, S. 233f, 247. (1278) - Es hängen die Siegel 1) des Junkers Wilhelm von Aarberg, mit der Umschrift: + S’. COM. WILLELMI. DE. ARBERC. — und 2) des Freien Heinrich von Jegistorf, mit: + S’. HENRICI. DE. IEGIST. RF.
Wilhelm geriet auch mit dem Kloster in Streit wegen der Aue (Land und Giessen an der Aare), der Mühle zu Mühlethal und anderem mehr. Im 13. Jh. gehörte die Mühle dem Grafen von Thierstein. Von ihm trug sie ein Rudolf zu Lehen. Im Jahre 1279 erscheint nun aber das Kloster Frienisberg als Besitzer der Mühle, denn in diesem Jahre gibt die Abtei jenem Rudolf ihre Mühle zu Mühlethal zu Lehen, gleich wie er und seine Vordern sie einst vom Grafen von Thierstein empfangen hatten. Dann meldet eine Urkunde vom Jahre 1284, dass Rudolf sein Erblehen im Mühlethal, Mühle mit Stampfe und Mühlehofstatt, um 16 Pfund an die Abtei verkauft habe.
Im Jahre 1285 bestätigte Wilhelm die Handveste von Aarberg, jedoch mit einer Einschränkung: Die Burgerschaft musste geloben, keine seiner Eigenleute ins Burgerrecht aufzunehmen, und allfällig Aufgenommene innert acht Tagen aus dem Burgerrecht zu entlassen.26
Daraus geht einerseits hervor, dass die Aarberger noch sehr geneigt waren, die Zahl ihrer Burger zu vermehren; anderseits zeigt sich der Graf mit seiner Forderung nicht als unbedingter Förderer der Stadt Aarberg:
FRB, Bd. 3, S. 396f, 414. (1285) - Es hängt das Siegel des Abtes von Frienisberg, mit der Umschrift: + SIGlLLVM. ABBATIS. DE. AVROKA. — Das Stadtsiegel von Aarberg ist abgefallen.
Wilhelm hatte noch andere Händel. Er verwickelte sich in einen langwierigen Streit mit dem Kloster Frienisberg, wobei ihm die Freundschaft mit Bern sehr zu statten kam. Die Besitzverhältnisse zwischen dem Kloster und dem Grafen waren unklar. Wilhelm und seine Brüder hatten kurz nach dem Tode ihres Vaters mit dem Kloster einen Gütertausch abgeschlossen. Sie überliessen dem Kloster ihre Güter zu Baggwil und empfingen dafür von diesem je eine Schuppose (9-12 Jucharten) zu Bargen und zu Merzligen und zwei Schupposen zu Kappelen.
FRB, Bd. 3, S. 420f, 437. (1287)
Abb. 10 Ansichtskarte des Schlosses Aarberg von 1911
FRB, Bd. 3, S. 531f, 541. (1292) - Es hängt noch das Siegel des Grafen Wilhelm von Aarberg, mit der Umschrift: + S. COMITIS. WILLELMI. DE. ARBERC.
FRB, Bd. 3, S. 629f, 640. (1295) - Die ‘Veste Neuville’ findet sich heute nur noch als ‘Ruine de la Bonneville’ südwestlich des Örtchens Engollon (NE) auf der Karte.
FRB, Bd. 3, S. 726f, 720. (1299) - König Albrecht war Graf von Habsburg (* Juli 1255 in Rheinfelden; † 1. Mai 1308 ermordet in Königsfelden bei Brugg), war ab 1282 Herzog Albrecht I. von Österreich, von Steiermark und von Krain sowie Herr der Windischen Mark im heutigen Slowenien; zudem ab 1298 römisch-deutscher König, aus dem Haus Habsburg.
FRB, Bd. 3, S. 757f, 744. (1299) - Es hängt das Siegel Wilhelms von Neuenburg, Herrn zu Aarberg, mit der Umschrift: + S’. COMITIS. WILLELMI. DE. ARBERCH.
FRB, Bd. 4, S. 121f, 109. (1303)
Aus allen diesen Angaben geht nicht hervor, dass Wilhelm von Aarberg irgendwelche Rechtsansprüche auf die Mühle machen konnte. Vielleicht gab es eine zweite Mühle im Mühlethal, um die sich der Streit zwischen Wilhelm und dem Kloster drehte. Das Kloster wandte sich an den Rat in Bern um Vermittlung. Dieser ordnete 1304 auf Montag nach St. Jakobstag (27. Juli) einen Gerichtstag an. Als Vertreter des Grafen von Aarberg erschienen Gerhard von Grasburg und Johann von Schartenstein, als Vertreter des Klosters Ritter Johann von Bubenberg und Johann von Lindach. Der bernische Schultheiss Lorenz Münzer amtete als Obmann. Die vorgebrachten Streitpunkte waren:
Frienisberg beansprucht entgegen den Forderungen Wilhelms bestimmte Waldungen, die es von den Grafen von Thierstein gekauft haben will.
Das Kloster beansprucht das Recht, den Bann im Mühlethal auf die Güter zu leiten.
Das Kloster fordert die zwei Eigenleute Rudolf und Enderlin zurück.
Das Kloster beansprucht gewisse Güter zu Lobsigen und die Aue und Acker zu Oberwerdt.
Das Kloster klagt, dass Wilhelm die Mönche in ihrem Besitz des Hauses zu Aarberg gestört habe.
Der Schiedsrichter fällte den Spruch sehr zu Gunsten des Klosters, wie es damals bei dem Einfluss der Kirche meist geschah. Die Aue und Matte zu Lobsigen wurden dem Kloster zugesprochen. Wegen der streitigen Aue an der Aare kam erst 1305 ein Vergleich zu Stande. Wilhelm gab die Güter auf dem obern Werdthof (früher Gut Strazza geheissen) dem Kloster für sein Seelenheil. Solange er, Wilhelm, lebe, mögen sie ihm für 5 Schilling verliehen sein. Als Pfand für diesen Zins setzte er eine Schuppose zu Kappelen.
Wilhelm hielt den Vertrag nicht. Er bedrohte sogar die Mönche und 1312 klagte der Abt wieder in Bern. – «Und do wir die Klag vernommen, do was üs sere leid, wann sie ze beiden siten unser Burger warend". Zur Schlichtung wurde zu Meikirch eine Zusammenkunft der Parteien vereinbart. Nach deren Ergebnis entschied der Rat der Zweihundert: Die Mönche sollen den Überfall vergessen und auf eine diesbezügliche Entschädigung verzichten. Anderseits soll der Graf die strittigen Auen und Matten aufgeben.
FRB, Bd. 4, S. 197f, 167. (1304)
FRB, Bd. 4, S. 226f, 195. (1305)
FRB, Bd. 4, S. 518f, 495. (1312) - Es hängt das Stadtsiegel von Bern.
An seinem Lebensende musste Wilhelm nochmals die Vermittlung Berns anrufen, aber diesmal gegen den eigenen Sohn Peter. Dieser hatte sich im Jahr 1319 gegen ihn erhoben. Mit seinen Helfern und Helfershelfern Johann von der Fluh, Johann von Spins, Konrad von Kloten, Kuno von Sutz und dem Zimmermann Bürcheli hatte Peter die Burg Aarberg eingenommen und den Vater gefangen gesetzt. Die Berner befreiten dann Wilhelm aus der Gefangenschaft und Peter musste für das Begangene Ersatz leisten. - In der Urkunde erklärt er (gezwungener Weise) mit seinem Vater und allen denen, welche dem Vater wider ihn halfen „gänzlich gericht und vrund" geworden zu sein:
FRB, Bd. 5, S. 149f, 95. (1319) - Es hängen die Siegel 1) des Herrn Walther von Wediswyl, mit der Umschrift: + S. DNI. WALTHERI. DE. WEDISWILE und 2) des Ritters Conrad von Sumiswald.
Um 1323 starb Wilhelm. Seine Fehden hauen ihm und besonders seinen Untertanen mehr geschadet als genützt. Der gräfliche Besitz, der wegen der fortgesetzten Teilungen ohnehin klein geworden war, hatte sich während der Herrschaft Wilhelms noch bedeutend verringert. Im Jahr 1292 war er genötigt gewesen, die ganze Herrschaft Ergenzach-Illingen (Arconciel-Illens) zu verkaufen. Mit Wilhelm hatte der Niedergang dieser Dynastie begonnen. Unter seinem Sohn und Nachfolger Peter wurde er vollständig.27
Abb. 11 Siegel des Wilhelm von Aarberg (1273) und des Ulrich von Aarberg 1257) [v.l.n.r.]28
Graf Peter, Wilhelms einziger Sohn, der um 1323 die Herrschaft antrat, besass alle Charakterschwächen seines Vaters in verstärktem Masse. Besonders die Fehdelust war bei ihm noch weit größer als bei Wilhelm.
FRB, Bd. 5, S. 343, 302. (1323) - Es hängen die Siegel 1) des Abtes von Engelberg, zum Teil beschädigt, mit der Umschrift: ABB’TIS. MON. MONTIS. ANGEL . . . — und 2) des Convents daselbst, mit: . . . COVENTVS. MONTIS. ANGEL . . .
Wie schon sein Vater, hatte auch Peter Besitzstreitigkeiten mit dem Gotteshaus Frienisberg. Gleich nach Wilhelms Hinschied eröffnete Peter wieder den Streit um die Au-Matte an der Aare. Es wurde zu Meikirch ein Gerichtstag angesetzt. An diesem erschien Peter nicht. Die Au wurde neuerdings vom Rat von Bern dem Kloster zugesprochen (1Q. Mai 1324). Peter anerkannte den Spruch nicht und störte offenbar die Mönche neuerdings in ihrem Besitz. Deshalb setzte Bern wieder auf die Klage des Abtes zu Meikirch einen Gerichtstag an. Als Vertreter des Klosters amteten Johann von Bubenberg und Fr. Münzmeister. Für Peter sollten Konrad von Sumiswald und Ulrich den Richen auftreten. Ritter Walter von Wediswyle (Wädenswil) amtete als Obmann. Allein auch diesmal erschien von Peters Seite niemand. So zog sich der Streit noch zwei Jahre hin. Erst 1326 liess sich Peter auf einer Tagung zu Bern herbei, für immer auf die Au zu verzichten und sie dem Kloster ausdrücklich zu schenken. Zugleich überliess er dem Kloster auch das Wäldchen Loo, nebst der Stampfe zu Lobsigen. Dafür behielt er sich die Buckenmatt als Leibgeding aus und Seelenmessen für sich und seinen verstorbenen Vater.29
FRB, Bd. 5, S. 411ff, 368. (1324) - Es hängen die Siegel 1) des Johannes von Bubenberg, Schultheissen von Bern und 2) des Lorenz Münzer.
FRB, Bd. 5, S. 450f, 408. (1325) - Beide Siegel hängen.
Mit seinen Vettern kam Peter allerdings besser aus als sein Vater. Zwischen ihm und seinem Vetter Rudolf von Nidau scheint ein besonders freundschaftliches und vertrautes Verhältnis bestanden zu haben. Peter vertrat seinen Vetter auf einem 1323 vor der Brücke zu Oltigen abgehaltenen Landgerichtstag.30 Ja, Rudolf gab Peter sogar die Möglichkeit, die Herrschaft Nidau zu erwerben.
FRB, Bd. 5,, S. 516, 476. (1326)
Ende Juli 1326 erklärt Graf Peter von Aarberg, dass ihm Graf Rudolf III. von Neuenburg die Burg Nidau, das Gericht und die Vogtei Tessenberg und alle seine Lehen, die er „von dem gothus und dem bistom von Basil ze lehen hatte oder haben sollte, und ðch mit allem dem, das er von dem riche ze rechtem man-lehen nutzbar besessen hat ze der burg von Nidowa“.
FRB, Bd. 5, S. 518, 479f. (1326). - Graf Rudolf II. behielt sich also das volle Verfügungsrecht vor. - Beide Siegel sind abgefallen.
Laut Vertrag vom 26. Juli 1326 übergab er Peter die Burg Nidau, das Gericht auf dem Tessenberg und alle seine Lehen, die er „von dem gotzhus und dem bistom von Basil ze lehen hat und och mit allem dem, das er von dem riche ze rechtem manlehen nutzbar besessen hat ze der burg von Nidowa". Die Verleihung sollte aber dahinfallen, für den Fall, dass Rudolf Leibeserben erhielt oder sonst diese Verleihung rückgängig machen wollte.29
Rudolf hatte seine Pläne rasch geändert. Schon sechs Tage später sah sich Graf Peter veranlasst, die Einwohner und den Vogt von Nidau des Eides, den sie ihm nach der Verleihung geschworen hatten, zu entledigen.31
FRB, Bd. 5, S. 519, 480. (1326). - Schon eine knappe Woche nach der Verurkundung Nr. 479 (!) entlässt Graf Peter von Aarberg den Vogt und die Einwohner von Nidau des Eides, den sie ihm nach der Verleihung geschworen hatten.
FRB, Bd. 5, S. 587f, 550. (1327) - Die Ritter von Spins waren Ministerialen der Grafen von Aarberg.32
Drei Jahre später (1329)33 aber kam Graf Rudolf auf ähnliche Ideen zurück. Er wünschte, dass der BasIer Bischof ihm und Graf Peter von Aarberg, «Nydow, die burg, lût und gut, twinge und benne und als, daz darzu horet» als gemeinsames Lehen übertrage, was auch geschah. Audi diesmal erklärte Peter, auf seine Mitherrschaft zu verzichten, wenn Rudolf Leibeserben bekommen sollte. Das Verhältnis Graf Peters zu Bern war anfänglich ein ziemlich günstiges. Er war gleich seinem Vater in Bern Burger geworden und focht im Gümmenenkrieg auf Seite der Berner. Dazu Justinger:
«Daz Gumynon zerbrochen wart (1331)
Also zugen die von berne us und slugen sich für güminon, und hatten dahin gemaut den bischof von basel, [der] sante inen sechtzig heim, …
… graf peter von arberg mit siner hilf …»34
Gemeinsam mit den Bernern machte er einen Streifzug in die Waadt und gewann reiche Beute. Die Freundschaft zwischen Peter und den Bernern verwandelte sich aber bald in Feindschaft. Im Laupenkrieg trat Peter wie alle seine Verwandten, wohl von diesen dazu veranlasst, auf die Seite des Adels wider Bern. Entgegen seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Bern nahm er in Freiburg Burgerrecht. Umsonst hofften die Berner, dass Graf Peter sich als ihr Burger wenigstens neutral halten werde. Er unterstützte den Grafen Gerhard von Valangin, der Raubzüge in bernische Gebiete machte und nahm ihn in den Mauern seiner Burg auf. Als die Berner dies vernahmen, beschlossen sie, Peter dafür zu strafen.
FRB, Bd. 5, S. 699f, 669. (1329) Es hängen, mehr oder weniger beschädigt, die Siegel 1) des Grafen Peter, Herrn zu Aarberg, wie an Nr. 476 — 2) des Ludwig von Savoien, Herrn der Waadt, mit: LVDOVICI. DE. SABAVDIE. D . . . VAVDI. MILI . . .. — 3) des Domsängers Ludwig von Thierstein, mit: S’. LVDE - WICI. D’ TIERSTEL CATORI’. ECCL. — 4) des Grafen Walraf von Thierstein, in zwei Bruchstücken, auf welchen noch erkennbar: . . . AFI. COMIT’. D’... IER. — und 5) des Freien Thüring von Ramstein.
Auch Justinger berichtet vom «Raub zu Wibelsburg» (Wiflisburg, heute Avenches VD): «Daz die von bern einen roub ze wibelspurg namen (ca. 1333)
Darnach zugent die von bern gen wibelspurg und mit inen graff peter von arberg, ze schedigen graf ludwigen, den usern grafen von Safoy; und namen da gar einen grossen roub, daz jeglichem ze bütung wart siben guldin, ane daz graf peter von arberg mit im heimfurte, der doch sich selber nit gern verteilte.»35
Abb. 12 Raubzug der Berner und des Grafen von Aarberg nach Wiflisburg (Avenches), 1333. [Illustration aus der amtlichen Berner Chronik von Diebold Schilling aus den Jahren 1478 -1483, Bd. 1, S. 110 (1475) (BBB Mss.h.h.I.1)]
FRB, Bd. 6, S. 65f, 72. (1333) - Es hängt noch das Siegel, aber mit unlesbarer Umschrift.
FRB, Bd. 6, S. 108, 118. (1334) Von beiden Siegeln hängen nur noch Bruchstücke; am erstem ist noch das Wappen erkennbar und von der Umschrift: RBERG...
FRB, Bd. 6, S. 157, 167. (1334) - Es hängen die Siegel 1) des Grafen Peter von Aarberg, mit der Umschrift: S. PETRI. DNI. IN. ARBERG. — 2) des Abtes von Frienisberg, wie an Nr. 7 — und 3) des Ritters Philipp von Kien.
FRB, Bd. 6, S. 217f, 229. (1335) - Die Siegel sind abgefallen. Zur Geschichte derer von Hasenburg sei hier auf das entsprechende Kapitel hingewiesen.
FRB, Bd. 6, S. 274, 281. (1336) - Beide Siegel sind abgefallen.
FRB, Bd. 6, S. 309f, 316. (1336) - Es hängen die beiden Siegel 1) des Freiherrn Johannes von Kien und 2) S. B ’CHTOLDI. DE. TORP’G. MILITIS.
FRB, Bd. 6, S. 380f, 393. (1338)
FRB, Bd. 6, S. 381f, 394. (1338)
FRB, Bd. 6, S. 384f, 398. (1338) - Es hängt nur noch ein Fragment des Siegels.
FRB, Bd. 6, S. 389f, 405. (1338) - Das Siegel ist abgefallen.
FRB, Bd. 6, S. 422f, 438. (1338)
Die Belagerung Aarbergs im Vorfeld der Schlacht von Laupen anno 1339 war für die Berner erfolglos gewesen. Sie konnten auch nicht lange bei Aarberg verweilen, da Laupen durch das Heer des Adels bedroht war. Graf Peter zog mit seinen Leuten auch nach Laupen.
Man übertrug dem Grafen von Aarberg die Hut über den Tross und das Feldlager. Peter nahm also nicht am eigentlichen Kampf teil. Als er die Wendung der Schlacht sah, “da machte er sich zu den hütten, da der herren watseck und Silbergeschirre lag, und nuste daz zu ihm und furte daz in fliechender und raubender und in dieplicher Wise mit im gan arberg". - Der Chronist Justinger war eben Berner, weshalb begreiflich ist, dass er damit Graf Peter ein schlechtes Zeugnis ausstellte. Wir haben darum allen Grund, die Richtigkeit seiner Darstellung zu bezweifeln. Zuzutrauen war die Sache Peter wohl. Aber hätte es sich so verhalten, so würde das wohl entdeckt worden sein, und die Beraubten würden auch sicher ihr Eigentum zurückgefordert haben. Auch hätten ihn dann die Freiburger kaum kurz darauf zu ihrem Feldhauptmann gewählt, wie es geschehen ist. Peter verpflichtete sich dabei zur Stellung von 5 Helmen und 4 Armbrustschützen, alle neun beritten, vorläufig während der Dauer eines Jahres. Für diese Dienste sollte ihm Freiburg 500 Florentiner-Gulden als Honorar an ihn persönlich und ferner ihm und jedem seiner Krieger ein Taggeld von 4 Livres Tournois auszahlen. Letzteres galt jedoch nur für die Tage, die die Reisigen wirklich im Krieg für Freiburg zubrachten. Bei persönlicher Verhinderung musste sich der Graf durch Ritter Werner von Eptingen oder Ritter Rudolf von Schüpfen36 vertreten lassen. Alle mit dem Banner von Freiburg gemachte Beute war zwischen der Stadt und Peter zu teilen. Was Peter allein erbeutete, konnte er behalten, trug dann aber auch dabei allfällig erlittenen Schaden allein. Da Peter (zusammen mit Rudolf von Erlach) auch die Vormundschaft über die Söhne des gefallenen Grafen von Nidau übernommen hatte, so führte er auch die Nidauer und Erlacher an.
Abb. 13 Die Flucht des Grafen von Aarberg mit dem geraubten Silbergeschirr (1339) [Illustration aus der Spiezer Chronik von Diebold Schilling, S. 285 (1485) [BBB Mss.h.h.I.16]; e-codices.unifr.ch
Noch im selben Jahr unternahm Peter Raubzüge in bernisches Gebiet, um die Niederlage bei Laupen zu rächen und natürlich auch in der Absicht, dabei reiche Beute zu machen. Schon bevor er in den Dienst von Freiburg getreten war, hatte er mit den Leuten von Nidau und Erlach Einfälle in das Gebiet von Murten unternommen, weil die von Murten den Bernern Vorschub geleistet hatten. Auf einem dieser Streifzüge liess er das Dorf Kerzers niederbrennen und ausplündern. Sämtliche Viehware, Hausrat und Getreide wurde nach Aarberg abgeführt. Ähnlich verfuhr er in den Dörfern Galmiz, Brüttelen, Münchenwiler, Golaten usw. Als freiburgischer Feldhauptmann suchte er nun auch bernisches Gebiet heim. Er liebte es, unerwartete Überfälle zu machen, hütete sich aber vor einem Kampf gegen gewappnete Feinde.
FRB, Bd. 6, S. 474, 489. (1339)
FRB, Bd. 6, S. 475f, 491. (1339) - Das Siegel des Grafen Peter von Aarberg hängt, mit der Umschrift, wie an Nr. 167.
Als die Berner im Frühjahr 1340 zu energischer und erfolgreicher Gegenwehr übergingen, da versagte Peter. Die Freiburger entfielen ihn darum aus ihrem Dienst. Übrigens hatte sich Peter im Jahre 1340 im Verein mit den Vertretern des Grafen von Nidau und der Stadt Freiburg mit Murten auf guten Fuss gesetzt, und im August des nämlichen Jahres wurde er in den durch die Königin Agnes zwischen Bern und Österreich vermittelten Frieden eingeschlossen.
FRB, Bd. 6, S. 480, 496. (1339)
«Doch seit man, das graf peter von aarberg den hütten ze hut geordnet was; do der sach daz die sache der herren halb übel gan wolt, do macht er sich zu den hütten, da der herren watsek und silbergeschirr lag, so und nuste das zu im und furt es mit ihm dannan gan aarberg.»37
FRB, Bd. 6, S. 489f, 506. (1339)
FRB, Bd. 6, S. 514f, 531. (1340) Die aufgedrückt gewesenen Siegel sind nicht mehr vorhanden.
Abb. 14 Raubzug der Berner nach Aarberg (1339) [Illustration aus der amtlichen Berner Chronik von Diebold Schilling aus den Jahren 1478 -1483, Bd. 1, S. 113 (1475) (BBB Mss.h.h.I.1)]
Als Vertreter des Grafen von Nidau bei der Verbindung des Grafen Peter mit weiteren Bundespartnern kommen primär die Grafen von Kyburg und Froburg in Betracht:
FRB, Bd. 6, S. 514f, 531. (1340) - Die aufgedrückt gewesenen Siegel sind nicht mehr vorhanden.
Die Bewohner der Stadt Murten dürften nicht einmütig hinter diesem Bündnis gestanden sein: Vielmehr schein sie in zwei Parteien gespalten gewesen zu sein: Eine, die zu Savoyen und damit zur Koalition hielt, und eine andere, gewichtigere, welche Berns Sache vertrat.
FRB, Bd. 6, S. 526f, 542. (1340) - Vom Siegel (wie an Nr. 491) ist nur noch ein Bruchstück vorhanden.
FRB, Bd. 6, S. 753, 777. (1343)
Im Jahre 1343 entstanden trotz dieser Vereinbarungen wieder Streitigkeiten zwischen Peter und dem Kloster. Es handelte sich auch diesmal um verschiedene Grundstücke, wie die „wilde Insel", die „Weihergiessen", die Oberinsel", die obern und die untern Werdthöfe usw. Es wurde ein Schiedsgericht bestellt aus den Herren von Froburg, dem Freiherrn Johann von Kramburg, Johann von Bubenberg, Schultheiss von Bern und Ritter Rudolf von Erlach. Dieses Gericht entschied wieder zu Gunsten des Klosters:
FRB, Bd. 6, S. 788ff, 810. (1343) - Es hängen die vier Siegel 1) des Grafen Johannes von Froburg, am Rand beschädigt, 2) des Freien Johannes von Kramburg, zur Hälfte zerbrochen, 3) des Johannes von Bubenberg, Schultheissen, und 4) des Ritters Rudolf von Erlach.
FRB, Bd. 7, S. 88, 93. (1345) - Das Siegel des Grafen Peter von Aarberg hängt, mit der Umschrift: + S. PETRI. DOMNI. IN. ARBERG.
Im Jahr 1345 übergab Graf Peter Burg und Stadt Aarberg als Mannlehen dem Grafen Walram von Thierstein. Diese Verfügung Peters wurde durch König Karl IV. von Prag aus am 14. September 1347 bestätigt. Es ist nicht klar, welche Gründe ihn dazu veranlassten:
FRB, Bd. 7, S. 127f, 129. (1345) - Die Siegel hängen nicht mehr.
FRB, Bd. 7, S. 149, 149. (1345) - Beide auf der Rückseite aufgedrückten Siegel sind abgefallen. – Über die Geschichte der Ritter von Mattstetten ist im betreffenden Buch38 mehr zu erfahren.
FRB, Bd. 7, S. 205, 206. (1346) - Von den zwei Siegeln hängt nur noch das des Schultheissen von Bern.
FRB, Bd. 7, S. 229f, 232. (1346) - Es hängen die Siegel 1) des Schultheissen Johannes von Bubenberg, wie an Nr. 1 — 2) des Peter von Balm, zum Teil beschädigt — und 3) des Freien Johannes von Kramburg.
FRB, Bd. 7, S. 286, 293. (1347) - Dieser Bestätigung ging die Verurkundung vom 2. Oktober 1345 (FRB, Bd. 7, S. 127f, 129.) voraus.
FRB, Bd. 7, S. 307, 319. (1347) - Das Siegel ist abgerissen.
Während der nächstfolgenden Jahre ist, nach dem Inhalt einer Urkunde zu schliessen, in Peter eine grosse Sinnesänderung vorgegangen. Sein Verhältnis zu den Mönchen des Klosters Frienisberg wurde nach dem Inhalt dieser Urkunde ein ganz anderes als früher. Nach jener Urkunde, die die Jahreszahl 1349 trägt, erkennt und bereut Peter alle Schädigungen wider das Gotteshaus und macht diesem verschiedene Vergabungen. “Wir, Graf Peter von Arberg, tun zu wussen, des wir betrachtet hein, daz in diser zit nit gewisser ist, denn der Tod und nit ungewisser den die Stunde des Todes und enheimen mönschen anders nit nachfolget, den sine Wort und Werch, es si bös old gut, dadür wir erkennen manigfaltigen schaden, den wir und unsere Fordern zugefüget hein der samunge des Gotzhuses Frienisberg." Er anerkennt darum alle Ansprüche Frienisbergs auf die Werdthöfe und auf Feldgerechtigkeiten auf verschiedenen anderen Feldern, befreit das Kloster von allen Zöllen, Steuern, Wachen und „Tagwen" zu Aarberg und erteilt ihm das Recht, einmal im Jahre ohne Gebühren und Abgaben in der Stadt Aarberg Bannwein feilzubieten. Alles das will er tun zu seinem Seelenheil.
Im Gotteshause zu Frienisberg soll er begraben werden. Seine Jahrzeit soll von 12 Priestern mit Virgilien und Messe lesen begangen werden. Bei seinem Tode ist sein Leichnam vom Kloster einzuholen und auf dessen Kosten zu bestatten, wozu der Abt Ulrich sich nach der Urkunde eidlich verpflichtet. Wer den Bestimmungen der Urkunde zuwider handelt, soll vom Fluche der ewigen Verdammnis getroffen werden.
Abb. 15 Das Schloss Aarberg
Bezeugt und besiegelt wird die Urkunde von mehreren angesehenen Persönlichkeiten: Peter von Bubenberg39, Ritter Hesso von Teitigen, Rudolf von Oltigen39, Burkhard von Brennwil, Domkustos zu Basel, Ulrich von Aarberg, Peters Vetter, dem Berner Schultheissen Johann von Bubenberg, Freiherr Johann von Kramburg40 und Rudolf von Erlach, dem Sieger von Laupen39.
Trotz der vielen Zeugen oder gerade deshalb muss die Echtheit dieser Urkunde angezweifelt werden. Schon die Schrift lässt eine Fälschung vermuten. Die Schriftzeichen erinnern an die Schreibweise des 15., nicht des 14. Jh. - Das Siegel des Klosters mit den Wappen von Citeaux in spanischer Schildform weist darauf hin, dass das Ganze im 15. Jh. angefertigt worden ist. Professor Türler führt noch andere Beweise gegen die Echtheit der Urkunde an. Es werden danach Zeugen genannt, die 1349 schon gestorben sind, z. B. Peter von Bubenberg, Kirchherr zu Schüpfen. Auch Ulrich von Aarberg starb bereits 1328. Das Siegel des Grafen Peter von Aarberg stimmt für das Jahr 1349 auch nicht. Es ist endlich höchst unwahrscheinlich, dass Graf Peter zu seinem Seelenheil gerade dem Kloster Schenkungen macht, mit dem schon sein Vater und auch er im Streit Iebte. Aus allen diesen Gründen kommt man also zum Schluss, dass die ganze Urkunde eine Fälschung ist, um zweifelhafte Ansprüche des Klosters sicherzustellen, Ansprüche, die es schon früher gestützt auf Zeugnisse machte, die vielleicht auch falsch waren. Die Grafen Wilhelm und Peter hatten also wohl nicht ohne Grund die früheren Urteile der Schiedsgerichte abgelehnt.41
FRB, Bd. 7, S. 422ff, 438. (1349) - Es hängen alle sechs Siegel, nämlich 1) des Abtes Ulrich von Frienisberg — 2) des Grafen Peter von Aarberg — und 3) seines Vetters Ulrich , Domcustos zu Basel , alle drei mit zerstörten Umschriften — 4) des (älteren) Johannes von Bubenberg , Schultheissen von Bern, — 5) des Freien Johannes von Kramburg — und 6) des Ritters Rudolf von Erlach.





























