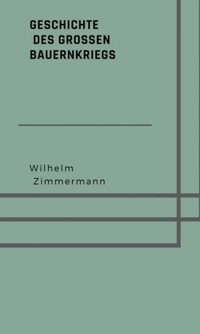
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die hoch hervorragenden Männer, welche mächtige Charaktere und Geister zugleich sind, werden seltener in Deutschland. Nur da und dort steht auf dem Boden unserer Literatur noch ein Eichbaum, der aus einem gewaltigeren Zeitalter deutschen Geistes herstammt, ein Bild der Mannheit und der Freiheit. Schwarz und moosig durch Jahre und Stürme sind seine Aeste; aber sie schafft noch fort in ihm Jahr für Jahr, die ihm inwohnende unsterbliche Lebenskraft Als eine dieser Eichen unserer Nationalliteratur stehen Sie da, hochverehrter Meister. Lassen Sie mich so Sie nennen. Im wörtlichen Sinne bin ich nie Ihr Zuhörer gewesen; ich habe nie Ihr Angesicht gesehen. Durch die Macht des Geistes, in weite Fernen zu wirken, haben Sie mich, ohne es zu wissen, gelehrt, und es soll mein schönster Stolz sein, wenn Sie in mir einen Ihrer würdigen Schüler anerkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1929
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichtedesgroßen Bauernkriegs.
Nachden Urkunden und Augenzeugen.
VonDr. Wilhelm Zimmermann.
Die hoch hervorragenden Männer, welche mächtige Charaktere und Geister zugleich sind, werden seltener in Deutschland. Nur da und dort steht auf dem Boden unserer Literatur noch ein Eichbaum, der aus einem gewaltigeren Zeitalter deutschen Geistes herstammt, ein Bild der Mannheit und der Freiheit. Schwarz und moosig durch Jahre und Stürme sind seine Aeste; aber sie schafft noch fort in ihm Jahr für Jahr, die ihm inwohnende unsterbliche Lebenskraft
Als eine dieser Eichen unserer Nationalliteratur stehen Sie da, hochverehrter Meister.
Lassen Sie mich so Sie nennen. Im wörtlichen Sinne bin ich nie Ihr Zuhörer gewesen; ich habe nie Ihr Angesicht gesehen. Durch die Macht des Geistes, in weite Fernen zu wirken, haben Sie mich, ohne es zu wissen, gelehrt, und es soll mein schönster Stolz sein, wenn Sie in mir einen Ihrer würdigen Schüler anerkennen.
Es waren Tage, in welchen die meisten deutschen Geschichtsschreiber die Wahrheit zu sagen nicht wagten, und die Unwahrheit zu sagen sich nicht scheuten; in diesen Tagen waren Sie es, welcher treu blieb dem Gesetz der Alten für Geschichtschreibung, niemals aus Geschmeidigkeit etwas Unwahres zu sagen, und niemals aus Furcht die Wahrheit zu verschweigen. Sie waren es, der ein scharfes und helles Licht fallen ließ auf jedes Unrecht in der Geschichte, auf Unrecht von oben wie von unten; auf das sittlich Hohe und Edle, wie auf das Niedere und Gemeine im Leben.
Da lernte ich an Ihnen verehren die Gewissenhaftigkeit, die Redlichkeit des Inhalts, und die unbefangene, reine Anschauung des Aeußeren und Inneren der Personen und Begebenheiten; verehren in Ihnen den Mann, der das Geschäft des Geschichtschreibers als eine heilige Pflicht nahm, als einen Beruf von Gott, Sucher und Finder, Hüter und Erhalter der Wahrheit für die Welt zu sein. Gleich zu Haus im Wissen und im Leben, hatten Sie nicht nur den Fleiß und Reichthum des Sammlers und des Quellenforschers; Sie hatten dabei den Verstand des Staatsmannes und des Kritikers; die ausgebildete Vernunft, die in den Begebenheiten die Ideen, in Allem den inneren Zusammenhang fand und aufzeigte; Sie hatten zudem das religiöse Gemüth, das den höheren Geist, der die Menschengeschichte lenkt und aus ihr redet, verstand und auf ihn hinwies; Sie hatten Liebe zur Freiheit und zur Tugend; den Muth, des Rechts der Unterdrückten sich anzunehmen; und das Auge des rückwärts und vorwärts gewandten Propheten, welcher verglich, warnte, ermahnte und weissagte. So schrieben Sie Geschichte, mit Klarheit und Kraft, in großem Sinn.—Das ist es, was ich an Ihnen verehren lernte und verehre.
Sie sind vor 7 Monaten in Ihr achtzigstes Jahr eingetreten, und nicht nur Ihr Geist, auch Ihre Hand schreibt noch. In Ihrer gütigen Zuschrift nennen Sie die Zueignung meines Buches eine Ehre für Sie. Die Annahme dieser Zueignung ist eine Ehre, welche Sie, der Meister, mir und meinem Werke erwiesen haben.
Leonbronn, den 16. Juni 1856.
W. Zimmermann.
Erster Band.
Vorrede zur neuen Auflage.
Man hat in dem Völker- und Staatenleben die Krankheitszustände, ihre Ursachen und Heilungen bisher viel weniger erforscht und dargestellt, als die Zeiten des Blühens und der gesunden Kraft. Weit zu wenig zur Erkenntnis des Gottes-Gerichtes, das sich in der Geschichte vollzieht, hat man die inneren Kämpfe und Entwicklungen, und am wenigsten das untersucht und unbefangen gewürdigt, was in der Tiefe der Gesellschaft lebte, webte und litt, was in ihr gährte und aus ihr herauf rang, in Europa überhaupt, und insbesondere im deutschen Reiche. Und doch ist ohne das Verständnis dieses Lebens und Regens in den Tiefen ein richtiges Verständniß der Geschichte des Ganzen nicht möglich.
In den fernen Zeiten des Mittelalters schon hört man von Zeit zu Zeit ein dumpfes Brausen unter dem Boden, auf welchem die herrschenden Stände der Gesellschaft sich eingerichtet hatten, gleich dem unterirdischen Grollen vulkanischer Kräfte. Von Zeit zu Zeit kam es auch zu einem schwächeren Ausbruch auf diesem oder jenem Punkte. Gleich den Aushauchungen von Gasen und Dämpfen und den kleinen Auswürfen glühender Schlacken aus Schlünden und Spalten eines Kraters, stieg es aus der Tiefe der Gesellschaft auf. Es waren Zeichen des inneren Brandes; aber man achtete nicht darauf, man glaubte wenigstens nicht an die Fortdauer der Regungen und Gährungen in der Tiefe, weil man zunächst die Ausgänge verstopft hatte, und weil lange Pausen folgten, in welchen nichts hervortrat, und Alles zu ruhen schien. Wenn auch wieder einmal irgendwo es hervor zuckte oder brach, so gab man sich doch dem Wahne, das drohende Element sei ganz verschwunden, stets wieder hin, sobald der Ausbruch vorüber war.
Während aber diese Kräfte der Tiefe zu ruhen schienen, sammelte sich immer mehr Bedrohliches unter den Füßen der Gesellschaft, die es sich wohl sein ließ, und zwar auf dem Wege des Unrechts es sich wohl sein ließ.
Da kamen die Tage des Uebergangs des Mittelalters in die neue Zeit: es wurde erfunden und gedacht, es wurde gedruckt und gelesen. Die neuen Gedanken gelangten bis hinab zu der Tiefe, in welcher der Unmuth kochte, und vermehrten dort die Spannung. Warnende Zeichen traten nach langer Ruhe wieder hervor und mehrten sich, Zeichen, die auf einen baldigen großen Ausbruch wiesen. Es gab solche, die ein Gefühl hatten, als stehen sie auf unterhöhltem Boden, und als erzittere dieser. Die Herrschenden in Masse aber, obgleich Erdstöße erfolgten, glaubten noch immer nicht an wirkliche Gefahr, weil die Stöße vorüber gingen, und wieder Ruhe wurde. Sie vermehrten sogar den Druck, selbst da noch, als außergewöhnliche Symptome sich zeigten, die man bei früheren Ausbrüchen nicht wahrgenommen hatte. Da erfolgte die Katastrophe. Der Ausbruch war ein plötzlicher, und hatte die ganze Furchtbarkeit einer Naturscene, wenn ein Vulkan ausbricht.
Die neuen Kräfte des Gedankens hatten in den untersten Schichten in weitem Umfang und gewaltig gewirkt, und der Druck von Oben hatte die Erhitzung und die Spannung täglich vermehrt, bis die Kräfte der Tiefe die Last sprengten, die man von Oben auf sie gewälzt hatte. Und wie man bei einem vulkanischen Ausbruch den Boden auf weite Entfernung hin erzittern fühlt, Blitze über die Berge durch die Wolken zucken, und in glühendem Roth die Oberfläche leuchtet unter unheimlichem Getöse, aus dem heraus man namentlich das Krachen von stürzenden Steinmassen hört: so war es bei dem gesellschaftlichen Ausbruch. Glühende Feuersäulen rötheten den Himmel Tag und Nacht unter Getöse und Krachen; das Verderben wälzte sich über Unschuldige wie Schuldige; mit stürzendem Gestein, bis zum Fuß, bedeckten sich die Berge, bedeckte sich oft weithin die Ebene; mit dem Gestein der zerstörten Häuser der Herrschenden.
Noch stehen überall, tausendweise, Ruinen von Klöstern und Schlössern, als Reste und Zeugen jener Katastrophe. Sie ist der Ausbruch, welchen das vorliegende Buch darstellt.
Im Innern der ganzen Gesellschaft fing es an zu glühen; viel Erstarrtes und Hartes wurde erweicht, schmolz und gerieth in feurigen Fluß; was unten lag, wurde empor gehoben, der Boden hatte sich gespalten, die Rinde der zeitlichen Gesellschafts-Verhältnisse war zerrissen. Aber die Feuerkräfte, nachdem sie eine kurze Zeit thätig gewesen waren, zogen sich zurück, oder sie erkalteten. Die plötzliche Hebung durch die Revolution, und zwar durch eine religiöse wie politische Revolution, machte einer langsamen Erhebung Deutschlands Platz, welche sich durch den Lauf von Jahrhunderten vollziehen sollte.
Dieser Ausbruch hat weithin verheert und zerstört, wohin seine Strömung traf. Durch ihn sollte gestraft werden, und durch ihn ist gestraft worden. Handlungen der Menschen waren es, welche ihn herauf beschworen. Unrecht, das zum Himmel schrie, war es, was ungeheures Unglück über die, welche das Unrecht thaten, oder Kinder und Enkel von solchen waren, gebracht hat. Ihr Unglück kam über sie als Strafe zu groß angewachsener Schuld. Ein höherer Wille ist es, nach welchem das Strafgericht kommt, und welcher es leitet, und Menschen sind nur die Werkzeuge dieses Willens, um an Menschen das Urtheil und die Absichten desselben zu vollziehen. Nach dem Ausbruch hatte die ganze Umgegend umher ein anderes Aussehen, Menschen und Dinge waren verändert; es wurde nicht mehr, wie es vor dem Ausbruch gewesen war, wenigstens in wesentlichen Stücken; eine neue Zeit war angebrochen Unter Verwüstungen und Erschütterungen, unter Sturm und Blut war es Tag geworden; aber Tag war es, was es geworden war.
Es war der gewaltsame Theil im großen Auflösungsprozesse des Mittelalters. Diejenigen Elemente der Gesellschaft, welche abgekehrt waren, und sich überlebt hatten, und die schon länger durcheinander hingen und zum Falle sich neigten, wurden entweder vollends zum Sturz gebracht oder dem Sturze nahe. Sklaven ein halb Jahrtausend lang, vermochten die Bauern nicht im Zeitraume einer Märznacht weder den Geist und Charakter der Freiheit, noch die nachhaltige Liebe zur Freiheit sich zu eigen zu machen. Sie machtens in Vielem bloß nicht besser, als ihre Herren, durch die sie von Kindheit auf systematisch verbittert und verwildert worden waren. Wer sich in dem Bauernkriege bloß an die unnützen, manchmal gräßlichen Zugaben halten wollte, der müßte ebenso der Reformation die ihren, dem Katholicismus die seinen zurechnen, und sich bloß daran halten. Oder fehlt es in der Geschichte der beiden letzten an Schauderhaftem?
Durchgeführt, hätte die Revolution von 1525 Deutschland eins machen müssen, im Politischen und im Religiösen eins. Nicht durchgeführt, aus Ursachen, welche dieses Buch nachweist, hat sie wenigstens weggeschnitten, geebnet, durchgebrochen für Luft und Licht, unvertilgbare Spuren der Zerstörung nicht bloß und des Gerichtes zurückgelassen, sondern auch Furchen gezogen und Keime darein gelegt für künftige Entwicklungen.
Diese Keime haben mit unwiderstehlicher Kraft getrieben, und sie sind ein Segen der Menschheit geworden, nachdem, was wild und wüst war an dem Ausbruch, längst verschwunden ist. Nicht bloß Spiel und Spieler und die Leidenschaften auf den Höhen, sondern auch die in den Tiefen der Gesellschaft müssen der göttlichen Ordnung dienen, nach welcher sich die Zeiten umwandeln und die Geschlechter.
Dieser Ordnung gemäß sieht man im Bauernkriege Gedanken hervortreten, die beim ersten Anblick wunderlich scheinen könnten, die aber auch nur Keime künftiger Entwicklungen sind. Wozu, nach Gottes Wort eben so sehr als nach der philosophirenden Vernunft, die Menschheit spät erst, im Laufe der Zeiten, sich entfalten und vervollkommnen wird, das wird schon beim Ausbruch von 1525 gefordert und gesetzt, als etwas, das da sein könne, solle und müsse, jetzt, sogleich, augenblicklich, herrschend und dauernd von nun an. Das ist der unter dem Namen des tausendjährigen Reiches von der Parteifraktion der sogenannten Wiedertäufer erwartete und gewollte Zustand auf Erden, wo der zeitliche Staat und die Kirche den mündig gewordenen Völkern sich überflüssig gemacht hätten, und die Menschen ihrem eigenen Gesetz unter der unmittelbaren Regierung Gottes gehorchen sollten. J. G. Fichte sagt, „die Tendenz aller Regierung gehe ihrer Natur nach dahin, sich selbst überflüssig zu machen.“ Die Wirkung dieser Tendenz nennt er „die Kultur zur Freiheit,“ zur Selbstregierung. Daß es dazu nur stufenweise fortgehe, das übersah man im Sturm und Drang von 1525. Aber selbst, was diesem Irrthum zu Grunde lag, war ein Keim einer tiefen Wahrheit. Eine Fülle solcher Keime, die sich entfaltet haben oder noch in der Entfaltung begriffen sind, Keime von Vielem, was jetzt das europäische Völkerleben im Tiefsten bewegt, trägt das Jahr 1525 in seinem Strome; diese Keime blieben alle und trieben, nachdem die wilden Wogen sich verlaufen hatten, im Stillen fort. Was jetzt sogar der Mittelpunkt alles Denkens und Strebens in Europa, aller öffentlichen Ereignisse geworden ist, die Idee der Mündigkeit und Selbstständigkeit der Völker: das ist ein Grundgedanke jener Bewegung von 1525. Auch der Gedanke der Einheit der Nation in Haupt und Gliedern wurde dazumal zuerst lebendig.
Ganz gleich den vulkanischen Kräften, welche nach langer Ruhe sich neue Wege öffnen, seitwärts, und dann neue eigenthümliche Wirkungen hervorbringen, brach der Geist der neuen Zeit nicht mehr auf deutschem Boden aus; seine Ausbrüche geschahen seitwärts, zuerst in nächster Nähe des Schauplatzes, wo der Ausbruch von 1525 statt gehabt hatte, in den Niederlanden. Dann folgte der Ausbruch in England, später der in Nordamerika, zwei wesentlich germanischen Staaten. Bald hinter dem letztern drein erfolgte der große Ausbruch in Frankreich. Keiner in der Natur, keiner in der politischen Gesellschaft gleicht ganz dem andern. Aber wenn man die englische und französische Revolution mit der deutschen von 1525 vergleicht, so wird man finden, daß sie dieser in Manchem gleich, in sehr Vielem wenigstens ähnlich sind; nur nicht in dem nächsten Ausgang.
Die Gründe dieses Ausgangs, wie die Ursachen des Anfangs und die Hindernisse des Fortgangs habe ich in dieser neuen Bearbeitung noch deutlicher vor das Auge zu führen gesucht, namentlich die Säfte und Kräfte, die in Gährung gesetzt wurden, die aufregenden und die aufgeregten Elemente, den Zusammenhang der Ereignisse, ihre Bedeutung und ihren Einfluß. Seit dem Erscheinen der ersten Auflage haben Archive und Literatur viel neues Material zu Tage gefördert, und die Kritik hat Manches neu beleuchtet. Schlosser leitete mich mehrfach auf das Richtigere. Ebenso habe ich von Wuttke’s und Kortüm’s Kritiken meines Buches gelernt und ihre Winke benützt. Solche eingehende Kritiken, wie die Kortüm’s und Wuttke’s, fördern den kritisirten Verfasser nicht minder als die Sache. Ich bin Herrn Wuttke ebenso sehr für seinen Tadel dankbar gewesen, als für sein Lob. Gervinus’ freundliche Zuschrift, mit seiner überaus gütigen Anerkennung meiner Art, Geschichte zu schreiben, hat mich seiner Zeit erfreulichst gestärkt. Aber nicht nur von Diesen und andern freundlich Gesinnten habe ich gelernt, sondern selbst von Gegnern, und von feindlich Gesinnten. Ich erkenne es als eine Fügung und Gabe Gottes, daß meine Feinde mir Fundgruben für mein Werk aufgraben und mir Material holen und zuführen mußten, namentlich aus den reichen Archiven Bayerns. Sie haben mitgewirkt, es zu vervollkommnen, und dafür bin ich ihnen dankbar.
Ich selbst bin inzwischen nicht nur durch Jahre und Erfahrung überhaupt reifer, kühler und maßvoller geworden, sondern auch mitten in einer ähnlichen Volksbewegung gestanden, und habe zum Theil darin mitgehandelt; ich habe an der lebendigen Gegenwart Beobachtungen und Vergleichungen anstellen können, und ich habe auch daraus Manches gelernt. Das konnte auf die Auffassung und Darstellung der Menschen und Dinge in meinem Buche nicht ohne tieferen Einfluß bleiben; es mußte dadurch Vieles in Form und Inhalt richtiger, wirklicher, wahrer werden. Alles, was mir jugendlich und idealisirend an der früheren Gestalt des Buches, Alles, was nicht zur Sache nothwendig zu gehören schien, alles Parteifarbige und Tendenziöse, habe ich ausgeschnitten, ganz Neues eingefügt, nicht nur sehr Vieles, sondern das Ganze in der Form umgestaltet. So ist das Buch in Form und Inhalt großentheils ein ganz neues geworden. Bezüglich neueröffneter Quellen bin ich zu besonderem Danke auch Herrn Eduard Stephan zu Mühlhausen in Thüringen verpflichtet, welcher mir gütig mittheilte, was sein verewigter Oheim, Archivar Stephan, aus dem städtischen Archiv über Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer erhoben hatte.
Ich bin noch weniger als früher von Voraussetzungen, von idealen Gesichtspunkten ausgegangen, sondern von den unmittelbaren Quellen und ihren Thatsachen, die ich vorsichtig prüfte, ehe ich etwas aufnahm. Diejenige Art Geschichtschreibung, welcher nicht das Allgemeine aus dem Besondern, sondern so zu sagen das Besondere aus dem Allgemeinen sich ergibt, welche den lebendigen Fluß der concreten Thatsachen in die Gefäße ihrer Abstraktionen zu fassen, und die weite Welt unter den Hut ihrer Voraussetzungen zu bringen sich abmüht,—diese Art halte ich für einen sehr schädlichen Irrthum. Die Geschichte duldet keinerlei Octroyirung. Ihr Leben, weil sie die leibhafte Wahrheit ist, ist mächtiger und energischer, als die Gewalt der Waffen, der Dekrete und der gelehrten Einbildungen.
Der Strom des Geistes der Wahrheit geht vorwärts, allen Reaktionen zum Trotz. Wer dieses Vorwärtsgehen desselben nicht fühlt, der ist eben zurückgeblieben und steht zu tief unten; und während er bloß selber stille gestanden ist, wähnt er, die Zeit stehe stille, die ihm doch längst voraus über den Kopf weggezogen ist, in neues Licht, in neue Luft, in neues Leben hinein. Die Jugend, welche vor unsern Augen heraufwächst, ist unbewußt von einer andern Luft umhaucht, als unsere Kindheit es war; ihr Herz und ihr Kopf wird genährt von den Zuflüssen des neuen Geistes, und Alles athmet diesen ein; auch die Alten, auch die ihn nicht mögen, und sich dawider sträuben. Der sicherste Weg zur Freiheit ist die Kultur zur Freiheit. Er ist länger, als der Ungeduld recht ist; aber er führt allein zur wahren und zur dauernden Freiheit, die mit dem Fürstenstaat so gut zusammenbestehen kann, als mit dem Freistaat, und die zeitweise unter der letzteren Staatsform so sehr mangeln kann als unter der erstern.
Leonbronn in Württemberg, den 9. Juni 1856.
Dr. W. Zimmermann
Aus der Vorrede zur ersten Auflage.
——Nun ein Wort über die Quellen, aus denen ich schöpfte. Die gedruckten führe ich hier nicht auf, da sie jedem Gelehrten bekannt sind. Der Kenner wird es mir auf’s Wort glauben und auch herausfinden, daß ich Alles, was nur immer von gedruckten Quellen auffindbar war, gelesen und verglichen habe. Doch selbst aus den berühmtesten Quellen dieser Art, wie z. B. aus Gnodal, konnte ich für meine Arbeit fast nichts benützen, da sie im Lichte der Urkunden und der Berichte der Augenzeugen in einem bisher nicht geahnten Grade oberflächlich, unlauter und unwahr sich zeigten. Gedruckte Quellen benützte ich darum nur, wo die handschriftlichen mich verließen, was nur höchst selten ganz der Fall war, und nirgends als hie und da auf sächsischem Boden. In reichster Fülle floßen dagegen die handschriftlichen Quellen für Schwaben, Franken, Elsaß, Schweiz, Oesterreich, sowohl Urkunden als Berichte der Augenzeugen, oder solcher, die aus dem Munde von Augenzeugen schrieben; ich habe sie überall unter dem Text angeführt.
Die wichtigste, vor mir für diesen Zweck von keinem benützte Quelle bilden die Akten des schwäbischen Bundes, von mir als Bundesakten im Text citirt, eine lange Reihe von Fascikeln, mancher von mehr als hundert Nummern oder Piecen. Sie befinden sich im Stuttgarter Staatsarchiv.
Ebendaselbst findet sich ein anderer reicher Schatz für den Geschichtschreiber des Bauernkriegs: es ist die Sammlung des verstorbenen Prälaten von Schmid. Gegen vierzig Jahre sammelte dieser edle Gelehrte für eine Geschichte des Bauernkriegs, starb aber, ohne daß er dazu gekommen wäre, etwas mehr daran auszuarbeiten, als den bekannten Aufsatz in der Encyclopädie von Etsch und Gruber. Einen Theil dieser Sammlung konnte Oechsle benützen; die Benützung der ganzen, an Urkunden, Auszügen aus Urkunden und Berichten von Augenzeugen höchst reichen Sammlung des Vollendeten wurde durch ein günstiges Geschick mir zu Theil.
Unter vielem Anderen enthält diese Sammlung in Abschrift die Handschriften: 1) Von Hans Lutz, Herold des Truchseß von Waldburg während des Bauernkriegs. 2) Von Niclas Thomann, Kaplan zu Weissenhorn während des Kriegs; er schrieb theils als Augenzeuge, theils aus dem Munde des Bürgermeisters von Weissenhorn, Diepold Schwarz, der immer um den Truchseß war und beim schwäbischen Bund in großem Ansehen stand; die im Jahre 1533 vollendete Handschrift Thomann’s zeichnet sich durch mehrere wichtige Aktenstücke aus. 3) Von Jakob Holzwart zu Roggenburg, ebenfalls Augenzeuge bei Vielem; seine Handschrift ist vom Jahre 1530. 4) Von Seidler; diese Handschrift ist eine Abschrift der Zeilischen Handschrift, welche der Schreiber des Truchseß, „so alleweil mit und dabei gewesen,“ verfaßt hat, und welche Seidler später in der Kanzlei zu Wolfegg copirte.
Diese Sammlung, so wie alle andern für meinen Zweck dienlichen Akten des K. Staatsarchivs zu Stuttgart, in dessen Gewölben so viele Archive des ehemaligen Schwabens mit ihren Urkunden und Berichten sich versammelt haben, wurden mir mit größter Liberalität zum freien Gebrauch überlassen: eine Freisinnigkeit, die mich zu ehrfurchtsvollem Danke verpflichtet. Direktion und Räthe des Stuttgarter Staatsarchivs erleichterten mir auf die dankenswertheste Art meine Arbeit, und neben meinen verehrten Freunden, den Archivräthen von Kausler und Oechsle, bin ich besonders Herrn Archivrath von Lotter für aufopfernde freundlichste Förderung zum Danke verpflichtet.
Wo ich den auf urkundlichen Forschungen ruhenden gedruckten Arbeiten Oechsles und Bensen’s, so wie den trefflichen Aufsätzen Schreibers in seinem historischen Taschenbuche Etwas verdanke, habe ich es immer unter dem Texte angegeben; für manches Detail vergleiche der Leser diese Arbeiten, sie bestehen und sollen bestehen in Werth und Wirkung fort neben der meinigen.——
Für die Kunst, Geschichte zu schreiben, müssen auch die allgemeinen Gesetze der Kunst gelten. Die Geschichte muß Darstellung sein, und zwar Darstellung des Lebens, nicht Beschreibung oder gar Aufzählung und Aufreihung des Todten. Alles muß im wahren Geschichtbuch in Gestalt und Verhältniß sich bewegen und regen, als wäre es gegenwärtig, als handelte es vor Augen. Was als wahr geglaubt werden soll, darf allein auf ächte Urkunden und auf das Zeugniß unverdächtiger Augenzeugen sich stützen. Geschichte ist Darstellung des kritisch erhobenen Welt- und Zeitinhalts, der thatsächlichen Wahrheit, in der Form der Schönheit. So ist die Geschichte der Alten: daher ihr nationaler, daher ihr über die Menschheit und die Jahrtausende hinlaufender Einfluß, die Ewigkeit ihrer Wirkung.
Nicht bloß die Wahrheit, auch die Kunst gewinnt durch das Studium der Urkunden. Nur der Geschichtschreiber seiner eigenen Zeit in nächster Nähe hat den Vorzug, wie der dramatische Dichter das warme Leben copiren zu können: dem Geschichtschreiber der Vergangenheit bleibt, um die wahre Gestalt wiederzugeben, wenigstens das, noch eine Todtenmaske zu nehmen. Die Archive sind Gräber der Todten, und das Bleibende, Wahre ihres Wesens bilden an längst Dahin- und Vorübergegangenen großentheils noch ihre urkundlich verzeichneten Worte und Thaten, ihre aufbewahrte Eigenthümlichkeit des Seins und des Ausdrucks.
Auf diesem Wege das Leben nachzuzeichnen, war mein Bestreben: Darum wurden bald selbst derbe Striche nicht beseitigt, bald schwächere Lichter und Schatten gegeben, wo stärkere viel wirksamer gewesen wären: sie sollten wieder vor die Augen so, wie sie im Leben gewesen sind, und nicht anders. Ich halte es für eine Sünde, die Wahrheit in der Geschichte zu verletzen, dazu zu machen, um den Zweck einer ästhetischen Wirkung zu erreichen. Und ebensowenig darf die Wahrheit der Schönheit zu Liebe, der gegebene Inhalt der künstlerischen Form wegen beschnitten werden. Nur so viel muß der Geschichtschreiber vom ächten Dichter und Maler an sich haben, daß er es versteht und vermag, naturwahr zu sein in Linien und Farben, das Leben getreu auf’s Blatt zu zaubern.—
Im Urtheil über das Ganze aber wie über Einzelnes möge Keiner vergessen, daß es mit alten Geschichten ist wie mit den Ruinen auf den Bergspitzen: Von unten hinauf schauend gewinnt man nur eine Ansicht; erst, wenn man durch Gestrüpp und Steinschutt mühsam hinaufgeklommen, hat man die Einsicht.
Am 8. November 1843.
Dr. W. Zimmermann.
Einleitung.
Die Geschichte der Völker hat ihre Stürme und Gewitter, wie die äußere Natur. Wie das Erdbeben und der Meeressturm, spielen Völkerstürme mit Städten und Menschenleben, und man ist gewohnt, auf sie nur als auf ein blutiges Unheil hinzublicken, mit Widerwillen und Schauder. Anders sind sie im Auge des Geschichtskundigen. Ihn hebt die Wissenschaft und das eigene durch sie größer gewordene Herz über die Schrecken der Zeiten; er sieht dem Laufe der Weltbegebenheiten, den Bewegungen des Völkerlebens zu, mit ruhigem Blick, stillmessend und combinirend, wie der Astronom dem Gange der Sterne. Er erkennt selbst in dem Zerstörenden auch wieder das Belebende, selbst da, wo nur rohe physische Kräfte zu walten scheinen, den Geist. Ihm sind Ländereroberungen und Völkerrevolutionen, die Donner des Kriegs und der Schlachten nur Symphonieen des göttlichen Geistes, nothwendig in dem großen Weltgedicht, das Geschichte der Menschheit heißt. Weil eine Vorsehung ist, so müssen auch die empörten Elemente ihren höheren Zwecken dienen, und es muß auch aus dem Walten der bösen Kräfte, aus wilder Gährung und Strömen Blutes das Gute hervorgehen. Sind doch im Wetter voll Blitzen und Donnern himmlische Kräfte: es befruchtet und erfrischt, indem es erschüttert und schreckt.
Die Menschheit muß fort und fort sich neu schaffen, die Völker müssen zu höherer Befähigung sich durcharbeiten, ihr letztes Ziel durch Kampf sich erstreiten. Dieses Ziel aber ist Freiheit. Alle Hoheit und aller Glanz des Lebens ist nur in ihr möglich, in ihr nur die wahre Veredlung und Größe der Menschheit zu hoffen, sagt Schiller. Nur unter dem Schutz weiser Gesetze und freier Institutionen entfalten sich alle Blüthen der Cultur kräftig, sagt Alexander von Humboldt. Für den Fortschritt der Menschheit in der Vervollkommnung ist politische Freiheit unumgänglich nothwendig, sagt der Engländer Finlay. Aber diese Freiheit, so mild und sanft, wenn sie groß geworden, wird unter sauren Mühen von der Zeit unter dem Herzen getragen, und muß meist bei der Geburt eine Geburt voll Schmerzen, bei der Taufe eine Taufe voll Blut durchmachen. Und das geschieht, weil meist die, welche in der Gewalt sind, es unterlassen, Gerechtigkeit zu lernen oder zu üben, und mit Grausamkeit und Verachtung auch das Billige und Zeitgemäße dem Volke vorenthalten; und weil dann meist die Leidenschaft im Volke über die Vernunft hinaus geht, und der Kampf für politische Rechte in Anarchie umschlägt.—Der Kampf um das Recht aber dauert oder erneuert sich so lange, bis das Recht festgestellt, oder das, was im wahren Sinne des Wortes Volk heißt, in einem Lande vernichtet ist.
Wie lange ist nicht schon Freiheit des Kampfes Panier und Siegespreis zugleich? Und doch herrschte zu allen Zeiten der meiste Unverstand oder Mißverstand über dieses Wort, wie über alles Einfache und Tiefe. Die Freiheit ist nicht an eine Gattungsart der Regierung gebunden; es gibt keine alleinseligmachende Staatsform. Wo des Regierens weder zu viel noch zu wenig ist, wo die Gesetze so weise sind, daß die Würde des Menschen in Allem aufs Höchste geachtet wird, da ist die meiste Freiheit.
Die Völker wären weiter in Rechten und freien Gesetzen, wenn es nicht ihre Art wäre, die Freiheit auf falschen Wegen zu suchen. Statt der Vernunft und der Leitung der Begabteren sich unterzuordnen, wie sie in Nordamerika thaten, wollen die meisten lieber maßlos und anarchisch sein; oder sie erschlaffen, auf halbem Wege, in Opfern und Anstrengungen, statt auszudauern. Ganze Nationen erschlaffen gerne, aber in den Nationen zuerst die untern Klassen. Auch mit den Völkern ist es wie mit einzelnen Menschen: sie bedürfen von Zeit zu Zeit eines Stoßes, der sie aufrüttelt und vorwärts treibt.
Zu diesen Bewegern des Menschengeschlechts gehören die Kriege, die innern, wie die äußern. Der Stoff dazu sammelt sich in Mitten der Völker selbst an, langsam, nach und nach, und wenn er sich entzündet und seine Verheerung über die Lande wälzt, pflegt man zu sagen: es ist die Zuchtruthe des Schicksals oder des Himmels. Wo Ungerechtigkeit oder Kurzsichtigkeit das Billige weigert, ruft sie den Widerstand hervor. Wo in den höhern Ständen Sitten-Verderbniß und Ueppigkeit, Gewaltstreiche und Bedrückungen Charakter der Herrschenden geworden sind, werden durch eben diese selbst die untern Elemente des Staats zur Empörung getrieben: ein Gift straft das andere. Das, dieses sittliche Gericht in der Weltgeschichte, ist freilich ein Gericht Gottes, der Hohe wie Niedere züchtigt, wenn sie ungerecht wandeln.
Als eines der unheilvollsten Ereignisse, als ein Einbrechen blinder Naturkräfte in den deutschen Staat pflegt man die bewaffnete Erhebung des gemeinen Mannes zu betrachten, welche unter dem nicht ganz entsprechenden Namen des großen Bauernkrieges bekannt ist. Man ist gewohnt, darin nur die düstere Brand- und Todesfackel zu sehen, welche die rohe Faust der Empörung gegen das Herz des deutschen Vaterlandes geschwungen, indem man mehr an einzelne Erscheinungen und Thaten, als an den innern Zusammenhang und an den Geist desselben sich hält.
Dreierlei hauptsächlich hat man meist nicht beachtet, einmal, daß so vieles, was man dem Bauernkrieg insbesondere zur Last legt, gewöhnlich im Gefolge des Krieges überhaupt, also jedes andern Krieges, in jener Zeit war; zweitens, daß die Herren es waren, welche das Volk dadurch, daß es das Aeußerste von ihnen zu leiden hatte, und durch ihre Treulosigkeit im Fortgange des Kampfes, zum Aeußersten trieben; endlich, daß man behutsam lauschen muß, um die zarte Stimme der Wahrheit aus dem übertäubenden Geschrei den Sieger, des mönchischen und aristokratischen Fanatismus, herauszuhören, ein Geschrei, in das nach der Niederlage selbst die der besiegten Partei einstimmten, aus Noth, um durch den Schein gleicher Gesinnung die Verfolgung von sich abzulenken. Wie anders würden die gleichzeitigen Berichte lauten, hätte das Volk gesiegt: sie sprächen wie die Geschichtsbücher der befreiten Schweizer, wie die des freien Englands. So aber, weil das Volk unterlag, ward die Bewegung vielfach verleumdet, das wirklich Großartige daran verschwiegen oder verketzert. Große Dinge und hohe Interessen der Menschheit waren es, welche der Bewegung zu Grunde lagen und in ihr hervortraten.
Diese Bewegung hat man sinnig das prophetische Vorbereitungswerk der neueren Weltgeschichte genannt. {1} Sie ist die gewaltige Ouvertüre zu dem Schauspiele, das sich auf dem Boden der neueren Zeit abspielt, und dem das Tragische nicht fehlt. Alle Erscheinungen der späteren socialen Bewegungen in Europa liegen in der Bewegung von 1525 eingeschlossen: sie ist nicht nur der Anfang der europäischen Revolutionen, sondern ihr Inbegriff im Kleinen. Alle die Erscheinungen, durch welche Staaten im Laufe der folgenden Jahrhunderte verändert wurden, so wie diejenigen, welche in unsern Tagen eine gesellschaftliche Umgestaltung vorbereiten, finden ihre Vorbilder in der Bewegung von 1525, sowohl was Individuen, als was Ideen betrifft. Mit Recht nannte Treitschke den Geists Thomas Münzers einen Spiegel, der die Erscheinungen künftiger Zeiten in sich prophetisch dargestellt; mit Recht hob er hervor, daß einzelne Ideen aus der Masse der Ideen, welche das Gemüth Münzers erfüllt haben, und die seine Zeit ver- lachte, später von andern Männern aufgefaßt und ausgebildet worden seien, die damit Bewunderung und Ruhm geerntet haben, wie William Penn, Spener, der Graf von Zinzendorf, J. J. Rousseau, die französischen Demagogen und die Naturphilosophen; heut zu Tage—wie manchen bekannten Namen hätte er nicht hinzuzusetzen?
Der ganze Ideengang der folgenden Jahrhunderte und der neuesten Zeit, so weit er politisch und religiös ein revolutionärer ist, findet sich von Münzer theils angedeutet, theils klar ausgesprochen. Um hellsten trat, was in ihm nur unvollendet und aufblitzend war, in der englischen Revolution, ein starkes Jahrhundert nach Münzer, in ausgeprägten Erscheinungen hervor; und was im germanischen Mutterlande, in Thüringen, angefangen und mißlungen war, verwirklichte sich zuerst in den beiden angelsächsischen Weltreichen diesseits und jenseits des atlantischen Ozeans, nämlich unter dem stammverwandten Volke auf dem Boden Englands, und in Nordamerika.
Die Bewegung von 1525 hat ihre schöne wie ihre düstere Seite; reine und edle Kräfte walten darin, neben unreinen und finsteren. Der Geist, aus welchem der ganze Kampf hervorging, war der Geist der Freiheit und des Lichtes. Die einzelnen Erscheinungen, in welchen sich der Geist Bahn zu brechen sucht, mögen noch so getrübt sein, dieser bleibt dennoch der, der er ist. Dieser Geist muß zuletzt mit Allem aussöhnen.
Die Bewegung war auch nichts plötzlich Hereinbrechendes und nichts Zufälliges; sie hatte sich lange vorbereitet und hatte ihren Grund in den Verhältnissen des gemeinen Mannes und in der Zeit. Daher ihre reißendschnelle Ausbreitung, der fast über ganz Europa hinlaufende Antheil daran. Die Anlage des Volkes dazu war so alt, als die Unterdrückung desselben. Auch an den Ketten schärft sich die Liebe zur Freiheit.
Die Geschichtschreibung ging lange an diesem großen Ereignisse entweder mit halbabgewandtem Gesichte vorüber, oder die es berührten, mißhandelten dasselbe, aus Mangel eines unparteiischen, eines höheren Standpunktes. Selbst diejenigen Bearbeiter der Einzelpartieen, die eine freiere Gesinnung hinzubrachten, behandelten ihren Gegenstand fast zaghaft, ohne das Wesen desselben, die großen Sünden der Herrschenden einer- und das aus tausend Wunden blutende Herz des zur Verzweiflung getriebenen Volkes andererseits nackt aufzudecken.
Daß die folgende Darstellung Niemand ein Anstoß sein werde, das wird nicht erwartet. Wer der Geschichte sich weiht, dem muß es um die Wahrheit zu thun sein und das Wohl der Menschheit, nicht um Gunst. Es ist schön, der Gegenwart zu gefallen; besser aber ist es, der Zukunft zu genügen.
Erstes Buch.
Erstes Kapitel.
Durch das ganze Mittelalter hin war von Zeit zu Zeit das Landvolk gegen adelige und geistliche Herren aufgestanden, theils zur Wahrung seiner alten, ursprünglichen Freiheit, theils zur Abwehr der Willkür, welche gewaltsam die Lasten der Unfreien schwerer, die Hörigen zu Leibeigenen machen wollte.
Dieser Kampf zeigt sich durch ganz Europa auf vielen Punkten. Die Bauern aber hatten zuletzt immer kein Waffenglück, theils weil sie auf weitentlegenen Punkten vereinzelt und nicht gleichzeitig, mit gesammter Kraft, und im Zusammenhang auf einer weiten Strecke umher, den Kampf versuchten; theils weil sie schlecht geführt oder verrathen wurden; theils weil sie der Waffen entwöhnt waren.
Glücklich kämpften die Bauern in Niederdeutschland, die Dithmarschen und die Kennemarer; in Oberdeutschland die Schweizer. Jene wie diese unterstützte ihr Boden: dort Flüsse, Meer und Sümpfe; hier die Berge und Engen der Alpenwelt.
Seit die Schweizer siegreich waren, und ihren Bund bis an den Bodensee und den Schwarzwald vorrückten, zuckte es durch ganz Schwaben, und weiter bis ins Herz von Franken. Der Umlauf freierer und hellerer Gedanken einerseits, und andererseits die gesteigerte Genußsucht und Pracht der Herren, und, um diese zu befriedigen, die Steigerung und Mehrung der Lasten wirkten zusammen, um den Drang nach einer Aenderung der Zustände im Volke zu nähren. Die Erfindung der Buchdruckerkunst um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts brachte manches fliegende Blatt auf das Land hinaus; es fand sich immer einer, welcher denen, die nicht lesen konnten, es las; und diese Flugblätter hatten sehr oft einen Inhalt, welcher den geistlichen oder den weltlichen Herren, meist beiden zugleich, feindselig war.
Theils nach einander, theils an entfernten Orten gleichzeitig, kam es zu Versuchen oder Ausbrüchen dessen, was in der Tiefe der Massen arbeitete und kochte. Im Jahre 1476 predigte der „Pfeifer-Hänslein“ von Niklashausen, Hans Böheim, im Würzburgischen allgemeine Freiheit und Gleichheit. Wie er jahrelang auf den Kirchweihen und Hochzeiten an der Tauber hin und wieder aufgespielt hatte, so verkündete er jetzt „ein neues Gottesreich, worin Alles abgethan sei, Kaiser, Fürst und Pabst, alle Herrschaft und alle Lasten, Jeder des andern Bruder sein, mit eigener Hand das tägliche Brod gewinnen, und Keiner mehr als der Andere haben müsse.“ Der Bischof von Würzburg ließ ihn Nachts überfallen und verbrennen, und die Bewegung zerfloß.
In den Niederlanden wurde im Jahre 1491, als Mißwachs und Theurung war, das Landvolk durch heillose Steuer- und Münzoperationen zur Bitte um Abhülfe seiner Beschwerden, und, da die Antwort eine neue Auflage von zwei Goldgulden auf jedes Haus war, zum Aufstande gebracht. Weil sie ein schlechtes Gerstenbrod und einen grünen Käs in ihre Fahnen gemalt hatten, hieß man sie „die Käsebröder.“ Ein großes Kriegsheer war nöthig, diesen Bauernaufstand zu unterdrücken. Im obern Deutschland war die Aufregung so, daß die Zeitgenossen urtheilten, wäre das Käse- und Brodspiel nicht zeitig genug unterdrückt worden, so hätte die durch die Käsebröder veranlaßte Bewegung an der Mosel und am Rhein hinauf sich fortgeleitet.
Seit dem Ablaufe der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts ist es überhaupt, als fange ein Verbindungsfaden sich durch alle Bauerschaften hindurchzuziehen an, und als gehen aus einem Gau in den andern Einzelne hin und wieder, und tragen im Stillen Entwürfe und Losungen hin und her. Der Trieb der Einigung wird in den Bauern seitdem immer lebendiger. Die gute alte Zeit hatten nicht Alle vergessen. Auf die ursprünglichen bäuerlichen Zustände, und auf die Arten und Wege, aus welchen sie um ihre Freiheit gebracht wurden, fällt ein scharfes Licht durch die Urkunden aus dem Allgäu, in Oberschwaben, namentlich aus der gefürsteten Abtei Kempten und aus Ochsenhausen.
Zweites Kapitel.Wie die freien Bauern zu Kempten um ihre Freiheit kamen.
Die Urkunden der im Allgäu gelegenen Abtei Kempten und die landschaftlichen Akten legen anschaulich dar, wie diese Landleute nach und nach Stück für Stück um ihre Freiheit gebracht und mit ungerechten Lasten beschwert wurden.
Die schöne Landschaft Allgäu erhebt sich im Osten des Bodensees und senkt sich an der Nordseite des Tiroler Gebirges gegen den Lech ab, vorwärts schließt sie sich unmittelbar an die Alpen an. Seit alten Zeiten hatte sich hier eine zahlreiche freie Bauerschaft erhalten, „eine freie Gebürs,“ die theils zerstreut umher saß, theils eine zusammenhängende Reihe von Weilern und Höfen ausmachte. Ihre Person und ihre Güter waren ursprünglich ganz frei, wie die der Edelleute. Frei konnten sie sich einen Schirmherrn wählen, wo sie wollten, ziehen, wann und wohin sie mochten, und waren dem Schirmherrn bloß gerichtsbar und botmäßig. Nur wenig von ihnen unterschieden war eine gleichfalls zahlreiche Klasse, die Freizinser: wie die erstern frei für ihre Person, hatten sie das Recht, wie diese zu testiren, Intestat-Erbschaften zu machen, Verträge zu schließen, ganz selbstständig über ihr Eigenthum zu verfügen, ohne Schatzung mit Leib und Gut überall hin zu ziehen, und zahlten nichts, als jährlich einen Zinspfennig auf den Altar und ein Schirmgeld dem Schirmherrn, den sie, wie es ihnen gut dünkte, wechseln konnten. Sie hatten weder Reisen, noch Besthaupt, Erbtheil, Tagdienste, oder sonst etwas zu leisten. Nur beim Tode eines Freizinsers oder einer Freizinserin wurde das beste Gewand als Todfall gegeben. Nach und nach kamen sie in die Unterthänigkeit ihrer Klöster, ihrer Freiherren, ihrer Städte. Bei der Landschaft Kempten ging es so:
Zuerst wurde im Laufe der Zeit außer dem rechten Todfall auch das Besthaupt genommen. Dann ging man daran, solche Freizinser, welche Güter des Gotteshauses zu Lehen nahmen oder trugen, und welche darum dieselben Zinse, Gülten und Dienste, wie andere Gotteshausleute, schuldig waren, nach und nach wie diese letztern anzusehen, sie mit diesen in eine Klasse zu werfen; und die, welche es sich gefallen ließen und nicht bei Zeiten die Rechte ihres freien Standes verwahrten, liefen nach Jahren in der Liste der Leibeigenen, und wurden als solche behandeln Da der größte Theil des Grundeigenthums bald auf den früher beschriebenen Wegen im Besitz der Abtei war, so waren viele Freizinser zugleich Lehenträger des Klosters, und eben darum bald auch Viele aus freien Leuten Eigenleute geworden, oder als solche behandelt. Das erste Stück, das man ihnen von ihrer Freiheit abzog, war das Recht, sich beliebig zu verheirathen. Die Abtei verbot den Freizinsern, welche zugleich Lehen von ihr trugen, die Heirath mit Leuten, die ganz frei waren, oder unter einer andern Herrschaft standen, weil nach allemanischem Gesetz Kinder, mit freien Frauen erzeugt, ganz frei waren; dagegen begünstigte die Abtei die Heirath freier Zinsbauern mit ihren Leibeigenen, weil so erzeugte Kinder Leibeigene des Gotteshauses waren.
In der Mitte des zwölften Jahrhunderts saßen urkundlich noch viele Bauern auf ihren Höfen völlig frei und unmittelbar unter kaiserlichem Schutze, zu nichts verpflichtet als zum Kriegsdienste. Natürlich wurden auch sie auf jede Weise dahingetrieben, sich unter den Schirm des Gotteshauses zu begeben, und dadurch in eine Stellung, worin es dem Schirmherrn leicht wurde, sie nach und nach den Unfreien gleich zu behandeln, und immer weiter zu greifen. Da die Ungunst der Zeiten manchen freien Mann dulden, und die Rückforderung seiner Freiheit und seiner Rechte verschieben ließ, wurde das lange gegen ihn geübte Unrecht zuletzt zu einem verjährten Rechte gestempelt.
Das Gotteshaus ging dabei methodisch zu Werke. Ein Abt baute auf dem, was sein Vorgänger gebaut, um die Freiheit der Bauern zu beschränken, unter Benutzung jedes günstigen Zeitverhältnisses weiter, bis man zuletzt von ihnen dieselben Leistungen verlangte, wie von den Eigenleuten des Klosters. Die freien Bauern und Zinser wiesen, als die Anmaßungen soweit gingen, diese zurück. Der Abt griff jetzt zu grobem Betrug. Er ließ eine Urkunde schmieden, und präsentirte sie als einen Stiftungsbrief Karls des Großen, worin die geforderten Leistungen als uralte Rechte des Gotteshauses enthalten waren. Die Bauern fühlten und wußten, daß ihnen gröblich Unrecht geschah, aber ein Dokument, ein altes Pergament sprach gegen ihr Gefühl und ihr Wissen. Den Betrug aufzudecken, waren sie außer Stande; denn einmal waren sie zu der Zeit—es war zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts—noch nicht aufgeklärt genug in diesen Landen, um einem so hoch gestellten frommen Manne einen solchen Betrug zuzutrauen; dann auch fehlte es den Bauern an den nöthigen wissenschaftlichen Kenntnissen, um die Urkunde als unächt und unterschoben nachweisen zu können, und Geistliche, die ihnen hätten hierin zur Hand gehen können, hätten in solchen Dingen niemals gegen Geistliche gearbeitet. In ihrer Noth suchten die freien Zinsbauern sich dadurch zu helfen, daß sie Gebrauch von einem alten Rechte machten, von dem urkundlichen Rechte, falls sie durch Ungebühr bedrängt würden, einen andern Schirm sich zu wählen. Sie stellten sich unter den Schutz des Grafen Wilhelm von Montfort-Tettnang. Der Abt schrie über Eingriffe in seine Rechte. Ein höheres Gericht, auf Befehl Herzogs Ludwig von Baiern aus Edeln und Städtebürgern zusammengesetzt, sollte entscheiden. Der Landadel und die Städter aber entschieden gegen die Bauern: es wurde dem Grafen abgesprochen, dieselben in Schirm zu nehmen.
Die Bauern wählten nun den Ritter von Freiberg, des Stiftes Vogt, der auf Wolkenberg saß, zu ihrem Schirmherrn, und vertheidigten mit den Waffen ihr altes gutes Recht wider das Kloster. Dieses wandte sich an den Pabst Martin V., und unter Androhung des Bannes wurde dem Ritter von Freiberg geboten, die Leute des Gotteshauses nicht zu schützen, und vor dem päbstlichen Delegaten zu Constanz binnen vierzehn Tagen sich zu verantworten. Als er nicht erschien, wurde er mit seinen Dienern und Unterthanen gebannt, und auf der Feste Wolkenberg belagert. Die freien Zinsbauern selbst wurden mit dem Bann bedroht, wofern sie nicht dem Gotteshause die schuldigen Renten, Zehnten und Zinse zu leisten sich entschlößen, oder sich binnen vierzehn Tagen zu Constanz rechtfertigten. Ein Schiedsgericht, das den Edeln Berthold von Stein zum Obmann, den Ulmer Bürger Ulrich Löw und den Edeln Peter von Hoheneck zu Schiedsleuten hatte, forderte, da der Streit bis in den Frühling 1423 sich verzog, von dem Abt, einen Eid zu schwören, daß seine Vorfahren und er die Zinser des Gotteshauses mit Steuern, Zinsen, Diensten und aller Gewaltsame gleich den Eigenleuten, wie er vorgebe, besessen haben; und nach ihm sollten die zwei vornehmsten Conventherren des Stiftes schwören, daß des Abtes Eid rein und nicht unrein sei. Der Abt verlangte Bedenkzeit, Aufschub; die Bauern drangen auf augenblickliche Leistung des Eides. Der Aufschub wurde gewährt. Am 4. Juli 1423 schwur der Abt den Eid, und die Bauern kamen dadurch ins Unrecht. Glücklicher waren die freien Zinsbauern, die in der Stadt wohnten: sie schützten die Städte, und, ein seltener Fall, selbst der heilige Stuhl zu Rom, so sehr auch die Priester der obern Lande einander wider die Bauern unterstützten.
Denn alle Stifter und Klöster sahen in der Streitsache der freien Zinsbauern und des Abtes zu Kempten ihre eigene Sache. Vierzig Prälaten verbanden sich zusammen, auf zwölf oder mehr Jahre, gemeinschaftlich den Streit wider die Bauern zu führen, die Geldkosten gemeinsam zu tragen, und auf jede Art einander behülflich zu sein.
Um des Pabstes Schutz den Angefochtenen zu entziehen, erlaubte der Abt sich in einem Schreiben an den heiligen Stuhl die Lüge, daß die freien Zinser gleichsam wie Leibeigene seit unvordenklichen Zeiten Dienste geleistet haben, und diese Lüge unterstützten mehrere Prälaten mit ihrem Zeugniß und Siegel.
Die freien Zinsbauern aber schickten selbst eine Botschaft nach Rom, deckten die Unwahrheit des geistlichen Schreibens auf, und brachten es dahin, daß der Abt die gütliche Vermittlung der Städte nachsuchte. Darauf ließen sie sich dahin vermögen, die Sache vor dem heiligen Stuhle nicht weiter zu treiben.
Der Meineid, die Lüge, die schlechten Mittel jeder Art, welche sich der Abt in dem Streite mit den Bauern erlaubt hatte, fingen nachgerade an, ihn in seinem Gewissen zu beängstigen. Er wandte sich in der Gewissensangst an den Pabst, und dieser sprach ihn, nachdem er dem Abte von Zwiefalten gebeichtet, von seinen Sünden los. Das Unrecht, womit er sich an Gott und Bauern versündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch offenbaren Meineid und Betrug freie Bauern um ihre Freiheit und ihr altes Recht betrogen.
Wenige Jahre darauf wußte das Stift vom Kaiser sich auszuwirken, daß Niemand des Gotteshauses Leibeigene, freie Zinsbauern oder Altarleute auf dem Lande wider den Abt und ohne dessen Willen in Schutz nehmen dürfte. So schnitt der Kaiser den freien Zinsbauern den letzten Weg ab, sich den Bedrückungen des Stiftes zu entziehen, und löschte so mit einem Federzug ihr uraltes Recht aus, wegzuziehen und das Zinserrecht aufzugeben, sobald man sie durch Ungebühr bedränge. Und die Bedrängungen gingen nicht nur fort, sondern nahmen zu. Die landschaftlichen Akten weisen nach, wie gleich derjenige Abt, der diese Vergunst vom Kaiser ausgewirkt, manchen freien Bauern zu völliger Leibeigenschaft gedrängt, und wie noch mehr sein Neffe und Nachfolger von den freien Zinsbauern Dienste, Steuern, Todfälle und Leibhühner forderte und eintrieb, wie von seinen Leibeigenen, denen er sie in Allem gleich behandelte. Heirathete eine freie Jungfrau oder Frau einen Zinsbauern des Stifts, so wurde sie vom Abendmahl, ja von der Kirche überhaupt so lange ausgeschlossen, bis sie sich in die Zinserschaft des Gotteshauses ergab; heiratheten freie Zinsleute Leibeigene, so wurde das Gleiche gegen sie angewandt, bis sie sich selbst auch leibeigen dem Stift ergaben.
Wirkte der Zwang, den man den Gewissen anthat, in einem und dem andern Falle nicht, so legte man den Ehemann ins Gefängniß, bis die neuvermählte Frau sich an das Stift ergab. Klagen, Berufungen auf ihre alten Freiheitsbriefe wurden mit dem Block oder Thurm beantwortet. In solcher Noth wagten sechsundzwanzig Familien freier Zinsbauern, dem letzten kaiserlichen Spruche zum Trotz, fremden Schirm zu suchen. Kaiser Siegmunds Spruch und Brief, sagten sie, finde auf sie keine Anwendung, indem solche ihren alten Briefen entgegen lauten, und der Kaiser von dem wahren Stande der Sachen nicht unterrichtet gewesen sei. Einige Familien beriefen sich auf besondere Briefe, alle aber auf ein altes Buch und auf eine Urkunde darin vom Jahre 1144, worin unzweifelhaft verzeichnet war, daß die freien Zinsbauern nichts als den Zinspfennig und den Todfall schuldig seien, und sonst keine Leistung. Diesem entgegen, habe sie der Abt zu Kriegsdiensten (Reisen), Steuern und andern Dingen gedrängt, zudem etliche von ihnen mit Thurm und Block genöthet, und so haben sie einen andern Schirm gesucht, wie sie wohl laut ihrer Briefe thun dürfen.
Jetzt suchte das Stift alle Spruchbriefe, welche in früheren Streiten mit den Bauern gegen diese erlassen worden waren, als Rechtsbeweise wider sie geltend zu machen. Aber umsonst. Die späteren Papiere, welche das Unrecht in Rechtsform gebracht hatten, waren nicht haltbar den alten Originalurkunden gegenüber, welche die Bauern wieder aufgefunden hatten. Der Abt mußte die alten Briefe seiner Vorfahren und die Freizügigkeit der Zinsbauern anerkennen, und es blieb ihm nichts, als die Dienstbarkeit derjenigen Zinsbauern, welche in diesen alten Briefen nicht begriffen waren, durch einen Eid zu erhärten. Er leistete ihn, und dieser Eid brachte diesen Theil der Zinsbauern nun für immer in die Lage, daß ihre Dienstbarkeit als eine gesetzliche Berechtigung des Gotteshauses galt.
Drittes Kapitel.Die Rechtswahrung der Kemptener am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.
In derselben Zeit, in welche das Käse- und Brodspiel am Niederrhein fiel, standen die Bauern der Abtei Kempten wieder gegen ihren Landesherrn. Durch Auswanderung in die Schweiz hatten sich manche Bauern den Bedrückungen zu entziehen gesucht. Die zurückgebliebenen Bauern des Stiftes aber sahen sich trotzdem nach wie vor so behandelt, daß die Unzufriedenheit immer mehr zur Gährung, zuletzt zum allgemeinen Widerstand wurde. Durch den Trotz und Uebermuth der Stiftsherren waren viele Leute des Gotteshauses ins Verderben gestürzt worden.
Abt Johannes II., der zu Ende des Jahres 1481 den Hirten- und Fürstenstab übernahm, that, als suche er, behutsam und klug durch Milde die Wunden seines Volkes zu heilen. So hoffte wenigstens dasselbe in der ersten Zeit. Aber in Kurzem „verwandelte sich, wie die Chronik des Stifts sich ausdrückt, das Schaf in einen Wolf.“ Alle Dienste und Steuern, früher schon ungerecht und drückend, wurden unter ihm noch gesteigert. Er trieb das Unterdrückungssystem in größerem Styl und Umfang, als wollte er den letzten freien Bauern in seinem Bereich zu seinem Zinsmann, die Zinsleute zu seinen Leibeigenen herab drücken. Wer das sich nicht gefallen lassen wollte, wurde wochenlang vor dem geistlichen Gericht herumgezogen, oder in Block und Thurm gelegt, zur Bürgschaft genöthet, oder von seinen Gütern vertrieben; die Länge und Vielheit der Plackereien machten wohl auch den Beharrlicheren und Stärkeren mürbe, daß er auf Urfehde gelobte, keinen fremden Schirm zu nehmen und mit Steuern, Reisen, Diensten, Faßnachthühnern, Todfall und Hauptrecht gehorsam zu sein. Die freien Weiber und Kinder der Zinsbauern wurden ohne Ausnahme dem Gotteshause verwandt. Die gleichen Lasten wie die Zinsbauern mußten auch freie Leute übernehmen, wenn sie ein Gut des Gotteshauses pachteten. Die Leibeigenen mußten überdies für den Fall ihres Absterbens die Hälfte ihrer Verlassenschaft dem Abt verschreiben. Vater- und mutterlose Waisen wurden ihres Erbes beraubt, Kinder unter Vormundschaft gezwungen, durch Verschreibungen sich als Leibeigene zu erklären. Die Ungehorsamen wurden mit Geldstrafen bestraft, bis auf hundert Gulden, ja bis auf den dritten Pfennig alles Vermögens, und diese Strafen wurden als ewige Zinse in die lehenfreien Güter geschlagen. Die Zinse aus den Gütern und die Steuern der Zinsleute, welche nur zwei Schillinge zu geben hatten, wurden nach dem Umfang ihrer Güter gewaltsam auf zwei, drei und vier Gulden erhöht. Mit Steuern und Reisegeldern Gemeinden doppelt zu belegen, und den herkömmlichen Betrag der gerichtlichen Strafgelder zu steigern, galt noch als das Geringste, und den Klagen wurde entgegengehalten: „Nicht bloß die Bauern seien mit Steuern und Anderem allzusehr belastet, auch Fürsten und Edle halten sich jetzt für beschwert, und selbst Kaiser und Könige seien zu dieser Zeit gegen ihren Willen zu Manchem gezwungen; warum da mit den Bauern eine Ausnahme gemacht werden sollte?“
Ja der Abt und seine Vertheidiger führten geradezu für seine Rechtfertigung an, „er mache es nur, wie andere Herren auch!“
Es ist ein fürchterliches Zeugniß, dieses Rechtfertigungswort des Abtes, gegen den Herrenstand, und Niemand widersprach ihm, Niemand verwies es ihm. Die Wahrheit des Wortes mußte, wenn auch nicht für alle Herren, doch für den Stand im Durchschnitt treffen und passen. Es kam im Jahre 1489 jene große Theuerung, welche von den obern Landen bis in die Niederlande sich erstreckte, so daß das Malter Roggen acht Pfund Heller an manchen Orten kostete; und ungeachtet dieselbe in den folgenden zwei Jahren bis zur Hungersnoth stieg, legte der Abt eine neue Steuer auf die Unterthanen um.
Zahlen konnten sie nicht, und doch wurde von ihnen gefordert. Am 15. November 1491 war die ganze Bauerschaft an der alten Malstatt zu Luibas beisammen, tagte und berieth über eine „Vereinigung, einander bei ihren alten Briefen und Rechten zu schützen.“ Sieben Tage darauf standen sie schon zusammen in einem Lager unweit Durach, und schwuren einander, Keiner vom Andern zu lassen, und vorerst die Herren und Städte des schwäbischen Bundes um Recht in ihrer Sache wider den Abt anzugehen. Sie wählten einen Hauptmann, Jörg Hug, von Unterasried. Er war ihr Sprecher vor dem schwäbischen Bunde. Bedeutsam nannte der Fürst-Abt diesen Bauernhauptmann Hug „den Huß von Unterasried.“
Die Herren und Städte aber sahen in des Abtes Sache ihre eigene; denn die Aufregung pflanzte sich bereits auch über ihre Gebiete fort, und schon war ihm bewaffneter Beistand zugesagt, die „meuterischen“ Unterthanen zur Pflicht zurückzuführen; nur die Stadt Nördlingen sprach dagegen und verlangte eine rechtliche Untersuchung der Klagen der Bauern. Auf dieses traten die Botschafter des Bundes auf dem Rathhause zu Kempten zusammen unter dem Vorsitze des Ritters Hans von Frondsberg zu Mindelheim, dem Oheim des berühmten Georg.
Auf den Knieen riefen hier die Abgeordneten der Bauern das Recht an: wären sie im Irrthum, so solle man sie zurecht weisen; ja, fände sich, daß sie Unrecht begehrten, so wollen sie ihre Köpfe hingeben. In den Herren des Schwabenbundes fand aber die Stimme des Rechtes vor der Stimme des Eigennutzes kein Gehör. Das Einzige, was sie thaten, war, daß sie den Fürst Abt von blutiger Rache an den Bauern abhielten. Auf dem Schlosse Liebenthann brachten sie eine Vermittlung zu Stande, ganz zu Gunsten des Abtes. Darum wollten die Bauern sich an den Spruch nicht kehren, wiewohl sie die Waffen niederlegten, und sandten ihre Klage nun unmittelbar an den Kaiser. Heinrich Schmid von Luibas wählten sie, um ihre Sache wegen ihrer Freiheitsbriefe vor diesem höchsten Haupte zu führen, das durch den Krönungseid verpflichtet war, die Freiheit und die Armen zu schützen. Der Abt aber ließ diesen Botschafter der Bauern, als er auf dem Wege zum Kaiserhof war, meuchlings niederwerfen; er kam nie mehr zum Vorschein.
Ein zweiter Botschafter des Landvolkes, Sebastian Becherer von Kempten, war glücklicher. Als man schon auch an seiner Wiederkehr verzweifelte, kam er, und mit ihm die Nachricht, daß der Fürst vor den Kaiser werde vorgeladen werden, um auf die Klagen der freien Zinser und der armen Leute des Stifts sich zu verantworten.
Auf die Gewaltthätigkeiten hin, welche sich der Abt gegen ihren Botschafter und gegen sie selbst in mancher Weise fortwährend erlaubte, hatten die Bauern sich aufs Neue zusammen gethan. Der Abt wandte sich abermals an den schwäbischen Bund um Hülfe gegen seine widersetzlichen Unterthanen. Der Bund mahnte die Bauern drohend zur Waffenniederlegung und zum Gehorsam. Diese ließen sich noch einmal treuherzig machen, ihre Klagen vor einem Bundestag zu Eßlingen vorzubringen. Aber der Entscheid, den sie auch hier erhielten, war natürlich wieder der Art, daß ihn die Bauern verwerfen mußten.
Jetzt beschloß der Bund: „weil bei längerer Nachsicht alle Ehrbarkeit und Obrigkeit in Gefahr wäre, die Bauern mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen; vorerst die Rädelsführer aufzuheben und zu strafen; würden die Bauern dann noch nicht ruhig und gefügig, diese mit Krieg zu überziehen.“
Das Kriegsvolk des Bundes sammelte sich zu Günzburg, zu Mindelheim standen die Soldknechte des Abts. Doch wagten sie noch immer keine Gewalt. Wochen, Monate verstrichen. Die Bauern sollten sicher gemacht werden, und sie wurden es. Plötzlich, am Michaelis Abend, sahen sie sich von den Kriegsknechten des Bundes zu Roß und zu Fuß in ihren Dörfern überfallen, verwundet, verstümmelt, viele auf den Tod, ihr Hab und Gut ausgeraubt, ihre Wohnungen in Flammen. Ueber dreißig tausend Gulden wurde der Schaden geschätzt. Die Rädelsführer, der man habhaft wurde, wurden aufgehoben und ins Gefängniß weggeschleppt; einige hundert Bauern wanderten aus in die Schweiz.
Jetzt, nach solchen Vorspielen, setzte der Bund der Bauerschaft einen neuen Tag zu Memmingen zu rechtlicher Verhandlung. Von derselben, die nicht nur ihrer Habe, sondern, was jetzt schwerer für sie war, ihrer Häupter, Führer und Sprecher sich beraubt fühlte, kamen zweihundert und zweiundfünfzig Zinser und Gotteshausleute, aus 22 Ortschaften, als deren Vertreter.
Da ward ihnen gesprochen: Sie, die Unterthanen, haben dem Abte gehorsam, gerichtbar, dienstbar und botmäßig zu bleiben, wie sie ihm bei Anfang der Regierung geschworen; ihr Bündniß abzuthun und kein neues zu machen; jährlich an Steuer, Zins, Gült, Theilfällen, Hauptrecht, und Anderem das zu leisten und zu reichen, was sie bisher haben leisten und reichen müssen, so lange, bis sie rechtlich beweisen, daß sie das Eine oder Andere ganz oder zum Theil nicht schuldig seien.
Der Fürst solle seine Klagen wider seine Unterthanen, die Bauern ihre Klagen wider den Abt vor ein Schiedsgericht bringen, zu gütlichem Vertrag oder rechtlichem Spruch, namentlich auch den Streit über die Reise-(Kriegs-)Steuern und Anderes. Jeder solle in seine Heimath zurückkehren, und beide Theile sollen sich Vergessenheit des Geschehenen versprechen; die Gefangenen sollen nach Annahme des Vertrags ihrer Haft, die Gebannten des Bannes ledig, Jeder der Ausgetretenen bis zu einer gewissen Zeit in den Vertrag eingeschlossen werden, Jeder aber auch denselben nicht annehmen können. Gegen die, welche ihn nicht annehmen, soll es in Allem stehen, wie vor dem Vertrag, und das Gotteshaus alle seine Angehörigen bei ihrem Stande lassen.
Von den Ausgetretenen kehrten Etliche in ihre Heimath zurück, stellten sich in dem Stift und schwuren, dem Vertrage nachkommen zu wollen. Ein großer Theil der Bauerschaft aber nahm den Vertrag nicht an: sie hatten nicht ohne Grund das Vertrauen zu den rechtlichen Entscheidungen verloren. So kam es zu keiner Fortsetzung ihrer Klagen und Beschwerden; sie glaubten jetzt die Verhältnisse nicht günstig, ihre Sache fortzuführen. Es war eine Versöhnung zwischen dem Herrn und einem Theile der Unterthanen äußerlich, ein Stillstand für den Augenblick; das Mißvergnügen blieb innerlich, wie die Ursachen blieben, die es veranlaßten. {2} Eine endliche Entscheidung über die Beschwerden der Bauern erfolgte nicht. Der Abt aber setzte seine Bedrückungen bald wieder fort.
In diese Zeit fällt die erste Nachricht vom „Bundschuh.“
Daß die Bauern in der Landschaft Kempten einen „Bundschuh“ in ihrem Lager aufgesteckt haben, davon findet sich bis jetzt nirgends etwas erwähnt. Wohl aber wird erzählt, daß während dem der Bundschuh bereits als ein Zeichen des Aufstandes im Volke bekannt war. Dieses Zeichen geht weiter zurück, und man weiß nicht, wann und wo es zuerst gebraucht wurde. Während der Streitigkeiten der Bauern mit dem Fürstabte steckten Bürger in der Stadt bei einer Hochzeit, im Uebermuthe des Weines, gegen zweihundert an der Zahl, an einer langen Stange einen „Bundschuh“ auf, im Wirthshause zur Glocke in der Vorstadt. Der gemeine Mann lief herzu und sah es gerne. Das Volk wünschte, es möchte einmal dazu kommen, „mit dem Abt abzurechnen.“
Auf die Anzeige beim Rath, in der Vorstadt sei ein „Bundschuh“ aufgerichtet, kam der Stadtammann mit den Knechten in die Herberge und trug vor, welch großes Ding es sei, einen Bundschuh aufzustecken. Auf seine Vermahnung wurde der Scherz abgethan. {3} Das war im Jahre 1492.
Das Zeichen des Bundschuh’s als Panner hatte seinen Ursprung daher: Der Ritter trug als besondere Auszeichnung—Stiefeln; der Bauer, wenigstens der unfreie, als Zeichen der Unterthänigkeit und Unfreiheit—Schuhe, gitterartig vom Knöchel an aufwärts mit Riemen gebunden. Dieser allgemeingetragene Bauernschuh hieß von dieser Art des Bindens Bundschuh.
Viertes Kapitel.Der Bundschuh im Elsaß.
In den Städten mußten während der Theurung die Armen auf öffentliche Kosten gespeist werden. Das Landvolk aber hatte keinen Theil an dem wohlgekochten Muß, welches den Armen in der Stadt zur Nothdurft ausgegeben wurde, und die Theurung und die Noth stiegen im zweiten Jahre noch höher.
Diese Noth im Auge und die immer mehr gesteigerten Anforderungen der Landes- und Gutsherren, thaten sich im Elsaß im Jahre 1493 Bürger und Bauern in eine Einung zusammen. In tiefes Geheimniß hüllte sich der Bund. Geheimnißvolle Zeichen und Gebräuche banden die Mitglieder zusammen. Unter eigenthümlichen Ceremonien, mit schrecklichen Bedrohungen gegen Verräther, wurden die Neulinge in den Bund aufgenommen. Nachts, auf Seitenpfaden, schlichen sie zu dem Ort ihrer Zusammenkünfte, dem einsamen Hungerberge. Bald zählte der Bund Eingeweihte aus Schlettstadt, Sulz, Dambach, Epffig, Andlau, Stozheim, Kestenholz, Tiefenthal, Scherweiler und andern Orten der Umgegend. Es waren nicht nur Leute aus den niedern Volksklassen, Bauern und Handwerker, sondern es fanden sich Männer darunter, welche in städtischen Würden standen. Es waren zwar „viele verdorbene Leute, die sich zu heimlichen Anschlägen mit Eiden verpflichteten,“ wie die Berichte erzählen, jedoch Berichte, die ihre dem gemeinen Manne feindliche Stimmung unverdeckt an den Tag legen.
Die Grundsätze der Bundesverfassung waren zweierlei Art: die einen waren darauf berechnet, den religiösen und politischen Zustand umzugestalten, die andern, für diese Umgestaltung den gemeinen Mann anzulocken. Unter die letztern gehörte die vorgeschlagene Plünderung, beziehungsweise Ausrottung der Juden, die Einführung eines Jubeljahrs, wodurch alle Schulden abgethan sein sollten, die Aufhebung des Zolls, des Umgelds und anderer Lasten. Unter die erstern gehörte namentlich die beabsichtigte Beschränkung der Geistlichkeit, die Abschaffung des geistlichen und rottweilischen Gerichtes, das Recht der Steuerbewilligung, und die Selbstverwaltung der Gemeinden nebst Geschworenengerichten.
„Welcher Pfaff, hieß es in ihrem fünften Artikel, mehr dann eine Pfründ hätte, dem sollten sie genommen und ihm weiter nicht, denn des Jahrs fünfzig oder sechzig Gulden gegeben werden.“ Auch die Ohrenbeichte, eine Hauptstütze der geistlichen Herrschaft über die Menschen, sollte ganz und gar abgethan sein. In Zukunft sollte das Volk nicht anders als nach eigener freier Bewilligung steuern, und jede Gemeinde sich selbst richten.
Um einen festen Punkt, worin sich die Verschworenen für den Anfang des Kampfes halten könnten, und bedeutende Geldmittel zu gewinnen, ward beschlossen, sich zuerst des festen Schlettstadts zu bemächtigen, sich der Stadtkassen und der dortigen Klosterkassen zu versichern, und von da aus das ganze Elsaß an sich zu ziehen.
Als läge in einer Fahne eine geheimnißvolle Kraft, als gehörte das unumgänglich nothwendig zur Sache, wurde besonders berathen und beschlossen, ein Panner aufzuwerfen und ein charakteristisches Bild in dasselbe zu malen, „damit ihnen der gemeine Mann zuliefe.“ Es ward beschlossen, einen Bundschuh in das Panner zu malen. Sobald die Anzahl der Mitglieder des Bundes groß genug wäre, sollte losgeschlagen werden. Sie zweifelten nicht, daß der gemeine Mann in Städten und Dörfern umher sich ihnen anschlösse, und für den Fall, daß sie selbst nicht stark genug wären, die Sache des Volkes durchzufechten, sollten die schweizerischen Eidgenossen herbei gerufen werden.
Es dauerte nicht lange, und es hatte „eine große, merkliche Zahl“ in den Bund geschworen. Der Zeitpunkt, wo das Panner des Aufstandes und der Freiheit aufgeworfen werden sollte, konnte festgesetzt werden. Es war die Charwoche. Zu Anfang dieser sollte der Schlag auf Schlettstadt geschehen.
Aber das Geheimniß wurde nicht bewahrt. Es war ein Fehler des Anschlags von vorn herein, daß nicht Leute eines Standes, nur Bauern, in den Bund aufgenommen wurden, sondern allerlei Volk, Stadtmeister und Kleinbürger, Landleute und reisige Knechte; daß ferner nicht Jeder, welchem von dem Bunde geoffenbart wurde, gezwungen war, zu dem Bunde zu schwören.





























