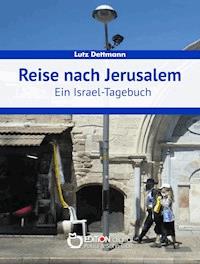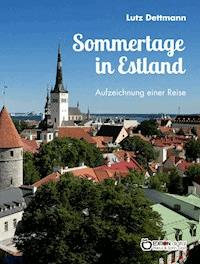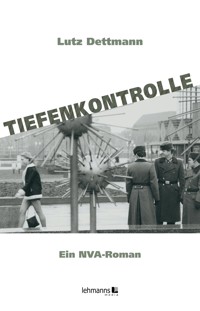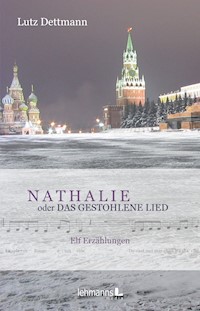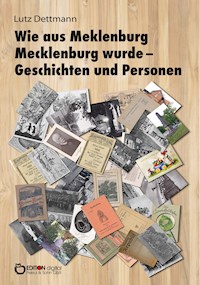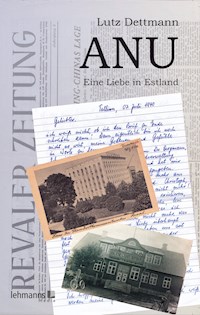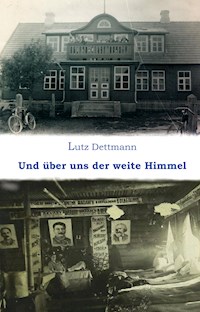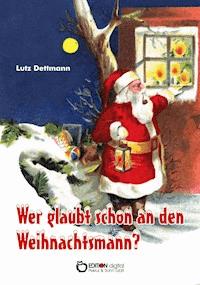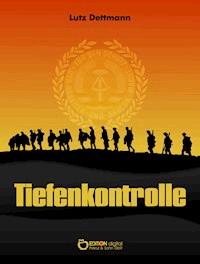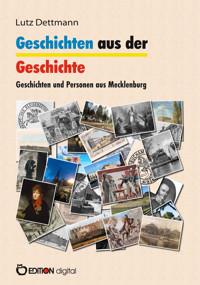
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass auf den mecklenburgischen Landtagen nicht nur politisiert, sondern auch der Degen oder Pistolen gezogen wurden? Ist Ihnen bekannt, dass mecklenburgische Dorfschullehrer nicht als Einjährigfreiwillige im deutschen Heer dienen durften? Wenn nicht, der Autor wird Ihnen davon berichten. Anschließend an seinen ersten Band „Wie aus Meklenburg Mecklenburg wurde – Geschichten und Personen“ nimmt er Sie wieder mit in die Geschichte Mecklenburgs, erzählt, warum der Postillion nicht unbedingt der Traumberuf eines jeden Jungen war, berichtet vom Brückenschlag über den Schweriner See und stellt ein besonderes Mühlen- und Bienenmuseum bei Woldegk vor. Sie werden Zeuge der Hochzeit des letzten Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin und sitzen auf einem der Bahnsteige des Schweriner Hauptbahnhofs bei Kaffee und Kuchen. Der Leser begibt sich in das Mecklenburg des frühen 19. Jahrhunderts, erfährt etwas über das Schulwesen in beiden Großherzogtümern und nimmt Teil am Landtag in Sternberg. Wie im ersten Band seiner Geschichten erfahren wir das alles auf eine leicht zugängliche, unterhaltsame Weise. Die 26 Texte, zum Teil Erstveröffentlichungen, zum Teil schon in der Schweriner Volkszeitung, im Nordkurier, der Zeitschrift Mein Mecklenburg und anderen Publikationen erschienen, sind in diesem Buch erstmals vereint und einige der Texte auch erweitert worden. Geschichten für „Zwischendurch“ – Geschichte, einmal anders erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Lutz Dettmann
Geschichten aus der Geschichte
Geschichten und Personen aus Mecklenburg
ISBN 978-3-68912-447-2 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-980-9 (Buch)
Das gedruckte Buch erschien gleichzeitig bei EDITION digital, Imprint des Geschichtlichen Büchertisches Ralf G. Jordan, 31162 Bad Salzdetfurth
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2025 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Mecklenburg im Aufbruch
Mecklenburg zwischen 1790 und 1806
Die „Landschaft“ Mecklenburg bestand am Ausgang des 18. Jahrhunderts aus zwei Herzogtümern: Dem Herzogtum Mecklenburg-Schwerin und dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz. Mecklenburg-Schwerin, der größere Landesteil Mecklenburgs, umfasste die Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und -Güstrow, das Fürstentum Schwerin, die Herrschaften Rostock und Wismar (ab 1803) und einige Klosterämter. Zusammen bildeten sie eine Fläche von etwa 228 Quadratmeilen. Diese Zahl entspricht etwa 13.000 Quadratkilometern.
Mecklenburg-Strelitz, der kleinere Landesteil Mecklenburgs, entstand 1701 als Ergebnis des Hamburger Erbvergleichs. Dieser Erbvergleich setzte jahrelangen Streitigkeiten um die Erbfolge der erloschenen Güstrower Linie, die von 1611 bis 1695 existiert hatte, ein Ende. Als Ergebnis wurde Herzog Friedrich Wilhelm als alleiniger Erbe der Güstrower Linie bestimmt. Adolf Friedrich, der Schwiegersohn des verstorbenen Güstrower Herzogs Gustav Adolf, erhielt als Ausgleich das Fürstentum Ratzeburg und die Herrschaft Stargard.
An den Namen der einzelnen Territorien Mecklenburgs lassen sich noch die alten Landesteile erkennen, aus denen im 13. und 14. Jahrhundert durch Aussterben der Nebenlinien, Heirat oder Kauf der Territorialstaat Mecklenburg unter Führung der Herrschaft Mecklenburg entstand.
Das Fürstentum Ratzeburg, wie auch das Fürstentum Schwerin, aus den gleichnamigen Bistümern gebildet, waren nach ihrer Säkularisierung bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges selbstständige, dem Reich unmittelbar unterstellte Kanonikate. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gingen sie direkt an Mecklenburg.
Das Herzogtum Mecklenburg-Schwerin hatte 1799 298.000 Einwohner, von denen 146.000 Personen in den 42 Kleinstädten des Landes lebten. Seit 1785 residierte Herzog Friedrich Franz I., der Neffe des pietistischen Herzogs Friedrich, in Ludwigslust. Doch Friedrich Franz war ein lebenslustiger Fürst, der durch seine Volkstümlichkeit bei den Mecklenburgern beliebt war.
Friedrich Franz I.
Mecklenburg-Strelitz wurde von Herzog Karl II. regiert. Er war der Vater der späteren Königin Luise, der Frau Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Mecklenburg-Strelitz hatte 1800 63.000 Einwohner, von denen 52.500 in der Herrschaft Stargard und 10.500 im Fürstentum Ratzeburg lebten.
An den Koalitionskriegen gegen das republikanische Frankreich hatte sich Mecklenburg nicht beteiligt. Mecklenburg hatte zwar, laut Repartitionsfuß im Reichsschluss von 1681, 425 (1/6!) Mann Infanterie und 510 (3/7) Mann Kavallerie zu stellen. Doch hoffte Friedrich Franz durch eine Geldzahlung, wie es auch in früheren Zeiten üblich gewesen war, von der Verpflichtung entbunden zu werden. Mecklenburg-Schwerin verfügte nur über geringe Truppen. Hinzu kam, dass drei Infanteriebataillone in Holland eingesetzt waren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten von Seiten des Reiches kaufte sich Mecklenburg schließlich doch von dieser Verpflichtung der jährlichen Zahlung frei. 1795 mussten fast 300.000 Taler gezahlt werden. Durch den Baseler Frieden 1795 zwischen Frankreich und Preußen brauchte diese Kontingentsersatzzahlung nicht mehr geleistet werden. Stattdessen zahlte Mecklenburg nun ein Schutzgeld an Preußen, das den Schutz für alle nördlich des Mains gelegenen, vom Krieg zurückgetretenen Länder übernommen hatte. So mussten 1802 1.081.000 Taler gezahlt werden.
Seit 1788 befanden sich zwei mecklenburgische Bataillone des Füselierregiments von Gluer und ein Bataillon des Grenadierregiments von Both in der Folge eines Vertrages zwischen Friedrich Franz und Prinz Wilhelm von Oranien in Holland. Das mecklenburgische Korps wurde bis 1790 von Generalmajor von Gluer, ab 1790 von Oberst von Pressentin geführt.
1786 war es zu Unruhen in Holland gekommen. Prinz Wilhelm V. von Oranien, der Erbstatter der vereinigten Niederlande und Schwager König Friedrich Wilhelm II., hoffte mit den mecklenburgischen Truppen diese Unruhen zu bekämpfen. Während dieser Kämpfe kamen die mecklenburgischen Söldner auch mit republikanischen Truppen in Berührung, da Frankreich am 1. Februar 1793 England und den Niederlanden den Krieg erklärt hatte. Dadurch verbreitete sich republikanisches Gedankengut innerhalb der Truppe, so dass es 1795 sogar zu Unruhen innerhalb des Kontingents kam. Anfang 1796 wurden die Truppen schließlich vom Eid entbunden und konnten in die Heimat zurückkehren. Es kehrten insgesamt 726 Mann, drei Viertel des ursprünglichen Kontingents, zurück. Holland hatte für die Unterstützung jährlich 30.000 Taler gezahlt, die der Herzog u.a. für den Ankauf von landwirtschaftlichen Gütern verwendete. Zur Schiffbarmachung der Elbe wurden zwischen 1790 und 1794 30.800 Taler aus diesen Geldern verwendet. Dieser Soldatenverkauf war leider typisch für diese Zeit und wurde von vielen deutschen Fürsten praktiziert.
Mecklenburg hatte einige Jahre des wirtschaftlichen Aufstiegs hinter sich. Die Folgen des Siebenjährigen Krieges waren beseitigt und durch eine kluge Politik der Landesfürsten zog ein gewisser Wohlstand im Lande ein. 1787 konnten die Ämter Plau, Eldena, Marnitz und Wredenhagen, die im preußischen Pfandbesitz waren, wieder eingelöst werden. Diese Ämter waren 1734 von Herzog Christian Ludwig in Folge der politischen Wirren unter Carl Leopold verpfändet worden.
Da die Ernteerträge dieser Jahre in Mecklenburg relativ hoch lagen, wuchs auch die Ausfuhr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Frankreich, das eine Reihe Missernten gehabt und durch die Folgen der Revolution und der Koalitionskriege große Ernteverluste hatte, war Hauptabnehmer der mecklenburgischen Agrarprodukte. 1800 wurden im Rostocker Hafen 640.000 Pfund (320 Tonnen) Butter für das Ausland verladen.
Folge dieser Ausfuhren war ein Mangel an Lebensmitteln in Mecklenburg, der eine Teuerung mit sich brachte. So kostete Ende 1.800 ein Pfund (500 Gramm) Butter 18 Schillinge, der Preis für ein Scheffel (33,42 Liter) Roggen war von 26 Schillinge auf zwei Taler gestiegen. Im Vergleich dazu betrug der Tageslohn eines Zimmermanngesellen 14 bis 16 Schillinge. Der größte Teil der Lebensmittel wurde dem täglichen Handel auf den Märkten entzogen. Die Städter hatten keine Möglichkeit, Waren auf den Märkten zu erhalten, da die Gutsbesitzer, Pächter und Bauern ihre Ernteerträge direkt an die Kaufleute weitergaben, die diese Waren dann mit großem Gewinn in das Ausland weiterverkauften. Nur verständlich ist die wachsende Verbitterung der städtischen Bevölkerung, musste sie doch trotz der hohen Ernteerträge hungern. Denn die hohen Lebensmittelpreise der wenigen auf den Märkten angebotenen Waren konnten von den meisten Mecklenburgern nicht bezahlt werden.
Im Schweriner Landesteil kam es zu Unruhen, deren Höhepunkt die sogenannte „Butterrevolution“ in Rostock vom 29.10.1800 war. Eine aufgebrachte Menschenmenge stürmte die Butterspeicher und plünderte diese. Diese wurde jedoch von Generalmajor von Pressentin, der nach der Hollandexpedition seit 1797 Kommandant der Stadt Rostock war, niedergeschlagen. Doch trotzdem musste der Herzog auf den Druck der Bevölkerung reagieren. Es wurde nun Getreide für einen niedrigen Preis bereitgehalten. Außerdem erließ Friedrich Franz ein Ausfuhrverbot für Kartoffeln und Speck.
Am Rande sei noch erwähnt, dass Friedrich Franz, auf Betreiben seines Leibarztes Dr. Samuel Gottlieb Vogel, das erste Seeheilbad Deutschlands gründete. Unweit Doberans entstand ab 1793 das Bad Heiligendamm, das innerhalb weniger Jahre zu einem der teuersten und elegantesten Bäder Deutschlands wurde. Während der Badesaison von Juni bis September hielt Herzog Friedrich Franz in Doberan Hof, mit ihm der mecklenburgische Adel und eine Vielzahl deutscher und ausländischer Fürsten. Trotzdem war Doberan und Heiligendamm aber auch von Beginn an ein Badeort des vermögenden Bürgertums.
Der Heilige Damm von der Seeseite 1843
1803 erwarb Friedrich Franz die seit 1648 verlorene Stadt Wismar mit den Ämtern Poel und Neukloster zurück. Er musste 1.750.000 Taler an Schweden zahlen. Schweden erhielt die Erlaubnis, diesen Besitz nach 100 bzw. 200 Jahren gegen Wiedererstattung der Kaufsumme und drei Prozent Zinseszins zurück zu erwerben. Erst 1903 verzichtete Schweden auf das Wiedererwerbsrecht für alle Zeiten.
Am 5. April 1795 war der Friede von Basel zwischen Frankreich und Preußen geschlossen worden. Frankreich verpflichtete sich, alle rechtsrheinischen Gebiete Preußens zu räumen, während die linksrheinischen Gebiete Preußens bis zum Friedensschluss mit dem Reich zu Frankreich geschlagen wurden. In Folge dieses Vertrages und der Verträge von Campo Formio (1797), Rastatt (1798) und Luneville (1801) bildete der Reichstag einen Ausschuss, der sich mit der Entschädigung der deutschen Fürsten, die durch Annexion der linksrheinischen Gebiete Schaden erlitten hatten, beschäftigte. Dieser Reichsdeputationshauptschluss arbeitete langwierig ein Reichsgrundgesetz aus, das 1803 vom Reichstag als letztes Grundgesetz angenommen wurde. Auch Mecklenburg-Schwerin kam in den Genuss von Entschädigungen. Es erhielt die Besitzungen des Lübecker Hospitals (ehemalige, im 14. Jahrhundert verlorengegangene mecklenburgische Dörfer), als Entschädigung für zwei erbliche Kanonikate (Sitz im Domkapitel des Straßburger Münsters). Diese hatte Napoleon Friedrich Franz formell entzogen; sie waren aber schon unter Ludwig XIV. verlorengegangen, da Straßburg seit 1681 französisch war. Für die wiedergewonnen Dörfer musste Mecklenburg aber auf die Halbinsel Priwall in der Lübecker Bucht verzichten.
Russland stellte 1803 bei Abhaltung der Reichsversammlung in Regensburg den Antrag, Mecklenburg die Kurwürde zu verleihen. Doch angesichts der beginnenden Auflösung des Reiches und der Hilflosigkeit gegenüber dem französischen Großmachtstreben lehnte Friedrich Franz diese Kurwürde ab.
Herzog Karl II., der Bruder und Nachfolger des kinderlos gestorbenen Adolf Friedrich IV. (Fritz Reuters „Dörchläuchting“), hatte durch strengste Sparsamkeit den Schuldenberg seines Bruders abgetragen. Er hob die kleineren Domänenämter Wanzka, Nemerow, Broda, Bergfeld und Sponholz auf und vereinigte sie mit den größeren Amtsbezirken Feldberg, Stargard und Strelitz. Durch den Zusammenschluss dieser kleinen Herzoglichen Ämter verringerte sich der Verwaltungsaufwand beträchtlich. Durch den Ankauf mehrerer Güter durch die herzogliche Kammer konnte das Domänengebiet vergrößert werden.
Viele Mecklenburger werden den Eindruck gewonnen haben, dass das neue Jahrhundert friedlicher als das vorige werden würde. Doch sie sollten sich täuschen.
Schloss Ludwigslust. Wandgemälde von Friedrich Jentzen
Blick in eine vergangene Arbeitswelt
Das Mühlenmuseum in Alt Käbelich – Müller und Imker mit Leidenschaft
„Sonne lacht, Blende acht.“ Der Spruch meines Vaters, einst Hobbyfotograf, fällt mir ein, als wir in Richtung Alt Käbelich, gelegen im Strelitzschen, starten. Der Sonnabend in der Mitte des Septembers macht seinem Namen alle Ehre. André und Anke Sump, Freunde von uns, sind zu Besuch im Sumpschen Elternhaus. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Alt Käbelich ist in diesem Jahr 725 Jahre alt geworden. André will heute Interessierte durch das Dorf und seine Geschichte führen. Wir sind dabei …
Laut des allwissenden (?) Internets gibt es 264 Museen in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu zählen Heimatstuben, Museumshöfe, Literaturmuseen … Von diesen sind 14 in privater Trägerschaft. Das privat geführte Mühlenmuseum in Alt Käbelich fehlt in dieser Aufzählung. Ein Grund mehr, dieses Museum vorzustellen. Es verdient, bekannt gemacht zu werden, nicht, weil es von Andrés Vater geführt wird, sondern weil Herbert Sump in dieses Museum so viel Herzblut, Kraft und Leidenschaft gesteckt hat. Und nicht nur er, sondern auch seine Frau, die ganze Familie.
Nach fast drei Stunden Fahrt, denn das Land ist voller Baustellen und Touristen, die mit Tempo 80 die mecklenburgische Landschaft genießen wollen, lenke ich unser Auto auf das Sumpsche Anwesen. Die Mühle, keine mit Windmühlenflügeln, sondern eine mit Strom angetriebene, ist nicht zu übersehen. An der Wand prangt in riesigen Lettern „Honig“. Warum? Dazu später.
Wir kommen etwas verspätet, der erste Durchgang Kartoffelpuffer auf dem Sumpschen Mittagstisch ist bereits durch. Trotzdem ist die Begrüßung herzlich. Auch Andrès jüngerer Bruder Karsten mit Tochter Elena sind daheim. Sie wollen am Wochenende den Eltern helfen, denn das Anwesen ist sehr groß. Kartoffelpuffer sind nicht so mein Ding. Obwohl, mit Käse schmecken sie sogar.
Gut, bevor ich mich in Kleinigkeiten verirre und den Leser langweile, ein Zeitsprung in den frühen Nachmittag: Herbert Sump, André, meine Frau und ich sitzen unter dem großen Walnussbaum. Der ist genauso alt wie ich, 1961 gepflanzt. Mein Notizbuch gezückt, erzählt mir der alte Müller aus der Familiengeschichte. Wenn er von seinen Bienen und dem Leben als Müller spricht, glaubt man nicht, dass er über 80 ist. Seit 1907 sind die Sumps ansässig in Alt Käbelich. Großvater Paul Sump übernahm hier die Bockwindmühle und das dazugehörige alte Fachwerkwohnhaus mit der rohrgedeckten Fachwerkscheune, die damals noch ein Storchennest trug. Dazu gehörte eine kleine Landwirtschaft, die er im Laufe der Jahre stetig vergrößerte. 1912 wurde der Stall gebaut, der sämtlichen größeren Haustieren Platz bot. Der Stallboden diente der Lagerung von Heu und Getreide. Der Domänenpächter Wendlandt sorgte dafür, dass es seit 1923 in Alt Käbelich elektrischen Strom gibt, und 1926 errichtete Paul seine elektrische Mühle. In den 1930er Jahren wurde dann ein weiteres Gebäude gebaut, das hauptsächlich zur Unterbringung der landwirtschaftlichen Gerätschaften diente. Herbert Paul Wilhelm Sump, Müller in zweiter Generation, aus der englischen Kriegsgefangenschaft 1948 zurückgekehrt, übernahm die beiden Mühlen und die Landwirtschaft von seinem Vater. Die elektrische Mühle wurde nach dem Krieg modernisiert, während die Bockwindmühle 1954 abgerissen werden musste. Sie rentierte sich nicht mehr.
Die ehemalige Mühle ist heute Museum
Ich möchte das Museum vorstellen. Falsch, denn es sind zwei Museen. Neben der Mühle mit ihrer Ausstellung ist im Stall eine (ja, wie soll ich diese Ausstellung beschreiben?) Heimatstube, ein DDR-Museum, ein Technikmuseum seit 2002 entstanden. Exponate aus dem Alltag der Familie, auch der Vorfahren, Alltagsgegenstände von den Dorfbewohnern zusammengetragen, Geschenke und Leihgaben, haben hier ihren Platz gefunden: alte Ackergeräte, DDR-Kassettenrecorder, Schulbänke aus der Alt Käbelicher Wladimir-Michailowitsch-Komarow-Schule, Kühlschränke aus den 1950ern, DDR-Auszeichnungen – die Aufzählung würde Seiten füllen – bis zu einer Schulbank aus Schweden, einst Geschenk an die Patenschule in Holzendorf. Besucher aus mehr als 20 Ländern besichtigten die Ausstellungsräume. Auf 500 Quadratmetern ist ein Panorama des Alltags der letzten 100 Jahre entstanden. Die strenge Systematik eines „kommerziellen“ Museums findet man hier nicht. Dafür hat man den Reiz, kleine Dinge des Alltags zu entdecken, die man sonst in kaum einer Ausstellung finden kann. Wann haben Sie zuletzt (ich frage jetzt die älteren Leser meiner Generation) eine der früher weit verbreiteten Heizsonnen gesehen? Heute unvorstellbar, damals normal bei dem Kilowattstundenpreis von acht Pfennigen. Oder einen Converter, natürlich selbst gebaut, mit dem man in den 1960ern Westfernsehempfang hatte? Damals stand er auf oder hinter dem „Dürer“- oder „Rembrandt“-Fernsehgerät, je nach persönlichem Mut oder politischer Einstellung des Nachbarn. Vater und älterer Sohn führen meine Frau und mich mit Begeisterung durch die Ausstellung. Doch die Zeit wird knapp, denn um 16 Uhr beginnt Andrès Führung durch den Ort.
Wieder ein Zeitsprung: Andrès Gang durch das Dorf mit etwa 30 Teilnehmern war auch für uns Mecklenburg-Schweriner sehr interessant, erlebten wir doch noch im Anschluss die Nähe der Einwohner in der Turnhalle des Ortes. Funktionierendes Dorfleben – fast schon selten in der heutigen Zeit.
Die Wohnküche der Sumps: Ort unserer Auswertung des Tages mit estnischem Paprikawodka und Killu, beides von unserem letzten Besuch aus Estland mitgebracht, plus gute Gespräche. Dann die Feststellung, dass wir noch gar nicht in der Mühle waren, obwohl wir nach dem Frühstück in Richtung Heimat aufbrechen wollen.
Sonntagmorgen mit warmen Brötchen vom dörflichen Bäcker, gut, von gestern, aber richtige Bäckerbrötchen. Sonnenschein. Nach dem Frühstück geht’s ins Mühlenmuseum. Das große Gebäude am Straßenrand ist nicht nur wegen der Inschrift nicht zu übersehen. Paul Sump hat den Nachfahren ein solides Gebäude hinterlassen. In den 1960er Jahren war der Mühlenbetrieb durch die Zentralisierung der Landwirtschaft – große produktivere staatliche Mühlen entstanden – nicht mehr lukrativ. Die Mühle wurde geschlossen, bis zur Wende als Lager für pharmazeutische Produkte genutzt.
Herbert Helmut Paul Sump, ebenfalls Müllermeister, der das Anwesen von seinem Vater 1988 übernahm, vermietete die Mühle für zwei Jahre an ein Kaminstudio. 1998, das Studio existierte nicht mehr, eröffneten die Sumps den ersten Teil ihrer Ausstellung, hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Gebrauchsgegenständen bestehend, die über Generationen auf dem eigenen Hof genutzt worden waren. 2002 wurden diese Exponate in den Stall eingelagert, um in der Mühle neben den Exponaten zum Müllerhandwerk auch Gegenstände aus der Arbeit des Imkers vorzustellen.
Herbert Sump führt uns durch die drei Etagen der Mühle. Der besondere Reiz dieses Museums ist, dass die Exponate und das Gebäude eins sind. Da ist nicht ein Museumsbau auf der grünen Wiese entstanden, sondern eine Mühle, die über Generationen betrieben wurde, jetzt ein Haus für Arbeitsgeräte und Utensilien des Mühlenhandwerks ist. Eine Mühle, die eine vergangene Arbeitswelt zeigt, vom schnöden Getreidesack bis zum noch heute funktionierenden Becherwerk. Man spürt den Geruch des Getreides, welches hier gemahlen worden ist. Und wenn man sich von den Schilderungen Herbert Sumps mitnehmen lässt, sieht man den Müller bei seiner Arbeit. Ob die Mühle oder seine Bienen wichtiger für ihn sind, habe ich nicht gefragt. Ich denke, seine Bienen sind Herbert Sumps größere Leidenschaft. Seit mehr als 60 Jahren pflegt er dieses Hobby, welches schon lange kein Hobby mehr ist. Das Museum ist Zeugnis davon: Auf zwei Etagen ist diese Leidenschaft dokumentiert – und nicht nur dort. Imker aus dem In- und Ausland haben ihm Exponate geschenkt oder als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Beuten, teilweise über 150 Jahre alt, eine Bienenröhre aus Palästina, geflochtene Körbe, wie wir sie aus den alten sowjetischen Märchenfilmen kennen. Genug der Euphorie. Der Besucher soll sich selber ein Bild machen.
Seit Juli 1998 findet jedes Jahr am ersten Sonnabend ein Tag der offenen Tür der Imkerei statt. Regelmäßig kommen Schulklassen und Reisegruppen vorbei. Gerne hätte uns Herbert Sump noch seine Bienen im großen Garten neben der Scheune gezeigt. 22 Völker hat er in diesem Sommer, im letzten Jahr waren es elf. Wo nimmt dieser Mann nur die Kraft her? Aus dem Honig, der täglich auf dem Frühstückstisch steht? Die Zeit drängt. Noch ein Einkauf im Imkerladen, den er mit seiner Frau Eva betreibt, eine herzliche Umarmung als Dank für die Gastfreundschaft. Herzlichen Dank für die Einladung! Gerne kommen wir wieder. Und die Sonne lacht – Blende acht.
Herbert Sump bei der Führung durch die Mühle
Teil der Ausstellung
Grenzkontrollen, Doberaner Sommerfrische, Scharlatane
1832, das Cholerajahr in Mecklenburg
Das Neujahr 1832 verläuft ruhig in der Hauptstadt des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, obwohl Grund zum Jubeln wäre, denn die Schelfstadt, bisher ein eigenständiges Gemeinwesen, wird am 1. Januar per Dekret mit der Altstadt Schwerins vereint.
Noch immer herrscht die Cholera in Norddeutschland, die Zahl der Erkrankungen geht zwar zurück, aber Vorsicht ist noch geboten. So gelten in Mecklenburg die meisten Schutzverordnungen des Vorjahres, obwohl Preußen, Hannover und Dänemark ihre Handelssperren aufgehoben haben. Selbst der namhafte Arzt Hufeland hatte sich für eine Lockerung der Verbote ausgesprochen. Nicht in beiden Mecklenburg, hier will man Vorsicht walten lassen, obwohl von einer epidemischen Erkrankung nicht zu reden ist. Das Land hat durch seine Maßnahmen die Epidemie ferngehalten. Die Grenzen zu Preußen und den Nachbarstaaten sind noch immer geschlossen, Reisepässe werden nicht ausgestellt, Brief- und Paketsendungen desinfiziert. Viele Städte, so auch Schwerin, führen Passkontrollen durch. Die Posten stehen am „Püsserkrug“, an der Bischofsmühle, in Lankow, Neumühle und den Torhäusern.
Cholerawache am Püsserkrug 1831, Lithographie von August Achilles
Doch Mitte Januar beginnt sich das Leben zu normalisieren. In Neubrandenburg wird nach über einem Jahr ein öffentliches Konzert aufgeführt, und auch das Hoftheater in Schwerin spielt wieder. Der im November 1831 abgesagte Landtag wird für den 28. Februar in Sternberg einberufen. Ab dem 19. Januar werden Sendungen, die aus cholerafreien Orten stammen, nicht mehr desinfiziert. Man beginnt mit der Schadensregulierung. Im „Freimüthigen Abendblatt“ wird über eine Reform des Gesundheitswesens diskutiert, scheinen die Ursachen der Cholera doch inzwischen bekannt: Mangelernährung, Schmutz und übermäßiger Branntweingenuss. Am 21. März lässt Großherzog Friedrich Franz nahezu alle Reisebeschränkungen für Wandergesellen aufheben, neun Tage später wird die „Immediat-Commission“, die gesundheitspolitische Einrichtung zur Bekämpfung der Cholera, aufgelöst, die Kontrolle direkt von der Landesregierung organisiert.
Doch trotz des Rückgangs der Cholera ist man vorsichtig. Alle einlaufenden Schiffe werden weiterhin von den „Quarantaine-Directionen“ der Hafenstädte kontrolliert. Schiffe, die aus „verdächtigen“ Städten kommen, müssen drei bis fünf Tage auf Reede liegen und dürfen erst nach ärztlicher Kontrolle ihre Ladung löschen. Am 24. März werden die seit dem 10. August 1831 geschlossenen Grenzen wieder geöffnet. Der Alltag in Mecklenburg organisiert sich wieder. Am 26. März findet in Wismar ein Benefizkonzert zu Gunsten der Armen statt, während sich die Stände in Sternberg über die Deckung der Kosten der Regelung der Cholera-Schutzmaßnahmen streiten. Schließlich einigt man sich auf eine Summe von 220.000 Talern, die in den nächsten Jahren durch eine zusätzliche Steuer aufgebracht werden sollen. Im Juni wird Doberan wieder zum Anlaufpunkt von hohen und höchsten Herrschaften. So trifft die Königin von Bayern mit Prinz Otto am 21. Mai ein, eine Woche später der preußische Kronprinz. Am 27. Mai findet wie gewohnt der Wollmarkt in Güstrow statt.
Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Einzelne Cholerafälle werden gemeldet – so bricht die Cholera am 10. Juli in Hagenow aus. Am 14. Juli entschließt sich die Landesregierung die Schutzmaßnahmen zu verstärken, denn in den Nachbarländern, so um Lübeck, steigt die Zahl der Erkrankten rasant. Alle Nebenstraßen nach Westen werden geschlossen, an den Chausseen Wachen aufgestellt. Trotzdem bereitet sich die Epidemie auch in Mecklenburg aus. Die Mitteilungen im Wochenblatt der Regierung ähneln denen der heutigen Corona-Statistiken: Für Rostock: „Bis zum 26sten sind erkrankt 20 Personen, genesen 3, gestorben 10, in Behandlung 7.“ Am 4. August bricht die Cholera in Sülze, kurz danach in Ribnitz und in Doberan aus – und die hohen und höchsten Herrschaften verlassen den Ort. Danach in Schwaan. Die Ärzte sind in der Regel machtlos. Dubiose Heiler treten auf, so ein Doktor Krüger-Hansen aus Güstrow, der in Rostock mit Opium heilen will und seine Patienten um ihr Geld und meist auch um ihr Leben bringt. Mitte August sind bereits 140 Choleraopfer in Rostock zu beklagen.
Doch es gibt auch gute Nachrichten: So kann Sülze melden, dass die Stadt nach zehn Tagen strenger Maßnahmen wieder cholerafrei ist. Und im „Freimüthigen Abendblatt“ wird gereimt: „Laß darum ruhig Pest und Seuchen toben, Sie fordern die bestimmten Opfer nur. – Es stirbt nur, der gerufen von dort oben. Das Wann? Verräth oft nicht die kleinste Spur.“ Die Cholera zieht ihre Spur durch das Land: Am 25.8. in Bützow, einen Tag später in Warin, am 3.9. Güstrow und Boizenburg … Ende August erreicht die Epidemie ihren Höhepunkt. In Rostock sind seit Ausbruch der Cholera 485 Einwohner erkrankt, von denen 266 starben. 25 Orte stehen in Mecklenburg-Schwerin unter Quarantäne. Die Herbstmärkte werden abgesagt. Bis Ende September befällt die Cholera in Rostock 663 Einwohner, von denen 390 sterben, in Bützow 184, mit 66 Todesopfern.
Dann, Ende September, entschärft sich die Lage. Rostock meldet ab dem 3. Oktober keine neuen Erkrankungen, ebenso Bützow und viele Ämter. In Güstrow wird die Genehmigung zum Viehmarkt erteilt. Anfang November flammt die Krankheit noch einmal in Kröpelin auf, doch dann werden keine neuen Fälle gemeldet.