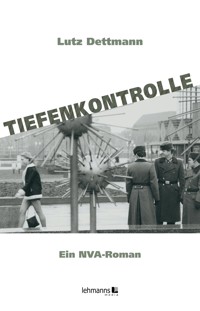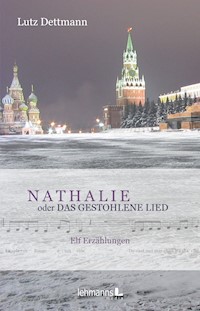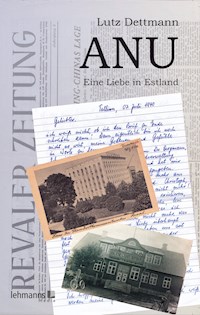8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Können Sie sich vorstellen, dass ein Erbherzog an ein Tischbein gefesselt seine Suppe auslöffeln musste? Oder wissen Sie, warum die Aussprache des Wortes Mecklenburg den Fremden oder den Mecklenburger verrät? Wenn nicht, der Autor wird Ihnen diese Frage beantworten. Und nicht nur das. Er nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Geschichte Mecklenburgs in Geschichten, stellt Ihnen mehr oder weniger bekannte Ereignisse und Persönlichkeiten aus Mecklenburg vor. Wir erfahren, dass man mit Käfern Klassenkampf machen kann, dass Mecklenburg einmal fast preußisch geworden wäre. Und das alles erfahren wir auf eine leicht zugängliche, unterhaltsame Weise. Die 21 Texte, über Jahre in der Schweriner Volkszeitung, den Norddeutschen Neuesten Nachrichten und anderen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, sind in diesem Buch erstmals vereinigt und zum Teil auch erweitert worden. Geschichten für „Zwischendurch“, Geschichte, einmal anders erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Lutz Dettmann
Wie aus Meklenburg Mecklenburg wurde – Geschichten und Personen
ISBN 978-3-96521-517-7 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-519-1 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Fotos und Dokumente: Lutz Dettmann
© 2021 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: rial",sans-serif'>[email protected] Internet: rial",sans-serif'>http://www.edition-digital.de
„Kurz oder lang – das ist die Frage“
Wie Archivrat Lisch für die Tilgung des „c“ kämpfte und warum die Aussprache den Fremden verrät
„Mäcklenburg …“ Oh, da war wieder dieses böse Wort in den Mund genommen worden. Eine Journalistin hatte sich gerade bei einer Schauspielerin erkundigt, ob sie wieder in Mäcklenburg Urlaub machen würde. Und diese hatte ihre Frage mit einem klaren „Ja, weil ich Mäcklenburg so liebe“, beantwortet. Ich weiß nicht, auf welchem Sender dieses Interview lief. Nur, dass sich „Mäcklenburg“ einmal wieder in mein Hirn gebohrt hatte. Fakt ist, Fragerin und Befragte stammen nicht aus Mecklenburg. Sonst hätte die eine mit einem deutlich langen „Meklenburg“ gefragt und die andere ebenso geantwortet. Seit Generationen erkennt der gebürtige Mecklenburger (oder wissende „Ausländer“), an diesem einen Wort, ob der Sprechende ein Eingeborener oder Nichtmecklenburger ist. Den Zugezogenen, die diesen Eigennamen richtig aussprechen, gilt meine Hochachtung. Sie haben unsere meklenburgische Sprachkultur erkannt. Und nicht ohne Grund schreibe ich mein „Meklenburg“ an dieser Stelle ohne das böse „c“, hat es doch in diesem Wort nichts zu suchen.
Und nun wird wieder ein Kampf um das Für und Wider dieses Mitlauts oder Konsonanten eröffnet. Nein, nichts da. Ich will nicht streiten. Der Kampf ist seit vielen Jahrzehnten für das „c“ entschieden. Ich möchte nur aus der Geschichte dieses Eigennamens berichten.
Geheimer Archivrat Dr. Friedrich Lisch
Also … begeben wir uns in eine Sprachzeitmaschine, die in grauer Vorzeit, weit vor Konrad Duden, Friedrich Lisch und den Gebrüdern Grimm landen wird. Sagen wir, wir landen im Jahr 995. Und da finden wir eine Urkunde, ausgestellt auf der Burg Michelenburg (Großburg) von Kaiser Otto III. Die Ersterwähnung dieses Namens – hier – nur der einer Burg, wird einige Jahrhunderte später, der Name eines Landes sein. Groß ist die Burg allerdings, die Größe des Walls wird nur von dem der Burg Werle im Land übertroffen. Warum später der Name der Burg für das entstehende Land Meklenburg herhalten wird, dieses Wissen entzieht sich den Historikern.
Steigen wir wieder in unsere Sprachzeitmaschine und durcheilen die nächsten Jahrhunderte auf der Suche nach dem „c“ in Meklenburg. Wir entziffern alle Möglichkeiten der Schreibweise unseres damals noch jungen Landes. Neben dem lateinischen Namen gibt es um 1300 „Michelenburc“, „Mechlenburg“ oder „Mechilburg“, alles im Stil der hochdeutschen Chronisten und Schreiber verfasst. Seit 1242 tauchen dann immer mehr niederdeutsche Varianten, der Sprache der Bewohner geschuldet, in den Urkunden auf. „Mechilburch“, „Mikilinburg“, „Mikelenburch“. Ab dem 14. Jahrhundert gewinnt dann die Schreibweise „Mekelenborch“ die Oberhand. Selbst in der von dem thüringischen Chronisten Ernst von Kirchberg geschriebenen Abhandlung der Geschichte Meklenburgs wird das niederdeutsche „Mekilnborg“ verwendet. Und was fällt dem geneigten Leser auf? Nix da mit „c“ vor dem „k“. In der Kürze liegt die Würze. Noch … denn ab 1450 entdecken die Schriftkundigen das Laster des „Wortindielängeziehens“. Immer häufiger tauchen doppelte Konsonanten in den Wörtern auf. Erst verhalten, ab dem 16.Jahhundert ist dann kein Halten mehr. Sinnlos häufen sie Buchstaben, um zu zeigen, wie schriftgewaltig die Schriftgelehrten sind. Die Zeilen der Urkunden werden sinnlos mit Buchstaben gefüllt. „Ck“, „gk“,“kk“ – man klemmt davor und findet es schön, wenn lange Buchstabenreihen die Seiten füllen. Wortenden werden mit Konsonantendoppelungen „verziert“. „Ck“ oder „gk“ in Meklenburg wirken schick. Nur einige der Schreibweisen als Beispiele: „Megkelburgk“, Meckelleburgk“, Meckelnnborch“. Da schmerzen die Augen. Da sträubt sich die Hand des heutigen Schreibers.
Schnell hinein in unsere Zeitmaschine. Hier wollen wir nicht bleiben, nicht nur der Schreibweise wegen, auch sind uns diese Jahrhunderte zu kriegerisch. Wir landen Ende des 18. Jahrhunderts. Inzwischen sind die Schreiberlinge zur Besinnung gekommen. Man liebt weiterhin fremde Sprachen, jetzt besonders das Französische. Aber man hat die deutsche Rechtschreibung entschlackt, die Wortungetüme getötet. Fast … nur in vielen Ortsnamen haben sie sich versteckt, die unnötigen Konsonanten. Nicht nur in Mecklenburg. Und das lassen sich alle gefallen?
Rein in die Maschine und ab ins 19. Jahrhundert. Wir haben die Industrialisierung und den wissenschaftlichen Fortschritt – auch in Mecklenburg/Meklenburg. Man schaut nach vorne, forscht für die Zukunft, wendet sich aber auch zur Vergangenheit. So gründet sich 1835 der Verein für meklenburgische (richtig geschrieben!) Geschichte und Altertumskunde, dessen Gründer und wissenschaftlicher Kopf Friedrich Lisch ist. Lisch, der Humboldt Mecklenburgs, wie er von FF II. einmal genannt wurde, betätigt sich neben vielen anderen Wissensgebieten auch mit der deutschen Sprache. Ihm ist das „c“ ein Dorn im Auge – verständlich, spricht doch jeder Meklenburger das „Meklenburg“ lang und nicht kurz. So ist es richtig. Was soll da denn das „c“? Ein schwieriges Unterfangen, das „c“ zu töten, denn der Name des Landes wird seit Jahrhunderten meist mit dem bösen „c“ geschrieben. Lisch forscht in den alten Urkunden und Chroniken, begründet, erklärt, beschwört, dass mit dauerhaft falscher Schreibweise auch die Aussprache des Namens falsch werden wird. (Heute wissen wir, dass er damit recht hatte.) Er erringt Erfolge: Die Publikationen des Vereins erscheinen mit der verkürzten, richtigen Schreibweise des Landesnamens, sogar der Staatskalender. Andere Größen setzen sich für Lisch ein, so die Gebrüder Boll aus Neubrandenburg. Auch Ernst Bolls „Geschichte Meklenburgs“ erscheint ohne „c“ auf dem Titel. Lisch wendet sich sogar an die Gebrüder Grimm, die am Deutschen Wörterbuch arbeiten. Er schreibt darüber im ersten Jahrbuch des Vereins: „Um eine sichere, unzweifelhafte Gewähr zu haben, legte ich den beiden Brüdern Grimm in Göttingen, als vorurtheilsfreie Sprachrichter jedermann bekannt, meine oben erwähnte Abhandlung zum entscheidenden Ausspruch vor, mit einer Anfrage, ob man meklenburgsch oder meklenburgisch schreiben sollte, worauf dieselben an mich antworteten:
"Ich kann zu Ihrer Abhandlung über die Orthographie von Meklenburg nichts sagen, als daß ich glaube, Sie haben völlig recht; dieser Meinung ist auch Jacob. Uebrigens würde ich "meklenburgisch" der harten Kürzung "meklenburgsch" vorziehen, die mir außerdem gemein lautet."
Wilh. Grimm.
Na bitte, alles scheint klar zu sein. Doch da tritt ein Vereinskollege auf den Plan: Friedrich Carl Wex, der Altphilologe und Direktor des altehrwürdigen Fridericianums in Schwerin. Er will Lisch beweisen, dass das „c“ doch nur ein altes Dehnungszeichen sei. 1856 erscheint seine Abhandlung „Wie ist Mecklenburg deutsch zu schreiben und wie lateinisch zu benennen?“. Und alle knicken ein. „Mecklenburg“ wird nun auch v.G.G. sanktioniert. Der Staatskalender nimmt das „c“ in den Titel, alle offiziellen Dokumente folgen. Fazit: Ein Fehler ist kein Fehler mehr, wenn ihn die Obrigkeit sanktioniert. Und so steht unser Meklenburg dann als Mecklenburg auch in der deutschen Sprachbibel, dem „DUDEN“. Und dies seit 1880.
Dass das Problem mit dem „c“ länderübergreifend ist, zeigen Landkarten aus der Mitte des IXX. Jahrhunderts. Auf des Verfassers Mecklenburg-Karte um 1860 nach Raabes Vaterlandskunde liest man neben „Meklenburg“ auch „Lübek“, auf einer späteren Ausgabe von 1880 „Lübeck“. Gab es in der alten ehrwürdigen Hansestadt eine ähnliche Diskussion? Heute hört man die lang ausgesprochene Form nur noch von wirklich alteingesessenen Lübecker Familien. Und was ist mit „Reinbek“, welches noch heute ohne „Dehnungszeichen“ geschrieben wird? Jeder (nicht nur) Reinbeker zieht den zweiten Teil des Ortes in die Länge. Hoffen wir, dass das lange „Meklenburg“, trotz der heutigen Schreibweise noch lange lang ausgesprochen wird. Sie können dabei helfen. Man ist eben „Meklenburger“, oder wissender Zugezogener oder „Ausländer“.
Nicht mehr als das nackte Leben
1725 verlieren beim großen Brand von Grabow fast alle Einwohner ihr Hab und Gut
Altstadtwinkel in Grabow: Am Wandrahm um 1910
Anfang des 18.Jahrhunderts war Grabow eine typische mecklenburgische Landstadt. Verwinkelte Gassen, mittelalterliche Bürgerhäuser, meist nur aus Lehm im Fachwerkstil errichtet, die Dächer mit Holzschindeln oder Stroh gedeckt, dicht aneinander gedrängt, mit Anbauten verunziert. Wohnhäuser und Scheunen oft nebeneinander, Schornsteine waren eine Seltenheit. Aber trotz des äußeren Bildes war Grabow eine fürstliche Residenz, denn das herzogliche Schloss auf einer Insel gelegen, die durch einen Elde-Nebenarm umflossen wurde, diente als Witwensitz. 1725 wohnte Christian Ludwig, der spätere Herzog, hier mit seiner Familie. Seine Schwester Sophie Charlotte, die Witwe des Preußenkönigs Friedrich I., bewohnte seit 1713 einen Flügel des Schlosses.
Zeitgenössische Darstellung des Brandes
Der 3. Juni 1725 ist ein Sonntag. Gerade hat der Frühgottesdienst begonnen, das Eingangslied ist von der Gemeinde gesungen worden, als von draußen Rufe zu hören sind. Ein Feuer ist ausgebrochen. Sofort wird der Gottesdienst abgebrochen. Die Männer laufen zum Rathaus, um Haken, Löscheimer und Leitern zu holen. Währenddessen steigen Rauchwolken über dem Runden Viertel (heute das Gebiet zwischen Große Straße, Kirchen- und Marktstraße) auf. Dieses Viertel ist besonders dicht bebaut. Die gefüllten Scheunen, die Strohdächer und hölzernen Giebel bieten dem Feuer genügend Nahrung. Die Zahl der Helfer wächst von Minute zu Minute, das Feuer ebenso, denn es herrscht ein starker Wind. Pumpen versagen, Löschgerät muss zurückgelassen werden, denn der Wind dreht immer wieder, treibt das Feuer plötzlich in eine andere Richtung. Bald herrscht Wassermangel. Herzog Christian Ludwig organisiert die Löscharbeiten, die gesamte männliche Dienerschaft hilft. Bereits eine halbe Stunde später gerät auch das Schloss in Brand. Die Herzogin, die Schwester des Herzogs und ihre Dienerschaft können nur noch ihr Leben retten. Das Inventar wird ein Opfer der Flammen. Die Grabower versuchen wenigstens ihre Kirche und das Rathaus zu retten – doch vergeblich. „Nichts mehr als die bloßen Mauern blieben stehen“, berichtet ein Zeitzeuge. Verzweifelt werden die Löscharbeiten eingestellt, gilt es doch jetzt sein eigenes Leben zu retten. Die Menschen versuchen wenigstens ihr lebendiges Inventar zu sichern. Doch die Stadt hat lediglich zwei Tore und Brücken. Menschen und Vieh drängen sich in den engen Gassen. Viele können nur noch das nackte Leben vor dem Feuer retten. Die Grabower sehen von den Eldewiesen aus, wie ihre Stadt untergeht. Nach drei Stunden ebbt das Feuer ab. Es gibt in der Innenstadt nichts mehr, was brennen kann. 300 Häuser, die Kirche, das Rathaus und das Schloss sind abgebrannt. Lediglich „ein Haus am Wasser“ und 20 Häuser zwischen Erbmühle und Mühlentor und in der Vorstadt sind erhalten geblieben. Doch es ist nicht ein Menschenleben zu beklagen. Die Hilfe ist schon in den ersten Stunden groß. Viele Obdachlose finden zunächst in den umliegenden Dörfern Aufnahme. Die keinen Platz finden, müssen auf den Wiesen bleiben, werden mit Bekleidung von den Bauern der Nachbardörfer versorgt. Die herzogliche Familie, nun obdachlos, findet für die nächsten Tage eine Unterkunft im Hause der Küchenmeisterin Meyer, siedelt dann mit der Dienerschaft in das halbfertige Schloss nach Neustadt um. Acht Tage später findet in der ausgebrannten Ruine der Stadtkirche der erste Gottesdienst nach der Katastrophe statt. Der Hof- und Stadtprediger Hinck stellt den Brand als Zeichen und Strafe Gottes dar. Schmuggel, Wucher, Schwelgerei sind nur einige der Sünden der Grabower, das Feuer auch eine Strafe für das Schlafen während der Gottesdienste.
Karl Leopold, 1725 in Dömitz und Danzig ansässig, im Streit mit dem Kaiser und seinem Bruder Christian Ludwig, setzte bereits am 25. Juni eine Kommission ein, die den Wiederaufbau der Stadt organisieren soll. Die technische Leitung hatte der Ingenieur Behring, der eine Vermessung des alten Quartiers durchführte, um dann einen Plan der Neuregulierung der Straßen und Gassen anzulegen. Schon beim Festlegen der neuen Grundstücke kam es zu Streitigkeiten, denn etliche der Bauherren wollten ihre Häuser auf den alten Grundstücken wiedererrichten. Behring, der eine neue, den Brandschutz entsprechende, Regulierung durchführen wollte, entwarf schließlich seinen Plan, ohne auf die Befindlichkeiten der Grabower einzugehen. Die Wochen vergingen, der Herzog ließ sich bei der Begutachtung der Pläne Zeit, der Sommer war kalt und nass, und die Obdachlosen hausten noch immer in den Gärten und auf ihren alten Grundstücken in notdürftig zurechtgezimmerten Hütten. Am 14. September kam endlich die herzogliche Verfügung zur Regulierung des Wiederaufbaues. Inzwischen waren etliche Grabower verzogen. Auch Behring, der vom Magistrat kein Wartegeld erhalten hatte, arbeitete inzwischen im Brandenburgischen und konnte erst Ende Oktober zurückkehren. Zwischenzeitlich versorgten sich die Grabower mit Bauholz, welches die Stadt zur Verfügung stellte, und auch dabei gab es wieder Zank und Streit. „Wir sind von Männern und Weibern nicht allein von frühmorgens bis fast an die Nacht entsetzlich geplaget“, klagte ein Mitglied der Kommission. Behring wurde sogar tätlich angegriffen. Doch langsam beruhigten sich die streitbaren Geister. Ende März, Behring hatte inzwischen seine Absteckungen beendet, begannen die Bauarbeiten. Das Rathaus war eines der ersten Gebäude, die gerichtet wurden. Doch nun gab es herzoglichen Ärger: Um ein gleichmäßiges Stadtbild zu erreichen, hatte Behring vorgeschlagen, dass die Bürgerhäuser in den Hauptstraßen dreigeschossig errichtet werden sollten. Finanziell nicht starke Bauherrn sollten in den Nebenstraßen zwei-, Tagelöhner eingeschossige Häuser bauen. Nach Intervention einzelner Bauherren entschied Karl Leopold, dass jeder so bauen könne, wie er wolle. Die Arbeit der Kommission war quasi sinnlos geworden. Klagen beim Herzog halfen nicht. Von nun an baute jeder, wie er wollte. Behring hatte sich schon zurückgezogen, Grantz, der Grabower Amtmann, bat um Entlassung, die ihm nicht gewährt wurde. Und weiter ging der Streit zwischen Herzog, Kommission, Bauherren, Magistrat. Noch immer waren etliche Bauplätze lediglich Lagerplätze für das Material. Es wurde gestohlen, verkam. Einheimische und fremde Handwerker stritten sich. 1726 kam es fast zu einem Blutbad zwischen fremden und Grabower Zimmerleuten. Reichsexekutionstruppen, die im Schloss lagen, sorgten für Unruhe. Doch trotz der Querelen war im Dezember 1726 bereits die Hälfte der Stellen wieder bebaut. Solange die innere Stadt nicht geschlossen war, durften keine Häuser in der Vorstadt gebaut werden. Der Wiederaufbau der Stadt zog sich bis 1740 hin. Die neuerrichteten Häuser trugen keine Strohdächer, aber Scheunen wurden im Stadtgebiet errichtet. Erst nach massiven Maßnahmen verschwanden diese bis 1768. 1770 gab es keine schornsteinlosen Gebäude mehr. Damit die alten Strohdächer von den nichtabgebrannten billigen Häusern der Stadtarmen verschwanden, zahlte die Regierung Bauhilfen und stellte Ziegel zur Verfügung. Als das bei einigen nicht half, wurden die Dächer einfach heruntergerissen, den Eigentümern mit Zwangsverkauf ihrer Häuser gedroht. 1772 konnte der Magistrat nach Schwerin melden, dass alle Strohdächer in Grabow verschwunden seien. Eine moderne Landstadt war entstanden. Die Nutzung als Residenz hatte die Stadt allerdings verloren. Noch heute zählt Grabow zu den reizvollsten Landstädten mit einer im Inneren fast geschlossen Fachwerkarchitektur.
Der „Amikäfer“ – ein Käfer im Klassenkampf
Berufsverbot durch ein Insekt
Kennen Sie den Coloradokäfer? Nein? Aber Sie kennen den kleinen, schwarzbeige gestreiften Kartoffelkäfer, den früheren Schrecken der Kleingärtner und Bauern? Dieser kleine gefräßige Käfer spielte vor 70 Jahren eine große Rolle im Klassenkampf. Damals hieß er in Propagandasprache der jungen DDR der „Amikäfer“ und konnte sogar Biografien zerstören.
Wo stammt er her, der Käfer? Nun, sein Name verrät ihn: aus Nordamerika. Leptinotarsa decemlineata, so sein wissenschaftlicher Name, ist ein sehr umtriebiges Insekt. Bereits im 19. Jahrhundert versuchte er den großen Sprung nach Europa. Doch so richtig gelang ihm dieser erst in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Um 1920 kam es zu einem ersten Massenauftreten des Käfers auf Kartoffelfeldern um Bordeaux. Mit seiner sprichwörtlichen Gefräßigkeit arbeitete er sich in wenigen Jahren in Richtung Mitteleuropa vor und kannte keine Grenzen.
Die Kartoffelkäferfibel aus den 1930er Jahren
Mitte der Dreißigerjahre sind die Schäden durch den Käfer auch in Deutschland so groß, dass die Reichsregierung 1935 einen Kartoffelkäfer-Abwehrdienst (KAD) gründet. Man setzt zunächst auf Volksaufklärung, bringt eine „Kartoffelkäferfibel“ und Bilderbücher, die über den Käfer aufklären sollen, unters Volk. Mit der Parole „Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer, acht’ auf den Kartoffelkäfer!“ strömt in den nächsten Jahren die Volksgemeinschaft über die Felder und sammelt die kleinen Käfer, ohne sie ausrotten zu können. Und sind sich Deutsche und Franzosen sonst auch nicht grün, hier sind sie sich einig und forschen länderübergreifend. 1940 wird in Kruft (Eifel) eine Forschungsanstalt gegründet. Die deutsche Wehrmacht erwägt sogar, die kleinen Fresskäfer als biologische Waffe einzusetzen. 1943 werden gezüchtete Käfer in der Pfalz abgeworfen, die Tests aber gestoppt, denn Käfer kennen keine Grenzen oder Frontlinien, fressen bei Feind und Freund. Nach dem Weltkrieg spielt Leptinotarsa decemlineata zunächst keine Rolle mehr. Die Probleme sind zu groß und vielfältig, dass man sich mit ihm beschäftigt. Der Käfer nutzt das aus und vermehrt sich rasant. Fünf Jahre nach Kriegsende ist fast die Hälfte der Kartoffelanbaufläche Ostdeutschlands von ihm befallen. Im Mai 1950 hat er seinen großen Medienauftritt, allerdings nur in der jungen DDR. Der Kalte Krieg tobt. Die Verantwortlichen für die Versorgungsnotlage in der DDR benötigen einen Schuldigen: die USA und ihre „Bonner Handlanger“. Am 7. Juni berichtet die „Landeszeitung“: „Helle Empörung im ganzen Land – Die Antwort unserer Bevölkerung zum Abwurf der Kartoffelkäfer: Verstärkter Kampf in der Nationalen Front gegen die anglo-amerikanischen Imperialisten