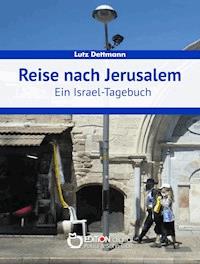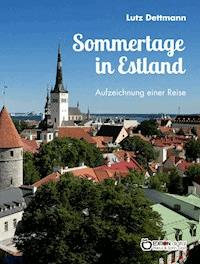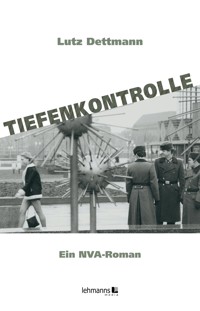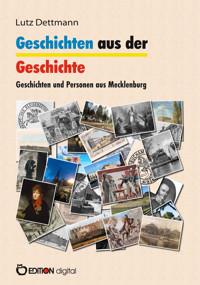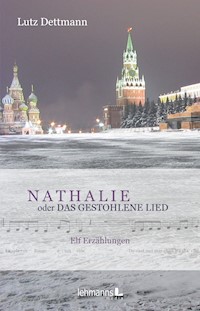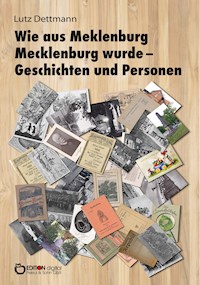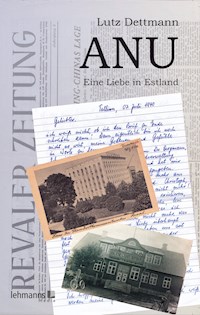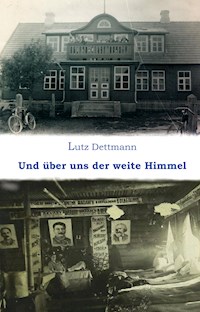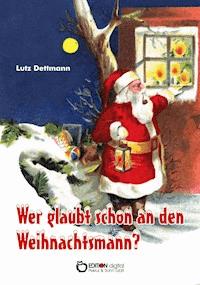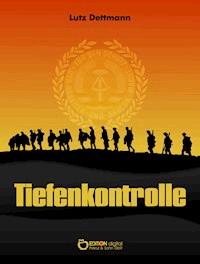7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Alte Friedhof Schwerin zählt zu den ältesten Landschaftsfriedhöfen Deutschlands und ist das kulturelle Gedächtnis der ehemaligen Residenz- und heutigen Landeshauptstadt Schwerin. Auf einer Fläche von etwa 24 Hektar befinden sich zahlreiche Grabanlagen von Personen, die die Geschichte des Landes und der Stadt Schwerin mitgestaltet haben, aber auch Grabanlagen von architektonischer Bedeutung. Die Autoren des zweiten Bandes „Orte der Erinnerung“ präsentieren die Architektenfamilien Clewe und Hamann, den Architekten Ehmig, den Schöpfer des bekannten „Weihnachtsfensters“ im Schweriner Dom, Ernst Gillmeister. Aber auch heute vergessene Persönlichkeiten wie zum Beispiel der Soldat, Hofbeamte und Gegner des Gauleiters Hildebrandt Bernhard von Hirschfeld werden vorgestellt. Die Autoren nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise in die Geschichte Schwerins und Mecklenburgs und laden zu einem Spaziergang auf dem Alten Friedhof Schwerin ein. Mit dem beigefügten Friedhofsplan können Sie die Grabmale selbst entdecken. http://alterfriedhofschwerin.de/
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Orte der Erinnerung
Heft 2
SCHRIFTENREIHE VOM FÖRDERVEREIN ALTER FRIEDHOF e. V.
Herausgeber: Förderverein Alter Friedhof Schwerin e.V.
Redaktion: Lutz Dettmann
2. überarbeitete Auflage
Mai 2020
ISBN (Buch) 978-3-92655-124-6
ISBN (E-Book) 978-3-92655-125-3
2020 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Der Förderverein ALTER FRIEDHOF Schwerin e.V.
Der Verein setzt sich für die Bewahrung des ältesten noch genutzten Friedhofes in Schwerin ein. Dabei arbeitet er eng mit der Landeshauptstadt zusammen.
Ziele:
- Erweiterung der Liste der erhaltenswerten Grabanlagen
- Bestandsaufnahme der gefährdeten Grabanlagen und deren Sicherung
- Wiederherstellung und Pflege von Grabanlagen
- Gewinnung von „Grabpaten“, Fördermitgliedern und von Unternehmen und Institutionen
- langfristig die Wiederherstellung der alten parkartigen Struktur des Alten Friedhofes
Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir auch Ihre Hilfe.
Möchten Sie helfen, ein Stück altes Schwerin zu bewahren?
Werden Sie Mitglied des Fördervereins! Selbstverständlich können Sie auch als Förderer aktiv werden.
Förderverein Alter Friedhof Schwerin e.V. Obotritenring 245, 19053 Schwerin
Tel.:03 85 / 7 60 79 35
Fax: 03 85 / 7 60 79 36
E-Mail: [email protected]
Web: www.alterfriedhofschwerin.de
Spendenkonto:
Sparkasse Schwerin
IBAN: DE83 1405 2000 1710 0136 10
BIC: N0LADE21LWL
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
in Ihren Händen halten Sie das zweite Heft unserer Schriftenreihe „Orte der Erinnerung“, in dem wir Ihnen bekannte und vergessene Persönlichkeiten vorstellen möchten, die ihre letzte Ruhestätte auf dem Alten Friedhof der Landeshauptstadt Schwerin gefunden haben. Mit diesem Heft wollen wir an das erste Heft, welches 2012 erschien, anknüpfen. In unregelmäßiger Folge werden weitere Hefte erscheinen, die von Mitgliedern des Fördervereins Alter Friedhof Schwerin e.V. gestaltet werden. Der Verkaufserlös der Hefte geht zu hundert Prozent in die Arbeit des Fördervereins.
Der zweite Teil der „Orte der Erinnerung“ erscheint im zehnten Jahr des Bestehens des Fördervereins. Darum stellen wir Ihnen, neben den Persönlichkeiten, die die Geschichte und das Gesicht der Landeshauptstadt oder Mecklenburgs geprägt haben, auch Projekte vor, die in den zehn Jahren durch die Arbeit des Fördervereins auf dem Weg gebracht wurden.
Wir laden Sie ein zu einem Gang über den Alten Friedhof der Stadt Schwerin. Er ist nicht nur das Gedächtnis der Stadt Schwerin, sondern auch ein Ort der Ruhe und ein Naturparadies inmitten der Stadt.
Diese Broschüre soll Ihnen Anregung geben, diese Kulturlandschaft näherkennenzulernen.
Schwerin im April 2020
Uwe Lange
Vereinsvorsitzender im Namen des Fördervereins Alter Friedhof e. V.
An der Backsteinkapelle. Foto: Uwe Poblenz
Ernst Gillmeister – ein Glasmaler von Rang
Dem Hofglaser Johann David Gillmeister zu Ludwigslust wird am 26. April 1817 ein Sohn geboren. Der wird auf den Namen Johann David Ernst getauft.
1836 wendet sich der Vater an den künftigen Großherzog Paul Friedrich erfolgreich mit der Bitte, seinem von ihm selbst ausgebildeten Sohn ein Stipendium für die Ausbildung in der Glas- und Porzellanmalerei zu gewähren. Proben der Fertigkeiten des Sohnes überzeugen Paul Friedrich.
Ernst Gillmeister begibt sich im Alter von 19 Jahren nach Göttingen, um bei Heinrich Friedrich Wedemeyer seine Ausbildung fortzusetzen. Wedemeyer ist Porzellanmaler, der sich auch mit Glasmalerei auskennt. Es wird vermutet, dass Gillmeister in Göttingen auch Vorlesungen im Fach Chemie besucht hat.
Ein Jahr später geht der junge Gillmeister nach München, um sich an der Königlichen Glasmalereianstalt, deren künstlerische Leitung in den Händen des Historienmalers Heinrich Maria von Hess liegt, zu vervollkommnen. Hess muss seine Begabung erkannt haben, denn sonst hätte er ihn wohl nicht dem Direktor der Porzellanmanufaktur in Sévers empfohlen.
Die Porzellanmanufaktur besaß eine Abteilung für Glasmalerei, die alle Möglichkeiten, die die Glasfarben boten, nutzten, um die Glasfenster von den Zwängen der Bleifugen zwischen unterschiedlich eingefärbten Gläsern zu befreien. So konnten Vorlagen bekannter Maler auf Glastafeln übertragen und eingeschmolzen werden.
Mit dem erforderlichen technischen und künstlerischen Rüstzeug versehen, verlässt Ernst Gillmeister 1842 Frankreich, kehrt nach Mecklenburg zurück und lässt sich in Schwerin nieder. Im selben Jahr stirbt Großherzog Paul Friedrich, der die Residenz von Ludwigslust wieder nach Schwerin verlegte. Sein Sohn folgt ihm als Großherzog Friedrich Franz II. und ist zugleich auch das Oberhaupt der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Als solcher fördert er in seiner lange währenden Amtszeit den Kirchenbau und veranlasst den Umbau des Schlosses. Das verspricht eine günstige Auftragslage für einen Glasmaler. An Selbstbewusstsein fehlt es Gillmeister offensichtlich nicht, wenn er schreibt: „Den größten Theil aber habe ich – wenn ich so sagen darf – selbst wieder erfinden und entdecken müssen. Was mich in meinen Experimenten nun auf geebnete Bahnen leitete, war daß ich im Malen und in der Chemie immer ziemlich gleichen Schritt hielt: was in dem einen mißlang, war nun für das andere nicht zu Schade; wie es mir in dem einen mehr glückte, wurde ich in den anderen um so sicherer. (…) Die neuen und alten Glasmalereien waren auf meinen Reisen meine Lehrmeister, wie ich es machen oder nicht machen sollte.“
Schon 1839 hat Paul Friedrich mit der Restaurierung der Heiligblutkapelle im Schweriner Dom begonnen. Sein Wunsch ist es, nach seinem Tod dort bestattet zu werden. Den erfüllt der Thronfolger Friedrich Franz II. durch den Befehl, die Heiligblutskapelle als Bestandteil des Chorumgangs zur Begräbnisstätte seines Vaters und darüber hinaus des großherzoglichen Hauses umzugestalten. Er wendet sich in dieser Angelegenheit an seinen Onkel, König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der ihm für die Gestaltung der Fenster seinen Hofmaler Peter von Cornelius empfiehlt. Dieser fertigt Kartons in Ölfarben im Maßstab 1:1 an, die dann von Gillmeister auf Glas übertragen werden. Den ornamentalen Teil der drei Fenster entwirft Gillmeister selbst.
Teil des Weihnachtsfensters im Schweriner Dom_Foto_Domgemeinde Schwerin.jpg
Die so genannten Cornelius-Fenster sind ein Ergebnis handwerklicher Disziplin, gepaart mit einer hohen Meisterschaft im Umgang mit Schmelzfarben, die nicht nach dem Auftragen, sondern erst nach dem Brand ihre erwünschten Farbwerte und die vorgesehene Transparenz erlangen. Nicht zu Unrecht preist das in Schwerin erscheinende Freimüthige Abendblatt am 30.Januar 1846 das Werk als „das vorzüglichste seiner Art im Norden“, dass Gillmeister mit einem Schlag berühmt macht. Fortan werden ihm die bedeutendsten Aufgaben in der Glasmalerei Mecklenburgs übertragen, die er hinsichtlich Qualität und Quantität vorzüglich löst.
Beispielhaft zu nennen sind:
- Weihnachtsfenster im Schweriner Dom
- Fenster in der Kirche und Hofdornitz des Schweriner Schlosses
- Fenster oder deren Restaurierungen in Bad Doberan, Dobbertin, Kirch Stück, Neukloster,
Röbel und Waren
Als letzte große Arbeit entstehen in Gillmeisters Werkstatt zwischen 1866 und1868 die fünf großen Chorfenster im Zuge der Errichtung der Paulskirche in Schwerin. Als Vorlage dienen Kartons des Düsseldorfer Historienmalers Gustav Stever und Hintergrund- und Randmuster des ausführenden Architekten Theodor Krüger. Mit Ausnahme des Mittelfensters sind es keine großflächigen Glasmalereien, sondern kleinteilige Szenen aus der Heilsgeschichte in vertikaler Anordnung, die sich am vorgegebenen Bildprogramm des Schweriner Oberkirchenrats Theodor Kliefoth orientieren.
Im Jahr 1873 versieht dann Gillmeister wegen Überstrahlung durch natürlichen Lichteinfall des Chorraums das südliche Querhausfenster der Paulskirche mit farbigem Glas, das so genannte Passionsfenster nach einem Entwurf von Stever. Danach wird es ruhig um ihn. Auf Mutmaßungen darüber, warum er die Glasmalerei nicht fortsetzt, soll hier nicht weiter eingegangen werden.
Ernst Gillmeister findet in der Großherzoglichen Gemäldegalerie ein neues Betätigungsfeld als Kustos. Darunter ist ein sachkundiger wissenschaftlicher Mitarbeiter zu verstehen. Welche Arbeiten unmittelbar damit verbunden sind, ist bislang nicht bekannt.
Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass die von Gillmeister so meisterhaft ausgeführte Schmelzfarbenmalerei sich als korrosionsanfällig erweist. So müssen die Fenster der Schlosskirche bereits 1907 vollständig ersetzt werden.
Dem Mangel an restauratorischen Erfahrungen im Umgang mit Schmelzfarbenmalerei auf Glas begegnet man in den Jahren 1994 bis 1998 mit dem Projekt „Modellhafte Beseitigung von Umweltschäden“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. In Anerkennung der unbestrittenen Leistungen Ernst Gillmeisters werden im Rahmen dieses Projekts modellhaft die von ihm für den Schweriner Dom und die Paulskirche gefertigten Scheiben erfolgreich restauriert. Auch die schadhaften Fenster in der Dobbertiner Klosterkirche und in der Hofdornitz des Schweriner Schlosses können mit den Erfahrungen aus diesem Projekt überarbeitet werden.
Am 25.März 1887 stirbt Ernst Gillmeister in Schwerin und wird auf dem Alten Friedhof im Grabfeld IVa beigesetzt. Die Grabstelle 1487 ist nicht mehr vorhanden. Ein Teil wurde 1949 abgetrennt und unter der Grabnummer 1487a neu belegt. Es wird seitens des Fördervereins Alter Friedhof in Betracht gezogen, auf dem nicht neu belegten Teil der ursprünglichen Grabstelle eine Gedenktafel anzubringen, um Ernst Gillmeister als herausragende Persönlichkeit der Glasmalerei des 19. Jahrhunderts in Norddeutschland angemessen zu würdigen.
Burkhart Stender
Quellen:
Voss, Johannes: „ … damit er als tüchtiger Glas- und Porzellanmaler seinem Vaterlande …dereinst Ehre mache.“, in Schriftenreihe „Denkmalschutz und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern“, Heft 7,Schwerin 2000, S. 56-67.
Kuhl, Reinhard: Glasmalerei des 19. Jahrhunderts-Mecklenburg-Vorpommern, Die Kirchen, Leipzig, 2001.
Vaassen, Elgin: Bilder auf Glas, München Berlin, 1997
Der Mecklenburg-Schweriner General der Infanterie Alwin Albert August Carl von Bilguer
Der Mecklenburg-Schweriner General der Infanterie Alwin Albert August Carl von Bilguer als Chef des Militär-Departements im Paradewaffenrock nach 1881. Foto: Staatliches Museum Schwerin
Als Alwin Albert August Carl von Bilguer am 22. Mai 1812 in Rostock geboren wurde, nahm sein Vater, August Ludwig (Louis) von Bilguer (1777-1858), gerade als Titular-Stabskapitain und Kompanieführer im Mecklenburg-Schweriner Kontingent-Regiment, am Feldzug des Kaisers Napoleon I. gegen Russland teil. Die Mutter war Louise geb. von Hahn aus dem Haus Charlottenthal bei Güstrow (Geburtsjahr unbekannt, 1838 gest.). Der Vater überlebte als einer von wenigen Angehörigen des Regiments die Katastrophe und setzte seinen militärischen Dienst ungebrochen fort, der am 5. April 1840 mit der Verleihung des Charakters als Oberst und dem Erhalt der Stelle als Kommandant von Güstrow endete.
Alwin Albert August Carl von Bilguer besuchte das Rostocker Gymnasium. Im Jahre 1826 verließ er es, um Page am Mecklenburg-Schweriner Hof zu werden. Etwa vier Jahre später trat er – wie damals oft üblich – jung in die Fußstapfen seines Vaters und am 1. April 1830 als Unteroffizier in dessen Bataillon ein. Dort erhielt er am 10. Dezember des Jahres das Offizierspatent als Sekondeleutnant. Mit Blick auf seine Familie sind eine ältere und zwei jüngere Schwestern sowie unbedingt sein jüngerer Bruder zu erwähnen. Paul Rudolf von Bilguer (1815-1840; kurze Zeit preußischer Offizier) war aufgrund seiner außergewöhnlichen mathematischen Begabung als Schachspieler und Autor eines führenden Schachhandbuches, das nach seinem frühen Tode erschien, sehr bekannt geworden.
Die militärische Laufbahn des August von Bilguer wies im Vergleich zum überschaubaren Weg seiner meisten Offizierskameraden durchaus deutliche Abweichungen auf, die schon früh auf die herausragende Karriere des Offiziers hindeuteten. Eine lange Zeit – oft unterbrochen von Kommandierungen – gehörte August von Bilguer dem Leichten Infanterie-Bataillon an, nämlich vom 1. April 1830 bis zum 12. November 1842 und noch einmal, dann als Kommandeur, vom 3. April 1856 bis 23. Februar 1859. Das erste Mal war er von März 1835 bis Dezember 1836 in die preußische Armee zum damaligen Kaiser Franz Grenadier-Regiment und zur Kriegsschule kommandiert. Im Hinblick auf die fortschreitende Annäherung Mecklenburg-Schwerins an Preußen war diese Kommandierung sehr karrierefördernd. In der Zeit vom 20. April 1838 bis 12. November 1842 wirkte August von Bilguer als Adjutant seines Leichten Infanterie-Bataillons. Zu dieser Dienststellung wurden besonders befähigte junge Offiziere erwählt. Hier erfolgte am 7. April 1840 seine Beförderung zum Premierleutnant.
Ein weiterer Schritt in seiner Karriere begann am 12. November 1842, als er in der Verwendung Generalstabsoffizier zur Brigade kommandiert wurde. Im Mecklenburg-Schweriner Militär hatte es unter der Herrschaft Großherzogs Paul Friedrich (1800-1842; Großherzog ab 1. Februar 1837) einige Veränderungen gegeben. Am 5. Dezember 1839 war der bisherige Kommandeur der Brigade, Generalleutnant Carl von Both, in den Ruhestand getreten. Für ihn übernahm wenige Tage später, am 11. Dezember, der bisherige Kommandeur des Grenadier-Garde-Bataillons, Oberst Hartwig von Elderhorst (seit 5. April 1840 Generalmajor), die Brigade. Ihm war also Premierleutnant August von Bilguer unterstellt.
Bereits kurz vor seiner Verwendung als Generalstabsoffizier war August von Bilguer am 1. Juli 1842 mit Eröffnung der Militär-Bildungsanstalt in Schwerin als Lehrer für die Kadetten in deren dreijähriger Ausbildung zum Offizier eingesetzt worden. Er blieb es bis September 1848.