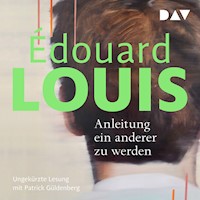14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Regisseur von »Ich, Daniel Blake« und der Autor von »Das Ende von Eddy« gemeinsam im Gespräch Édouard Louis und Ken Loach - zwei Künstler aus unterschiedlichen Ländern und Generationen blicken in ihren Werken immer wieder in die dunklen Ecken unserer Gesellschaft. Sie erzählen die Geschichten, die gerne verschwiegen werden: von Armut, sozialem Abstellgleis und politischer Gewalt. Hier treffen sich der Kultautor und der renommierte Filmemacher zum Gespräch über Kunst, Kino, Literatur und deren Bedeutung für die heutige Gesellschaft. Wie kann immer wieder neu über Klasse, soziale Gewalt und Gerechtigkeit nachgedacht werden? Wie sieht eine Kunst aus, die die Machtverhältnisse nicht nur beschreibt, sondern erschüttert? Wie kann sie intervenieren und mobilisieren? In ihrem Dialog entwerfen Ken Loach und Édouard Louis ein Manifest für eine radikale Veränderung der Kunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Édouard Louis | Ken Loach
Gespräch über Kunst und Politik
Über dieses Buch
Édouard Louis und Ken Loach – zwei Künstler aus unterschiedlichen Ländern und Generationen blicken in ihren Werken immer wieder in die dunklen Ecken unserer Gesellschaft. Sie erzählen die Geschichten, die gerne verschwiegen werden: von Armut, sozialem Abstellgleis und politischer Gewalt.
Hier treffen sich der Kultautor und der renommierte Filmemacher zum Gespräch über Kunst, Kino, Literatur und deren Bedeutung für die heutige Gesellschaft. Wie kann immer wieder neu über Klasse, soziale Gewalt und Gerechtigkeit nachgedacht werden? Wie sieht eine Kunst aus, die die Machtverhältnisse nicht nur beschreibt, sondern erschüttert? Wie kann sie intervenieren und mobilisieren?
In ihrem Dialog entwerfen Ken Loach und Édouard Louis ein Manifest für eine radikale Veränderung der Kunst.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Édouard Louis wurde 1991 geboren. Sein autobiographischer Debütroman »Das Ende von Eddy«, in dem er von seiner Kindheit und Flucht aus prekärsten Verhältnissen in einem nordfranzösischen Dorf erzählt, sorgte 2015 für großes Aufsehen. Das Buch wurde zu einem internationalen Bestseller und machte Louis zum literarischen Shootingstar. Seine Bücher erscheinen in 30 Ländern und werden vielfach fürs Theater adaptiert und verfilmt. Im Sommer 2018 war Édouard Louis Samuel-Fischer-Gastprofessor an der Freien Universität Berlin, wo er den Begriff der »konfrontativen Literatur« prägte. Zuletzt erschienen »Wer hat meinen Vater umgebracht«, »Die Freiheit einer Frau« sowie »Anleitung ein anderer zu werden«. Édouard Louis lebt in Paris.
Ken Loach, geboren 1936 in Nuneaton, ist einer der weltweit bekanntesten Filmregisseure und Drehbuchautoren. In seinen Filmen setzt er sich mit sozialkritischen Themen auseinander. »Ich, Daniel Blake« wurde 2016 mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet.
Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt seit 1987 Belletristik und Theaterstücke aus dem Französischen, Italienischen und Norwegischen, darunter Werke von Jon Fosse, Henrik Ibsen, Jean Echenoz, Louis-Ferdinand Céline, Stefano Benni und Massimo Carlotto. Er ist u.a. Träger des Jane-Scatcherd-Preises der Ledig-Rowohlt-Stiftung, des Paul-Celan-Preises und des Deutschen Jugendliteraturpreises.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
DIALOG I
FRAGEN AN KEN LOACH UND ÉDOUARD LOUIS
DIALOG II
FRAGEN AN KEN LOACH UND ÉDOUARD LOUIS
Dank
DIALOG I
Arbeit und Gewalt
ÉDOUARD LOUIS: Ich möchte gern mit einer Annäherung und einer Frage beginnen. In meinem Buch Wer hat meinen Vater umgebracht habe ich versucht, das Leben meines Vaters zu rekonstruieren, mein Vater hat nämlich mit ungefähr 35 Jahren in der Fabrik, wo er angestellt war, einen Arbeitsunfall erlitten. Ein schwerer, an Kabeln aufgehängter Gegenstand stürzte auf ihn herab und zerschlug ihm den Rücken. Nach diesem Unfall musste er mehrere Jahre lang immobilisiert werden, er bezog eine Invalidenrente, bis zu dem Tag, da der französische Staat beschloss, er könne jetzt wieder arbeiten, sei dazu wieder imstande – dabei sah ich, wie er sich wegen der Unfallfolgen nachts immer noch vor Schmerzen wand. Nur waren in Frankreich ganz einfach die Voraussetzungen für eine Invalidenrente oder Sozialhilfe härter geworden, die Regierung hatte beschlossen zu »sparen« … Ab dem Moment, wo mein Vater wieder als arbeitsfähig angesehen wurde (nach welchen Kriterien eigentlich?), saßen ihm also die Behörden im Nacken und drängten ihn, Arbeit zu suchen; es hieß, »entweder finden Sie eine Anstellung, oder Ihnen wird ihre jämmerliche Rente gestrichen«, mit anderen Worten, entweder Sie sterben hungers, oder Sie sterben an der Arbeit, als gäbe es nur diese Alternative für die Beherrschten: sterben oder sterben. In der Tat habe ich das Buch teilweise unter dem Einfluss deines großartigen Films Ich, Daniel Blake geschrieben, in dem ein Mann von der englischen Verwaltung dazu getrieben wird, Arbeit zu suchen, um jeden Preis, trotz seiner zerrütteten Gesundheit, da der Staat sich umfänglich aus der Verantwortung ziehen und einem arbeitsunfähigen Mann wie ihm kein Geld mehr zahlen will. Man ruft ihn an, man verlangt Nachweise über seine Bemühungen bei der Arbeitssuche, man bestellt ihn ein …
Alles bringt mich auf den Gedanken, dass dein Film von gesellschaftlicher und politischer Verfolgung handelt. Ich stelle fest, dass die Beherrschten häufig die Sprache der sozialen Exklusion übernehmen; man redet von den »Ausgeschlossenen«, von der »Gewalt der Exklusion«, aber wenn man das Leben meines Vaters oder das von Daniel Blake betrachtet, ist doch frappierend, in welchem Ausmaß diese Leben von Verfolgung geprägt werden, nicht nur von gesellschaftlicher Ausgrenzung, auch wenn beide Mechanismen Hand in Hand gehen können. Ist vielleicht am Ende der Zweck der Herrschaft die Verfolgung, noch sehr viel mehr als der Ausschluss? Wenn man Ausschluss in dem Sinn versteht, dass man sich selber absondern kann, ein Land verlassen, sich zurückziehen, ein politisches Regime verlassen kann, dann ist das häufig ein Privileg, so geringfügig es auch sein mag. So weiß man ja, dass die Migranten, die aus Kriegsgebieten fliehen, häufig zur Mittelklasse gehören oder selbständig arbeiten, also zu denjenigen gehören, die es sich leisten können, den Schleusern mehrere tausend Euro zu zahlen, das sind also nicht unbedingt die Ärmsten. Betrachtet man das Leben Schwarzer Personen in Frankreich oder Amerika und das Ausmaß der Polizeigewalt und Justizgewalt, die sie erleiden, so wird klar, dass sie noch viel mehr unter Verfolgung als unter Exklusion zu leiden haben. Glaubst du nicht, dass man die traditionelle politische Sprache umformen müsste, um vielleicht die Vorstellung der Verfolgung in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man die Mechanismen der gegenwärtigen Politik analysieren möchte?
KEN LOACH: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde es sehr gut beobachtet, und ich glaube, die Antwort muss zunächst eine ökonomische sein. Die Art der Arbeit hat sich gewandelt. Es gibt immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die meisten davon wirklich extrem schlecht bezahlt, die Unternehmen verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, den Mindestlohn zu unterlaufen. Die Leute sind gezwungen, sehr harte Arbeit für einen sehr schlechten Lohn anzunehmen. Und dazu bringt man sie unter anderem, indem denen, die keine Arbeit haben, klargemacht wird, dass es ihnen richtig schlecht ergehen wird. Auch wenn sie aus Krankheitsgründen oder wegen einer Behinderung nicht arbeiten können, wird eine Situation geschaffen, in der eine erniedrigende und jämmerlich bezahlte Arbeit noch erträglicher ist, als unterhalten zu werden, unterhalten und unterstützt von … von uns allen. Denn es wird ja behauptet, der Staat sei hier im Spiel, aber in Wirklichkeit sind es ja wir alle, es müssten wir alle sein, oder? Wenn wir als Gemeinschaft leben, müssen wir aufeinander achten,