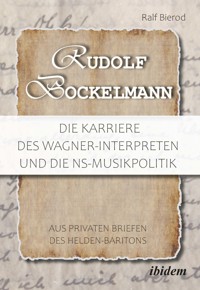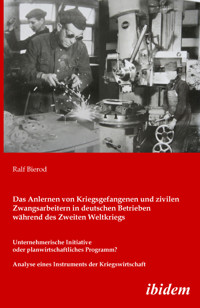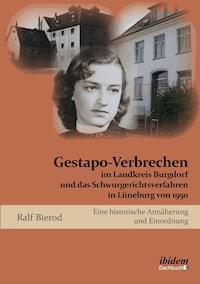
Gestapo-Verbrechen im Landkreis Burgdorf und das Schwurgerichtsverfahren in Lüneburg von 1950 E-Book
Ralf Bierod
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Februar 1950 verurteilte das Schwurgericht Lüneburg zwei Kriminalbeamte des früheren Außenpostens der Geheimen Staatspolizei in Celle zu Freiheitsstrafen. In zwei Dutzend Fällen hatte das Gericht nachgewiesen, dass die Angeklagten während des letzten Kriegsjahres Menschen bei Verhören geschlagen und misshandelt hatten. Die Staatsanwaltschaft bewerte die verhandelten Vorfälle als "Spitze eines Eisberges". Zum Bezirk des Celler Gestapo-Büros zählte auch der Landkreis Burgdorf. Die hier im Sommer 1944 durchgeführte Razzia in mehreren Wohnlagern von Zwangsarbeitern führte zur Verhaftung von 300 Ukrainern und Polen, die in der Turnhalle von Burgdorf über mehrere Wochen hinweg verhört und dabei auch geschlagen worden waren. Den Frauen und Männern war die Gründung einer Widerstandsbewegung unterstellt worden. 40 Personen wurden in das Konzentrationslager Neuengamme überwiesen, 31 von ihnen hingerichtet. Die "Ukrainer-Aktion" war einer der zentralen Fälle, die 1950 im Mittelpunkt der Verhandlung in Lüneburg standen. Seit 1947 hatte das Team der britischen Besatzer zur Ermittlung von Kriegsverbrechen Aussagen von Zeugen aufgenommen. Historiker Ralf Bierod erläutert, weshalb das Gericht 1950 Lynchmorde an polnischen Zwangsarbeitern sowie zahllose Überstellungen von Personen in Konzentrationslager nicht zur Anklage bringen konnte. Mit seiner regionalhistoriographischen Fokussierung auf den Einzelfall legt der Autor anschaulich Zeugnis über die alltäglichen Grausamkeiten im NS-Regime ab und zeigt die Verstrickungen von Justiz und Zivilbevölkerung auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung–Das Schwurgerichtsverfahren in Lüneburg1950gegen Hermann K.und Herbert B.
Die Hamburger Morgenpost sprach im Februar 1950 von einem"skandalösen Urteil zum Schutze von Verbrechern”. Auch andere Zeitungen hatten sich ein höheres Strafmaß gegen die"Gestapo-Sadisten” erhofft.Mehrere Blätter berichteten von Unruhe und weitreichender Empörung in der Bevölkerung.Polnische Arbeiter waren exekutiertworden, Menschen geschlagen, bis Blut spritzte, Zeugen unter Wasser getaucht, Bürger ins KZ überstellt.Diezwei BeamtendesCellerBüros derGestapoLüneburg hatten1944 Angst und Schrecken indenLandkreisenBurgdorfund Celleverbreitetund bei unzähligen Verhören die Verhafteten brutal geschlagen undmisshandelt.Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeitwurden sie im Februar 1950 vom Lüneburger Schwurgerichtzu Freiheitsstrafenverurteilt.[1]Zuden Vorfällen hatte auch der sogenannte"Ukrainer-Aufstand"gezählt,dieRazzia gegen 300 ausländische Arbeitskräfte, aus denen in der Burgdorfer Turnhalle bei wochenlangen Verhören Geständnisse erpresst werden sollten. 40 Personenwarenin das Konzentrationslager Neuengamme überführt, 31 von ihnendorthingerichtetworden.
1950 kamen in Lüneburgallein körperliche Tätlichkeiten zur Anklage,wie das Schlagen mit Gummiknüppel und Peitsche. Das Schicksal vieler Menschen, derenWegüberden SchreibtischdesCeller Gestapo-Büros[2]direktinsKonzentrationslager geführt hatte, war auch von der Staatsanwaltschaft unberücksichtigt geblieben.Oberstaatsanwalt K., der 1948 die Anklage erhob,hatte bis 1943 am selben Gericht und in selberFunktion Ermittlungen gegen deutsche Frauen geführt, die wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen verurteilt worden waren.Auch der vormalige Landgerichtsdirektor T. war von August 1948 wieder als Richter im selben Hause tätig.[3]Die umfangreichen Vorermittlungen und Aussagen sehr vieler Zeugen tragen dennoch zur Aufklärung oder besser gesagt Annäherung an einige Verbrechen im Landkreis Burgdorf bei, die auch nach 70 Jahren noch als lokale Ereignisse der Schreckensherrschaft an nachwachsende Generationen weitererzählt werden.Die Akten aus Lüneburg sind heute im HauptstaatsarchivHannoverfür jedermann öffentlicheinsehbar. Zu den Vorfällen, die nicht angeklagt wurden,zählen die Exekutionen von insgesamt vier polnischen Männern in Uetze und Röhrse.Wohl aberging das Gericht derVerhaftungdesKaufmannesErnst SchulteinWeferlingsennach, der einemBürger jüdischer Abstammung Unterschlupf gewährt hatte und dessen Spur sich später im Konzentrationslager Sachsenhausen verlor.Deutsche Bürger aus dem Landkreis Burgdorf sagten in Lüneburg als Zeugen aus, die nach Denunziation von Mitbürgern wegen nichtigerAnlässe in die Fänge der zwei angeklagten Beamten geraten waren.
Sie gabenHinweise aufdas zynische Menschenbild der Angeklagten unddie Verstrickung der NSDAP-Kreisleitung im Landkreis Burgdorf in die Untaten der Geheimen StaatspolizeiLüneburg. Im NS-Staat hatte dieGestapoeine rechtsfreie Parallelwelt zur Arbeit der Justizgebildet, ein gefährlicher Umstand, den derGeneralstaatsanwalt in Cellewährend der Jahre des Kriegesmit offener Kritik begleitethatte.
Aber auch über ordentliche Strafverfahren verschwanden unabhängig vom Vorgehen der Gestapo unzählige Personen wegen Bagatellen im Celler Zuchthaus, wo ein großer Teil der Inhaftierten während des letztenKriegsjahres wegen verheerender Zustände verstarben.
Gleichwohl veranschaulicht das Verfahrenvor dem Lüneburger Schwurgericht gegen die zwei früheren Beamten Hermann K. und Herbert B.,wie Gestapo-Terror funktionierte,wie Menschen im Landkreis Burgdorf diesemTeil der nationalsozialistischenWirklichkeitausgeliefert waren, ihn aber auch durch Denunziation willentlich oder ungewollt unterstützt hatten.
Der als"Ukrainer-Aufstand” bekannt gewordene Vorfall, der während des Sommers 1944 in dem brutalen Verhör von 300 Männern und Frauen aus Osteuropa in der Burgdorfer Turnhalle gipfelte,war nur einer von 26 verhandelten Fällen, die von der Staatsanwaltschaft ihrerseits als Spitze des Eisbergs bewertet wurden.ÖffentlicheLynchjustiz der Gestapo, wie dieSchau-Hinrichtung von drei Polen in Uetzeunter Teilnahme der NSDAP-Kreisleitung aus Burgdorfwar gar nicht erst zur Anklage gebracht worden.Dies entsprach der damaligen Auffassung sowohl der Briten als auchspäterder deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichte, wonach fürVerbrechen, die auf Todesurteilen des Reichssicherheitshauptamtes beruht hatten, allein die politische Führung verantwortlich gewesen sei. Hier verwies man auf die Nürnberger Prozesse. Der von der Gestapo abseits der Justiz geschaffene rechtsfreie Raum für Lynchmorde an osteuropäischen Arbeitskräften, Juden und Deutschen blieb in der juristischenAufarbeitung stets unangetastet, wenn es darum hätte gehen können, alle Beteiligten der Handlungskette zur Verantwortung zu ziehen.So konzentrierte man sich in der Hauptverhandlung 1950 darauf, den zwei Angeklagten Misshandlungen nachzuweisen, um sie überhaupt einer Strafe zuführen zu können.Beide gaben sich in ihren Aussagen als ahnungslose Unschuldslämmer, die Anweisungen befolgt hatten, die angeblich nichtgewussthatten, weshalb die Polen damals hingerichtet wurden, dieangeblich geglaubthatten, im Konzentrationslager würdendie von ihnen überstelltenHäftlinge lediglich hart arbeiten.
Das Celler Gerichtsgefängnis – am Schlossplatz gelegen – existiert heute nicht mehr. Hier fanden einige der brutalen Verhöre statt, wegen derer Hermann K. und Herbert B. 1950 verurteilt wurden. Das Gebäude wurde in den 80er Jahren abgerissen. © Stadtarchiv Celle
Hermann K. war Leiter der Gestapo-Außenstelle Cellegewesen. Ihm wurden 14 Fälle, Kriminalassistent Herbert B. sieben Fälle von Misshandlungen nachgewiesen. 50 Zeugen hatten 1950 vor dem Lüneburger Schwurgericht ausgesagt.Während die zwei Angeklagten im Internierungslager Fischbeckbei Hamburginhaftiertgewesenwaren, hatte das britische Ermittlerteam zur Aufklärung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit das Verfahren seit 1947 mit zahlreichen Zeugenaussagen vorbreitet.Insgesamt waren 26 Taten von Misshandlungen mit Gummiknüppel und Faustschlägen gegen zivile Ausländer und deutsche Staatsbürger verhandelt worden, die die Beschuldigtenzwischen dem 1. April 1944 und Kriegsende begangen hatten.Mehrere Zeugen berichteten von Blutspritzern an den Wänden nach einem Verhördurch die beiden Angeklagtenim Celler Gerichtsgefängnis. Der Raum musste hinterher geweißt werden.Darüber hinaus wurde längst nicht jeder Vorfall aus den Vorermittlungen zur Anklage gebracht.Und so blieb auch der Vorgesetzte der beiden Angeklagten, der Leiter der Gestapo Lüneburg, August W., unbehelligt. Man hatte ihm zwei Exekutionen von Polen anlasten wollen, doch fand sich gegen ihn nichts Belastendes. Wohl zu geschickt hatte er sich stets im Hintergrund gehaltenund seine Mitarbeiter vorgeschickt.
Das Schwurgerichtsverfahren von 1950 war das größte und wichtigste Verfahren zu Ereignissen in der NS-Zeit im Landkreis Burgdorf.Es machte letztendlich deutlich, dass am Anfang eines jeden Vorfalles der Verrat, die Denunziation, das unüberlegte Wort aus Neid, Wut oder Rachsucht gestanden hatte, das Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld der Opfer zur Anzeige, zur Beschwerde oder nur zum laut artikulierten Vorwurf hervorgebracht hatten. Aus nichtigen Anlässen ergab sich oft in Windeseile eine Handlungskette, in der mehrere Personen einige Telefonate führten und schon war das Schicksal eines Menschen besiegelt. Jenseits aller Gerichtsbarkeit verschwanden Menschen über das Celler Gerichtsgefängnis in Lagern oder kamen bei Schauhinrichtungen an den Galgen.
In der Rekonstruktion des"Ukrainer-Aufstandes"folgte die Staatsanwaltschaft der Perspektive der Gestapo, wonach Ukrainer, die zum Teilbei der Erdölgesellschaft ElwerathinNienhagen gearbeitet hatten, zum Teil in Immensen, Aligse, Lehrteund Dachtmissen aber auchim DienstderFeuerschutzpolizeiinBurgdorfgestanden hatten, Eisenbahnwaggons aufgebrochen hatten, um Waffen zu stehlen. IhrangeblichesZiel soll die Zerstörung einer deutschen Flakbatterie gewesen sein.Die300 Ukrainer und Polenwurden bei der Gestapo-Razziain den Wohnlagern ihrer Arbeitgeberverhaftet.66 von ihnen arbeiteten bei den Erdölwerken Elwerath in Nienhagen.In Immensenwarin der Wohnbaracke der Ukrainer am Bahnhofangeblicheine Pistole gefunden worden.Eine Russin, die Botendienste für dievermeintlichenVerschwörer ausgeführt hatte, wurde bei dem Verhör unter Wasser getaucht. Andere Häftlinge wurden mit Stock und Peitsche zu Aussagen geprügelt. 250 Personen wurden entlassen, laut Akte40dem KZ Neuengamme überstellt.[4]Ihre Namen blieben in dem Verfahren unbenannt. Das Schicksal der 31 Männer unter ihnen, die in Neuengammeam 9. August 1944[5]durch den Stranghingerichtet worden waren, interessierte das Gericht 1950 nicht. DieExekutionen wurden den Angeklagten auch nicht zur Last gelegt, da die Urteile vom Reichssicherheitshauptamt ergangenwaren.
Der 1899 in Malankowo im Kreis Kulm geboreneHermannK. war seit 1933 im Gestapo-Dienst. Nach eigenen Angaben war er von Hamburg nach Celle strafversetzt worden, weil er mit Juden zu human umgegangen sei. Kriminalassistent HerbertB. war 1911 in Görlitz geboren.HermannK. erhielt vier Jahre Zuchthaus, wobei drei Jahre Internierungshaft angerechnet wurden.HerbertB. wurde zu zwei Jahren verurteilt, wobei die Strafe durch die angerechnete Haft im Gefängnis Fischbeck bei Hamburg als verbüßt galt. Das Gericht räumte selbst ein, dass die Urteile in weiten Kreisen der Bevölkerung Aufsehen und Unwillen erregt hätten.HerbertB. zeigte bei der Urteilsverkündung Reue mit Tränen in den Augen.HermannK. dagegen sah sich als"Opfer der Demokratie". Die Anschuldigungen seien Verleumdungen und üble Nachrede.Nebenher hatte die Verhandlung ergeben, dass sich Hermann K. umfangreichen Hausrat und Besitz einiger der von ihm verhafteten Personen angeeignet hatte. Bei seiner Festnahme nach dem Krieg waren zwei dieser Konvolute nahezu vollständig bei ihm vorgefunden worden.
Der Landkreis Burgdorf lag im Bezirk des Celler Arbeitsamtes sowie im Bezirk der Gestapo Lüneburg und ihresCellerAußenpostens.Die Hauptverhandlung erfolgte am 2., 3.,4.und 8. Februar 1950 vor dem Schwurgericht Lüneburg. Der Antrag für Hermann K. lautete auf fünf JahreZuchthaus und fünf Jahre Ehrentzug, der fürHerbertB. auf drei Jahre und neun Monate Zuchthaus sowie vier Jahre Ehrentzug.Von dem Verfahrenhattensich zahlreiche Menschen Gerechtigkeitversprochen und das Urteil schlug insbesondere in der Hamburger Presse hohe Wellen.Von den britischen Ermittlern war eine akribische Voruntersuchung mit der Befragung sehr vieler Zeugen schon Jahre vorher erfolgt.Sohatte sichdie Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, das Komitee ehemaliger politischer Gefangeneram 29. Juli 1947 gegenüber der Oberstaatsanwaltschaft Hamburgerklärtzur Strafanzeige gegen den früheren Stapo-Beamten Hermann K.Überlebende und Zeugen warfen ihmTötung und Misshandlung an Juden,Zwangsarbeiternund Deutschen sowie Zwangsverschickung von Juden in Vernichtungslagervor.Um den Charakter des BeschuldigtenK.zu verdeutlichen, dienteden Opfer-Vertreterndieses Zitat:"Am 2. November 1942 wurde in Höfer, Kreis Celle, ein junger Pole öffentlich erhängt. An der Exekution nahmen K. und ein Mitarbeiter aktiv teil. K. äußerte sich:‚Von dieser Sorte jeden Tag ein Dutzend, das wird unsgar nicht zu viel‘."[6]
Der politische Ausschuss für Wiedergutmachung und Betreuung ehemaliger politischer Inhaftierter und Verfolgter schrieb an den Hauptausschuss ehemaliger politischer Häftlingein Hamburg am 8. Juli 1947:"In Celle und Umgebung befanden sich viele Ausländer-Lager, insbesondere Polen- und Ukrainer-Lager. Alle paar Tage erschienen K. und B. in diesen Lagern und haben planlos mit Lederpeitschen und Gummiknüppeln die Insassen durchgeprügelt und schwer misshandelt."
Letztendlich kam es zur Anklage von Hermann K. und Herbert B.Gegen den Leiter der Außendienststelle Lüneburg, August W., der auch für alle Aktionen in Burgdorf der Verantwortliche gewesen war, wurde keine Anklage erhoben.
2.Zwangsarbeit im Landkreis Burgdorf
Im1885 gegründetenLandkreis Burgdorf, der heute den wesentlichen Teil der nördlichen und der gesamten östlichen Region Hannover ausmacht,arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs dienstverpflichtete ausländische Arbeitskräfte in erheblicher Zahl. In der Land- und Forstwirtschaft, in Handwerk und Gewerbebetrieben arbeiteten Frauen und Männer aus West- und Osteuropa ebenso wie Kriegsgefangene aus Frankreich, Belgien, Polen und der Sowjetunion.
Das Ausmaß der Zwangsarbeit in den 68 Gemeinden des ehemaligen Landkreises Burgdorf ist auf Grundlage der Quellen gut zu erfassen. Wie keine andere Quelle geben die im Celler Stadtarchiv verwahrten Monatsberichte des Celler Arbeitsamtes[7]einen Überblick über den tatsächlichen Anteil der Ausländer. Im September 1943 waren im Bezirk des Arbeitsamtes Celle 64.547 Menschen beschäftigt, darunter 24.927 deutsche Frauen und 21.580 Ausländer. Es war der Höchststand anBeschäftigung während des Zweiten Weltkrieges. Zum Bezirk des Amtes gehörte seit dem 1. April 1943 auch der Landkreis Burgdorf. Hier gab es20.837 Beschäftigte, wobei 8.238 deutsche Frauen waren. Im Landkreis Burgdorf arbeiteten also etwa ein Drittel aller Beschäftigten des Celler Bezirks, wobei der Anteil der dienstverpflichteten deutschen Frauen überproportional hoch ausfiel.Die genaue Zahl der Ausländer liegt für den Landkreis Burgdorfin der Statistik des Celler Arbeitsamtesallerdings nicht vor. Ihre Quote erreichte im Jahr 1943 jedoch rund 33 Prozent. Jede dritte Arbeitskraft stammte aus einem der von deutschen Truppen besetzten Länder Europas. Die Gesamtzahldürfteim Landkreis Burgdorf mindestensrund 6.500 Personen umfasst haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum Landkreis Burgdorf auchLehrte, Sehnde, Ilten,Burgwedel, Isernhagenund die Wedemark gehörten.
Im September 1943 arbeiteten 46,5 Prozent aller Beschäftigten im hiesigen Raum in Industrie und Handwerk.25,6 Prozent waren in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Kriegsgefangene und so genannte Ostarbeiter machten im Bezirk des Celler Arbeitsamtes im Schnitt jeweils ein Viertel der Ausländer aus. 50 Prozent der Ausländer waren anderer Herkunft. Dazu zählten Zivilarbeiter aus West- und Südeuropa sowie italienische Militärinternierte und freiwillig angeworbene italienische Landarbeiter. Der so genannte Ausländereinsatz wurde allein von den Arbeitsämtern gesteuert. Dies betraf auch die Gruppe der unter Aufsicht der Wehrmacht bleibenden Kriegsgefangenen. Im Landkreis Burgdorf entsprach die Beschäftigung von Ausländern wohl jedoch nicht den Verhältnissen des gesamten Celler Bezirks. Kriegsgefangene machten hier mindestens ein Drittel aller eingesetzten Ausländer aus. Im ersten Quartal 1943 warenüber das Stammlager XIB in Fallingbostel im Landkreis Burgdorf 67 Arbeitskommandos von Kriegsgefangenen gebildet, insgesamt 2.200 Soldaten aller Nationen mit Ausnahme von Briten. Bewacht wurden sie in ihren jeweiligen Lagern von Angehörigen der Landesschützenkompanie Burgdorf, die Vermittlung steuerte das Celler Arbeitsamt.
Im Landkreis Burgdorf lagen verglichen mit dem Gesamtbezirk des Arbeitsamtes deutlich weniger Rüstungsbetriebe. Die Mineralölbetriebe von Dollbergen und Hänigsen waren die kriegswichtigsten. Danach kamen die Heeresmunitionsanstalten in den Bergwerken von Lehrte und Hänigsen. Die Muna im Bergwerk Hohenfels in Wehmingen bei Sehnde zählte damals nicht zumGebiet des Landkreises Burgdorf und somit nicht zum Celler Bezirk des Arbeitsamtes.
Die Beschäftigung von Ausländern wandelte sich mit Fortschreiten des Krieges. Je mehr Gebiete von deutschen Truppen besetzt wurden, umso mehr Nationalitäten kamen hinzu. Doch zu keiner Zeit konnte das Celler Arbeitsamt den Arbeitskräftebedarf decken. Allein die hiesigen Kalibergwerke, die wie Bergmannssegen in Lehrte und Niedersachsen in Wathlingen während des Krieges ununterbrochen förderten, meldeten im April 1943 255 unbesetzte Stellen. Insgesamt fehlten dem Arbeitsamt 6.481Kräfte. Obwohl immer mehr deutsche Männer eingezogen oder längst gefallen waren, nahm die Beschäftigung stetig zu. Nahezu 40 Prozent der Gesamtbevölkerung im Bezirk des Celler Arbeitsamtes von 150.000 Menschen war 1943 unter Arbeit. Verpflichtet waren alle, die sich noch auf zwei Beinen halten konnten.Das betraf auch Menschen im Rentenalter.Rund elf Prozent derarbeitendendeutschen Frauen waren in unserem Gebiet 65 Jahre und älter. 37 Prozent derarbeitendendeutschen Männer waren zwischen 50 und 75 Jahren alt.
Kaum Kenntnisse existieren über das Lehrter Durchgangslager. Esunterstand dem Landesarbeitsamt der Provinz Hannover sowie von Ende 1943 an dem Gauarbeitsamt Ost-Hannover undwarfür ankommende zwangsverpflichtete zivile Arbeitskräfte aus Osteuropader erste Sammelpunkt, dessen Lage sich erklärt durch den Knotenpunkt der Eisenbahn. Von hier wurden die Frauen und Männer über die Arbeitsämter der Provinz Hannover zu lokalen Lagern und Arbeitgebern vermittelt.In Lehrte erfolgte die Erstregistrierung.Wie viele Menschen während der sechs Kriegsjahre insgesamt durch unser Gebiet geschleust wurden, ist nur schwer abzuschätzen. Allein 228 Osteuropäer sind auf den Friedhöfen des Lehrter Stadtgebietes begraben. Pro Monat kamen im Celler Bezirk zwischen 200 und 700 Ausländer neu hinzu, viele über das Lehrter Durchgangslager. Andere wurden abgezogen. Neben dem Durchgangslager, das dem Landesarbeitsamt unterstand und eine Kapazität von 2.000 Personen gehabt haben soll, gab es weitere große"Zivilarbeiterlager"in Lehrte.Die Heeresmunitionsanstalt im Bergwerk Erichssegen, die Zuckerfabrik und die Reichsbahn unterhielten große Lager, sowie auch die fördernden Bergwerksbetriebe von Lehrte und Sehnde. Das Reichsbahnlager soll für 1.000 Personen bestimmt gewesen sein. Das Lager Erichssegen soll 150, das von Bergmannssegen 300 Plätze umfasst haben. Diese Zahlen gibt der"Heimatgeschichtliche Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung"an. Diese 1986 vom Bund der Antifaschisten herausgegebene Dokumentation ist die einzige, die bisher einen regionalenGesamtüberblick zu geben versucht hat. Sie gilt unter Fachleuten inzwischen als fehlerhaft, unterscheidet nicht zwischen zivilen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Wohl bewusst setzte diese Arbeit die maximale Lagerkapazität mit der Zahl der dort arbeitenden Zwangsarbeiter gleich, was zu Verzerrungen führen kann, zumal auch viele deutsche Dienstverpflichtete aus anderen Provinzen in Barackenlagern lebten.In Burgdorf hatte die Konservenfabrik ein Lager für 275"Zivilarbeiter", die Möbelfabrik Tappe für 200 Leute. In Sehnde zählten die Zuckerfabrik, das Bergwerk Friedrichshall der Kali-Chemie AG und die Munitionsanstalt Bergwerk Hohenfels zu den Betrieben, die viele Ausländer beschäftigten. Die im Heimatgeschichtlichen Wegweiser für Friedrichshall genannte Zahl von 300 und für Hohenfels von 500 Zwangsarbeitern darf man jedoch stark anzweifeln.Denn man muss berücksichtigen, dass in Teilen der Lager Kriegsgefangene und auch viele deutsche dienstverpflichtete Frauen aus anderen Reichsgebieten einquartiert waren. Gerade die Arbeit in den Munitionsanstalten vergaben die Arbeitsämter vorrangig an deutsche Frauen - schon der Gefahr der Sabotage wegen.Immer nur dann, wenn keine deutschen Frauen mehr zu vermitteln waren, wies das Arbeitsamt den Munitionsbetrieben ausländische Arbeiter zu. Diese Praxis geht auch aus den Protokollen des Celler Arbeitsamtes hervor. Je nach Dringlichkeit und Kriegswichtigkeit setzte das Arbeitsamt die Ausländer häufig um. Mit Fortschreiten des Kriegs und dem immer größer werden Facharbeitermangel zog das Celler Arbeitsamt auch immer mehr Osteuropäer aus der Landwirtschaft ab, um sie je nach Vorkenntnissen in der Industrie einzusetzen oder sie mit anderen Amtsbezirken auszutauschen. Nur zu wenigen Orten geben die Quellen ein annähernd vollständiges Bild. Allein in Hänigsen haben zwischen 1939 und 1945 523 zivile und kriegsgefangene Ausländer gearbeitet.[8]Dies waren 80 Belgier, 76 Franzosen, 62 Niederländer, 42 Jugoslawen, 82 Polen, 115 Russen, 28 Tschechen, 29 Ukrainer, sechs Ungarn und drei Rumänen. Allein 174 davon waren mit letztem Aufenthaltsort im Lager der kriegswichtigen Deutschen Vacuum AG als Beschäftigte im Erdölfeld registriert. Dazu zählten auch Ingenieure, diedie Tiefbohrungen vorantrieben. 95 Handwerker und Landwirte hatten allein in Hänigsen Ausländer beschäftigt. In der Regel richteten die Ortsbauernführer die Anforderungen für ihre jeweiligen Dörfer an das Arbeitsamt. Viele Betriebe liehen sich"ihre Ausländer"bisweilen gegenseitig aus. Diese Praxis war zwar verboten, wurde aber dennoch in großem Stil betrieben.
Der Begriff Zwangsarbeit wurde von der deutschen Zeitgeschichtsforschung geprägt. Die Arbeitsämter kannten diesen Begriff nicht. Sie sprachen vom Ausländereinsatz und unterschieden lediglich zwischen Kriegsgefangenen, Ostarbeitern und Zivilarbeitern aus anderen Staaten. Die Forschung hatte mit dem Begriff Zwangsarbeit zunächst die Sklavenarbeit in Betrieben der Konzentrationslagerund außerhalb dieserin Industrie- und Rüstungsbetriebenumschrieben. Je mehr Erkenntnisse jedoch über grausame Misshandlungen und Arbeitsbedingungen aus Industriebetrieben, von Massensterben und Totschlagin Lagern der Fabriken bekannt wurden, umso mehr wurde der Begriff Zwangsarbeit auf densogenannten"Ausländereinsatz"allgemeinund insgesamtangewandt, ebenso auf die Arbeit von Kriegsgefangenen. Dabei konzentriert sich der Blick auf die Schicksale derzivilenOsteuropäer, die auf Basis der sogenannten"Ostarbeiter-Erlasse"rechtlos waren.