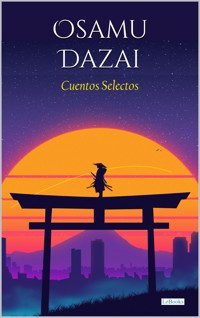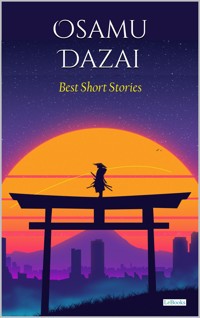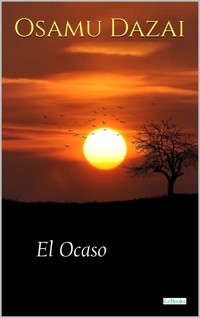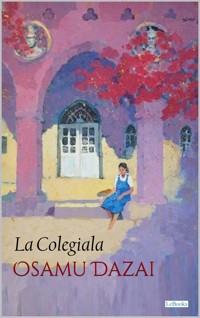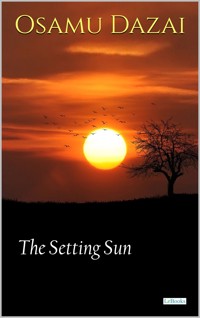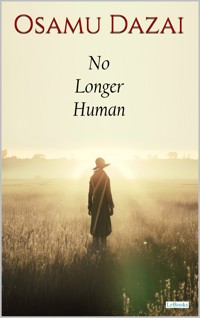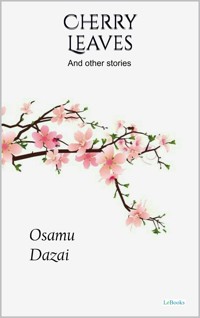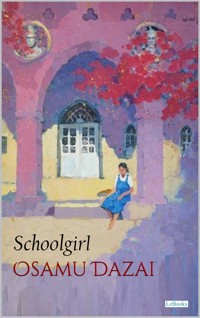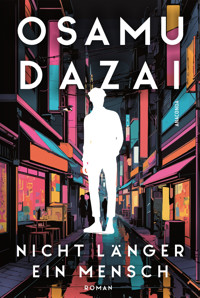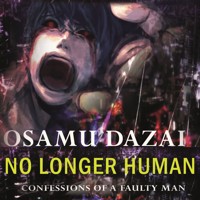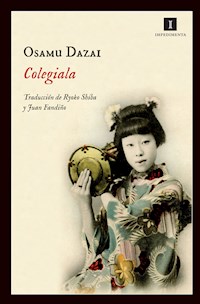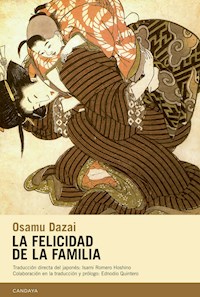4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines der meistgelesenen japanischen Bücher des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Schriftsteller entschließt sich, drei Notizhefte, die ihm zugespielt worden sind, zu veröffentlichen. Es sind die hinterlassenen Aufzeichnungen eines genialen jungen Mannes, eines Comiczeichners, der schonungslos von seinem verpfuschten Leben berichtet: Frauen, Trunksucht, Drogen, Irrsinn – tatsächlich in vielem das Leben des Autors Osamu Dazai. Die packenden Skizzen einer conditio inhumana haben seit Erscheinen des Buches 1948 Generationen japanischer Leser fasziniert. "Gezeichnet" ist ein Kultbuch, Dazai selbst ein Idol.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Originaltitel: Ningen shikkaku (1948)
Printausgabe: © Cass 2015
Der Roman erschien zuerst 1997 im © Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: November 2019
ISBN 978-3-95988-161-6
Über das Buch
Ein Schriftsteller entschließt sich, drei Notizhefte, die ihm zugespielt worden sind, zu veröffentlichen. Es sind die hinterlassenen Aufzeichnungen eines genialen jungen Mannes, eines Comiczeichners, der schonungslos von seinem verpfuschten Leben berichtet: Frauen, Trunksucht, Drogen, Irrsinn – tatsächlich in vielem das Leben des Autors Osamu Dazai.
Die packenden Skizzen einer conditio inhumana haben seit Erscheinen des Buches 1948 Generationen japanischer Leser fasziniert. Dazai selbst ist ein Idol.
Über den Autor
Osamu Dazai (1909-1948) zählt zu den bedeutendsten japanischen Schriftstellern. Gezeichnet (Originaltitel: Ningen shikkaku; wörtlich „Als Mensch disqualifiziert“) ist sein Hauptwerk. Im Juni 1948, noch vor Erscheinen des Buches, setzte Dazai gemeinsam mit einer Geliebten seinem Leben ein Ende.
Osamu Dazai
Gezeichnet
Roman
Prolog
Ich habe drei Photographien von ihm gesehen.
Die erste stammte aus seiner, nun, Kindheit muss man wohl sagen, und zeigte ihn als Neun-, Zehn-, Elfjährigen, in einem Park am Ufer eines Teiches stehend, umringt von Mädchen (seinen, wie anzunehmen, Schwestern und Cousinen); er trug eine breit gestreifte formelle Kimonohose, hatte den Kopf etwa dreißig Grad nach links geneigt und stellte ein hässliches Grinsen zur Schau. Ein hässliches Grinsen? Unsensible Leute freilich (Leute, mit anderen Worten, denen Schön oder Hässlich nichts bedeutet) hätten ein belangloses, ein nichtssagendes Gesicht gemacht und ein Allerweltslob von sich gegeben: »Was für ein niedlicher Bengel!« – ein Lob, das nicht einmal völlig falsch geklungen hätte, weil eben im Lächeln auch dieses Kindes durchaus eine Spur dessen auszumachen war, was gemeinhin als »niedlich« gilt; jeder aber, der nur eine Idee geübt ist in der Unterscheidung von Schön und Hässlich, hätte sofort höchstes Missfallen an dem Jungen gefunden und womöglich die Photographie mit einem »Mein Gott, was für ein grässliches Kind!« und spitzen Fingern, als hätte er eine Raupe angefasst, von sich geworfen.
Und in der Tat: Je länger man den lächelnden Knaben betrachtete, desto unheimlicher wurde er einem. Er lächelte nämlich nicht. Er lächelte nicht im mindesten. Der Beweis dafür waren seine zu Fäusten geballten Hände. Menschen können nicht lachen mit geballten Fäusten. Affen vielleicht. Es war das Lächeln eines Affen. Der Junge grimassierte, legte sein Gesicht in hässliche Falten, das war alles. Man mochte ihn geradezu einen »Runzelbankert« nennen, so befremdlich, so abstoßend war seine Miene, die einen auf sonderbare Weise gegen ihn einnahm. Nie zuvor hatte ich ein Kind mit einem so seltsamen Gesichtsausdruck gesehen.
Die zweite Photographie zeigte ihn mit einem ebenso erstaunlichen, grotesk verwandelten Gesicht. Es war das Bild eines Studenten. Ob zu Gymnasial- oder Universitätszeiten, war nicht klar – jedenfalls zeigte es einen Studenten mit erschreckend schönen Zügen. Doch auch hier hatte man merkwürdigerweise nicht den Eindruck, dass es sich um das Bild eines Menschen aus Fleisch und Blut handeln könnte. Gekleidet in eine Schul- oder Hochschuluniform, aus deren Brusttasche ein weißes Taschentuch hervorlugte, saß er mit übergeschlagenen Beinen in einem Korbsessel, und zwar, wie könnte es anders ein, lachend. Diesmal stellte er kein runzliges Affenlachen zur Schau, sondern ein recht raffiniert ausgeführtes Lächeln, das aber dennoch nicht das eines Menschen war. Nichts war darin, was an, sagen wir: Schwerblütigkeit, nichts, was an Lebensherbe gemahnt hätte, es schwebte, nicht wie ein Vogel, sondern wie Flaum, ein bloßes weißes Blatt Papier – das lacht. Ein, mit anderen Worten, durch und durch erkünsteltes Lachen. Nicht affektiert, das wäre zu wenig. Nicht falsch auch, nicht manieriert. Und natürlich nicht bloß glatt und blasiert, auch das wäre zu wenig. Und, wenn man genau hinschaute, vermittelte auch dieser hübsche Student etwas gespenstisch Unheimliches. Noch nie hatte ich einen schönen jungen Mann von so merkwürdigem Äußeren gesehen.
Die letzte Photographie war die widerwärtigste. In welchem Alter sie ihn zeigte, ließ sich nicht einmal raten. Sein Haar war stellenweise ergraut. Er befand sich in der Ecke eines furchtbar verwahrlosten Zimmers (deutlich waren drei Stellen zu sehen, an denen der Putz bröckelte), hatte beide Hände auf den Rand der Feuerstelle, ein kleines Kohlebecken, gelegt; er lachte nicht. Er machte überhaupt kein Gesicht. Er saß da – mit den Händen auf dem Kohlebecken – wie tot – eine wirklich garstige, unglückverheißende Photographie. Doch das allein war nicht das Widerwärtige. Auf dem Bild war sein Gesicht ziemlich groß abgelichtet, so dass ich es mir gründlich ansehen konnte: Gewöhnlich die Stirn, gewöhnlich die Falten darauf, gewöhnlich die Brauen und die Augen, die Nase, der Mund und das Kinn – ach, dieses Gesicht hatte nicht nur keinen Ausdruck, es hatte nichts. Es vermittelte nicht den geringsten Eindruck, hatte nichts Eigenes. Wenn ich die Photographie betrachtete und dann die Augen schloss, war das Gesicht sofort weg, vergessen. Die Zimmerwände und das kleine Kohlebecken konnte ich mir ins Gedächtnis rufen, doch das Gesicht der Hauptperson in dem Zimmer verschwand sofort hinter Nebel, es ließ, es lässt sich einfach nicht erinnern. Ein Gesicht, das man nicht malen kann, nicht karikieren, nichts. Ich mache die Augen wieder auf. Richtig, so sah es aus, ja, ich erinnere mich – nicht einmal diese Freude stellt sich ein. Überspitzt gesagt: Man öffnet die Augen, schaut sich die Photographie ein zweites Mal an – und erinnert sich nicht. Was bleibt, ist reines Missfallen, ist Ärger, man wendet sich ab.
Selbst »Totenmasken« haben mehr an Ausdruck, an Flair; wenn man einen Pferdekopf auf einen Menschenkörper setzte, entstünde vielleicht ein ähnlich widerwärtiger Eindruck, ich weiß es nicht, jedenfalls schaudert es den Betrachter. Nie, wirklich nie zuvor hatte ich einen Mann mit einem derart merkwürdigen Gesicht gesehen.
Das erste Heft
Ich habe ein schändliches Leben geführt.
Was menschlich leben heißt, weiß ich nicht. Ich bin im Nordosten geboren, auf dem Lande, und eine Eisenbahn habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich schon ziemlich groß war. Ich stieg die Überführung an der Station hinauf und wieder hinunter, ohne dass mir dabei in den Sinn gekommen wäre, dass es sich um eine Konstruktion handelt, die zum Überqueren der Gleise dient, glaubte, dies sei bloß eine Einrichtung, den Bahnhof komplex und vergnüglich, ihn modisch erscheinen zu lassen wie einen ausländischen Spielplatz. Und das glaubte ich ziemlich lange. Die Überführung hinauf- und hinunterzusteigen hielt ich für ein recht weltmännisches Spiel, die geschmackvollste aller Dienstleistungen, die die Eisenbahn bot, so dass ich, als ich später entdeckte, dass es sich nur um eine sehr praktische Treppe handelt, die den Fahrgästen ermöglicht, die Gleise zu überqueren, auf der Stelle jedes Interesse daran verlor.
Als Kind glaubte ich auch, dass Untergrundbahnen, wie ich sie in einem Bilderbuch gesehen hatte, nicht aus einer praktischen Notwendigkeit heraus erfunden worden waren, sondern dass es ein lustiges Vergnügen sei und abwechslungsreich, einmal mit Wagen nicht auf, sondern unter der Erde zu fahren.
Ich war von Kindesbeinen an kränklich und musste oft das Bett hüten, wo mir das Laken und der Bezug von Kopfkissen und Decke als höchst langweiliger Zierat erschienen; dass es sich dabei um durchaus nützliche Dinge handelt, ging mir erst auf, als ich fast zwanzig war, und ich war enttäuscht und traurig ob der Nüchternheit der Menschen.
Auch Hunger habe ich nie gekannt. Damit meine ich nicht, dass ich in einer Familie aufwuchs, die keine materiellen Sorgen hatte, nichts so Einfältiges, nein: Ich hatte einfach keine Ahnung, was für ein Gefühl das ist, »Hunger«. Es mag komisch klingen, aber ich merkte nichts, auch wenn ich nichts im Bauch hatte. Wenn ich aus der Schule kam, aus der Grundschule, aus der Mittelschule, ging’s zu Hause los: Na, du hast bestimmt Hunger, wir kennen das, wenn man aus der Schule kommt, hat man mächtigen Hunger, wie wär’s mit kandierten Bohnen? Oder Sandkuchen? Brot haben wir auch. Mit dem kriecherischen Geist, der mir eigen ist, murmelte ich dann, Mensch, hab ich Hunger, und schob mir eine Handvoll Bohnen in den Mund, obwohl ich nicht die geringste Ahnung hatte, was das sein könnte: Hunger.
Natürlich esse auch ich alles mögliche, kann mich aber kaum erinnern, jemals gegessen zu haben, weil ich Hunger gehabt hätte. Ich esse das, was als ausgefallen gilt. Ich esse das, was als luxuriös gilt. Ich esse meistens auch das – selbst wenn ich mich überwinden muss – was mir an fremden Tischen vorgesetzt wird. Das Schlimmste in meiner Kindheit waren mithin die Mahlzeiten daheim.
In unserer über zehnköpfigen Familie auf dem Land wurden die Esstischchen, jeder hatte sein eigenes, in zwei Reihen einander gegenüber aufgestellt, wobei mir als Kleinstem natürlich ein Platz ganz am Ende der Reihe zukam; das Esszimmer war düster, und wenn wir zehn oder zwölf beim Mittagessen beispielsweise dahockten und jeder stumm für sich sein Essen aß, überlief mich jedesmal eine Gänsehaut.
Da wir eine bodenständige Landfamilie waren, stets also mehr oder weniger das Gleiche aufgetragen wurde und ausgefallene oder luxuriöse Gerichte nicht zu erwarten waren, bekam ich am Ende regelrecht Angst vor den Mahlzeiten. Warum, dachte ich manchmal sogar, auf meinem Platz am Ende der Reihe in dem düsteren Zimmer, gleichsam vor Kälte zitternd, einen winzigen Bissen zum Munde führend, schluckend, warum müssen denn die Menschen dreimal täglich essen, dreimal, und alle mit so feierlicher Miene, warum muss die Familie sich dreimal, dreimal täglich zu festgesetzten Zeiten in dem düsteren Zimmer versammeln, die Tischchen korrekt ausrichten und, Hunger oder nicht, schweigend ihr Essen kauen, gesenkten Blickes, vielleicht ist es eine Art Ritual, um die Geister der Toten zu besänftigen, die im Hause spuken.
Wer nicht isst, stirbt! Der Satz klang mir stets als bloß widerwärtige Drohung in den Ohren. Gleichwohl versetzte mich sein Aberglaube (den ich noch heute irgendwie für Aberglauben zu halten nicht umhin kann) immer in Angst und Schrecken. Der Mensch stirbt, wenn er nicht isst, deshalb – denn essen muss er – arbeitet er: Worte, die dunkler, die enigmatischer und von gleicher Bedrohlichkeit gewesen wären, gab es für mich nicht.
Und anscheinend weiß ich, um es kurz zu machen, immer noch nicht, was es heißt, sich als Mensch zu gerieren. Die Unsicherheit, dass mein Begriff von Glück grundverschieden sein könnte von dem aller anderen Menschen, hat mich ganze Nächte nicht schlafen lassen, hat mich winseln gemacht, hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Bin ich glücklich? Tatsächlich hat man mir von klein auf oft gesagt, ich sei ein Glückskind; mir aber kam es immer wie die Hölle vor, mir schien ganz im Gegenteil, dass es denen, die sagten, ich sei ein Glückskind, unvergleichlich viel besser ging als mir selbst.
Ich habe mir sogar schon vorgestellt, dass mir zehn Übel anhafteten und dass nur eines davon meinem Nachbarn, hätte er es zu tragen, Grund genug wäre, sich das Leben zu nehmen.
Ich habe, mit anderen Worten, keine Ahnung, wie und woran mein Nachbar leidet. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht hat er praktische Sorgen, Sorgen, die verfliegen, wenn er nur zu essen hat, vielleicht hat er furchtbare Pein zu erdulden, grässliche Höllenqualen, gegen die meine zehn Übel geradezu verblassen, ich weiß es nicht – doch geht es ihm, wenn er sich dennoch nicht das Leben nimmt, wenn er nicht verrückt wird, wenn er über Politik schwadroniert, wenn er nicht verzweifelt, wenn er unverzagt den Kampf des Lebens fortsetzt, geht es ihm dann wirklich schlecht? Ist er nicht egoistisch – und hält das für die natürlichste Sache der Welt? Hat er sich jemals selbst in Frage gestellt? Das wäre in der Tat bequem – nur: ob alle so sind und, wenn ja, es nicht das beste wäre, weiß ich nicht ... Schlafen sie nachts tief und fest, stehen morgens frisch und munter auf? Wovon träumen sie? Woran denken sie, wenn sie durch die Straßen gehen, an Geld? Nein, das allein kann es nicht sein, der Mensch lebt, um zu essen, das habe ich, scheint mir, schon gehört, doch dass er des Geldes wegen lebte, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, das heißt, andererseits ... Nein, ich weiß es nicht ... Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger verstehe ich es, desto stärker die so ganz andersartige Unsicherheit und Angst, die nur mich allein zu befallen scheint. Mit meinem Nachbarn kann ich mich kaum unterhalten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
So verfiel ich auf die Clownerie.
Es war mein letztes Mittel, um Liebe zu werben. Denn es wollte mir, obwohl ich die Menschen in höchstem Maße fürchtete, einfach nicht gelingen, mich von ihnen abzukehren. Die Clownerie erlaubte mir schmalen Kontakt. Nach außen trug ich immerfort ein entgegenkommendes Lächeln zur Schau, ein desperates Unternehmen, das ständig um Haaresbreite, muss man sagen, zu kippen, zu scheitern drohte, das mich innerlich den Schweiß der Verzweiflung kostete.
Von Kindheit an hatte ich nicht die geringste Vorstellung davon, woran die Mitglieder meiner eigenen Familie wohl litten, was sie Tag um Tag dachten, ich hatte nur Angst, fühlte mich dem nicht gewachsen und wurde deshalb schon früh ein guter Clown. Ich war, mit anderen Worten, unmerklich zu einem Kind geworden, das nie, nie sagte, was es meinte.
Auf Familienphotos aus dieser Zeit machen alle immer ein ernstes Gesicht, nur ich allein ziehe unweigerlich eine Grimasse und lache. Auch das war ein Mittel meiner kindlich-traurigen Clownerie.
Kein einziges Mal auch habe ich, wenn mir etwas vorgeworfen wurde, Widerworte gegeben. Den kleinsten Tadel empfand ich wie einen Donnerschlag, der mich in Wahnsinnsangst versetzte, so dass ich nicht nur keine Widerworte geben konnte, sondern mich im festen Glauben, dieser Tadel sei eine ewige, den Menschen seit Äonen überkommene »Wahrheit«, fragte, ob ich, da mir die Kraft fehlte, mich dieser Wahrheit entsprechend zu verhalten, überhaupt geeignet sei, mit Menschen zusammenzuleben. Mit Worten streiten oder mich rechtfertigen konnte ich deshalb nicht. Wenn ich von jemandem beschimpft wurde, hatte ich das Gefühl, ich, ich allein und niemand sonst hätte einen furchtbaren Irrtum begangen und nahm, innerlich halb wahnsinnig vor Angst, die Attacke schweigend hin.
Niemandem gefällt es wohl, kritisiert oder gescholten zu werden; ich aber sah im Gesicht des Menschen, der mich schalt, immer das fürchterliche Wesen eines Tieres, schlimmer als das eines Löwen, eines Krokodils, eines Drachens. Wenn ich sah, wie dieser wahre, furchtbare Charakter des Menschen, den er normalerweise verbirgt, bei irgendeiner Gelegenheit im Zorn und so plötzlich, wie ein phlegmatisch auf der Weide dösendes Rind mit dem Schweif die Bremsen auf seinem Bauch erschlägt, zum Vorschein kam, überlief mich jedesmal ein Schauer, der mir die Haare zu Berge stehen ließ, und der Gedanke, dass auch dies wahrscheinlich ein Wesenszug sei, der den Menschen erst befähigte, das Leben zu meistern, nahm mir für mich selbst alle Hoffnung.
Menschen gegenüber empfand ich immer nur Angst und Furcht, und da ich in mein eigenes Verhalten als Mensch nicht das geringste Vertrauen haben konnte, verschloss ich meine ureigenen Qualen im Herzen, verbarg und versteckte meine Melancholie und meine nervöse Angst, kleidete sie mit Hingabe in einen arglosen Optimismus und vervollkommnete mich so allmählich in der Kunst, ein Kauz, ein Clown zu sein.
Bring sie zum Lachen, die Menschen, sagte ich mir, egal wie, dann merken sie vielleicht nicht, dass du außerhalb dessen stehst, was sie »Leben« nennen, auf keinen Fall darfst du ihnen Dorn im Auge sein, du bist das Nichts, bist Wind, bist Luft – solche Gedanken wurden immer stärker in mir, und so brachte ich meine Familie durch Clownerien zum Lachen, gab ihr bis hin zu den Hausdienern und -mädchen, die mir noch geheimnisvoller und schreckenerregender erschienen, ein verzweifeltes Stück nach dem andern zum besten.
In der heißen Jahreszeit erheiterte ich alle im Haus, indem ich mit einem roten Wollpullover unter dem dünnen Sommerkimono den Flur entlang spazierte. Selbst mein großer Bruder, der selten lachte, prustete, als er mich sah, los und sagte unendlich zärtlich: »Mensch, Yozo, das passt doch jetzt nicht!«
Natürlich nicht. Ich war exzentrisch, aber keineswegs so unempfindlich gegen Wärme oder Kälte, dass ich mitten im Sommer in einem Wollpullover herumgelaufen wäre. Ich hatte mir nur die Wadenwärmer meiner Schwester über die Arme gestreift und ließ sie so unter den Kimonoärmeln hervorschauen, dass es aussah, als hätte ich einen Pullover an.
Mein Vater hatte viel in Tokyo zu tun, so dass er im Sakuragi-Viertel in Ueno ein Zweithaus unterhielt und dort die meiste Zeit des Monats verbrachte. Wenn er nach Hause kam, brachte er immer unzählige Geschenke mit, für jeden in der Familie, ja für die ganze Verwandtschaft, es war eine Art Steckenpferd von ihm.
Eines Abends vor seiner Abreise nach Tokyo versammelte Vater die Kinder im Besuchszimmer, fragte lachend jedes einzelne, was es denn gerne mitgebracht hätte und trug die Antworten getreulich in sein Notizbuch ein. Dass er sich so um uns Kinder kümmerte, war selten.
»Und du, Yozo?«
Ich brachte auf seine Frage keinen Ton heraus.
In dem Augenblick, als er fragte, was ich mir wünsche, kam mir jeder Wunsch abhanden. Flüchtig meldete sich der Gedanke: Ganz egal, es gibt sowieso nichts, was mir Spaß machen würde. Und zugleich, dass ich nicht würde ablehnen können, was man mir gab, wie wenig auch immer es mir gefiele. Ich konnte nicht nein sagen zu dem, was mir zuwider war, und selbst das, was ich mochte, kostete ich furchtsam wie ein Dieb, mit einem bitteren Geschmack auf der Zunge, zerrissen von unsagbarer Angst. Ich hatte, mit einem Wort, nicht einmal die Kraft, zwischen zwei Dingen, zwei Möglichkeiten zu wählen. Dies ist, will mir scheinen, eine meiner Eigenheiten, die ganz wesentlich dazu beitrug, dass ich in späteren Jahren mein besagtes »Schandleben« führte.
Da ich nur herumdruckste, sagte mein Vater leicht verstimmt: »Aha, also wieder ein Buch? Ich kenne in Asakusa einen Laden, in dem man Neujahrsmasken verkauft, Löwenmasken, und zwar genau in der richtigen Größe für Kinder, aber so eine willst du nicht, nicht wahr?«
Aber so eine willst du nicht, nicht wahr?