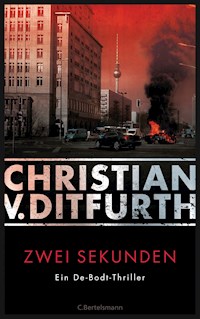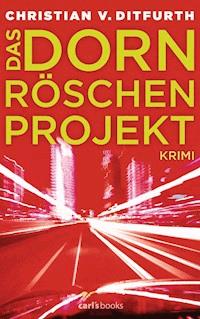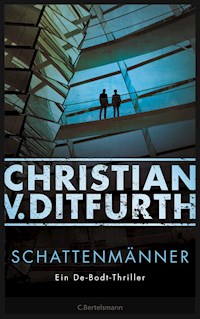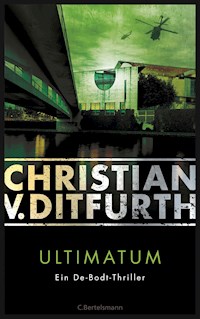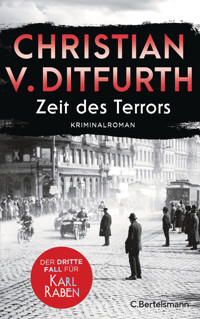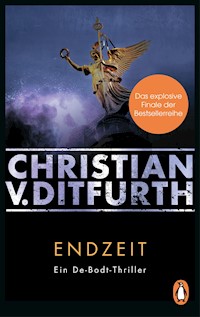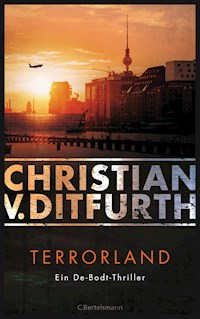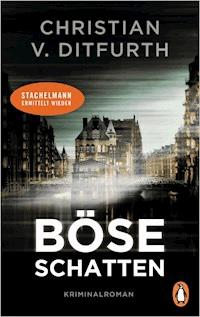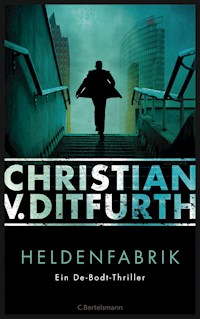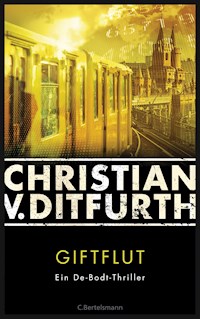
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar de Bodt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Aktuell, brisant, spannend - ein Thriller von internationalem Format
Ein Sprengstoffanschlag auf die Oberbaumbrücke erschüttert Berlin. Es gibt Tote und Verletzte. Auch in Paris und London explodieren Brücken. Es folgt Anschlag auf Anschlag. Die Polizei tappt im Dunkeln, die Täter hinterlassen keine Spur und keine Botschaft. Klar ist nur: Jemand führt Krieg gegen Europa. Die Politik verfällt in Panik, die Bevölkerung lebt in Angst, es kommt zu Übergriffen auf Minderheiten und Flüchtlinge. Rechtsparteien werden stärker. Aktienmärkte und Wirtschaft stürzen ab.
Mit hoher Schlagzahl jagt Christian v. Ditfurth seinen Berliner Hauptkommissar Eugen de Bodt durch ein Land am Abgrund. De Bodt wirft alle Regeln über den Haufen, ermittelt hart am Rand der Legalität und darüber hinaus. Mit seinen Kollegen Silvia Salinger und Ali Yussuf verfolgt er Spuren im In- und Ausland.
Eugen de Bodts dritter Fall spielt in einer Welt, die sich auflöst. Alle Gewissheit schwindet. Eherne Regeln werden zertrampelt. Moral ist Ballast, Recht ein Störfaktor. In einer entfesselten Welt braucht es neue Ideen, um Ideale zu bewahren. Und um Gewalttäter zu fassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Christian v. Ditfurth
GIFTFLUT
Ein De-Bodt-Thriller
Informationen über dieses Buch: www.cditfurth.deDieses Buch ist ein Roman und kein Tatsachenbericht. Das Beschriebene hat sich so nicht ereignet. Trotz der vom Autor in künstlerischer Freiheit gewählten fiktiven Handlungsabläufe mögen im Einzelfall Anklänge an Verhaltensweisen lebender oder verstorbener Personen oder an öffentlich bekannte Unternehmen nicht immer vermeidbar gewesen sein; dies ist aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfassend geschützt. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by carl’s books, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur gsk
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19596-0 V004 www.cbertelsmann.de
Für Chantal
I’m God.
Edson Mitchell
Prolog
Hundertfünfundfünfzig Meter. Er blickte hinunter. Auf der Taunusanlage staute sich der Verkehr. Wie jeden Morgen. Ein milder Wind. Die Sonne blendete. Es war viel zu warm für diesen Wintermorgen. Er dachte an Odette. Wie sie sich verabschiedet hatten. Wie jeden Werktag. Einen flüchtigen Kuss. »Mach’s gut!« – »Du auch!« Sie würde später an die Uni gehen. Sie hatte vor zwei Jahren beschlossen, noch einmal zu studieren. Die beiden Kinder, Ronald und Margit, waren aus dem Haus. Sie Sinologin in Boston, offenbar glücklich verheiratet mit ihrem Professor. Obwohl man so was nie wirklich wusste. Er Investmentbanker in London. Neue Freundin, auch Bankerin. Ehrgeizig, sympathisch. Nein, er konnte sich nicht beschweren. Er hatte viel richtig gemacht.
Die Sonne spiegelte sich in den Glastürmen. Unten strömten seine Mitarbeiter in das Gebäude. Ein neuer Tag.
Sein letzter. Gestern Nachmittag hatte er den Bericht der Börsenaufsicht gelesen. Nichts. Aber er wusste, dass Andeutungen genügten, um die Hunde auf die Spur zu setzen. Sie würden schnüffeln, bis sie etwas gefunden hatten. Angermann würde als Erster umfallen. Feilschen. Freiheit gegen Wahrheit. Koste es, was es wolle. Er würde es genauso machen, wäre er an seiner Stelle. Er hatte Angermann alle Wege freigeräumt. Wissen, Kontakte, Tricks. Was nicht in den Lehrbüchern stand. Was niemand auf Tagungen sagte. Was nur die Profis wussten. Das Einverständnis unter Eingeweihten. Jetzt würde Angermann alles gegen ihn kehren. Alles, was er ihm beigebracht hatte. Weil er sein kleines Leben retten wollte. Mit der blassen Freundin und dem Hund aus dem Tierheim, dessen Bild tatsächlich auf seinem Schreibtisch stand.
Zeit für eine Bilanz. Für ihn sprach, dass er alles versucht hatte. Alles. Um sein Haus zu retten. Die Institution. Die Existenz. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt. Den Matrjoschka-Plan. So komplex, dass niemand die Zusammenhänge würde entwirren können. Niemand. Hatte er gedacht. Alles hatte dafür gesprochen.
Die Kolonne von Polizeifahrzeugen schloss den Kreis um die Doppeltürme.
Er hatte sich geirrt. Dieser Typ in Berlin hatte die Puppen ausgepackt. Eine nach der anderen. Wie er es gemacht hatte, wusste er nicht. Es war auch egal. Zählte nicht mehr. Es zählte das Ergebnis. Wie immer.
Er hatte gelernt, Niederlagen zu akzeptieren. Konsequenzen zu ziehen. Von seinen Gefühlen abzusehen. Von Angst. Von Verzweiflung. Von Hoffnung. Eins und eins sind zwei. Basta.
Er zog das Jackett aus. Legte es auf den Boden. Öffnete die Schnürsenkel. Entledigte sich seiner Schuhe. Stellte sich an den Rand. Und sprang.
Hundertfünfundfünfzig Meter.
1.
War ja klar. Wenn sonst schon alles schiefging, tropfte aus dem Wasserhahn nur Brühe. Das Wasser in der Filterkanne war braun. Er leerte sie in der Spüle. Den Filter warf er in den Müll. Schraubte am Hahn. Der ploppte zweimal trocken, dann kam nichts mehr. De Bodt rieb den Finger am Auslaufsieb. Braune Schmiere. Fluchte, nahm das Telefon und wählte die Nummer der Hausverwaltung. Natürlich war besetzt.
Er klingelte an der Wohnung gegenüber. Benec stand auf dem Schild. Handgeschrieben. Es öffnete eine Frau. Er hatte sie noch nie gesehen. Um die dreißig. Kurze Haare. Ein bisschen Salinger in Schwarz. Sie blickte ihn an. Im Hintergrund rbb-Inforadio.
»Das Wasser?«, fragte sie.
Er nickte. »Ich hab versucht, die Hausverwaltung …«
»Ich auch. Besetzt. Wahrscheinlich haben die keine Lust. Wie meistens.«
»Hoffentlich dauert das nicht ewig.«
»Ich hätte noch einen Tee«, sagte die Frau.
Wasserausfall in Kreuzberg, Treptow, Neukölln und Friedrichshain seit heute früh seit sieben Uhr fünfunddreißig. Die Ursachen sind noch nicht bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden … Eine Frauenstimme im Radio.
»Na, das kann ja was werden«, sagte sie und öffnete die Tür ein Stück weiter. In ihren Augen reizte ihn etwas.
»Ich muss ins Büro«, sagte er. »Aber bald einmal …«
Sie lächelte. »Gewiss. Welchen Tee trinken Sie am liebsten?«
Sein Handy klingelte. Yussuf war dran. »Zwei Leichen in Friedrichshagen. Ein Ehepaar. Sieht nach Doppelmord aus. Ich habe einen Wagen geschickt.«
»Grünen«, sagte er.
2.
Er unten, auf dem Rücken. Sie auf dem Bauch, auf ihm. In der Badewanne. Er starrte de Bodt an, über den Kopf seiner Frau hinweg. Das Wasser ließ die Pupillen verschwimmen. Eine Haarsträhne der Frau schwamm über seinem Mund. Schlaffe, faltige Haut. Bleich.
De Bodt rieb seine Hände und knetete die Kälte heraus.
»So was hab ich noch nie gesehen«, sagte die Zander. »Erinnert irgendwie an Leichen in der Spree.«
»Ist aber … intensiver. Die Wirkung. Eine Inszenierung«, sagte de Bodt. »Eine Inszenierung hat immer eine Absicht. Was wollen uns die Täter sagen? Oder der.«
»Keine Ahnung. Verraten kann ich Ihnen aber schon, dass beide ertrunken sind. Die liegen mindestens zwei Tage im Wasser. Ob in der Wanne, das wird sich zeigen. Das Kauderwelsch schicke ich heute Abend, spätestens morgen Mittag. Wasser in der Lunge. Oder kein Wasser in der Lunge. Ich tippe auf Variante eins. Bisher habe ich keine Spuren äußerer Einwirkung gefunden. Sagt aber nichts.« Sie war heute Morgen trockener als ein Brötchen von vorgestern.
»Leichen auf nüchternen Magen …«, sagte er.
Als Erstes roch er sie. Sie streifte ihn am Ellbogen und stellte sich neben ihn. Ein kurzer Seitenblick, dann betrachtete Salinger die Leichen in der Wanne.
»So eine Scheiße«, sagte Yussuf. Er hatte sich auf der anderen Seite neben de Bodt gestellt.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte de Bodt.
»Die Putzfrau«, sagte Yussuf.
»Was wissen wir über die Opfer?«, fragte de Bodt.
Yussuf blickte auf sein Smartphone. »Ehepaar Wolter. Sie ist Hausfrau. Er technischer Leiter im Wasserwerk Friedrichshagen. Das größte Wasserwerk der Berliner Wasserbetriebe, ist ein Landesunternehmen.«
»Nach dem neoliberalen Wahnanfall«, sagte Salinger. »RWE und Veolia hatten Anteile. Aber das war vor deiner Zeit.«
»Sonst was?«, fragte de Bodt.
»Die Kollegen gehen in der Nachbarschaft rum. Niemandem ist was aufgefallen. Bisher. Die Wolters sind zurückhaltend gewesen. Höflich. Unauffällig. In der Garage steht ein Golf. Sie war meist mit dem Rad unterwegs.«
»Ganz normale Leute«, sagte Salinger. Es klang, als wollte sie sagen: Endlich ein gewöhnlicher Mord. Kein Spektakel. Keine Bürgerkriegsarmeen, die alles niederknallten.
De Bodt nickte. »Ganz normale Leute. Nur ist das kein normaler Mord.« Er mühte sich, das Würgen im Hals zu unterdrücken. Kalter Schweiß auf dem Rücken. Die Stirn klebte.
Sie zuckte die Achseln.
»Nehmt das Haus auseinander. Uhlenhorst schon da?«
»Keine Ahnung«, sagte Yussuf.
»Macht mal Platz«, sagte Uhlenhorst. »Scheißverkehr. Und die Straßen perfekt für Kati Witt.«
3.
»Haut alle ab«, sagte Uhlenhorst. »Es sei denn, Frau Dr. Zander …«
Die winkte ab und ging.
Vor der Tür blies ein scharfer Wind de Bodt Graupel ins Gesicht. Wie Schrotkörner. Der Leichenwagen rutschte beim Bremsen.
»Fehlt noch die Quietschente«, sagte Yussuf.
Beamte unterwegs von Haustür zu Haustür: Ist Ihnen etwas aufgefallen? Wie waren die Wolters als Nachbarn? Hatten sie Besuch? Irgendein Auto, Handwerker, Lieferant vor zwei oder drei Tagen, der länger blieb? Fremde in der Straße?
Salinger stellte sich zu ihnen. Sie blies in ihre Hände, steckte sie in die Manteltasche.
»Ich habe ein blödes Gefühl«, sagte de Bodt. Der Schweiß ließ ihn frieren.
»Der Chef vom Wasserwerk ertränkt in der eigenen Badewanne«, sagte Yussuf.
»Und seine Frau.« Salinger wippte auf dem Schnee.
Jetzt schwebten Flocken. Wenige, groß. Plötzlich war es windstill.
»Angehörige?«, fragte de Bodt.
»Eine Tochter, wohnt in Potsdam«, erwiderte Yussuf.
4.
Wie die Eltern. Kleinbürgerlich. Natalie Dreher. Nur das Brillengestell schillerte, rot. In der Wohnung ein Querschnitt aus der Möbelhauswerbung für Leute, die es heimelig mochten. Van Goghs Selbstporträt vor Staffelei über einem Elektrokamin. Vom Dreisitzersofa Blick in den Garten. Tannen, schneebedeckt. Marmorfigürchen am Terrassenrand, Schneehüte.
Sie weinte. »Mein Mann …«, sagte sie.
»Arbeitet wo?«, fragte Salinger.
Dreher schniefte, fingerte. Salinger reichte ihr ein Papiertaschentuch.
»In der Senatsverwaltung.«
De Bodt blickte zum Fenster hinaus. Der Boden weiß, der Himmel grau.
»Wir hatten uns gestritten«, sagte sie.
»Worüber?«, fragte Yussuf. Tief versunken im Sessel.
De Bodt schüttelte den Kopf. Nur eine Andeutung.
Yussuf verstand es trotzdem. Lass sie reden. Lass ihr die Zeit.
»Weiß ich schon gar nicht mehr.« Schluchzen. »Sie hatten was an meinem Mann auszusetzen. Immer.« Starrte Yussuf an. »Immer.«
Salinger faltete die Hände, drückte sie, legte sie auf die Knie.
Drehers Augen folgten der Bewegung.
Ein Handy vibrierte. Weit weg.
»Dass er nicht Karriere machen wollte … wie mein Vater.« Blickte nach draußen. »Für mich. Damit es uns gut ging.«
Yussuf betrachtete den Bildschirm seines Handys.
»Hatten Ihre Eltern Streit mit jemandem? Gab es Drohungen?«, fragte de Bodt.
Sie blickte ihn überrascht an. Schüttelte den Kopf. »Bestimmt nicht.«
»Was macht Sie so sicher?«, fragte Salinger.
»Mein Vater war im Beruf … zielstrebig. Aber privat … bloß nicht anecken. Nicht auffallen. Er war sehr auf seinen Ruf aus.«
De Bodt setzte sich neben Salinger. Neigte sich zu Dreher. »Ihre Eltern haben nie etwas angedeutet? Anfeindungen?«
»Nein, nie. Vielleicht waren es Einbrecher.« Es klang fast so, als würde der Gedanke sie erleichtern.
»Es fehlt nichts«, sagte Salinger. »Soweit wir das überblicken. Aber wir müssen Sie bitten, uns bald in das Haus zu begleiten. Vielleicht morgen?«
Dreher nickte wie abwesend. »Ertrunken?«
»Ertränkt, vermutlich«, erwiderte de Bodt leise.
5.
»Was zu lesen«, hatte Uhlenhorst gesagt, als er frühmorgens auftauchte. »Haben wir im Schreibtischschubfach gefunden.«
Er legte einen Stapel Papier auf de Bodts Schreibtisch, eingehüllt in eine Plastiktüte. »Fingerabdrücke sind gesichert. Stammen vermutlich von Wolters.«
Yussuf saß auf dem Stuhl seines Chefs. Er öffnete den Beutel. Blätterte. »Briefe.« Las, blätterte. Hielt ein Blatt hoch. »Durchschlagpapier, ich glaub’s nicht.«
De Bodt stellte sich neben Yussuf.
Teils Ausdrucke, mit blauem Kuli unterschrieben:
Beste Grüße,
Paul
Teils Kohlepapierkopien, mit Schreibmaschine. De Bodt erinnerte sich an die fransigen Buchstaben.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
»Ein Korinthenkacker«, sagte Yussuf.
»Ein altmodischer Korinthenkacker.« De Bodt nahm den Stapel und setzte sich auf den Stuhl neben dem Eingang.
Nach ein paar Minuten Lektüre fügte er hinzu: »Ein böser Korinthenkacker. Passt zu dem, was Frau Dreher erzählt.«
Die hatte sie zur Tür begleitet, das Taschentuch in der Hand. De Bodt hatte ein komisches Gefühl gehabt, als sie Zehlendorf verlassen hatten, das Einfamilienhaus-Paradies. Rosen, Venusfiguren, Gartenhäuschen, Volkswagen, Audi, Benz. Den Schnee der Bürgersteige zu Hügeln am Straßenrand gehäuft.
De Bodt stellte sich Wolter vor. Verkniffen. Zu klein geraten, humorfrei, rechthaberisch. Sorgte sich um Wohlergehen und Ruf seiner Tochter. Bot Hilfe an. Bei der Hausfinanzierung, beim Knüpfen von Kontakten in der Senatsverwaltung, bei der Urlaubsplanung.
Ich helfe doch gern. Nur ist es enttäuschend, wenn Du meine Hilfe zu Deinem Schaden ausschlägst.
Das erinnerte ihn an seinen Vater, den Gelehrten, Ehrenbürger Hamburgs. Erdrückende Hilfsbereitschaft. Ich will doch nur das Beste für dich. Dünkel hieß der Mief des Großbürgertums. Wolter war Heinrich de Bodt im Kleinformat.
Wolter wusste alles. Riet, welchen Rasen sein Schwiegersohn säen sollte, welches Urlaubsziel bei welchem Reisebüro, welches Auto. Nur wenn man es kauft, gehört es einem. De Bodt fand keinen Brief an die Tochter. Offenbar erzählte die Tochter ihren Eltern viel. Und der Schwiegervater mischte sich ein.
»In der Badewanne ertränkt. Beide«, sagte die Zander. Sie stand unschlüssig in der Tür. »Liebesbriefe?«
»Eher Prosa als Minnesang«, erwiderte de Bodt.
»Ich beneide Sie.«
»Freut mich.«
»Wie ertränkt? Vorher gefesselt? Sonstige Spuren?«
»In meinem wie immer lückenlosen Bericht werden Sie morgen, spätestens übermorgen lesen, dass beide kaum Spuren äußerer Einwirkung aufweisen. Nein, nicht gefesselt.«
»Aber freiwillig werden sie nicht …«, sagte de Bodt. »Oder Doppelselbstmord. Gibt’s ja.«
»Vielleicht doch freiwillig«, sagte die Zander. »Kann aber sein, dass Uhlenhorst noch was findet. Die KT funktioniert ja wieder.«
De Bodt saß eine Weile mit geschlossenen Augen, nachdem die Zander mit einem »Tja« gegangen war. Die Zander hatte recht. Uhlenhorst lief wieder im Normaltakt, nachdem de Bodt seine Kinder und seine Ex gerettet hatte.
»Sie müssen nacheinander in die Badewanne gestiegen sein«, sagte Yussuf ins Schweigen.
»Das geht doch gar nicht.« Salinger legte die Hände ums Genick.
»Warum nicht?«
»Versuch’s dir vorzustellen.«
De Bodt las gründlich, was er überflogen hatte. Die Antwortbriefe waren knappe Ausdrucke. Dreher dankte immer wieder. Aber zwischen den Zeilen las de Bodt den Überdruss. Dann gab er Salinger den Stapel. Die brauchte nicht lang und reichte ihn Yussuf.
»Genug gelesen?«, fragte de Bodt.
Yussuf nickte.
»Reicht fürs Erste«, sagte Salinger. »Wenn Dreher es war, plädiere ich auf Notwehr.«
»Dreher traute sich nicht, dem Alten Kontra zu geben«, sagte Yussuf.
»Da hat sich Frust in ihm angestaut«, sagte Salinger.
»Tolles Mordmotiv«, erwiderte de Bodt.
»Kann doch sein«, widersprach Yussuf. »Wolter nervt und nervt. Irgendwann reicht es dem Schwiegersohn. Mir wäre schon früher der Kragen geplatzt.«
»Dreher gehört zu den Typen, die sich nicht wehren. Und dann schlägt er plötzlich zu. Der berühmte Tropfen … Und vielleicht hat ihm die Holde in den Ohren gelegen. Der Schwiegervater macht Druck, die Frau nervt.« Salingers Zeigefinger malte einen Kreis in die Luft.
Yussuf nickte. »Kennt man doch. Jeden Abend nach der Arbeit zetert die Frau Gemahlin. Immer das Gleiche. Was ihr der Schwiegervater ins Ohr gesetzt hat. Bis es reicht.«
Salinger blickte de Bodt in die Augen.
»Gibt es. Aber es war keine Affekttat«, sagte de Bodt. »Ihr habt gehört, was die Zander gesagt hat. Um zwei Menschen in einer Badewanne zu ertränken …«
»Ist ja gut. Das muss man vorbereiten.« Yussuf winkte ab. »Kein Affekt …«
»Vielleicht doch der merkwürdigste Suizid aller Zeiten?«, fragte Salinger.
6.
Simon Dreher wollte lieber ins LKA kommen. Zweimal Polizei vorm Haus, das sah nicht gut aus in Zehlendorf.
Er saß verschwitzt vor de Bodts Schreibtisch. Yussuf ihm gegenüber. Als der ihm den Briefstapel zeigte, nickte Dreher.
»Der Schwiegervater …«
»War ein Ekel«, sagte Dreher. »Hat sich in alles eingemischt.«
»Ihre Frau hat …«
»Pausenlos. Sie hat pausenlos mit ihrer Mutter telefoniert. Und wir mussten jedes Wochenende …«
»Das würde mich nerven«, sagte Salinger. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und tat so, als hätte sie ihn gerade erst bemerkt.
Er blickte sie an. Nickte. Sah hilflos aus.
»Und Sie haben sich gefragt, warum Sie sich darauf eingelassen haben.« Yussuf trommelte mit de Bodts Lieblingskuli auf dessen Schreibtisch. Eingraviert war Veni vidi vici. Irgendwann hatte er auf dem Schreibtisch gelegen. Salinger hatte gelacht, als Yussuf ihn ihr zeigte. »Hat ihm bestimmt diese Kollegin aus Hamburg geschenkt. Die Einzige, die ihn dort mochte.«
Dreher wandte seinen Blick zu Yussuf.
De Bodt blickte zum Fenster hinaus, als ginge ihn die Vernehmung nichts an. Er wirkte unwillig. Salinger musterte ihren Chef und wusste, warum. Sie hatten Dreher nicht ausreden lassen. De Bodt sagte lieber wenig. Oft ließ er Zeugen oder Beschuldigte Fragen beantworten, die er noch gar nicht gestellt hatte. Salinger tippte sich auf die Lippen, als Yussuf sie anblickte. Er hob die Hände, ließ sie sinken. Ist ja gut.
»Haben Sie sich mit Ihrem Schwiegervater gestritten?«, fragte Salinger.
Dreher blickte sie an. »Nein.« Überlegte. »Nein«, wiederholte er und schwieg.
»Ihr Schwiegervater ist Ihnen auf die Nerven gegangen, aber gestritten haben Sie sich nicht?«
»Warum?«, erwiderte Dreher.
Schweigen. De Bodt kramte in seiner Jacketttasche, fand ein Taschentuch und schnäuzte sich.
»Ich streite mich nicht. Ich finde das … sinnlos.«
»Bis Ihnen der Kragen platzt«, sagte Yussuf.
Verständnisloser Blick. »Mir platzt der Kragen nicht.«
»Das staut sich doch in einem an. Immer wieder nervt der Schwiegervater. Irgendwann reicht es, oder?« Yussuf unterbrach das Getrommel einen Augenblick, blickte Dreher ins Gesicht und trommelte weiter.
Dreher betrachtete den Stift in Yussufs Hand.
»Was soll sich da anstauen?«
»Wut? Enttäuschung? Hat Ihre Frau dem Schwiegervater recht gegeben?«
»Mal ja, mal nein.« Schüttelte den Kopf. »Der Mensch ist kein Luftballon.«
De Bodt lächelte. »Danke, Herr Dreher.«
7.
Was für eine Scheißstadt! Sogar ohne das Touristengewimmel im Sommer. Pampe auf dem Gehweg. Irgendwas zwischen Schnee und Regen aus dem schwarzen Himmel. Schon schmutzig, bevor es auf die Straße matschte. Ein Verkehr, der einen zum Kriechgang verdammte. Ein Gewimmel hektischer Menschen, gegenüber dem ein Ameisenhaufen als Kurpark durchging. Und ein neuer Fall, auf den er so viel Lust hatte wie auf trocken Brot und leere Flaschen. Er hatte überhaupt keine Lust mehr auf Fälle.
Aber es half nichts.
Das Haus war gegen die Straße mit einer Mauer geschützt. Darauf Stacheldraht, zwei Kameras. Das Hoftor aus Stahl. Es stand offen. Vor dem Absperrband Gaffer. Handyfotos. Lebranc schnippte die Zigarette in den Rinnstein. Vierter Stock, natürlich kein Lift. Im dritten öffnete sich eine Tür und klackte gleich wieder ins Schloss. Ein paar Stufen höher stand eine alte Frau. Abgetragener Mantel, in Hausschuhen. Sie stierte ihn an. Vor der Wohnung in der vierten Etage wachte ein Polizist. Er legte die Hand an den Mützenschirm. Die Tür war angelehnt. Lebranc ging hinein. Der Flur war verstopft mit Kollegen.
»Wer hier nichts zu tun hat, verschwindet. Sofort!«, schnauzte er. Kollegen quetschten sich an ihm vorbei. Er rückte keinen Millimeter zur Seite.
»Wer zuerst hier war, wartet vor der Tür.«
Er betrat das Badezimmer.
Flanier stand am Fuß der Badewanne und tippte auf seinem Tablet. Dann beugte sich der hagere Rechtsmediziner über die Wanne. Lebranc kannte ihn, hatte aber seinen Namen vergessen. Überhaupt vergaß er in letzter Zeit viel. Stress. Er atmete schwer, die Treppen. Lebranc lehnte sich an die Wand, es klirrte auf dem Boden. Splitter einer Puderdose, die er mit dem Mantel vom Waschbecken gewischt hatte. Der Doktor blickte ihn an. »Guten Abend«, murmelte er.
Lebranc hasste Wasserleichen. Lieber Blut. Lieber Verstümmelungen. Sie fischten Tote aus der Seine. Selbstmörder, Besoffene, Zugefixte. Er hasste die Farblosigkeit der Gesichter. Die Engerlinghaut. Am schlimmsten war es, wenn die Körper aufgequollen waren.
Die beiden Körper lagen dafür nicht lang genug in der Wanne. Er unten, auf dem Rücken. Sie auf dem Bauch über ihm. Sein Toupet hatte sich am Wannenrand verklebt. Rötlich. Ihre Haare waren offen. Grau. Schwammen auf dem Wasser.
Lebranc ging vor die Wohnungstür. Der Flic hatte Bauchansatz und Doppelkinn. Er schien auf etwas zu kauen. »Sie waren als Erster am Tatort.«
Der Untersuchungsrichter Carlo schnaufte die letzten Stiegen hoch. Lebranc wies mit dem Daumen zur Wohnung. »Guten Abend, Bruno«, sagte er, ohne den Mann anzublicken.
Der Richter wischte sich mit dem Mantelärmel die Stirn trocken, hustete, nickte und betrat die Wohnung.
»Also«, sagte Lebranc.
»Die Concierge … hat uns angerufen, Herr Kommissar.«
»Wann?«
Der Polizist blickte auf den Notizblock. »Um 21 Uhr 48.«
»Wo ist die Concierge?«
Der Beamte reckte den Hals, um ins Treppenhaus zu blicken. »Sie steht da.« Zeigte hinunter.
Lebranc stieg die Treppe hinab.
Die Alte im Mantel. Hausschuhe aus grauem Filz. Sie blickte zu ihm auf. Ängstlich. Zupfte an einer Haarsträhne. Weiß. »Sie haben die Leichen gefunden?«
Sie nickte. »Ich hatte die Meuniers seit Donnerstag nicht mehr gesehen. Sie waren aber nicht verreist. Das hätte ich gewusst, wegen der Post und der Pflanzen.«
»Sie haben sich Sorgen gemacht.«
»Ja, Herr Kommissar.«
»Sie hatten einen guten Kontakt mit dem Ehepaar Meunier.«
»Ich habe mit allen Nachbarn einen guten Kontakt. Ich bin die Concierge, Madame Tribeau.«
»Natürlich. Sie haben einen Wohnungsschlüssel?«
Sie blickte ihn erstaunt an. »Ich bin die Concierge«, wiederholte sie.
»Und wenn ein Mieter …«
»Es sind Eigentümer. Alle.«
»Und wenn die Herrschaften« – sie nickte – »verreist waren, haben Sie sich um die Wohnung gekümmert …«
»Und die Blumen, die Tiere …«
Vor Lebrancs innerem Auge vervollständigte sich das Bild einer Concierge, die gern fremde Wohnungen betrat, um ihre Nachbarn zu bespitzeln.
»Und wenn Sie einen Bewohner eine Weile nicht gesehen haben, haben Sie das Appartement aufgesucht …«
Sie nickte. »Sie ahnen ja nicht, was im Haushalt alles passieren kann.«
»Und weil die Meuniers seit Donnerstag nicht aufgetaucht sind …«
»Genau.«
»Sie haben Schlüssel zu allen Wohnungen …«
»Natürlich.« Ihre Brauen hoben sich. »Ich bin die Concierge.«
»Sie wohnen auch hier und haben ein … Büro …«
»Unten, neben der Pforte. Aber ein Büro brauche ich nicht.«
Lebranc hatte das Zimmer durchs Fenster von außen gesehen. Der Fernseher färbte es in Kunstlicht. »Und Sie sind immer so lang auf?«
»Das ist mein Wohnzimmer.«
»Dürfte ich es mir ansehen?«
Tribeau machte kehrt und stieg die Treppe hinab.
Alles sauber, alles verschlissen. Falscher Orientteppich. Ein Nierentisch, zwei Sessel. An der Wand ein gezeichnetes Porträt, das Joséphine de Beauharnais zeigen sollte, Napoleons erste Frau. Eine Kommode vor der Lilientapete. Mit der Concierge vergilbt. Nur der Fernseher war modern. »Hat mein Sohn mir geschenkt. Er arbeitet bei der FNAC«, sagte sie. Sie beobachtete ihn genau. »Nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten?«
»Danke, nein.«
Er trat ans Fenster und entdeckte jetzt erst die Luke. »Praktisch«, sagte er.
»Da kann ich meinen Nachbarn die Pakete geben, ohne die Tür zu öffnen. Hat mein Sohn eingebaut. Wissen Sie, er ist sehr … praktisch.«
Lebranc nickte. Er massierte mit Daumen und Zeigefinger seine Bartstoppeln, die er schon eine Woche nicht mehr gestutzt hatte.
»Man braucht einen Zifferncode …?«
Sie ging zur Kommode, öffnete ein Schubfach und stellte eine Blechschachtel auf den Tisch. Öffnete sie. Riss vorsichtig das Plastik auf. »Bedienen Sie sich.«
Lebranc griff in die Schachtel.
»Mein Sohn mag die. Sind echte Galets aus Quimper.«
Lebranc biss ein Stück ab und überlegte. Wie waren die Täter in die Wohnung gekommen? Es waren mindestens zwei. Nicht, dass er es hätte beweisen können. Aber zwei Menschen in einer Badewanne ertränken, für einen ist das schwer. Nicht unmöglich.
»Sie waren Donnerstagabend hier?«
»Ich bin jeden Abend hier. Gucke die Nachrichten auf France 2, dann noch einen Film oder eine Show, danach gehe ich ins Bett. So gegen elf Uhr. Jeden Abend.«
»Hören Sie es, wenn die Hoftür sich öffnet?«
»Ich höre und sehe es. Außerdem geht dann draußen das Licht an. Dieses … Gerät hat mein Sohn eingebaut.«
Lebranc nickte bedächtig. »Ihr Sohn kennt auch den Torcode …«
»Natürlich.«
»Wenn jemand nach elf Uhr den Hof betritt, das merken Sie nicht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe einen guten Schlaf. Und das Schlafzimmer« – sie wies zur Tür neben der Kommode gegenüber dem Fenster – »geht zur anderen Seite raus.«
Der Keks schmeckte buttrig. Brösel landeten in Lebrancs Kehle. Er begann zu husten. Die Concierge erhob sich, verschwand im Flur und kehrte mit einem Glas Wasser zurück. »Trinken Sie.«
Er trank. Hustete Brösel ins Taschentuch und wischte sich den Mund ab. Als er wieder bei Atem war, deutete er auf ein Stahlkästchen an der Wand: »Die Wohnungsschlüssel?«
Sie nickte.
»Für alle Wohnungen im Haus?« Er steckte sich eine Zigarette an.
Sie verließ den Raum, kehrte mit einem Aschenbecher zurück und nickte.
»Und der Schlüssel für den Schlüsselschrank steckt immer …«
Sie blickte ihn an und schwieg.
»Der Schrank ist also nie abgeschlossen?«
»Ich hab den Schlüssel mal verlegt. Gerade als Herr Ayrault ihn haben wollte, weil seine Frau … das war … furchtbar.«
»Wer in Ihre Wohnung gelangt, hat Zugriff auf die Schlüssel.«
Große Augen, verschämtes Nicken. »Aber es gibt ja den Code am Tor. Hier hat noch nie jemand eingebrochen.«
»Wie oft wird der Code geändert?«
»Jeden Monat. Das ist meine Aufgabe.«
»Und Sie informieren die Mieter … Bewohner?«
»Ich lege ihnen eine Nachricht in den Briefkasten, eine Woche vor der Änderung.«
»Und wie ändern Sie den Türcode?«
Sie erhob sich und hängte Joséphine ab. Eine kleine Stahltür, in die Wand eingelassen. Sie nahm einen Schlüssel aus der oberen Kommodenschublade und öffnete die Tür. Nummerntasten, darunter Funktionstasten. Input, Delete, Save, Exit.
»Wie ändern Sie den Code?«
Sie blickte ihn an. »Das macht mein Sohn. Wissen Sie, er ist sehr praktisch.«
8.
»Vielen Dank«, sagte Salinger. Verzog das Gesicht.
»Ich habe uns Zeit gespart«, erwiderte de Bodt.
»Weißt du mehr als wir? Wir hätten den Dreher in die Mangel nehmen müssen. Der hat ein Motiv.«
»Ich fürchte, wir finden bei diesen Opfern einen Haufen Leute mit Motiv.«
Die Tür öffnete sich, Krüger stellte sich in den Rahmen. »Na, Fall schon gelöst?« Er musterte Salinger.
»Ohne deine Mitwirkung ist das eigentlich unmöglich, Herr Hauptkommissar Krüger«, sagte sie.
»Hab ich’s mir doch gedacht.« Krüger grinste. »Also, wenn ich helfen kann …«
»Tempus fugit«, sagte Yussuf, ohne aufzublicken.
Salinger lachte leise.
Krüger schüttelte den Kopf, starrte Salinger noch einmal auf die Brüste, als wollte er das Bild mitnehmen, und schloss die Tür.
»Fängst du jetzt auch mit dem Scheiß an?«, fragte Salinger.
Yussuf schüttelte den Kopf. »So wie unser Chef mühe ich mich, das Niveau in diesem Laden ein klein wenig zu heben. Man kann nicht nur über Fußball reden. Oder das Wetter.«
»Wenn ich mich recht entsinne, bist du der Einzige hier, der über so was redet.« Sie deutete auf den Hertha-Wimpel auf seinem Schreibtisch.
»Krüger hat sich aber flott berappelt«, sagte Yussuf. »Ich hatte gehofft, er gibt sich die … verdiente Frühpensionierung.«
»Wie kämen wir ohne Krüger aus«, erwiderte Salinger. »Die Polizeiarbeit läge brach. Die Verbrecher würden ein Freudenfest nach dem anderen feiern.«
De Bodt saß auf dem Stuhl neben der Tür und war im Geist woanders. Sein Handy klingelte. Er zog es heraus, blickte auf den Bildschirm und steckte das Telefon wieder ein. »Wir fahren zu den Wasserwerken. Yussuf, du fasst alles zusammen, was wir über die Wolters wissen. Die Kollegen werden ihre Berichte geschrieben haben. Über die Nachbarn und so weiter, du weißt schon.«
»Ich weiß schon. Haut bloß ab.«
»Er war … korrekt«, sagte sie. Sie saß im Vorzimmer und sah ernst aus. Nicht traurig.
»Und persönlich? War es auszuhalten mit ihm?«, fragte Salinger.
Die Sekretärin zog ein Papiertaschentuch aus der Schreibtischschublade und tupfte sich die Stirn. »Freundlich war er nicht. Unfreundlich war er auch nicht.«
»Sie mochten ihn also nicht«, sagte Salinger.
»Ich mochte ihn nicht besonders, das stimmt. Es gab hier wohl niemanden, der ihn sympathisch fand.«
»Hat er Mitarbeiter gedemütigt?«, fragte Salinger.
Sie wiegte den Kopf. »Nicht direkt.«
»Sie waren sein Stellvertreter als Leiter des Wasserwerks«, sagte Salinger.
Er im Pullunder. Hinter dem Schreibtisch. Blickte sie aus dicken Gläsern an. Fuhr sich durch die schütteren Haare.
»Die Frage ist nicht schwer zu beantworten«, sagte Salinger.
De Bodt schüttelte den Kopf, kaum wahrnehmbar. Ein Hauch von Rosa in ihrem Gesicht. Sie verstand. Immer der gleiche Fehler. Sie ärgerte sich über sich selbst. Schluckte den Ärger hinunter und konzentrierte sich auf den Mann vor ihr. Dessen Stirnglatze begann zu glänzen.
Er nickte. »Ja, es ist schrecklich.«
Salinger setzte an, etwas zu sagen, schwieg aber.
De Bodt stellte sich ans Fenster. Es zeigte auf den Hof. Lieferwagen, die Privatautos von Angestellten, drei Männer standen zusammen und rauchten. Dunkle Wolken zogen heran. Er horchte ins Schweigen. Ein Summen, vermutlich vom Lüfter des PC unter dem Schreibtisch. Aus dem Gang Schleifgeräusche. Weitab ein Telefon.
»Schrecklich«, wiederholte der Mann und faltete seine Hände über dem Bauch. Er betrachtete den Monitor, als der einschlief. Schnaufte. »Man soll das ja nicht sagen. Aber Herr Wolter war unausstehlich.« Er blickte Salinger ängstlich an.
Nach einer Weile fügte er hinzu: »Aber deswegen bringt man einen nicht um. Bestimmt nicht.« Die Daumen klopften aneinander. Er wischte über die Tischplatte. »Er war … gnadenlos.« Blickte die Schreibunterlage an, dann Salinger. Sein Blick wanderte zu de Bodt. Aber der zeigte ihm den Rücken. Schien den Schnee zu bestaunen. Große Flocken segelten zu Boden.
»Er war ein Pedant«, sagte der Stellvertreter. »Ein furchtbarer Pedant. Niemand konnte es ihm recht machen. Nein, nein …« Er lehnte sich zurück, stützte die Hände auf die Tischkante. »Er hat nicht rumgeschrien, wie das Idioten tun. Er ist nicht ausgerastet. Aber er hat die Leute fertiggemacht.«
»Und gegenüber Vorgesetzten, wie war er da?«, fragte Salinger. »Unterwürfig?«
»Keineswegs. Er war gefürchtet. Verstrickte die Leute in endlose Debatten. Beharrte auf seinem Standpunkt.«
»Er war stur.«
»Der sturste Mensch, den ich kenne.«
»Aber er hat Karriere gemacht.«
»An seiner Qualifikation gab es keine Zweifel. Ich kenne keinen Menschen, der mehr über Wasser und Wassertechnik wusste. Seine Diplome, Zeugnisse, fachlichen Beurteilungen waren überragend.« Betrübnis im Gesicht. »Menschliche Werte zählen ja eher weniger.«
»Können Sie sich vorstellen, dass ihn jemand aus dem Werk so gehasst hat …«
»Warum sollte man ihn umbringen … Sie meinen doch nicht mich? Weil ich ihm als Leiter nachgefolgt wäre? Ach, du lieber Himmel … ich bin zufrieden … ich hoffe, sie holen einen Nachfolger woanders her. Die Verantwortung … wissen Sie, Wasser … stellen Sie sich vor, jemand würde das Wasser abdrehen.«
»Wie gestern früh?«, fragte de Bodt, ohne sich umzudrehen.
»Wie gestern früh.«
»Woran lag es?« De Bodt lehnte sich mit dem Rücken ans Fensterbrett, blickte ihn an.
»Irgendein Idiot … irgendwer hat im Schaltraum die Hähne zugedreht. Wie das passiert ist, müssen die noch klären. Also die Chefs …«
»Und wenn das zusammenhängt, der Vorfall im Wasserwerk und der Mord an Wolter?«
Der Stellvertreter zuckte die Achseln. »Wie gesagt …«
»Natürlich. Sie müssen das noch klären.«
»Wenn man das Wasser abdrehen will, braucht man …«
»Einen Schlüssel und einen Zugangscode«, sagte der Stellvertreter.
»Wer hat die?«, fragte Salinger.
»Wolter natürlich. Ich habe auch …« Er wurde bleich.
»Zeigen Sie Ihren Schlüssel«, sagte Salinger.
Er zog ein Schlüsselbund hervor. »Der mit der roten Kappe.«
De Bodt nahm den Schlüssel. »Den kann man nicht nachmachen«, sagte er. »Wo bewahren Sie Ihren Zugangscode auf?«
Der Stellvertreter tippte sich an die Schläfe.
»Keine Notiz, wirklich nicht?«
Stirn in Falten. »Auf einem Zettel, versteckt in Zahlen. Nur ich weiß, welche Ziffern es sind.«
»Würde ich auch so machen«, sagte de Bodt. Er fotografierte den Schlüssel mit dem Handy.
»Dürfen Sie das?«
»Ich frage unsere Kollegen von der Spurensicherung, ob sie bei Wolter so einen Schlüssel gefunden haben.«
Der Stellvertreter nickte. »Wenn das so ein Irrer ist … ich möchte Polizeischutz.«
9.
Auf der Rückfahrt ins Präsidium fiel lang kein Wort. De Bodt überlegte, wie es gewesen wäre, hätte er mit Salinger geschlafen. Nachdem sie das letzte Mal im Nest gewesen waren. Sie hatte es gewollt, er wusste es. Er auch. Aber es ging nicht. Vor ihrer Wohnungstür hatte er sie flüchtig geküsst, hatte sich umgedreht und war gegangen. Hatte ihre Blicke im Rücken gespürt. Gewusst, dass sie in der Nacht mehr weinen als schlafen würde. Ihm war jedenfalls zum Heulen gewesen.
Am Tag darauf war sie bleich gewesen, gerötete Augen. Aber sie hatte kein Wort darüber verloren. Bis jetzt nicht. Oberflächlich betrachtet verhielt sie sich wie immer. Manchmal verschlossen, manchmal witzelte sie mit Yussuf. De Bodt begegnete sie freundlich, aber da war etwas zerbrochen. Doch ihn kostete sie so viel Schlaf wie zuvor. Es gab Stunden des Nachts, in denen er sich zuredete. Versuch es doch einfach. Du scheiterst ohnehin. Sie werden dich rausschmeißen, früher oder später. Du legst es immer wieder darauf an. Du provozierst den Kriminalrat, den Polizeipräsidenten mit deiner Arroganz. Die sehnen sich nach dem Tag, an dem du einen Fehler machst. Sie mussten deine Erfolge ertragen. Derzeit konnten sie ihn schlecht rausschmeißen. In den Medien hatten sie sich gepriesen, als er die Attentatserie aufgeklärt hatte. Aber sie kannten die Wahrheit. Dass er sie alle blamiert hatte. Es war nicht das erste Mal gewesen. Umso heftiger die Verbitterung. Der Kriminalrat Dr. Werner Tilly – »ja, wie der aus dem Dreißigjährigen Krieg« – grüßte nur noch knapp, betrat de Bodts Büro nicht mehr, sah ihn auf Zusammenkünften kaum an. Redete nur das Notwendigste. Der Polizeipräsident übersah ihn. Er bereute längst, de Bodt von Hamburg nach Berlin gelobt zu haben. Nur Krüger hatte die Niederlage weggesteckt. Oder Salinger zog ihn mehr an, als de Bodt ihn abstieß.
All das war de Bodt egal.
Sie bremste vor einer Ampel hinter einem Toyota Prius.
»Wenn da niemand das Wasser abgestellt hätte, sähe die Sache ziemlich einfach aus«, sagte Salinger, ohne ihn anzusehen. »Fehlt jetzt noch ein hübsches Zitat. Vielleicht Hegel?«
»Weil der Mensch den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig loswerden kann.«
»Aha.«
»Kant.«
»Mal was anderes.«
Er lächelte sie an. »Vielleicht hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Der Wasserausfall und der Mord.«
»Unwahrscheinlich … gut, gut, der Schein …«
Die Ampel schaltete, sie fuhr los.
De Bodts Handy klingelte. Yussuf.
»Sie haben Wolters Schaltraumschlüssel nicht gefunden«, wiederholte de Bodt für Salinger. »Weder im Büro noch bei ihm zu Hause.«
10.
Unruhige Augen hinter den Brillengläsern. Der Sohn der Concierge saß dem Kommissar gegenüber. Wollte lieber ins Kommissariat kommen. »Macht sich nicht so gut, wenn die Polizei im Laden auftaucht.«
Vor dem Kommissar lag der Bericht der Rechtsmedizin. Ertrunken, in der Badewanne. Vermutlich Donnerstagnacht. Das stimmte mit den Beobachtungen der Concierge überein.
Als deren Sohn sich gerade gesetzt hatte, öffnete sich die Tür. Der Untersuchungsrichter erschien, in seinem Schlepptau ein junger Mann. Fein gekleidet, moderner Haarschnitt. Der Untersuchungsrichter setzte sich neben den Sohn, während der junge Mann nur einen Schritt in den Raum tat.
»Guten Tag, ich bin … Floire …« Beide Daumen in den Gürtel gesteckt. »Jean-Antoine Floire, Ihr neuer Assistent.«
Lebranc beäugte ihn knapp und begrüßte den Untersuchungsrichter mit einem Nicken. Der grinste. Lebranc wusste, was dahintersteckte. Sie würden in den Büros Wetten darauf abschließen, wie lange der Neue bei Lebranc durchhielt. Der letzte Assistent hatte ein knappes halbes Jahr geschafft und war dann nach Lille geflüchtet. Die Kollegen erzählten sich Geschichten, aber natürlich waren die übertrieben. Fand Lebranc, dem das Getratsche nicht entging. Er wusste längst, dass seine Sekretärin die Urheberin vieler Gerüchte war. Bestimmt hatte sie den Neuen schon gewarnt.
»Herr Tribeau, Sie helfen Ihrer Mutter, sie ist Concierge?«
»Wo ich kann. Ist doch selbstverständlich.« Er putzte sich mit einem Stofftaschentuch die Nase.
»Sie programmieren auch den Eingangscode.«
Tribeau nickte. »Das ist zu kompliziert …«
Lebranc musterte den Aktendeckel. Blickte auf. Betrachtete Tribeau. Schlug die Akte auf und blätterte. »Wir haben Fingerabdrücke gefunden.«
»Wo? Meine?«
»In der Wohnung des Ehepaars Meunier.«
»Klar. Ich habe denen mal den Wannenabfluss entstopft.«
»Sie sind Klempner?«
»Nein. Aber ich habe keine zwei linken Hände. Wenn ich Ihnen mal was richten soll …«
»Mein Wohnungstürschloss klemmt«, sagte Floire.
Tribeau blickte sich um. Floire saß halb auf einer Aktenkommode, die Hand in der Hosentasche.
»Gehen Sie mal Kaffee holen«, sagte Lebranc. »Und lassen Sie sich viel Zeit. Nicht im Automat. Gegenüber gibt es eine Brasserie. Mir bringen Sie einen doppelten Espresso, dem Herrn Untersuchungsrichter einen Cappuccino. Und Sie, Herr Tribeau?«
Der schüttelte den Kopf. »Danke, danke!«
Floire lächelte und verließ den Raum.
Lebranc blickte Tribeau an. »Sie hatten Zugang zum Haus.«
Verblüffung in den Augen. »Ich kannte den Code.«
»Hatten Sie Wohnungsschlüssel?«
»Von meiner Mutter. Und den Schlüssel vom Keller.«
»Sonst keinen?«
»Ich verstehe Ihre Fragen nicht. Sie glauben doch nicht etwa …?«
»Was ich glaube, ist egal. Wir müssen jeden befragen, der Zugang zur Wohnung hatte. Und Sie haben immerhin Fingerabdrücke im Badezimmer hinterlassen. An der Badewanne.«
»Hab ich doch erklärt.« Tribeau schnäuzte sich wieder. Faltete das Taschentuch, wischte sich die Stirn.
Lebranc zog einen Ordner von der Schreibtischecke auf die Akte der Rechtsmedizin. Öffnete den Deckel. Las. Blickte Tribeau eine Weile an.
Die Tür wurde aufgestoßen, Floire trat ein, den Blick auf dem Handy.
Lebranc blickte ihn an. »Sie wollten …«
»Ich sollte. Kommt gleich.«
Lebranc überlegte, wie er ihm unter Einhaltung der Dienstvorschriften in den Arsch treten könnte. Entschied aber, dass ein Doppelmord erst mal wichtiger war. Gelegenheiten finden sich. Er blätterte in der Akte der Kriminaltechnik, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Sie sind der Einzige, der Zugang zu den Wohnungsschlüsseln und dem Code hatte. Außer Ihrer Mutter.«
Klopfen an der Tür. Laut. Herein kam ein junger Mann mit einem Tablett. Pappbecher mit Deckel. Dazu Tüten mit Zucker. Auf dem T-Shirt stand Fuck off.
»Ich hab auch Süßstoff dazulegen lassen. Sie sind eingeladen. Betrachten Sie es als meinen Einstand«, sagte Floire mit dem freundlichsten Lächeln im viel zu jungen Gesicht.
Die Sekretärin öffnete die Zwischentür zum Vorzimmer, ohne vom Stuhl aufzustehen. Betrachtete die Szene, schüttelte den Kopf und schloss die Tür.
Lebranc saß starr und sagte kein Wort.
Der Untersuchungsrichter lächelte. »Stellen Sie die Becher auf den Tisch.« Er zeigte zum Besprechungstisch. Der Mann tat es. Auf der Rückseite des T-Shirts stand Piss off the cops. Der Mann hob den Daumen und verließ den Raum.
Lebranc hätte es nicht erstaunt, der Typ hätte den Mittelfinger gewählt. Gut, Floire, wenn du es so spielen willst.
»Wer hatte noch Zugang zum Code?«
»Niemand … soviel ich weiß.«
Lebranc ärgerte sich. Das hatte er die Mutter nicht gefragt. »Keine Verwandten, Freunde?«
»Ihre Schwester Thérèse, sie treffen sich manchmal. Sie wohnt in einem Altenheim im 10. Arrondissement.«
Lebranc wechselte einen Blick mit dem Untersuchungsrichter. Der holte den Espresso für den Kommissar und den Cappuccino für sich. Floire hatte sich schon bedient. Natürlich trank das Bürschchen einen Macchiato aus einem Glasbecher. Diese Milchbrühe, welche die Italiener für ihre Kinder erfunden haben.
»Haben Sie Kontakt zu Verwandten?«, fragte Floire.
Lebranc erschoss ihn mit einem Blick. Sah den Blutfleck sich weiten auf der Weste des Dreiteilers. Sie saßen perfekt. Dreiteiler und Herzschuss.
Tribeaus Augen flatterten. Er wandte den Blick zu Floire. »Ja, einen Bruder, Jean, und eine Schwester, Amélie.«
»Und wo wohnt Ihr Bruder?«, fragte Floire.
»In Meudon.«
»Ist ja nicht so weit. Und was ist er von Beruf?«
»Er arbeitet bei Monsieur Minute.«
»Das ist diese Kette, die man in Supermärkten findet. Ich kenn die von meinem Super U.« Plauderton.
»Genau.« Tribeau nickte.
»Er ist Fachmann für Stempel, Schuhe auch?«
»Genau.«
»Und Schlüssel.«
»Unbedingt.«
»Wann hat er Ihre Mutter zum letzten Mal besucht?«
»Weiß ich nicht.«
»Weil Sie sich mit Ihrem Bruder nicht so gut verstehen?«
Tribeau wandte den Blick zu Lebranc. Massierte sich das Genick. Wandte sich wieder ab. »Leider.«
»Und Ihre Mutter sagt es Ihnen nicht, wenn er sie besucht.«
Er nickte.
»Sie verhindert, dass Sie Ihren Bruder bei ihr treffen.«
»Ich besuche meine Mutter nur, wenn Sie mich darum … bittet.«
»Und Ihre Schwester?«
»Wohnt in Deutschland, hat da geheiratet. In Hannover.«
»Ich habe Sie doch nach Verwandten gefragt, und Sie haben nur Ihre Tante genannt«, giftete Lebranc.
»Sie hatten nach Freunden gefragt.«
Lebranc blickte ihn streng an. »Herr Tribeau, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, haben Sie ein Problem.«
»Ich sag die Wahrheit.« Ein Jammerton in der Stimme.
»Ich weiß«, sagte Floire freundlich. »Sie haben sich mit Ihren Geschwistern zerstritten …«
»Mit meinem Bruder. Nur mit dem.«
»Warum?«
»Als mein Vater starb …«
»Geld?«
Tribeau nickte.
»Ihr Bruder könnte Schlüssel nachmachen?«
»Natürlich.«
Lebranc beschloss, Floire den Kopf abzureißen. Am besten noch am Abend. Spätestens morgen. Er schlug noch einmal den Bericht der Kriminaltechnik auf. Das Wohnungsschloss unbeschädigt. Nur die Kratzer, die mit der Zeit entstanden, wenn Leute das Schloss nicht gleich trafen. Der Türrahmen, die Tür, nichts zeugte von einem Einbruch. Die Fenster waren von innen geschlossen.
»Wer ist denn Ihr bester Freund?«, fragte Lebranc und kam sich gleich blöd vor. »Lassen wir das. Gehen Sie nach Haus, Herr Tribeau.«
»Der Herr Kommissar sucht zwei Leute, mindestens zwei, weil einer kaum zwei Leute in einer Badewanne ertränken kann. Außer er ist Superman, aber der ertränkt ja keine Leute«, sagte Floire.
Tribeau blickte den Boden an, dann die Decke, schaute irgendwohin. »Was …?«, fragte er, stellte die Frage aber nicht.
Carlo blickte sich lächelnd um, was Lebranc erst recht auf die Palme brachte. Er schob die beiden Ordner zur Seite, erhob sich. »Gehen Sie«, sagte er zu Tribeau. Und verließ das Büro. Ging zur Toilette, pinkelte, wusch sich die Hände. Eine Weile starrte er sein Spiegelbild an. Sah die Falten, die grauen Haare, die sich unter die schwarzen Stoppeln mischten. Er wurde alt, seine Nerven verrotteten noch schneller. Er wusste es, aber das Wissen half ihm nichts. Es war demütigend. Er ließ sich schon von einem Bengel aus dem Konzept bringen. Häufte Fehler auf Fehler.
Wusch sich die Hände, strich sich durch die Haare, trocknete die Hände und kehrte zurück. Floire und Carlo unterhielten sich über St. Germain, dieses von einem Scheich ausgehaltene Kickerbordell.
Lebranc hatte sich noch nicht hinter seinen Schreibtisch gesetzt, als Carlo sagte: »Ich wollte nur mal hören, wie der Stand der Dinge ist.«
»Ich verfluche Napoleon, er hat Frankreich verhasst gemacht, konnte den Hals nicht vollkriegen vom Gemetzel, hat den Krieg auch noch verloren. Und das Schlimmste, er hat …«
»… den Untersuchungsrichter erfunden«, fiel Carlo ein.
»Der nur dem lieben Gott verantwortlich ist«, sagte Lebranc.
Immerhin hielt Floire die Klappe. Als hätte er gewusst, dass jedes weitere Wort seinen Tod nur beschleunigte.
»Hast du die Berichte bekommen?«
Carlo nickte.
»Mehr weiß ich auch nicht.«
»Er war Chef des Wasserwerks in Saint-Cloud.«
11.
Uhlenhorst stand am großen Tisch im KT-Büro. Seine Augen hetzten über die Tischplatte. An der Decke Strahler. Sie beleuchteten in Plastiktüten verpackte Teile. Nummeriert. Nur eine kleine gelbe Tube lag tüten- und nummernlos am Tischrand.
»Habt ihr was?«, fragte de Bodt.
Salinger stellte sich neben ihn.
»Wenn ihr so was meint wie Fingerabdrücke, Haare, DNS-Spuren …« Er warf Luft weg. Uhlenhorst beäugte die beiden. Er hatte was mitgekriegt. Vor einiger Zeit. Hatte erlebt, wie Salinger um das Leben ihres Chefs kämpfte. Das eigene riskierte. Man musste schon blind, taub sein und blöd dazu, um das nicht zu verstehen.
Uhlenhorst deutete auf die Tube. »Ist die wichtigste Spur, schätze ich.«
Salinger blickte ihn neugierig an. Am liebsten hätte sie ihn nach Exfrau und Töchtern gefragt, aber vermutlich wollte Uhlenhorst den Irrsinn schnell vergessen. Nicht dran rühren. »Das ist Klebstoff.«
»Genau«, sagte Uhlenhorst, ohne den Blick von der Tube zu wenden. »Der schönste Name für das Zeug ist Atomkleber. Wenn du den an die Finger kriegst, hast du ein Problem. Den kriegst du nur mit der Haut ab.«
»Ja, und?«
Uhlenhorst deutete auf einen kleinen Beutel neben der Tube. Nummer 14. »Reste von Atomkleber. Wir haben den Wannenabfluss nur mit Gerät aufgekriegt. Und den Stöpsel zerstören müssen. War mit dem Zeug verklebt.«
»Deswegen hat die Wanne tagelang dicht gehalten.«
»Deswegen«, sagte Uhlenhorst.
»Das heißt, die Täter haben zuerst den Stöpsel verklebt. Dann haben sie vermutlich Herrn Wolter gezwungen, sich in die Wanne zu legen. Danach Frau Wolter. Um schließlich Wasser einlaufen zu lassen.«
»Und wie haben sie die Wolters gezwungen, unter Wasser zu bleiben? Wir haben keine Spuren von Gewalt gefunden.«
»Vielleicht findet die Zander noch was«, sagte de Bodt.
»Was?«, fragte Salinger.
»Ein Betäubungsmittel. Midazolam oder so was.«
»Midazolam«, sagte die Zander. Sie hatte Espresso zubereitet. Es war wie eine religiöse Zeremonie. Die Tässchen vorgewärmt auf dem Gerät. Sie bewunderte die Maschine, während sie brummte und zischte. Als wäre sie neu. Wischte am Ende die Düsen mit Mikrofasertuch ab.
Salinger warf einen Blick auf de Bodt. Dann nippte sie an ihrem Espresso und hörte der Zander zu.
»Wenn man jemandem dieses Zeug gibt, als Tablette oder Injektion, dann macht der jeden Mist mit. Hängt nur von der Dosis ab. Ich habe in der Armbeuge Einstiche gefunden. Wer es gemacht hat, traf die Vene übrigens im ersten Versuch. Bei ihr war das nicht einfach. Da hätte auch ich so meine Schwierigkeiten gehabt. Aber vielleicht hatte der Mörder einfach nur Glück.«
»Wie haben wir uns die Tat vorzustellen?«, fragte de Bodt.
»Meiner Meinung nach so: Der oder die Täter haben den Wannenabfluss abgedichtet …«
»Bestätigt Uhlenhorst«, sagte de Bodt.
»Schön, dass der wieder auf den Beinen ist. Ich habe ja gefürchtet, der kommt nicht zurück aus der Psychiatrie. Also, Badewanne … dann haben sie den Mann gezwungen, sich in die Wanne zu legen. Vorher haben sie vielleicht etwas warmes Wasser eingefüllt. Es folgte die Injektion.«
»Also erst ins Wasser, dann Spritze?«, fragte Salinger.
»Beschwören würde ich es nicht. Aber das Zeug wirkt extrem schnell, wenn es injiziert wird.«
»Und er hat sich nicht gewehrt gegen die Spritze?«, fragte Salinger.
»Wohl nicht körperlich«, erwiderte die Zander.
»Vielleicht haben sie seine Frau bedroht«, sagte de Bodt.
»Vermutlich.«
»Vielleicht war es doch nur einer«, sagte de Bodt.
»Vielleicht.« Die Zander schniefte und leerte ihre Tasse. »Aber das ist riskant. Auch wenn es keine Kampfsportler sind, allein zwei Leute zu kontrollieren … na ja …«
»Gut«, sagte de Bodt. Er zähmte seine Ungeduld. »Sie haben Wolter gezwungen, in die Wanne zu steigen. Und weil die Täter nette Menschen sind, haben sie vorher warmes Wasser eingefüllt, sodass er es angenehm hatte …«
»Er konnte sich einbilden, dass die Typen pervers waren, Spielchen machen wollten. Was man sich so einbildet, wenn man in der Scheiße steckt und keine Wahl hat«, sagte Salinger. »Und sie haben seiner Frau eine Waffe an den Kopf gehalten …«
»Irgend so etwas«, erwiderte die Zander. »Das Problem ist, dass wir außer den Einstichen keine Spuren haben. Es gibt Druckspuren, aber nur dort, wo sich die Körper berührt haben. Hätte ein Täter am Arm fest zugedrückt, wir würden was finden. Nein, die haben die Opfer behandelt wie chinesisches Porzellan.«
»Was heißt, Wolter hat sich in die Wanne gelegt, einer der Täter hat ihm die Spritze gesetzt, der andere hat die Frau bedroht, ohne sie hart anzufassen«, sagte Salinger.
»So in etwa.« Die Zander nickte.
»Dann haben die noch mehr Wasser eingelassen, und die Frau musste in die Wanne. Ich vermute, die haben sie vorher gezwungen, eine Dormicum-Pille zu schlucken. Mit dem Zeug kann man die Leute in eine Art Hypnoseschlaf versetzen. Und dann die Spritze …«
»Dormicum?«, fragte Salinger.
»So heißt das Präparat, der Wirkstoff ist Midazolam.« Sie winkte ab. »Noch einen?«
Beide schüttelten den Kopf. Die Zander zögerte, schnaufte und sagte: »Schließlich haben sie die Wanne mit Wasser gefüllt. Ich vermute, sie haben den Kopf der Frau unter Wasser gehalten. Ihr Widerstand dürfte nicht heftig gewesen sein. Sie war so gut wie bewusstlos.«
»Druckspuren am Hinterkopf?«, fragte Salinger.
»Die Haare polstern es ab. Und wie ich unsere Freunde kenne, trugen sie weiche Handschuhe oder haben ein Frotteetuch benutzt, um zu drücken.« Die Zander schniefte noch mal. »Dieser Fall ist absurd. Viel Spaß damit.« Sie blickte sehnsüchtig auf ihre Kaffeemaschine. »Vielleicht doch …«
»Warum macht einer so was?«, fragte Salinger.
12.
Eine Schlosserwerkstatt in einem baufälligen Schuppen. Teerpappe auf dem Dach, Efeu an der Klinkermauer. Der Schuppen lehnte sich an ein Haus mit fleckiger Fassade und moosbewachsenem Schieferdach. Als würde er umfallen ohne Stütze. Marcel Tribeau war kleiner als sein Bruder. Sehnig. Nervöse Augen misstrauten dem Kommissar.
»Warum laden wir den nicht vor. Hätte uns den Weg nach Meudon erspart«, hatte Floire gefragt. Das Kaff lag an der Pariser Peripherie. Durchgangsstraße, Bäcker, Metzger, gefühlte zehn Immobilienagenturen und zwanzig Banken. Schmale Bürgersteige. Autos parkten am Straßenrand.
»Ich will mir anschauen, wie der Mann lebt«, hatte Lebranc erwidert. Das war die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte: Ich will raus aus dem Bullenbetrieb. Dauernd steckte jemand seine Nase ins Büro. Das Telefon klingelte pausenlos. Der Pressesprecher des Präsidiums rief alle Stunde an, weil die Journalisten Lunte gerochen hatten. Der Badewannenmord. Mal was anderes. Dazu: Polizei ratlos. Und weil Le Figaro und die anderen Scheißblätter sich auf den Fall stürzten wie Fliegen auf Mist, genauso das Radio, die privaten TV-Sender und auch France 2. Der Innenminister wurde nervös.
Floire steuerte den Peugeot 508 lässig.
»Was verrät die Methode über die Täter?«, fragte Lebranc.
Floire trat aufs Gas und überholte einen Lieferwagen. »Er hat eine Botschaft hinterlassen.«
»Aha.«
»Ich frage mich nur, welche.«
»Die haben den Chef des Wasserwerks in Saint-Cloud in der eigenen Badewanne ertränkt. Scheint was mit Wasser zu tun zu haben. Könnte aber auch Zufall sein. Das ist Spekulation. Wichtiger: Wie sind die in die Wohnung gekommen?«
»Die hatten den Code«, sagte Floire.
»Was Sie so alles wissen.«
»Wie sonst?«
»Was geschieht, wenn eine Concierge einen neuen Code eingibt und dann einen Herzinfarkt kriegt?«
»Dann hoffen wir zuerst, dass sie überlebt.«
Lebranc musterte ihn. Wollte der Typ ihn verarschen? Oder war er doch blöd? »Nein, sie stirbt gleich. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind hier der Chef. Fällt Ihnen dazu was ein?«
»Ich bin aber nicht der Chef.«
»Wenn Sie so weitermachen, werden Sie’s auch nie.«
»Ach, wenn ich weiter von Ihnen lerne … also, ich bin immer optimistisch.«
»Dann will ich Ihnen mal helfen: Wenn die Concierge tot umfällt, dann kommen die lieben Leute nicht mehr in ihr Haus und in ihre Wohnungen. Irgendein Schlaumeier, und das wären dann nicht Sie, käme auf die Idee, sich an die Firma zu wenden, die das Schließsystem eingebaut hat. Weil die bestimmt einen Notfallcode oder so was haben.«
»Stimmt«, sagte Floire und nickte beifällig. Als hätte der Kommissar eine verzwickte Prüfungsfrage beantwortet.
»Haben Sie sich da schon kundig gemacht?«
»Sie sind Fachmann für Schlösser, Schlüssel …«, sagte Lebranc.
Marcel Tribeau blickte ihn an. »Ich arbeite bei Monsieur Minute«, erwiderte er endlich.
»Sie haben die Frage des Kommissars nicht beantwortet«, schnauzte Floire.
»Sie haben zu viele Schwarz-Weiß-Krimis im Fernsehen gesehen, mit Lino Ventura und Jean Gabin«, sagte Lebranc zu Floire. »Gehen Sie mal spazieren und entspannen Sie sich.«
Floire schien nicht überrascht, zuckte die Achseln, lächelte und schloss die Holztür von außen.
»Wir haben auch immer Probleme mit dem Nachwuchs«, sagte Tribeau. »Die jungen Leute haben nur Flausen im Kopf, wissen alles besser …«
»Wir kriegen den schon hin«, erwiderte Lebranc. »Sie wissen, warum wir hier sind.«
»Und ich habe eine Vorstrafe«, sagte Tribeau. »Hat Ihnen mein Bruder auch schon gesagt, jede Wette.«
Lebranc schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht in den Akten gegraben. Wegen was?«
»Jugendsünde. Einbruch bei einem Juwelier.«
»Mit einem falschen Schlüssel?«
»Mit einer Spielzeugpistole.«
»Ist so einfacher.«
»Wie man’s nimmt.«
»Und warum wurden Sie gefasst?«
»Der Kumpel hat’s dem falschen Hehler angeboten.«
»Man kann sich auf niemanden verlassen.«
»Hat mich fast drei Jahre gekostet.«
Floire kehrte zurück, kaute auf irgendetwas herum.
Lebranc musterte ihn, aber er wandte sich an Tribeau. »Ihr Bruder hat Ihrer Mutter geholfen, den Türcode zu ändern.«
Tribeau steckte die Hände in die Taschen seines Blaumanns. »Kann sein.«
»Ihre Mutter oder Ihr Bruder haben sich nie an Sie gewandt wegen eines Problems mit der Torsicherung?«, fragte Floire.
»Raus«, sagte Lebranc. Äußerlich ruhig.
Floire hob die Hände, als wollte er kapitulieren. Er blickte den Kommissar fragend an und trat ab, als der nichts weiter sagte.
Tribeau grinste flüchtig. »Nein, haben sie nicht.«
»Aber Sie hatten Zugang zum Schlüsselschrank und zur Torsicherung, wenn Sie Ihre Mutter besucht haben.«
»In letzter Zeit haben wir uns irgendwo getroffen. Ich wollte nicht zu ihr.«
»Warum nicht?«
»Ich habe sie getroffen, wenn ich geschäftlich in Paris war. Ware abholen oder so. Dann habe ich sie in ein Restaurant eingeladen.«
»Seit wann haben Sie ihre Wohnung nicht mehr betreten?«
»Zwei Jahre, mindestens. Eher drei.«
»Sie wollten Ihren Bruder nicht treffen.«
»Auf den hab ich keine Lust.«
»Sie wüssten, wie man in das Haus kommt …«
»Wo meine Mutter arbeitet?«
Lebranc nickte.
»Ohne Code und ohne zu klingeln?« Als der Kommissar wieder nickte: »Nein, wüsste ich nicht.«
13.
»Wenn wir das zusammenfassen, haben wir nichts«, sagte Salinger.
»Außer unserer Fantasie«, sagte de Bodt.
»Und das von dir? Fantasie statt Fakten?« Salinger lachte, erstickte die Gemütsregung aber gleich wieder.
»Nein«, erwiderte de Bodt, »mir geht’s um ›die Erhebung der Vernunft mit den Flügeln der Fantasie‹.«
»Sag ich auch immer«, erklärte Yussuf, während er sein Handy befummelte. »Wer hat mir den Spruch geklaut? Vielleicht kann ich den verklagen.«
»Mr. Hume, der ist aber schon eine Weile tot«, sagte de Bodt.
»Mist, muss ich weiter in Blut und Hirnmasse waten.«
Salinger zeigte ihm die Faust. »Was sagt uns denn die Fantasie?«
»Dass wir nachdenken sollten, warum ein Ehepaar auf diese Weise in einer Badewanne ertränkt wird …«
»Wegen des Schlüssels für den Schalterraum«, erwiderte Yussuf.
»Denk nach«, sagte de Bodt. Er saß auf dem Stuhl neben dem Eingang und schien die Decke zu inspizieren.
»Finde ich ziemlich nervig«, sagte Yussuf.
»Wir wissen, dass jemand im Schalterraum den großen Wasserhahn zugedreht hat«, sagte Salinger. »Wir wissen, dass Wolters Schlüssel fehlt. Daraus schließen wir, dass die Täter ihn von Wolter haben. So viele Schlüssel gibt’s nicht …«
»Sieben«, sagte Yussuf.
»Das wissen wir bereits«, erwiderte Salinger.
»Ist ja gut.«
»Wir wissen aber nicht, warum die Täter die Wolters nicht einfach umgebracht haben, sondern …«
»Ich weiß, ich weiß. Es ist eine Botschaft.«
»Sehr gut. Du machst Fortschritte.«
Yussuf rümpfte die Nase.
»Wir wissen aber nicht, was für eine Botschaft das ist und an wen sie sich richtet.«
»Das überlassen wir unserer … nein, der Fantasie unseres Chefs.«
De Bodt erhob sich, nahm seine Aktentasche vom Schreibtisch und ging. »Tschüss!« Die Tür schloss sich. Salinger und Yussuf blickten sich an, dann arbeiteten sie weiter.
Zu Hause setzte er sich aufs kleine Sofa, das er billiger gekriegt hatte. Mängelware. Auf dem Tisch lagen Briefe. Sie stammten vom Familiengericht Hamburg. Scheidungstermin. Dazu Briefe von Elviras Anwalt, der angeblich ihr gemeinsamer Rechtsbeistand war. Einvernehmliche Scheidung nach einem Trennungsjahr. Er überflog die Briefe, faltete sie zusammen und legte sie unter den Tisch. Blätterte in den Zeitungen, die sich in den letzten Tagen stapelten. Die Schlagzeilen und Berichte machten ihn müde. Hoffnungslos. Der Pöbel bestimmte die Schlagzeilen. Aber die Wirtschaft wuchs. Ein trübsinniger Aufschwung.
Er ging in die winzige Küche. Sie bestand aus einer Küchenzeile. Das Buchenholzfurnier war vergilbt, der schwarz-weiße Kachelboden mit Flecken gesprenkelt. Neben der Spüle ein Billigküchenherd aus Emaille, die einmal weiß gewesen war. Vier Kochplatten, angerostet. Links der Spüle der Kühlschrank, dessen Motor nur noch ächzte und ungefähr die Hälfte von Berlins Strom fraß. Aber de Bodt besaß einen Vorrat von Grüntee, einen Wasserfilter und eine Teekanne. In der wartete der dritte Aufguss vom Frühstück.
Mit der Teekanne und einer Tasse kehrte er zurück ins Wohnzimmer. Immerhin ahnte er jetzt, was ihn so verstimmte. Da foppte ihn jemand, als wüsste er genau, was de Bodt hasste. Warum ertränkten diese Scheißkerle ein Spießerpärchen, um ein Rätsel zu stellen? Warum sagten sie nicht, was sie wollten? Geld, den Rücktritt des Sparkassenpräsidenten, zehn Minuten Sendezeit auf RTL 2. Oder war es ein Witz, über den nur Perverse lachen konnten? Obwohl es keinen Beweis gab, die Täter hatten das Wasser abgestellt. Er begriff es immer noch nicht. Warum dann die Mordinszenierung, wenn sie nur den Schlüssel wollten? Sie waren nachts oder am frühen Morgen ins Wasserwerk eingedrungen und hatten das Wasser abgedreht. Niemand hatte sie gesehen. Warum das Wasser abdrehen, wenn in der Mordinszenierung eine Botschaft steckte? Wenn überhaupt, welche Botschaft?
Er nippte am Tee. Sie sagten nicht, was sie wollten. Sie hatten ein Zeichen gesetzt, dessen Sinn niemand erkannte. Auch die Journalisten hatten gerätselt oder sich gleich jede Auslegung erspart.
Vielleicht genügte den Tätern das Zeichen nicht. Vielleicht bestand das Zeichen auch aus mehreren Taten. Hatte es in letzter Zeit einen Fall gegeben, der zum Badewannenmord passte? Nein, ein Mann in Marzahn hatte im Suff seine Frau erschlagen. Ein Dealer aus Somalia starb bei einer Messerstecherei in Kreuzberg. Und das Zufallsopfer einer Schießerei zwischen libanesischen Banden hatte genauso wenig zu tun mit einem Zeichen. Wenn es in der Vergangenheit nichts gab, würden womöglich weitere Taten folgen. In seinem Kopf setzte sich der Gedanke fest, dass die Botschaft aus mehreren Akten bestehen würde. Wie ein Theaterstück. Und erst am Ende würde sich alles auflösen. Wenn es so sein sollte, würde es weitere Opfer geben.
Er saß und trank seinen Tee. Dachte an Salinger. Verdrängte die Finsternis, in die seine Seele tauchen wollte. Schob die Briefe mit dem Fuß ein Stück weiter unter den Tisch. Dachte an Salinger, die so wenig mit ihm klarkam wie er mit ihr. Hätte am liebsten eine Flasche Wodka weggekippt, um zu vergessen. Versuchte seine Töchter zu vermissen. Blickte er in die Zukunft, sah er ein schwarzes Loch. Und wenn er es doch mit ihr versuchte?
Er ging früh zu Bett. Sein Schlafzimmer war winzig. Neben dem Bett so viel Platz, dass er gerade hineinsteigen konnte. Am Fußende streifte die Tür fast das Gestell. Am Kopfende ein kleines Fenster, davor ein verschlissenes Rollo. Er las in einem Roman. Wusste aber nicht, warum er das Buch nicht weglegte. Oder ein anderes las. Nach einer guten Stunde hatte er genug. Er löschte das Licht.
Wir hätten noch mal ins Wasserwerk gehen müssen, dachte er. Ein Fehler.
In diesem Augenblick hörte er einen dumpfen Schlag. Weitab, wie ein Echo. Kurz darauf wackelte der Boden. Wie bei einem Erdbeben.
14.
»Wenn wir im Büro sind, arbeiten Sie die Akte durch. Wir suchen Leute, die Zugang zum Haus haben oder hatten. Sie laden alle Mieter ins Präsidium. Morgen früh finden Sie als Erstes die Firma, welche die Sicherheitsanlage eingebaut hat.«
Floire hielt seinen Blick auf der Straße. Sie hatten auf der Rückfahrt bis jetzt kein Wort gewechselt. Lebranc hatte keine Lust, den Idioten zu belehren. Verschwendete Zeit. Manche kamen als Idioten zur Welt und waren zeitlebens stolz, Idioten zu bleiben. Floire war ein Sprössling dieser Gattung.
»Klar, Chef.«
Lebranc blickte ihn nicht einmal an.
Gewerbegebiete, Bistros, Bars, Tankstellen. Die Fassaden heruntergekommen. Dazwischen Betonbauten neueren Datums. Supermärkte. Ödnis. Abwechslung brachten nur die Wälder am Rand.
Sie hatten zwei Leichen, eine Mordinszenierung und einen Ausfall der Wasserversorgung im 16. Arrondissement. Wenn auch nur kurz. Das war ihnen erst später gemeldet worden. Zählte man eins und eins zusammen, gab es ebenso viele Erklärungsmöglichkeiten. Bisher. Entweder die Täter hatten eine Rechnung mit den Meuniers offen. Oder es war der Auftakt von Serienmorden. Eine dritte Möglichkeit hielt er für ausgeschlossen. Dass die Täter Wahnsinnige waren, Perverse oder was auch immer. Dafür war die Tat zu gut geplant und ausgeführt worden.
Nur das Motiv. Was, verdammt, wollten diese Arschlöcher? Was für einen Sinn hatte dieses Verbrechen? Mord war immer sinnvoll. Aus der Sicht des Täters. Um Rache zu üben, Eifersucht abzureagieren, um zu strafen. Eine Mordinszenierung ohne Sinn? Nein, dachte Lebranc.
»Was ist das Motiv? Da müssen wir ansetzen«, sagte Floire.
»Sie setzen gar nichts an. Sondern mich zu Hause ab, bevor Sie ins Büro zurückkehren. Bis dahin halten Sie die Klappe.«
Der Verkehr wurde dicht. Sie unterquerten den Boulevard Périphérique. Lebranc hasste den Dauerstau auf den Umgehungsstraßen von Paris. Die Autobahnen waren mit Blech vollgestopfte Betonmonster. Bis in alle Ewigkeit.
Sie quälten sich ins Zentrum.
An der Métrostation Porte de Versailles sagte Lebranc: »Halten Sie mal an.«
Floire warf ihm einen Blick zu und bremste in der zweiten Reihe. Sofort begann das Gehupe.
»Sie nehmen die Métro«, sagte Lebranc.
15.
Als er die erste Sirene hörte, lief de Bodt los. Er hatte es nicht weit. Musste nur den Einsatzwagen folgen. Er sah den Schein der Blinklichter von Polizeiautos und Ambulanzwagen schon von Weitem. Stolperte auf einer festgetretenen Schneeinsel. Vom Himmel fiel dickflockig Nachschub. Als er die Schlesische Straße querte, ahnte er, was geschehen war. Er atmete schwer, schwitzte. Wischte sich Schneewasser von der Stirn. Fror. Die Oberbaumstraße war gesperrt. Ein Hubschrauber flappte, der Lichtkegel schwenkte über die Brücke. Weißes Licht. Der Schnee wurde dichter.
Am Absperrband kramte er seinen Dienstausweis hervor und hielt ihn dem Beamten hin. Der warf einen flüchtigen Blick drauf und hob das Band. Nach ein paar Metern erstarrte de Bodt.
Die Oberbaumbrücke war in die Spree gestürzt. Mitsamt einem U-Bahn-Zug, Autos, Radfahrern und Fußgängern. Die schmutzig-gelben Wagen der U1 lagen verkantet über- und nebeneinander. Dazwischen Autowracks. De Bodt erkannte das Dach eines Taxis, die Leuchte brannte. Unter Wasser im Scheinwerferlicht ein roter Škoda, darauf ein Fahrrad. Beton- und Steinbrocken. Er hörte Leute schreien. Irgendwo knarzte ein Funkgerät. Boote der Wasserpolizei suchten nach Überlebenden.
»Um Himmels willen«, sagte sie und legte ihre Hand auf seinen Unterarm. Sie war nass von Schweiß und Schnee. Die Haare verklebt. In den Augen spiegelte sich die Orgie aus Scheinwerfern und Alarmlichtern. Und Angst.
Salinger lehnte sich an ihn. Er nahm sie in den Arm. Sie starrten ins Inferno.
Wie in einer anderen Welt.
De Bodt erkannte den Wagen der Einsatzleitung. Der Polizeipräsident gestikulierte. Drei Männer hörten ihm zu, sagten etwas, woraufhin der Präsident die Arme hob. Seine Hände malten einen Halbkreis in den Himmel. Im Gesicht Leere.