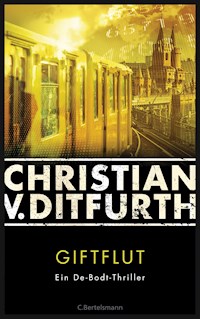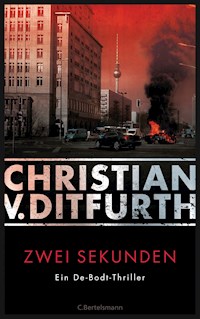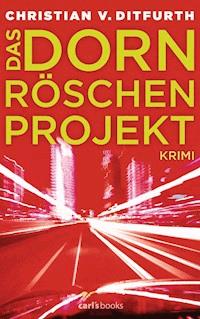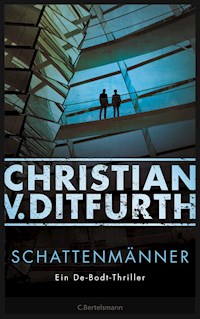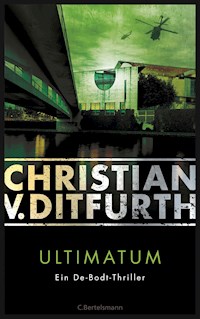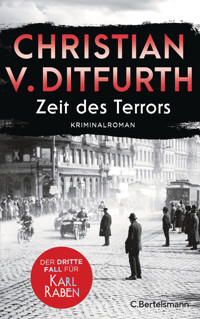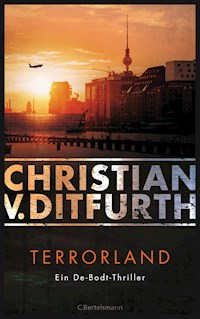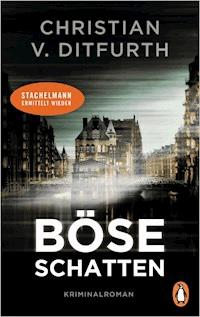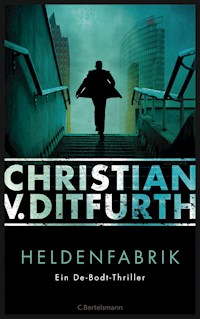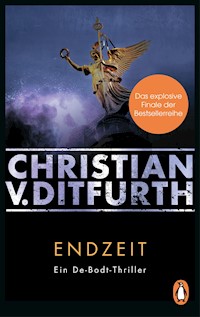
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar de Bodt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der 7. Fall für Eugen de Bodt – »Jeder Thriller dieser Serie ist ein Politthriller der Extraklasse« (HR 2, »Krimi mit Mimi«)
Panik in Berlin: Ein Mörder tötet philippinische Dienstmädchen aus saudi-arabischen Diplomatenhaushalten. Und während de Bodt ermittelt, sprengt jemand die Kreuzberger Moschee in die Luft. Es folgt ein Anschlag auf de Bodts Wohnung. Doch der Kommissar lässt sich nicht einschüchtern. Er stellt sich tot und ermittelt weiter. Hinter allem scheint der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zu stecken. Plant er einen Militärschlag gegen den Iran? Die Saudis drehen den Ölhahn auf, Russland und Iran geraten in Not. Die Börsen brechen ein. In seinem letzten Fall muss Eugen de Bodt verhindern, dass die Welt aus den Fugen gerät.
»Ditfurth liefert Action mit Anspruch. Die beste Art, einen klugen Politthriller zu schreiben.« Westdeutsche Zeitung (über »Ultimatum«)
Entdecken Sie die weiteren Bänder der De-Bodt-Reihe:
1. Heldenfabrik
2. Zwei Sekunden
3. Giftflut
4. Schattenmänner
5. Ultimatum
6. Terrorland
7. Endzeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christian v. Ditfurth
ENDZEIT
Ein De-Bodt-Thriller
C. Bertelsmann
Dieses Buch ist ein Roman und kein Tatsachenbericht. Das Beschriebene hat sich so nicht ereignet. Trotz der vom Autor in künstlerischer Freiheit gewählten fiktiven Handlungsabläufe mögen im Einzelfall Anklänge an Verhaltensweisen lebender oder verstorbener Personen oder an öffentlich bekannte Unternehmen nicht immer vermeidbar gewesen sein; dies ist aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfassend geschützt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das Zitat stammt mit freundlicher Genehmigung aus: Bertolt Brecht, Leben des Galilei, in: ders., Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 5: Stücke 5.© Bertolt-Brecht-Erben / Suhrkamp Verlag 1988.
Copyright © 2021 C. Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Claudia Alt
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur gsk GmbH, Hamburg
Coverabbildungen: © Damien Aubert/EyeEm/Getty Images; © Jose A. Bernat Bacete/Getty Images; © Westend61/Getty Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24449-1V003
www.cbertelsmann.de
Zu diesem Buch
Der 7. Fall für Eugen de Bodt – das große Finale der »Krimi-Reihe mit Suchtfaktor« Ruhr Nachrichten
Panik in Berlin: Mörder töten philippinische Dienstmädchen aus saudi-arabischen Diplomatenhaushalten. Währendde Bodt ermittelt, sprengt jemand die Kreuzberger Moschee in die Luft. Es folgt ein Anschlag auf de Bodts Wohnung. Doch der Kommissar lässt sich nicht einschüchtern. Er stellt sich tot und ermittelt weiter. Hinter allem scheint der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zu stecken. Plant er einen Militärschlag gegen den Iran? Die Saudis drehen den Ölhahn auf, Russland und Iran geraten in Not. Die Börsen brechen ein. In seinem letzten Fall muss Eugen de Bodt verhindern, dass die Welt aus den Fugen gerät.
Weitere Informationen über dieses Buch: www.cditfurth.de
Zum Autor
CHRISTIAN V. DITFURTH, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. Neben Sachbüchern und Thrillern wie »Der 21. Juli« und »Das Moskau-Spiel« hat er Kriminalromane um den Historiker Josef Maria Stachelmann veröffentlicht. Seit 2014 ermittelt Eugen de Bodt erfolgreich. »Endzeit« ist der siebte und letzte Band der preisgekrönten Reihe.
»Jeder Thriller dieser Serie ist ein Politthriller der Extraklasse.«HR 2, »Krimi mit Mimi«
»Ditfurth hat mit Eugen de Bodt einen Ermittler kreiert, der aus der Masse der literarischen Kommissare heraussticht.« NDR Info zu »Schattenmänner«
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook
Für Chantal
Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen.
Bertolt Brecht
Prolog
De Bodt hatte seinen Dienstausweis in der Hand. Ihm folgten Salinger und Yussuf. Bis de Bodt Yussuf rausschickte. »Schau dich um. Vielleicht bestaunt der Täter sein Kunstwerk.« Es war mehr ein Vorwand, um Yussuf den Anblick zu ersparen. Die Moschee war in sich zusammengebrochen. Eine riesige Wolke aus Rauch und Staub stand über ihr in der Windstille. Weiter hinten brannte es.
»Das war eine Riesenbombe. Die Moschee bestand nicht aus Legosteinen«, sagte Salinger. »Und sie war groß.«
»Die Kollegen der Spurensicherung müssen den Schuttberg durchsieben«, sagte de Bodt. Er stand neben einem Kopf, den ein paar Sehnen noch mit dem Körper verbanden. Auf dem Rückweg Richtung Görlitzer Bahnhof versuchten sie, nicht auf Körper, Hände, Arme, Beine zu treten.
»Die haben sich den richtigen Augenblick ausgesucht«, sagte Salinger. »Das Abendgebet.«
Die Einsatzleitung stand vor dem Bahnhof. Ein Polizeibus. De Bodt erkannte den Polizeipräsidenten. Tilly stand neben ihm. Weitab Krüger, der Uniformierte anschnauzte. Wie immer, wenn er die Nerven verlor.
»Sie wissen bestimmt schon, wer es war«, sagte der Polizeipräsident zur Begrüßung.
»Ja«, sagte de Bodt.
1.
Sie hörte die Schritte. Schnell. Die Füße des einen ploppten auf dem Asphalt. Tap-tap-tap. Weite Sätze. Der andere trippelte. Schneller, kürzer. Tip-tip-tip.
Sie blickte sich um. Es war Nacht, es regnete. Hier war sie nie gewesen, obwohl es keine fünf Minuten vom Haus entfernt war. Sie hatte sich schon fremd gefühlt, als sie es verließ. Dabei war sie seit fast zwei Jahren hier. Sie rannte, immer weiter. Wohin? Sie wusste schon nicht mehr, wie sie zurückkehren könnte. Dorthin, wo der Tod sie erwartete. Die Knie wurden weich, der Atem raste. Weiter, weiter. Das Stampfen näherte sich, das Tippeln folgte. Sie sah die Gasse, rannte hinein. Haken schlagen. Dann nach links. Vorbei an Häusern. In denen Licht brannte.
Seitenstechen. Sie lahmte. Stolperte zu einer Haustür. Klingelte. Klingelte. Klingelte. Zog an der Tür.
2.
»Schöne Scheiße«, sagte die Zander. Sie kniete neben der Toten. »Vielleicht zwanzig, vielleicht jünger. Stranguliert, mit einem Draht. Einer Garotte. Dünn, hat sich tief eingeschnitten. Habt ihr einen Draht gefunden?« Sie blickte nicht mal auf.
»Wir haben nichts gefunden«, sagte Uhlenhorst. »Und du, schon eine geniale Eingebung?« Blickte de Bodt an.
Der betrachtete die junge Frau. Sie lag auf dem Rücken. Auf der Straße, neben einem Gully, am Bürgersteig. Der Rock hochgerutscht. Roter Slip. Eine junge Frau, mit schwarzen Haaren und hellbrauner Haut. Asiatin. Vielleicht von den Philippinen. Oder Thailand. »Ich habe den Fall schon gelöst«, sagte er. Es klang wie: Lass mich in Ruhe.
Uhlenhorst warf ihm einen Blick zu. Hob die Brauen. Blickte Salinger an. Sie blinzelte und schüttelte kaum merklich den Kopf.
Yussuf verkrümelte sich zur Oberkommissarin Baumann. Bis Krüger auftauchte. »Das ist mein Fall«, sagte er.
»Gern«, erwiderte de Bodt.
Salinger wechselte einen Blick mit Yussuf. Eine tote Frau in einem Villenviertel in Dahlem. So ein Fall interessierte den Chef nicht. Eifersucht, Raubmord, das Übliche. Er hätte widersprechen können. Schließlich hatte der Kollege vom Notruf de Bodt als Ersten informiert. Aber der Kriminalrat Tilly hatte sich für Krüger entschieden. Beide kauten noch an der Demütigung, die de Bodt ihnen bereitet hatte. Als er das Attentat auf den US-Präsidenten vereitelte. Ein Attentat, an das nur de Bodt geglaubt hatte. Und natürlich Salinger und Yussuf. Die es sich angewöhnt hatten, ihrem Chef die verrücktesten Geschichten abzunehmen.
Da tauchte Tilly auch schon auf, mit Blaulicht auf dem Dienst-Benz. Als wäre seine Anwesenheit nötig gewesen.
Er eilte auf de Bodt zu. »Lassen Sie den Kollegen Krüger den Fall übernehmen.« Klang wie: Der braucht das jetzt, nachdem er monatelang das Coronavirus gejagt hat. Es machte keinen Spaß, tausendmal am Tag Bekloppten zu erklären, dass sie sich nach Hause verpissen, Abstand halten und eine Maske tragen sollten.
De Bodt hatte sich in dieser Zeit in Quarantäne begeben, und niemand hatte gewagt, ihm das auszureden. Ihn zu fragen, ob er infiziert sei oder in Kontakt mit Virusträgern gewesen. Er hatte hin und wieder mit Salinger und Yussuf telefoniert und Hegel gelesen. Kriminalistische Weiterbildung. Salinger war stinksauer gewesen, weil de Bodts Quarantäne sie und Yussuf unter Krügers Fuchtel gebracht hatte. Tilly hatte sich zwei-, dreimal erkundigt, ob es dem Kollegen besser gehe. Er hatte sich offenbar eingeredet, dass de Bodt krank sei. So kam er am besten mit dieser Frechheit seines Untergebenen klar. Er hatte sich vorgestellt, was er dem Polizeipräsidenten erklären müsste. Wenn er die Wahrheit sagte. Dass de Bodt einfach nicht mehr gekommen war. Sie haben Ihre Leute nicht im Griff, wäre der geringste Vorwurf gewesen. Aber Tilly hatte ein Elefantengedächtnis mit einem Sonderfach für Kränkungen. Da war alles gelagert, was de Bodt ihm während der letzten Jahre angetan hatte. Der Tag der Abrechnung nahte. Wenn keine Kanzlerin mehr de Bodt schützte. Warte, warte nur.
3.
Lebranc zählte. Wie viele Tage er noch im Dienst war. Er hätte sich in Quarantäne zurückziehen können, weil sein Assistent sich infiziert hatte. Hatte Floire endlich was genutzt. Aber natürlich war die Krankheit mild verlaufen. Bald verkündete Floire seinem Chef, er sei genesen und jetzt wenigstens eine Weile immun gegen das Virus. Eine der traurigsten Nachrichten dieser Zeit. Nicht dass er Floire den Tod gewünscht hätte. Aber wehtun hätte es schon dürfen. Außerdem erklärte Floire, er habe im Zwangsurlaub viel Hegel gelesen. Wie de Bodt in Berlin. »Wenn man sieht, wie der seine Fälle löst …« Das hatte geschmerzt wie ein Dolch, der einem im Bauch umgedreht wurde. Nach Ende der Ausgangssperrenserie war Floire in der Präfektur aufgetaucht, als wäre nichts gewesen. Nur schien Lebranc, dass sein Assistent so was wie einen erleuchteten Eindruck machte. Ein mildes Lächeln im Gesicht. Das auch bei Rüffeln nicht verschwand. Wie früher diese Verehrer indischer Gurus, die noch im Schlaf lächelten und verziehen, bevor ein böses Wort gefallen war. Aber Floire hatte nicht nur die Hegelei von de Bodt übernommen, sondern auch dessen Arroganz. Es waren nicht die Worte, es war der Gesichtsausdruck. Wenn er verständnisvoll lächelte, wann immer Lebranc ihn anschiss. Das hatte er früher provozierend kühl ertragen. Aber jetzt lächelte er. Als wollte er sagen: Ich weiß, Chef, Sie sind nicht mehr auf der Höhe. Reif für die Rente. Aber ich will Ihnen die letzten Tage nicht vermiesen. Im Alter verbittert mancher. Versteh ich doch.
Floire saß im Vorzimmer an seinem kleinen Schreibtisch, als das Telefon klingelte. Er nahm ab, hörte zu. Legte auf. Klopfte und betrat Lebrancs Büro. Der war im Halbschlaf. Öffnete die Augen, erst erschreckt, dann wütend.
»Leiche auf der Place Dalida«, sagte Floire. »Junge Frau. Mehr weiß ich nicht.«
4.
»Gibt es eine Vermisstenmeldung?«, fragte Salinger.
»Bis jetzt nicht«, erwiderte Yussuf. Blickte zum Stuhl neben dem Eingang. Wo sonst de Bodt saß. Aber der war wieder nicht erschienen.
Die Zander hatte einen kurzen Bericht gemailt. Keine Vergewaltigung. Das Mädchen war Jungfrau. Alter siebzehn bis einundzwanzig. Las Yussuf vor.
»Jungfrau und junge Frau, nicht Mädchen«, sagte Salinger.
»Ist ja gut. Die sieht aus wie ein Mädchen. Die Klamotten stammen aus Berlin. H&M. War nicht reich, die Kleine.«
»Hat die in Berlin gewohnt? Vielleicht Touristin? Schick das Foto an die Streifen. Die sollen in Hostels und Hotels nachfragen. Vielleicht hat jemand die Frau gesehen.«
»Medien?«
»Nein, zu früh«, sagte Salinger. »Stell dir vor, die Eltern schlagen die Zeitung auf …«
»Stell dir vor, der Mörder wartet auf dem Flugplatz …«
»Krügers Sklaven belästigen im BER gerade alles, was zwei Beine hat.«
»Und ihr sitzt hier herum«, sagte Krüger. Stand in der Tür und blickte herrisch. Wie Cäsar, als ihm Vercingetorix das Schwert vor die Füße warf.
»Wir arbeiten«, sagte Salinger. »Versuchen uns ein Bild vom Opfer zu machen.«
»Dann schaut euch die Fotos vom Tatort an.«
»Die kennen wir. Wir fragen uns, ob sie aus Deutschland stammt. Oder aus Asien. Philippinen, Thailand, Vietnam.«
»Woher wollt ihr das wissen? Da hilft nicht mal die Genetik. Eltern vielleicht in Manila geboren, sie in Düsseldorf. Glaubst du, du findest in den Proben der DNS Spuren des Umzugs … oder der Flucht?«
»Sie ist offenbar vor ihrem Mörder geflohen«, sagte Yussuf. »Wir fahren noch mal zum Tatort. Angeblich hat niemand was gesehen oder gehört.«
Salinger nickte. Gute Idee. Krüger vor der Nase wegfahren.
5.
Dalidas von Männerhänden polierte Bronzebrüste glänzten in der Sonne. Vor der Fünf-Quader-Säule unter der Büste lag eine schlanke Frau. Fast nackt. Der Fetzen eines blauen Kleides neben ihr auf dem Gehweg. Der Rechtsmediziner saß auf einer kleinen Stelenmauer und rauchte. Lebranc hatte ihn schon mal gesehen, erinnerte sich aber nicht seines Namens. Stellte sich vor ihn. »Und?«
»Ermordet in dieser Nacht. Erwürgt. Vorher vergewaltigt, wie es aussieht. Aber nicht hier. Hier wurde sie abgelegt. Das Kleid hat der Mörder hiergelassen, damit wir glauben, es wäre hier geschehen. Asiatin, woher auch immer zwischen Paris und Singapur.«
»Warum nicht hier ermordet? Haben Sie Beweise?«
»Sie wurde über einen Holzboden geschleift. Wir haben Splitter im Gesäß gefunden. In der Pathologie finden wir mehr davon. Ich glaube, sie wurde in einem Zimmer vergewaltigt und erwürgt. Dann hergefahren und hier abgelegt.«
»Warum gerade unter der Dalida-Büste?«
»Keine Ahnung.«
»Um das sexuelle Motiv zu unterstreichen«, sagte Floire.
»Sie meinen, der Mörder wollte uns ein bisschen Arbeit abnehmen?«
»Könnte man fast glauben. Es handelt sich aber kaum um ein sexuelles Motiv. Sondern um den Versuch, uns irrezuführen.«
Der Arzt nickte. »Schlaue Idee. Aus Ihnen wird mal ein Polizist.«
»Schön, dass Sie das so sehen. Ich lerne jeden Tag von meinem Chef.«
Der war der Einzige, der begriff. Dass Floire ihn gerade durch den Kakao zog.
6.
Yussuf klingelte. Nichts. Er klingelte noch einmal. Lang. Schlurfen. Ein Klacken. Die Sicherheitskette. Die Tür öffnete sich. Ein Mann, um die siebzig. Mönchsglatze, ängstlicher Blick. »Ja?«
Salinger hielt ihm den Dienstausweis vor die Augen. »LKA Berlin.«
»Ja?«
»Wir würden uns gern mit Ihnen unterhalten.«
»Worüber?«
»Sie lassen uns rein, oder Sie kriegen eine Vorladung ins LKA«, sagte Salinger.
Die Tür schloss sich. Die Kette klackte leise. Dann öffnete sich die Tür. »Man weiß ja heute nicht mehr, wer …«
»Wir sind nur die Polizei«, sagte Yussuf.
Eine Frau erschien im Flur. Krummer Rücken, am Stock. »Kommen Sie ins Wohnzimmer, bitte. Tee, Kaffee, Wasser?«
»Danke, nein. Nur Antworten. Wir haben keine Zeit«, sagte Salinger.
Die Frau humpelte vorweg, ihr Mann bildete die Nachhut. Das Wohnzimmer musste schon den Führer gekannt haben. Kein freier Quadratzentimeter ohne Kitsch und Nippes.
»Nehmen Sie bitte Platz.« Sie deutete mit ihrem Stock auf ein riesiges Sofa. Worin Yussuf und Salinger versanken.
Nachdem sie den Polstergrund erreicht hatte, fragte Salinger: »Quasi vor Ihrer Haustür wurde letzte Nacht eine junge Frau ermordet. Haben Sie etwas gesehen? Gehört?«
Sie hatten auf den beiden Sesseln Platz genommen, die sich am Tisch gegenüberstanden. Der Alte blickte seine Frau an. Schüttelte den Kopf.
Yussuf roch die Lüge, bevor einer von den beiden den Mund öffnete.
»Nein«, sagte die Frau. »Wir haben da bestimmt schon geschlafen.«
»Und wenn ich unsere Spurensicherung bitte, an Ihrer Haustür nach Fingerabdrücken zu suchen?«, fragte Yussuf. Ein Schuss ins Blaue.
Schweigen.
»Ja, da machte sich jemand an unserer Tür zu schaffen.«
Sie blickte auf den Plüschteppich.
»Hat jemand was gerufen?«, fragte Salinger.
»Ich …«, sagte die Frau.
»Ja«, sagte der Mann. »Die hat uns Angst gemacht.«
»Ich wette, die Fingerabdrücke an Ihrer Tür stammen vom Opfer«, sagte Yussuf.
Der Mann blickte ihn lange an. Zuckte die Achseln. »Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, alt zu sein. Wir sind zu schwach« – deutete zur Haustür – »für das da draußen. So viele Kana… Ausländer. Wir haben Angst. Ach ja, ich hatte mal einen schwarzen Kollegen im Ingenieurbüro, der war nett. Aber …«
»Es war also eine Frau, die gerufen hat?«, fragte Salinger.
Die beiden Alten wechselten einen Blick.
»Ja«, flüsterte sie.
»Und vor der hatten Sie Angst?«
Sie nickte. »Wir haben vor allem Angst … da draußen.«
»Sie wissen, dass die Frau ermordet wurde?«
Der Alte nickte. Sie saß starr.
»Hätten Sie die Tür geöffnet … die Polizei gerufen …«, sagte Yussuf.
»Dann hätten die uns umgebracht, bevor das erste Polizeiauto hier gewesen wäre.«
»Sie haben die also gesehen?«, fragte Salinger.
»Ich habe im Büro aus dem Fenster gelinst, hinterm Vorhang.«
»Und Sie fanden es nicht nötig, die Polizei zu rufen?«
Sie schwiegen.
»Das ist unterlassene Hilfeleistung, eine Straftat. Sie werden vom Staatsanwalt hören«, sagte Yussuf. Salinger merkte seiner Stimme an, dass er sich kaum beherrschen konnte. »Warum haben Sie uns nicht angerufen?«
»Ich weiß nicht«, sagte er. »Ich weiß nicht.« Flüsternd.
»Aber Sie konnten sich den Mord seelenruhig ansehen. War’s wie im Tatort?«
Schweigen.
Der Alte räusperte sich. »Es waren zwei. Ein kleiner, schlanker. Und ein Großer, korpulent, kräftig. Araber, Türken oder so was.«
»Beide?«, fragte Yussuf.
»Beide.«
»Und dann?«
»Dann?« Der Alte blickte auf den Boden. »Der Schlanke hat sie an den Schultern gepackt, vorn. Der Große hat ihr was um den Hals gelegt. Von hinten. Dann hat er gezogen, bis ihr Körper schlaff wurde. Sie haben sie fallen lassen und sind abgehauen.«
»Und das haben Sie sich angesehen, ohne auch nur ans Telefonieren zu denken?«
»Die hätten ja …«
Salinger schickte Krüger eine SMS.
Du hast morgen, 9.00, Besuch von zwei Zeugen des Mordes. Es geht um deren Aussagen und unterlassene Hilfeleistung. Schalte den Staatsanwalt ein.
Darunter stand unsichtbar de Bodt.
»Wir brauchen Personenbeschreibungen. Sie kommen morgen früh Punkt neun Uhr ins LKA 1 in der Keithstraße. Da machen wir Phantombilder.« Sie legte ihre Visitenkarte auf den Tisch.
Er nickte betrübt. »Was hätten wir denn machen sollen?«
»Die Frau ins Haus lassen. Dann die 110. Oder andersherum. Ganz einfach. Jedenfalls nicht glotzen.«
7.
»Unter der Dalida. Da haben die sich ja einen schönen Platz ausgesucht«, brummte der Doc. Er hatte sich wieder eine angezündet.
»Die?«, fragte Floire.
»Sie wurde vermutlich zweimal vergewaltigt. Sie hat unterschiedliche Druckspuren auf den Knöcheln und den Handgelenken. Massive Verletzungen an der Vagina. Deshalb glaube ich, dass es mindestens zwei waren.«
»DNS-Proben?«
»Die haben wohl Kondome benutzt. Vorbildlich. Aids oder Tripper kriegt sie nicht mehr …« Hob die Hand. »Ich habe ein paar Holzsplitter gezogen. Buche, gebeizt. Müsst ihr nur noch das Zimmer finden.«
Der Untersuchungsrichter Carlo erschien. Schnaufte. Blieb stehen. Blickte sich um. Beugte sich zum Doc. Flüsterte was mit dem. Stellte sich an Lebrancs Seite. »Haltet die Medien raus.«
Lebrancs Daumen zeigte über der Schulter nach hinten. In diesem Augenblick blitzte es.
»Kein Wort zu denen«, sagte der Richter.
Lebranc nickte. Drehte sich um. Sah Floire an der Absperrung lebhaft in ein Gespräch verstrickt. »Floire!«, brüllte Lebranc.
Der zuckte die Achseln, drehte sich um und ging gemächlichen Schritts zu seinem Chef.
»Kein Wort an die Aasgeier«, sagte Lebranc. »Pressesperre, Anweisung vom Untersuchungsrichter.«
»Das war kein Aasgeier, sondern ein Freund. Und der leitet ein Zahnlabor und kein Fernsehstudio. Wenn Sie sich mal die Zähne richten lassen wollen … Er macht Ihnen bestimmt einen Sonderpreis.«
Lebranc erstarrte innerlich. Einem eine Frechheit dermaßen perfide zwischen die Rippen zu jubeln, das schaffte nur Floire.
»Und was treibt Ihren … Freund …«
»Sein Labor liegt hinter der Absperrung. Vielleicht könnten Sie ihm eine Ausnahmegenehmigung … Ich würde ihn auch zur Tür begleiten und aufpassen …«
»So weit kommt’s noch, dass … Freunde von Flics … Machen Sie nur weiter so, bald bietet Ihnen einer ein Bündel Euroscheine für einen kleinen Gefallen.«
»Aber, Chef!«
Lebranc winkte ab.
»Darf ich jetzt meinen Freund …?«
»Sie helfen den Kollegen der Kriminaltechnik. Und geben mir am Nachmittag einen ausführlichen Bericht.«
»Klar, Chef.« Zog ab.
»Dein schwerster Fall«, sagte der Untersuchungsrichter.
Lebranc sah Floire nach. »Ganz sicher. Aber bisher habe ich noch jeden Fall geknackt. Der Floire ist nur besonders widerborstig. Aber das wird schon.«
»Und die da?« Blickte zur Leiche. Bedeckt von einem weißen Tuch.
»Keine Ahnung. Sexualverbrechen. Der Freund, der Geliebte, der Freund des Geliebten. Neunzig Prozent.«
Der Richter nickte. »Hoffen wir, dass es nicht die anderen zehn Prozent sind.«
8.
»Du musst uns helfen«, sagte sie. Klang wie: Rette uns vor Krüger.
De Bodt hörte ihren Atem im Hörer. »Das ist Krügers Fall. Wenn ich mich einmische …«
»Ich weiß doch …« Schnaufte. »Krüger hat nicht die blasseste Ahnung, wir haben keine Spuren. Wissen nur, dass zwei Typen … der eine hat sie festgehalten, der andere sie erwürgt. Mit einem Stahlseil. Das ist kein Beziehungsdrama.«
»Ehrenmord?«, fragte de Bodt.
»Vielleicht, glaub ich aber nicht. Hast du schon von einem Ehrenmord mit Garotte gehört?«
»Alles hat es irgendwann zum ersten Mal gegeben.«
»Danke«, sagte sie trocken.
»Das ans Handeln gehende Individuum scheint sich also in einem Kreise zu befinden, worin jedes Moment das andere schon voraussetzt, und hiermit keinen Anfang finden zu können, weil es sein ursprüngliches Wesen, das sein Zweck sein muss, erst aus der Tat kennenlernt, aber, um zu tun, vorher den Zweck haben muss.«
Sie schwieg einen Augenblick. »Du nervst, erstens. Zweitens kann man den Kern der Kriminalistik nicht besser ausdrücken.« Sie lachte. »Du druckst den Spruch aus, und wir hängen den gerahmt ins Büro.«
Er lachte kurz mit. »Und was ist der Zweck, den wir aus der Tat kennenlernen? Das Motiv? Das vor der Tat steht, sich in ihr aber ausdrückt?«
»Leider haben die Täter vergessen, ihre Persos liegen zu lassen.«
»Warum hält einer eine Frau fest, damit ein anderer sie strangulieren kann? Warum machen die das mitten auf der Straße? Weil sie es eilig haben.«
»Kannst die anderen Fragen auch gleich beantworten.«
»Es war keine Affekthandlung. Der Täter hatte das Mordwerkzeug bei sich. Der andere dürfte es gewusst haben. Du hältst sie fest, ich nehm die Garotte. Das wäre eine Absprache. Arbeitsteilung. Ein Plan. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Männer spontan losziehen, um unter höchstem Risiko eine Frau zu erdrosseln? Kennen wir vergleichbare Fälle? Nein«, sagte er. »Wir hatten einen Fall, wenn ich mich recht erinnere. Das war vor hundert Jahren, da war ich noch in Hamburg. Der Fall hat damals ziemlich Wellen geschlagen, in Hamburg allemal. Da war es ein Zuhälter, der eine Nutte ermordet hat.« Er verkniff sich hinzuzufügen: die bei der Polizei um Schutz gebeten hatte.
»Nachdem du den Fall so gut wie gelöst hast, könntest du die Adressen der Mörder rausrücken.«
»Morgen Nachmittag im Café Eliza. Bring Ali mit.«
»Mist, ich dachte schon, es geht um was Ernstes.«
9.
»Ist die Sache erledigt?«, fragte der Mann hinterm Schreibtisch. Die Klimaanlage summte leise. Ein riesiges Fenster öffnete den Blick aufs Meer. Weit entfernt begegneten sich zwei Containerschiffe. Noch weiter weg ein Tanker. Richtung Süden.
Der Uniformierte nickte. Verschwendete keinen Blick aufs Meer. Blickte seinem Chef in die Augen. »Ja, ist erledigt.« Er legte eine Speicherkarte auf den Tisch.
»Es gibt keine Kopien?«
»Unwahrscheinlich. Aber garantieren kann ich es nicht.«
Beim Verlassen des Büros blickte er sich noch einmal um. Der Chef hatte seinen Stuhl gedreht. Schaute aufs Meer. Als gäbe es nichts anderes. In gewisser Hinsicht stimmte es auch.
10.
Sie saßen an einem Tisch im Schatten. Yussuf zankte sich gerade mit Anne, als de Bodt eintraf. »Die will heute keine Bruchstücke rausrücken«, maulte Yussuf.
»Ich kann mir keine Geschenke mehr leisten. Hab noch Corona-Schulden.«
»Geiz, wohin das Auge blickt«, sagte Yussuf. »Dann nehm ich gar nichts außer einer Schokotorte und einem Cappuccino. Das haste nun davon. Und das auch nur, weil der Chef zahlt.«
»Danke für die Information«, sagte de Bodt. Bestellte grünen Tee, dritter Aufguss. Dazu Kekse, deren Schicksal in diesem Augenblick besiegelt war.
»Der kriegt Kekse«, sagte Yussuf.
»Der bezahlt sie auch. Und du willst schnorren«, erwiderte Anne.
»Ich nehme einen Cappuccino und auch Kekse. Dazu ein Hackmesser …«, sagte Salinger.
Als Anne sie erstaunt anblickte: »Um meine Kekse gegen den da zu verteidigen. Wollte ohnehin mal wissen, wie man sich ohne Finger in der Nase bohren kann.«
»Fieses Pack.« Yussuf fummelte eine Zigarette aus der Packung, erhob sich und zündete sie an. Ging ein paar Schritte.
»Schön, dass er wieder normal tickt. Nachdem die Sache mit Jasmin in die Brüche ging, war er nicht auszuhalten«, sagte Salinger.
»So schnell klappt das nicht. Es bleibt immer etwas«, sagte de Bodt.
»Da spricht einer aus Erfahrung.«
»Was hat die Vernehmung gebracht?«, fragte de Bodt.
»Es war grässlich. So die Mischung aus ›Wir sind unschuldig. Wie hätten wir wissen können?‹ bis ›Meine Frau hat mir verboten, die Tür zu öffnen‹ und ›Vor Kurzem hat es einen Einbruch gegeben, die haben auch an der Tür geklingelt‹.« Salinger hob die Brauen. »Es hat in der Tat vor sechzehn Jahren so was wie einen Einbruch gegeben. Ein paar Straßen weiter. Zwei Betrunkene haben geklingelt und dann die Bude verwüstet, das Geld und Schnapsflaschen mitgenommen. Wurden gleich festgenommen. Konnten kaum auf den Beinen stehen. Hatten die Beute fast leer getrunken.«
»Habt ihr Phantombilder hingekriegt?«, fragte de Bodt.
»Nee, einer war groß, der andere korpulent und kleiner. Die Straßenlaterne flackerte. Ich hab’s überprüft und gleich beim Bezirksamt gemeckert. Ändert aber nichts. Nach den Aussagen der beiden könnten wir halb Berlin verhaften.«
Anne trug ein Tablett an den Tisch. Sie hatte eine Papierserviette über eine Untertasse gelegt. Bruchstücke. »Sind für den.« Deutete auf Yussuf, der gerade angefangen hatte zu telefonieren. Und sich noch eine Zigarette ansteckte.
Er setzte sich an den Tisch, das Telefon am Ohr. Er radebrechte auf Französisch und trennte das Gespräch. »Das war Floire. Die haben auch eine Frauenleiche. Vergewaltigt. Fundort Dalida, Tatort unbekannt.«
»An der Place Dalida?«, fragte de Bodt.
»Hab ich so verstanden.«
»Vergewaltigt«, sagte de Bodt. »Irgendwo, und dann dort abgelegt. Unter der Büste mit den glänzenden Brüsten, angetatscht von Millionen.«
»Zufall? Oder irgendeine perverse Botschaft?«, fragte Salinger.
»Keine Ahnung«, sagte Yussuf. »Sie könnte aus den Philippinen stammen oder sonst woher in Asien … oder Ihre Vorfahren.« Sein Telefon klingelte. Er hatte dafür einen Muezzin mit Quakstimme ausgesucht.
Salinger hielt sich die Ohren zu. »Der macht das nur, um zu nerven.«
»Ruhe, das nennt sich Religionsfreiheit.« Yussuf nahm das Gespräch an. »Was?« Er hörte zu. Steckte das Telefon in die Tasche. »Die Zander. Sagt, dass die Frau einen Ring trug. Mit einem Kreuz auf der Innenseite. Außen sah er aus wie ein Ehering. Die war Christin.«
De Bodt blickte ihn an. Grübelte. »Frag den Floire, ob das Opfer in Paris auch ein religiöses Symbol trug. Kette, Ring … ach, er soll seinen Chef grüßen.«
Yussuf rief an. Nickte de Bodt zu. Hielt die Hand aufs Mikrofon. »Ein Bauchnabelpiercing. Ein Kreuz.«
Nachdem Yussuf fertig war, sagte de Bodt: »Achtzig Prozent, dass die beiden Filipinas waren. Dreißig Prozent, dass sie sich kannten.«
11.
»Da habt ihr mir ja zwei Blinde geschickt. Die Zeugenaussagen der beiden sind fürn Arsch!« Krüger war sauer. Vielleicht besonders, weil de Bodt im Büro aufgetaucht war. »Filipinas also. Verraten Sie mir, woher Sie diese Weisheit beziehen … sofern Sie es uns Sterblichen anvertrauen wollen.«
»Gern«, sagte de Bodt. Er saß auf dem Stuhl neben der Tür. »Die Philippinen waren lange spanische Kolonie. Sie wurden missioniert. Wie üblich mit Überzeugung, Bestechung und Gewalt. Warum ist Mexiko ein katholisches Land, katholischer als Spanien heute? Weil es spanische Kolonie war. Die Spanier haben sich in Asien auf die Philippinen gestürzt, wie sie sich auf Peru, Ecuador, Chile und so weiter gestürzt haben.«
»Danke für die historische Aufklärung. Warum das Kreuz auf der Ringinnenseite in Berlin und das Nabelpiercing in Paris?«
Tilly betrat das Büro. »Gibt es Fortschritte, Herr Krüger?«, fragte er.
»Der Kollege de Bodt gibt gerade einen Kurs in spanischer Geschichte.«
»Beide sind demnach Filipinas. Beide haben an Orten gearbeitet, wo man seinen christlichen Glauben besser verbirgt«, sagte Yussuf.
Tilly blickte de Bodt an. »Sie sprechen auch vom Opfer in Paris?«
»Genau. Die beiden kannten sich vielleicht. Es ist womöglich kein Zufall, dass sie fast gleichzeitig ermordet wurden. Jedenfalls haben sie dort gearbeitet, wo das Christentum nicht geduldet wird. Sonst hätten sie Kettchen mit Kreuz getragen.«
»Ein bisschen viele Vielleicht«, sagte Tilly.
»Beginnt nicht jede Ermittlung mit einem Vielleicht? Oder mehreren?«, fragte de Bodt. »Bei mir ist das jedenfalls so.«
»Sie wissen schon, dass es mein Fall ist«, sagte Krüger.
»Das muss Sie nicht daran hindern, Ideen zu prüfen. Auch wenn sie nicht von Ihnen stammen.«
12.
»Schön, dass es dich doch noch gibt. Und schon in Bestform. Tilly notiert gerade in seinem schwarzen Buch: De Bodt wieder böse gewesen«, sagte Salinger.
De Bodt lächelte. Gar nicht schlecht, wieder im Büro zu sein. Er grinste Salinger an. Die grinste zurück. Krüger hatte es nicht gewagt, sie loszuschicken. Obwohl Tilly ihm Salinger und Yussuf unterstellt hatte. Nach seinen letzten Erfolgen war de Bodt unantastbar geworden. Ihm hatten sie es zu verdanken, dass buchstäblich und bildlich Hektoliter Champagner über der Berliner Polizei ausgeschüttet wurden. Gemäß der Rangfolge: das meiste auf den Innensenator, dann den Generalbundesanwalt, den Generalstaatsanwalt, die Geheimdienstchefs, den Polizeipräsidenten, schließlich Tilly. De Bodt sollte angeblich zum Kriminalrat befördert werden. Aber das hatte dann jemand vergessen. Obwohl er alle vorm Ertrinken gerettet hatte. So lange war der letzte Fall noch nicht her. Seine Beliebtheit unter den Kollegen hatte das nicht erhöht. Aber sein Draht zur Kanzlerin war ein paar Zentimeter kürzer geworden. Noch war sie im Amt. Danach würde man sehen. De Bodts Erfolge hatten die Kollegen gedemütigt. Sie hatten ihn für bekloppt erklärt, aber er hatte recht behalten. Mal wieder. Glück hatte jeder Bekloppte mal, so viel Glück wie de Bodt konnte aber niemand haben. Auch de Bodt hatte schon danebengelegen. Aber er war der Erste, der es merkte. Und einem Irrtum keine Sekunde anhing. Und jetzt begann er sich für einen Fall zu interessieren. Es zeichneten sich Zusammenhänge ab. Das fixte ihn an.
»Krüger führt gerade einen Freudentanz auf«, sagte Yussuf.
De Bodt saß auf seinem Stuhl neben dem Eingang. Und war weit weg. Nachdem sein Hirn gelandet war, wiederholte er: »Unterstellen wir, es sind Filipinas. Dann sind sie wohl Katholikinnen. Beide müssen ihren Glauben verbergen. Welchen Sinn sollen die versteckten Kreuze sonst haben?«
»Sie arbeiten bei Atheisten«, sagte Yussuf. »Oder bei Moslems, strengen Moslems.«
»Genau«, sagte de Bodt.
»Ich frag, ob die jemand vermisst«, sagte Salinger. Telefonierte. Legte auf. Schüttelte den Kopf. »Nach unserem Opfer hat niemand gefragt, sagt die Vermisstenstelle.«
»Ruf in den kommenden Tagen …«
»Schon klar. Ist zwar nicht unser Fall …«
»In muslimischen Haushalten arbeiten Hausmädchen, oft aus Asien. Oft beschissen behandelt.« Yussuf überlegte. »Ich ruf Floire an. Vielleicht vermisst jemand deren Opfer.«
13.
Er liebte das Schaukeln auf dem Rücken des Dromedars. Hinaus in die Wüste. Weit hinter ihm seine Beschützer, auf Kamelen. Bewaffnet mit G36-Gewehren aus Deutschland. Er wollte die Getreuen nicht hören, nicht sehen. Sein Telefon hatte er zu Hause gelassen. Er wollte sich wenigstens vorstellen, allein zu sein. In den sanften Hügeln und Tälern. Ocker vor Blau. Keine Wolke am Himmel. Er genoss diese Stunden. Er bedachte, was sie geplant, was sie erreicht hatten. Es war nicht schlecht. Aber sie waren noch weit entfernt vom Ziel. Ihm machte das zu schaffen. Ungeduldig, wie er war. Er kannte seine Schwäche: Immer alles. Sofort. Er sollte mehr auf seine Berater hören. Er sollte neue Berater einstellen, die ihm auch mal widersprachen. Er hatte dieses seltsame Buch gelesen. Machiavelli: Der Fürst.
Er würde in die Geschichte eingehen. Als Führer seiner Welt. Als Befreier. Oder als Verlierer. Als Urheber einer Niederlage, die den Lauf der Geschichte wenden würde. Gegen ihn, gegen sein Volk. Gegen seine Welt. Die Verantwortung raubte ihm oft den Schlaf. Konnte er sich auf seine Verbündeten verlassen? Würden sie zurückweichen, wenn Gegenschläge folgten? Vertrauen war keine Währung, auf die er sich verließ. Aber vielleicht würde sich nie wieder eine Gelegenheit wie diese ergeben. Er musste seine Chance nutzen. Die Lage war einmalig, sie konnte sich nur verschlechtern. Die Geschichte rief ihn. Jetzt.
14.
Lebranc blickte auf. Floire stand vor seinem Schreibtisch. Der Kommissar deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
Floire setzte sich. »Danke, Chef.«
Hinter der Höflichkeit lauerte die Bereitschaft, ihn zu verspotten. Dieser Dreckskerl nahm ihn nicht ernst.
»Was gibt’s?«
»Es gibt keine Vermisstenanzeige … wegen der Toten an der Place Dalida.«
»Es ist doch viel zu früh, um danach zu fragen.«
»Wenn jemand sich Sorgen macht, sind ihm unsere Fristen vielleicht egal.«
»Aha.«
»Ich war bei den Kollegen. Sie hätten sich den Fall notiert, sogar wenn sie eine Vermisstenanzeige für verfrüht gehalten hätten.«
»Aha.«
Schweigen.
Floire erhob sich. »Das wollte …«
Lebranc deutete auf den Stuhl. Floire erstarrte, setzte sich wieder.
»Wir haben zwei Fälle, die sich deutlich voneinander unterscheiden«, sagte Lebranc. Man musste diesem Belämmerten alles erklären. Und das in dem Wissen, dass er Perlen vor die Säue warf. »Die eine wurde stranguliert, mit einer Garotte. Die andere, unsere, wurde vergewaltigt und erwürgt. Mit den Händen. Ist bei Sexualverbrechen oft so. Was die beiden Opfer gemein haben, ist wenig: Sie sind Asiatinnen, sie sind jung. Wie viele junge Asiatinnen gibt es in …«
»Beide waren Katholikinnen«, warf Floire ein.
»Vermutlich. Geschenkt«, sagte Lebranc. »Wir werden dem nachgehen. Aber wie Sie natürlich noch nicht wissen können, besteht die Ermittlungsarbeit zu achtzig Prozent aus der Verfolgung falscher Spuren. Daran wird sich nie etwas ändern. Aber Sie schweben gewiss schon in einer Science-Fiction-Welt, in der alle Verbrechen schnurstracks im Labor gelöst werden.«
»Das würde ich sehr begrüßen«, sagte Floire mit Strebermiene. »Aber bis dahin müssen wir auch den schwächsten Spuren folgen.« Und fügte hinzu: »Die Wahrscheinlichkeit verliert gegen die Wahrheit allen Unterschied von geringerer und größerer Wahrscheinlichkeit; sie sei so groß, als sie will, ist sie nichts gegen die Wahrheit.« Blickte seinen Chef mit geneigtem Kopf an. »Hat der Kollege de Bodt mal gesagt. Zitiert. Hegel.«
Floire erhob sich vorsichtig. Jederzeit bereit zu erstarren.
Aber Lebranc schwieg.
»Ich geh telefonieren …«, sagte Floire.
Lebranc tat, als hörte er es nicht. Er fühlte sich, als zöge ihm jemand den Stuhl unterm Hintern weg. Oder gleich den Fußboden. Sie hatten keine Spuren. Keine Zeugen. De Bodt hatte immerhin zwei. Obwohl die nichts taugten. Er versuchte Floire per Telefon zurückzurufen. Aber bei dem war besetzt. Lebranc rief die Sekretärin an. Floire möge sofort beim Chef erscheinen.
»Ja, Chef?« Floire steckte den Kopf durch den Türspalt.
»Was sagt Ihnen die Tatsache, dass es weder in Berlin noch bei uns Spuren gibt? Eine Vergewaltigung ohne Spuren. Keine Hautreste unter den Fingernägeln, keine Kopf- oder Schamhaare am Opfer. Als wäre es nicht berührt worden.«
»Das hat mich Yussuf auch gerade gefragt. Sein Chef zerbricht sich den Kopf darüber. De Bodt glaubt, die beiden Fälle seien miteinander verbunden. Obwohl die Taten sich stark unterscheiden. Die Gemeinsamkeiten: christliche Symbole, Asiatinnen, vermutlich Filipinas als Opfer. Und keine Spuren. De Bodt sagt, die Vergewaltigung solle womöglich das Motiv vertuschen. Und dann noch, dass die Unterschiede in der Tatausführung die Gemeinsamkeiten nur unterstreichen.«
Lebranc blickte ihn fragend an.
»Was immer das heißt«, sagte Floire. »De Bodt will arabische Haushalte in Berlin abklappern. Und im Außenministerium nachfragen.«
»Im Außenministerium?« Lebranc blickte Floire streng an. »Sie haben sich nicht verhört?«
15.
»Eugen, du bist es! Welch Zufall!«
»Hallo, Laura. Du arbeitest im Auswärtigen Amt?«
»Hab die Schnauze voll gehabt von Versicherungen. Und hab im Vorzimmer der Kanzlerin gefragt, ob sie was hätten. Sie hatten. Immerhin haben wir zusammen der Kanzlerin den Po gerettet. Protokollabteilung im Außenministerium. Besuch mich doch mal.«
De Bodt sah, wie Salingers Gesicht einfror. Laura, die er im Kofferraum seines später gesprengten Privatautos aus Berlin herausgeschmuggelt hatte. Sie hatte sich nach dem Fall immer mal wieder gemeldet, bis sie verstand.
»Ihr betreut die Diplomaten in Berlin, glaube ich.«
»Richtig geraten. Unter anderem. Wenn sich die Bußgeldbescheide mal wieder häufen. Die natürlich nie bezahlt werden. Diplomatische Immunität. Die hätte ich auch gern. Ich wüsste, wem ich ungestraft den Hals umdrehen würde.«
»Wir haben einen Fall. Junge Frau, Asiatin, vielleicht Filipina …«
»Ach die! Hab ich in der Abendschau gesehen.«
»Was du nicht weißt: Sie trug einen Ring. Auf der Innenseite war ein Kreuz eingraviert. Sie war wohl Katholikin.«
»Du meinst, eine Katholikin, die in einem streng muslimischen Haushalt arbeitete. Du hast recht, in solchen Familien arbeiten viele Asiatinnen. Billig, fleißig, und wenn der Hausherr auf Mädchen steht …«
»Du hättest dich beim LKA bewerben können«, erwiderte de Bodt lachend. »Sie musste ihr Christentum verbergen. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein.«
»Vielleicht gefiel ihr der Ring. Vielleicht wollte sie ihren Glauben für sich behalten. Mal in einen Club gehen, ohne angemacht zu werden.«
»Klar, aber irgendwo müssen wir anfangen zu graben.«
»In der Glotze hat sich aber dein Kollege Krüger als Leiter der Ermittlungen verkauft.«
»Ist er auch. Aber wir haben einen ähnlichen Fall in Paris. Und seitdem sind es meine Ermittlungen. Der Kollege weiß das nur noch nicht.«
Laura prustete. »Nächstenliebe ist doch was Geiles.«
16.
Salinger sagte kein Wort, als de Bodt aufstand. Ihr Gesicht verriet Eifersucht und Wut. »Helft Krüger. Vielleicht haben die was herausgefunden«, sagte de Bodt, als er in der Tür stand.
Yussuf grinste.
Laura war hübsch und lebhaft wie eh und je. »Grüner Tee, dritter Aufguss, oder war’s der vierte?« Deutete auf eine Kanne in der Besucherecke. Daneben zwei Tassen. »Ich wollte die Brühe immer schon mal versuchen.«
Sie setzten sich gegenüber an den Tisch. Stühle aus Leder und Chrom. Laura goss ein.
»Du verwaltest also die ausländischen Diplomaten in Deutschland.«
»Kann man so sagen.« Sie goss Tee ein.
De Bodt nahm die Tasse, trank einen Schluck.
»Wir haben schon besondere Erfahrungen mit Diplomaten aus arabischen oder anderen muslimischen Ländern. Mit Arabern: Golfstaaten, Katar, Kuweit, vor allem Saudi-Arabien. Wo Mörder wie dieser Mohammed bin Salman al-Saud das Sagen haben. Aber solche Gestalten stellt ja keiner vor Gericht. Die Leute empören sich immer nur über die Schlächter der anderen Seite. Warum sollte MbS besser sein als Assad? Dem Ölprinzen küssen sie die Füße, weil er ihnen Waffen und Autos abkauft. Assad dagegen ist ein böser Bube. Kauft ja auch keine Waffen bei uns, sondern bei den Russen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir diese Heuchelei auf den Geist geht.«
De Bodt nickte. In ihrem moralischen Rigorismus erinnerte sie ihn an Salinger. »Die Moral kann ihre Grundsätze insgesamt auch in concreto, zusamt den praktischen Folgen, wenigstens in möglichen Erfahrungen geben, und dadurch den Missverstand der Abstraktion vermeiden«, flüsterte er vor sich hin.
»Ach, ich erinnere mich, du bist ja ein Zitatenkiosk. Oder sagt man heute Zitatenstreamingdienst? Hegel-Netflix.«
»War Kant«, erwiderte de Bodt. »Wenn ich behaupte, dass unser Opfer Dienstmädchen in einem vermutlich reichen arabischen Haushalt war …«
»Dann liegst du womöglich richtig. Am Golf ist es normal, dass billige Asiatinnen angeheuert werden. Dienstmädchen, Kindermädchen, Mädchen für alles. Sexuelle Übergriffe und sonstige Gewalt eingeschlossen. Darüber regt sich bei uns aber niemand auf. Die Frauen sind rechtlos. Sie geben den Pass ihrem Arbeitgeber. Kündigen ohne dessen Einverständnis geht nicht. Sie sitzen in der Falle. Auch in Berlin haben wir immer wieder mit solchen Fällen zu tun. Die Frauen werden hergelockt, Pass weg, eingesperrt im Haus. Keine Freizeit, Prügel, Vergewaltigung. Wenn es sich um Diplomatenfamilien handelt, haben wir kaum eine Chance. Von den meisten Fällen erfahren wir nichts. Und wenn doch, reden wir den Diplomaten ins Gewissen. In den Arsch treten dürfen wir ihnen leider nicht. Wenn du wissen willst, wie sich Ohnmacht anfühlt, mach ein Praktikum hier.«
»Es ist eine subjektive Ohnmacht der Vernunft«, sagte de Bodt.
»Der Streamingdienst …«
De Bodt nickte. »Was gibt es sonst an Arabern in Berlin?«
»Liest du keine Zeitung mehr? Berühmt sind die libanesischen Clans. Die meisten sind aber Flüchtlinge. Des libanesischen Bürgerkriegs, längst eingelebt. Zuletzt Syrer, natürlich. Könnte sein, dass euer Opfer für Libanesen gearbeitet hat. Oder Marokkaner, Algerier …«
»Aber warum melden die ihr Hausmädchen nicht als vermisst?«, fragte de Bodt.
»Weil sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, sorry.«
De Bodt winkte ab. Wenn er sich etwas vorstellen konnte, dann das.
»Andere werden glauben, dass die einfach abgehauen ist. Kann man ja verstehen. Anderen wiederum ist das Leben einer Ungläubigen wurst. Oder sie haben sie selbst umgebracht. Vielleicht hatte sie keinen Bock mehr auf Vergewaltigung und/oder Prügel?« Sie lächelte ihn an.
»Du verbreitest Hoffnung.«
»Wenn ihr den Fall nicht heute Abend gelöst habt, seid ihr Flaschen.«
»Sind wir sowieso. Du hast nichts gehört? Du redest doch viel mit Diplomaten. Da hat sich niemand beklagt, dass das Hausmädchen abgehauen ist?«
Laura schüttelte den Kopf. Wischte eine Locke von der Stirn. »Das wäre auch nichts, was die mit uns klären wollten.«
»Aber die haben den Pass unseres Opfers?«
»Wenn sie den haben, wozu gibt es Kaminöfen?« Sie legte den Kopf schief. »Und wenn das eine Touristin wäre, die auch arabische Staaten besucht hat? Tochter reicher philippinischer Eltern. Und Papa schenkt ihr zum Abschied einen Ring mit dem Kreuz. Der soll Glück bringen. Die Tochter an den Glauben gemahnen oder so was?«
»Du lässt uns schon noch bis übermorgen?«
»Die Bullen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
17.
Der Mann im Anzug schwitzte. Obwohl die Klimaanlage lief. Fünfundzwanzig Grad. Ein milder Lufthauch. Er nippte an seinem Mokka. Wischte sich mit einem Tuch die Stirn trocken.
»Die Kompensation«, sagte er. »Natürlich, die Kompensation.« Als hätte er sie fast vergessen.
Sein Gegenüber lächelte ihn freundlich an. Natürlich, die Reise, die Hitze, der Prunk. Das hatte schon andere verunsichert. Aber er kannte den Mann zu gut, um ihm Verunsicherung abzukaufen. Es war das Spiel. Wie auf dem Basar. Nur dass es nicht um Kürbiskerne ging.
»Es gibt dort Öl, viel Öl«, sagte der Anzug. »Die Hälfte, Ihre Majestät.« Obwohl er diesen Vorschlag schon mal gemacht hatte.
Sein Gegenüber lächelte fortwährend in seinen Zehn-Tage-Bart. Wahrscheinlich tat er es auch, wenn er die Leute in den Tod schickte. Fremde, die eigenen. »Sie wissen, dass der Ölmarkt zusammengebrochen ist. Er wird nie wieder wie vorher sein. Vor zwei Jahren hätten Sie mit diesem Vorschlag vielleicht meinen Pagen beeindrucken können.« Er beugte sich nach vorn. »Vergessen Sie nicht, Sie wollen etwas von uns.«
»Das werde ich nie vergessen«, sagte der Anzug. »Aber Sie wollen auch etwas von uns. Sie leben am Fuß des Vulkans, nicht wir.«
Der Mann nickte versonnen. »Sie geben uns, was wir von Anfang an gefordert haben. Dann kann es losgehen. Meinetwegen können Sie es überwachen.«
Der Anzug hob die Brauen. Nickte. »Ich werde etwas ausarbeiten. Aber von uns haben Sie das nicht.«
»Wir haben großartige Wissenschaftler im Land. Und es gibt Länder, die einem helfen. Wenn man sie angemessen bezahlt. Keine Sorge, wir halten das geheim. Wir können das.«
18.
»Der Kollege Krüger glaubt, dass Sie sich in seine Ermittlungen einmischen«, sagte der Kriminalrat Tilly.
De Bodt hielt Sicherheitsabstand zum Gummibaum am Fenster, an dessen Bank er lehnte. Tilly hinterm Schreibtisch.
»Nein, ich überprüfe eine … Idee.«
»Das höre ich nicht das erste Mal von Ihnen.«
»Glücklicherweise. Nur kann das den Kollegen Krüger schlecht stören. Meine Mitarbeiter arbeiten ihm zu. Und ich denke nach«, erwiderte de Bodt.
»Als Einziger«, sagte Tilly spöttisch. Seit wann konnte er spotten? Vielleicht hatte das Virus sein Hirn angegriffen?
»Ich hoffe nicht«, sagte de Bodt.
»Was hat denn das Nachdenken ergeben?«
»Ein paar Ermittlungsansätze.«
»Ein paar gleich? Haben Sie das dem Kollegen Krüger schon mitgeteilt?«
»Das erledigen meine Mitarbeiter«, log de Bodt.
»Sehr gut. Und was für Ansätze, wenn Sie es mir auch verraten wollen?«
»Erstens, es handelt sich um eine Touristin. Finde ich unwahrscheinlich. Ich halte es für schwer vorstellbar, dass zwei Touristinnen, wohl aus den Philippinen, fast gleichzeitig in Paris und in Berlin ermordet werden. Beide Katholikinnen, die ihren Glauben verborgen haben. Wohl verbergen mussten. Was man sich in einem europäischen Staat schwer vorstellen kann.«
»Französischer Laizismus, vielleicht ist es das?«, fragte Tilly.
»Vielleicht, vielleicht nicht. Verbergen mussten sie den Glauben unter Muslimen. Vermute ich. Das waren keine Touristinnen, sondern Dienstmädchen, Kindermädchen. Wie das in vielen arabischen Haushalten üblich ist.«
»Davon habe ich gehört«, erwiderte Tilly.
»Ich war im Auswärtigen Amt. Betreuung der Diplomaten in Berlin. Da geht es nicht nur um unbezahlte Strafzettel. Es gibt viele Fälle von Gewalt, Freiheitsberaubung und so weiter in Diplomatenfamilien. Und eine Dunkelziffer. Die meisten Opfer wenden sich nicht an unsere Behörden. Sie wissen, dass wir kaum eingreifen können. Da könnte jemand ein Hausmädchen zersägen und irgendwo vergraben …«
»Wie Khashoggi, den Journalisten«, sagte Tilly.
»Inzwischen gehört diese Knochensäge vermutlich zur Grundausstattung jedes saudischen Diplomatenhaushalts. Erspart Transportprobleme.«
»Seien Sie nicht so zynisch.«
»Zynismus ist die einzige Form, in der gemeine Seelen an das streifen, was Redlichkeit ist; und der höhere Mensch hat bei jedem gröberen und feineren Zynismus die Ohren aufzumachen und sich jedes Mal Glück zu wünschen, wenn gerade vor ihm der Possenreißer ohne Scham oder der wissenschaftliche Satyr laut werden.«
»Ja, ja, Hegel …«
»Nietzsche«, sagte de Bodt. »Und es passt. Wer den Zynismus unserer Wirklichkeit nicht einmal erahnt, wird diesen Fall nie verstehen. Sogar wenn man ihm die Mörder vors Haus trüge.«
»Sie meinen nicht zufällig den Kollegen Krüger? Und mich …?«
»Zwei Morde geschehen in derselben Nacht an zwei unterschiedlichen Orten. In Hauptstädten. Es trifft zwei junge Frauen aus Asien, vermutlich Philippinen. Beide verbergen ihr christliches Bekenntnis. Wer da den Zusammenhang nicht sieht …«
»Touristinnen?«
»Die brauchen viel Geld, um hierherzureisen. Und um sich hier durchzuschlagen. Die Philippinen sind nicht Monaco oder Katar. So waren sie auch nicht gekleidet. Und geschminkt. Nur das Piercing und der Ring. Den die Täter ihnen gelassen haben. Da haben sie geschlampt. Sie haben das Piercing und den Ring nicht mitgenommen, beide aus Gold. Sie hätten auch anderen Schmuck mitgenommen. Offenbar gab es den aber nicht.«
»Vielleicht waren die Opfer mit Diamantenringen und Brillantencolliers …« Tilly winkte ab. »Schon klar. Was schlagen Sie als Nächstes vor? Dass ich Ihnen den Fall übertrage?«
19.
»Wir müssen zur Polizei.« Die junge Frau tippte auf die Zeitung. Wo sie gerade von dem Mord gelesen hatte. In der Abendschau kam es auch.
»Bist du wahnsinnig? Zu Hause werden wir geköpft …«, sagte ihre Freundin. Sie hatten ihren freien Tag. Den einzigen im Monat.
Sie blickte ihre Freundin an. Nickte. Verstand. Trauer in den Augen.
20.
De Bodt rief Lebranc an. Nachdem sie genug Höflichkeiten verschwendet hatten, fragte de Bodt: »Ich nehme an, Sie suchen bereits den Laden, der ihr das Piercing gemacht hat.«
»Natürlich«, sagte Lebranc. »Aber wenn Sie wüssten, wie viele Künstler so was anfertigen …«
»Es können nicht mehr sein als in Berlin.«
»Da haben Sie gewiss recht.«
»Wenn wir die Herkunft des Piercings und des Rings fänden …«
»Das wäre ein großer Schritt. Leiten Sie jetzt die Ermittlungen? Floire sagte, dass Ihr Kollege Krüger …«
»Ich mach es jetzt.«
21.
Krüger war ins Büro geplatzt. Aber seine Empörung war nur zum Teil echt gewesen. Es war eine Sauerei, dass de Bodt sich erst verpisst hatte, um sich dann doch den Fall unter den Nagel zu reißen. Der Herr Erste Hauptkommissar hielt sich für was Besseres. Doch Krüger war auch erleichtert, den Fall los zu sein. Wer hatte schon gern das Scheitern in der Personalakte stehen? Und jetzt diese Theorie. Zwei Asiatinnen, ermordet in Berlin und Paris. Wegen eines Rings und eines Piercings.
Im nächsten Seminar an der Polizeischule würde Krüger es auskosten. Von Fällen erzählen, deren Ermittler Spuren nicht von Spinnerei unterscheiden konnten. Er würde keine Namen nennen, aber seine Zuhörer lernten es gerade, Schlüsse zu ziehen. Und lasen Zeitung.
Aber der Empörungsauftritt war dennoch wichtig. Es war und blieb eine Sauerei.
»Beschwer dich bei Tilly!«, hatte Salinger gesagt.
De Bodt hatte am Schreibtisch gesessen, ausnahmsweise, und nur kurz den Blick gehoben. Um dann weiterzulesen.
»Ich kann deine Wut schon verstehen«, sagte Yussuf. Das Gesicht samt Blondschopf hinterm Monitor versteckt. »Aber du bist ja nicht raus aus dem Fall. Du sollst uns mit deinen Leuten nach Kräften unterstützen. Hat der Kriminalrat gesagt.« Das wusste Yussuf nicht, aber er kannte Tilly. Er hätte ihn zum Verwechseln nachäffen können. Die schnellen Schritte. Die Angst in der Stimme.
Krüger stierte ihn an. Machte auf dem Absatz kehrt und zischte ab. Die Tür ließ er offen. Was so viel bedeutete wie Türknallen. Einheit der Gegensätze. De Bodt grinste.
22.
»Wir sollten Fotos vom Piercingring rausgeben. Und den Hersteller suchen«, sagte Floire.
»Ist das auf Ihrem Mist gewachsen?« Lebranc lauerte.
»Leider nicht. De Bodt. Die machen das in Berlin so.«
»Ich weiß das schon. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen«, sagte Lebranc auf Deutsch.
»Wie bitte?«
»Ich dachte, Sie sprechen chleuh?
»Chleuh?«
»So haben unsere Vorfahren die deutschen Besatzer genannt und deren Sprache. Die freundliche Variante von boches.«
»Was Sie wissen!«
Spätestens jetzt ahnte Lebranc, dass sein Assistent ihn mal wieder hochnahm. »Mein Vater hat das miterlebt.«
»War er in der Résistance?«, fragte Floire. Sein Großvater war nicht im Widerstand gewesen. Sondern einer jener Kollaborateure, die sich mit allen Seiten gut gestellt hatten. Er hatte im Rathaus von Toucy gearbeitet und die Befehle der Deutschen ausgeführt. Als die Juden, keine zwanzig, verfrachtet wurden, war Floires Großvater verschwunden. Um am Tag darauf wieder aufzutauchen. Niemand hatte ihn vermisst. Die Gestapo nicht, die Milizen nicht.
»Das geht Sie … Der Präfekt sagt, wir sollten eine PK veranstalten«, erwiderte Lebranc. »Fotos vom Piercingring, von allen Seiten vergrößert. Das ist unser einziger Anhaltspunkt. Beten wir, dass die Frau den Schmuck in Frankreich gekauft hat. De Bodt macht das Gleiche in Berlin.«
23.
Diesmal war der Andrang lau. De Bodts vorherige PK waren überfüllt gewesen. Aber wen kratzte schon eine erwürgte Asiatin? Die Leute von den Krawallmedien saßen in der ersten Reihe im Konferenzsaal des Präsidiums. Dahinter verloren sich weitere Journalisten.
Eine Mitarbeiterin des Pressesprechers hatte jedem einen Satz Fotos ausgehändigt. Von der Toten. Vom Ring mit dem versteckten Kreuz.
»Und wenn die junge Frau ihren Glauben nur nicht so … demonstrativ … könnte ja abschrecken. Im Berghain mit Betschwesternring …«, sagte eine junge Reporterin. Die Sumpfpresse war zwar da, aber sie hatte die Anfänger geschickt.
Der Pressesprecher saß allein mit de Bodt vorn. Blickte den Kommissar an.
»Ich spekuliere nicht«, sagte de Bodt. »Ich zeige Ihnen, was wir haben. Das ist wenig. Aber wenn Sie die Bilder veröffentlichen, könnten Hinweise kommen.«
»Aber es gab immerhin Tatzeugen«, sagte ein junger Mann. Die Kurzhaare vorn nach oben gebürstet und mit Pattex fixiert.
»Es war Nacht. Die Leute hatten Angst. Sie haben wenig bis nichts gesehen.«
»Haben sie die Polizei gerufen?«
De Bodt beantwortete die Frage nicht. »Um es allen klarzumachen. Wir müssen wissen, wer diesen Ring hergestellt und verkauft hat. Es ist zweifellos eine Sonderanfertigung auf Kundenwunsch. Es gibt irgendwo einen Goldschmied oder eine Schmuckverkäuferin, die sich an diesen Ring erinnert. Wir müssen sie schnell finden. Sollte es Zeugen für die Tat gegeben haben, mögen die sich bitte melden. Und wenn sie noch so weit vom Tatort entfernt waren. Wer diese junge Frau in letzter Zeit gesehen hat, bitte melden. Was einem Zeugen unwichtig erscheinen mag, kann für uns der Schlüssel sein. Die Frau hat sich offenbar einige Zeit in Berlin aufgehalten …«
»Woher wollen Sie das wissen?«, fragte ein Grauhaariger in der letzten Reihe.
»Ich weiß gar nichts«, sagte de Bodt.
»Darf ich das zitieren?«
»Seltsame Frage, das ist eine PK. Sie dürfen aber hinzufügen, dass Sie noch weniger wissen als nichts. Diejenige Unwissenheit, welche nicht in einem bloßen Nicht-Wissen, sondern in einem fehlerhaften Wissens-Zustande besteht, ist der durch einen Schluss herbeigeführte Irrtum. Schon Aristoteles kannte dieses Phänomen.«
Der Mann grinste und schrieb in seinem Notizbuch.
24.
»Ich will aber nicht, dass jemand etwas erfährt«, sagte die Stimme am Telefon. Auf Englisch.
Sie verabredeten sich an der Weltzeituhr auf dem Alex. Wie Touristen. Sie war klein, dünn, mit einem Kindergesicht. Sie erkannte ihn. Hatte de Bodt im Fernsehen gesehen. Sie fuhren den Fernsehturm hoch und fanden einen Platz. Sie blickte sich immer wieder um.
»Ich wollte erst nichts … ich musste auf Ben aufpassen, den einzigen Sohn. Da hab ich Sie in der Abendschau gesehen. Sonst darf ich nicht fernsehen. Ins Wohnzimmer darf ich nur, wenn ich auf den Kleinen aufpassen muss. Oder putzen. Sonst bin ich in der Küche. Ich koche für die Familie. Wenn ich nichts zu tun habe, muss ich in meinem Zimmer sein. Im Keller, es ist winzig. Einmal im Monat darf ich das Haus verlassen. Sonst nur, wenn ich einkaufen gehe für meine Familie.« Übergangslos: »Ich kannte Ala … die tote Frau.«
»Woher?«
»Wir sind zusammen aus Manila hergeflogen. Man hat uns gleich die Pässe weggenommen. Die Flugkosten werden vom Lohn abgezogen. Das dauert. Miete muss ich ja auch bezahlen.«
De Bodt musterte sie. Er hatte über diese moderne Version der Sklaverei gelesen. Üblich in arabischen Staaten, vor allem am Golf. Wo die Welt zusah, wie Sklaven Fußballstadien und sonstige Betonriesen bauten. Wo Dienstpersonal missbraucht wurde. Aber nicht nur dort.
»Wer sind diese Leute, die Sie … beschäftigen?«
Sie legte die Hand vor den Mund. »Kein Wort … Sie müssen es versprechen.«
De Bodt nickte. »Arabische Familie? Reiche Leute?«
Sie nickte zögernd.
»Und Ala?«
»Sie auch. Sie arbeitete für den Botschafter Saudi-Arabiens, einen Neffen von Mohammed bin Salman.«
Es traf de Bodt wie ein Schock.
»Aber bitte nichts verraten.«
»Hat sie deshalb diesen Ring getragen …?«
»Mit dem Kreuz auf der Innenseite? Ja, klar. Stellen Sie sich vor, sie hätte die Familie nach Riad begleiten müssen. Und jemand hätte gemerkt, dass sie Ungläubige war? Sie hätten sie geköpft.«
»Sind Sie auch Katholikin?«
Sie nickte.
»Aber Sie tragen keine religiösen Zeichen?«
»Nein. Aber ich bin auch nicht so … gläubig wie Ala.«
»Hat Sie etwas erzählt von ihrer Arbeit?«
»Nicht viel. Es muss schrecklich gewesen sein. Der Botschafter hat …«
»Vergewaltigt?«
»Er hat sie betatscht. Überall. Unter der Kleidung. Und noch schlimmer.« Wieder die Hand vor dem Mund.
De Bodt versank einen Augenblick in sich. Wie viele solcher Schicksale mochte es in Berlin geben? Als wollte er es nicht glauben: »Der saudische Botschafter?«
Sie nickte.
»Und Sie?«
»Mich gibt es nicht. Bitte. Einverstanden?«
De Bodt nickte. Er schob seine Visitenkarte über den Tisch.
Sie prägte sie sich ein und ließ sie liegen. Erhob sich und ging. Tränen in den Augen.
25.
»Yussuf hat angerufen!«, sagte Floire, als er Lebrancs Luxusbüro betrat. Geklopft und gleich die Tür aufgerissen.
»Das ist ja sensationell. Herr Yussuf hat angerufen! Selbstverständlich gibt Ihnen dieses weltumwälzende Ereignis das Recht, hier reinzuplatzen.« Wandte sich an seine Besucherin, die Floire übersehen hatte. »Tut mir leid. Bei manchen Kollegen ist es mit den guten Manieren nicht weit her.«
»Pardon, Madame!«, sagte Floire. Zum Kommissar: »Das Opfer in Berlin war Hausmädchen beim saudischen Botschafter in Berlin … dem diplomatischen Vertreter von Mohammed bin Salman, Sie wissen schon, der, welcher Leute mit der Knochensäge losschickt und seine Helfer nach vollbrachter Heldentat zum Teufel jagt. Dankbarkeit 2.0 …«
Die Frau blickte ihn entsetzt an. Mittleren Alters, mit Hut, Brille, Bein übergeschlagen.
»Ich weiß, was ein Botschafter ist«, sagte Lebranc.
»Natürlich, Chef.«
»Dann überprüfen Sie jetzt das Personal der Saudis in Paris.«
»Bin schon dabei. Aber die mauern«, sagte Floire.
»Wenden Sie sich ans Außenministerium, Visa-Abteilung. Die wissen, wen die hier beschäftigen.«
»Das mauert auch. Fürchtet um saudische Investitionen, wir wollen denen Panzer und Flugzeuge verkaufen.«
»Das hat der Chef der Visa-Abteilung gesagt?«, fragte Lebranc.
Die Augen der Frau flogen hin und her.
»Nicht ganz so präzise. Er sprach von Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen.«
»Ihre Interpretationen brauch ich nicht.«
»Klar, Chef.« Frisch wie der junge Tag. Knallte die Tür zu.
»Ich beneide Sie um Ihren Mitarbeiter. Er hat Initiative, Witz und ist, wie’s scheint, recht intelligent«, sagte die Besucherin.
»Der erste Eindruck trügt oft.«
»Wie schade. Wollen Sie ihn mir abtreten? Ich kriegte das schon hin. Die DGSE braucht solche Leute. In meiner Abteilung …«
»Dass der Auslandsnachrichtendienst über gute Beziehungen zum Außenministerium verfügt … gut … aber ich soll ihn zu einem brauchbaren Polizisten machen. Dafür fühle ich mich verantwortlich. Sie verstehen das gewiss.«
»Natürlich.«
»Kommen wir zurück zu unserem Problem, Madame Haussmann. Unsere Kollegen in Berlin glauben …«
»Ich weiß. Wenn Ihr Opfer auch für einen Diplomaten gearbeitet hat, wird es schwierig.«
»Wir könnten die Visa überprüfen. Daraus sollte der Wohnsitz hervorgehen.«
»Das ist heikel. Wollen Sie zum saudischen Botschafter gehen und ihn fragen, ob er sein Hausmädchen hat umbringen lassen? So was machen die feinen Herren ja nicht selbst.«
26.
»Du kommst mir zuvor, Eugen«, sagte Laura. »Ich habe die Passbilder mit den Aufnahmen der Toten in der Zeitung abgeglichen. Deine geheimnisvolle Zeugin hat wahrscheinlich recht. Eure Tote heißt demnach Ala Quirino. Arbeitete im Haushalt des saudischen Botschafters Ahmed Zaki Fahd. Der ist nur einer der gefühlt zehntausend Neffen und Onkel des Königs. Genauer gesagt des Tattergreises, für den MbS die Geschäfte führt, einschließlich Krieg, Mord und Totschlag. Falls du den Botschafter verhaften willst, versuch’s gar nicht erst.«
Es stimmte also, was die Zeugin im Fernsehturm berichtet hatte. De Bodt lachte. Ihm war nicht danach zumute. Aber er war Laura dankbar. Ihr Sarkasmus passte. Und sie hatte die Privatadresse des Botschafters.
27.
Dahlem. Eine Villa, umzäunt, Stacheldraht und Kameras. Vor der Stahltür zum Grundstück stand ein Polizeiwagen. Ein Beamter stieg aus, als de Bodt sich der Tür näherte. Bewaffnet mit einer Aktentasche.
»Weisen Sie sich aus!«, befahl der Polizist.
»Kennen Sie das Wort mit den beiden T wie bei Mitte, nur vorn ein B?«
»Werden Sie nicht unverschämt.«
»Sie sind unverschämt«, sagte de Bodt. Hielt ihm seinen Dienstausweis vor die Nase.
Der Beamte schrak zurück. »Ich konnte doch nicht wissen …«
»Sie wollten damit andeuten, dass sich Ihre Höflichkeit auf Erste Hauptkommissare und darüber beschränkt?«
Der Mann schnappte nach Luft.
»Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf: Seien Sie höflich, und zwar zu jedem. Wenn Sie mir noch einmal auffallen, beschwere ich mich beim Polizeipräsidenten. Rüpel haben bei uns nichts zu suchen. Kapiert!?«
»Jawohl, Herr Erster Hauptkommissar … de Bodt.« Bei dem Namen fiel ihm was ein. Das war doch dieser Kommissar, der … um Himmels willen.
»Setzen Sie sich in Ihr Auto und lassen Sie mich meine Arbeit machen.«
»Jawohl, Herr …«
De Bodt wischte den Rest des Satzes weg.
Kein Name an der Tür. Er klingelte.
»Ja?«
»Post. Ich habe ein Express-Einschreiben für Frau Ala Quirino.«
Schweigen. Dann: »Warten Sie.«
Es dauerte. Dann hörte de Bodt Schritte auf hartem Untergrund. Die Tür öffnete sich. Ein Mann, kurze Haare, sportlich. Er lächelte freundlich: »Ich kann den Brief für Frau Quirino entgegennehmen. Sie ist leider unabkömmlich.« Auf Deutsch.
»Tut mir leid«, sagte de Bodt. »Dieses Einschreiben muss ich persönlich aushändigen. So sind die Vorschriften.«
Der Mann nickte. Lächelte eher gezwungen. »Warten Sie.«
Die Tür schloss sich.
De Bodt lehnte sich an die Mauer neben der Tür. Es war heiß, der Himmel wolkenlos. Er wusste, dass die Kamera über der Tür ihn beobachtete. In Zeiten des Terrors gedeiht die Paranoia. Vor allem in Diktaturen, wie Saudi-Arabien eine war. Diktatoren hatten keine Grundlage außer der Macht, die sie sich angeeignet hatten. Und die jederzeit gebrochen werden konnte, wenn sie jede Unterstützung im Volk verlor. »Die am wenigsten bevölkerten Länder sind für die Tyrannei am meisten geeignet; nur in Wüsten herrschen wilde Tiere«, sagte de Bodt in Richtung der Kamera. »Stammt von Rousseau, falls Ihnen der Name was sagt.«
Die Kamera antwortete nicht.
Nach einer kleinen Ewigkeit öffnete sich die Tür wieder. Eine junge Frau mit Kopftuch und schwarzem Rock lächelte ihn an. »Frau Quirino ist doch … tot. Im Fernsehen …«
»Laut ihres Visums wohnte sie hier.«
»Sicher, aber sie hatte einen Schlüssel und konnte das Gelände jederzeit verlassen. Das hat sie getan und ist nicht zurückgekehrt.«
»Aber sie hat ihren Pass und ihr Visum nicht mitgenommen. Die liegen im Safe …« De Bodt deutete auf das Villendach, das sich über der Festungsmauer erhob.
»Wie kommen Sie darauf? Selbstverständlich kann jeder unserer Angestellten Haus und Grundstück mit seinen Papieren verlassen. Wir halten uns an die Gepflogenheiten des Gastlandes.«
»Also in Deutschland ist es verboten, Hausangestellte zu misshandeln.« Die Zander hatte ihm einen Bericht geschickt. Verletzungen, vor allem auf dem Rücken. Peitschenhiebe vermutlich.
Sie blickte ihn unsicher an.
»Frau Quirino wurde also nicht ausgepeitscht? Werden Sie geschlagen?«
Schweißperlen auf der Stirn, das Gesicht färbte sich rosa. »Wie kommen Sie darauf? Ich finde, Sie gehen zu weit.«
»Sollten Sie Hilfe brauchen …« Er reichte ihr seine Visitenkarte.
Sie zögerte, nahm sie. »Sie sind also von der Polizei … Ich werde sie Seiner Exzellenz geben. Ich will unserem Botschafter nicht vorgreifen, aber er hätte allen Grund, sich über Sie zu beschweren. Niemand wird hier misshandelt.« Sie hätte jetzt kehrtmachen und die Tür zuknallen müssen. Sie blieb aber stehen.
»Wenn Frau Quirino außer Haus war, wohin ging sie?«
»Keine Ahnung. Was junge Leute heutzutage …«
»Wussten Sie, dass sie Katholikin war?«
Die Frau stutzte. »Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, halten wir uns an die Gesetze des Gastlandes …«
»Sieht man vom Autoverkehr ab.«
»Wie bitte?«
»Bei unserer Verkehrspolizei stapeln sich einhundertsiebenunddreißig Bußgeldbescheide und Anzeigen. Das Geringste ist Falschparken. Das beeindruckendste Mandat hat Ihr Kollege Ali Sharif erworben. Zweihundertsiebenunddreißig auf der Stadtautobahn.«
»Ich werde den Botschafter unterrichten. Seine Exzellenz wird zweifellos das Notwendige veranlassen.«
De Bodt bewegte sich, bis er zwischen ihr und der Kamera stand. Sein Rücken verdeckte seine Hände und sein Gesicht vor der Kamera. Er deutete auf die Visitenkarte und tippte auf der Handfläche wie auf einem Telefonbildschirm. »Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch …«
Sie nickte, Angst in den Augen.
»Ach so, hätte ich fast vergessen. Es gibt bestimmt Habseligkeiten von Frau Quirino im Haus. Die hätte ich gern.«
»Die wird Ihnen morgen ein Bote bringen. Wohin?«
»LKA 1, Keithstraße.«
Sie musste es nicht mitschreiben.
»Ich würde gern das Zimmer von Frau Quirino sehen.«
»Diesen Wunsch verstehe ich. Ich werde Seine Exzellenz fragen.«
28.
92, rue de Courcelles, im 17. Arrondissement von Paris. Nicht weit vom Arc de Triomphe. Wo es teuer und schick war. Auf dem gegenüberliegenden Gehsteig sammelten junge Leute Unterschriften. Amnesty International stand auf T-Shirts und Westen. Eine junge Frau stellte sich Floire in den Weg. Der unterschrieb für die Freilassung eines Journalisten, der wegen weniger als Nichts zehn Jahre im Gefängnis sitzen sollte. Lebranc schob die Frau zur Seite. Ging zur Tür der Botschaft und klingelte.