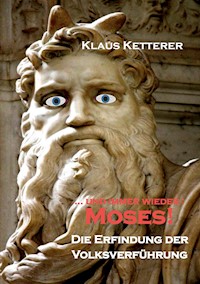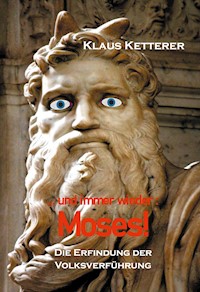Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Menschen werden immer wieder verführt und bis zur Benutzbarkeit ausgerichtet. Sie glauben und folgen, und lassen sich überreden, vorgegebene Wege zu gehen, die auf beiden Seiten Mauern haben, hinter die sie nicht schauen können. Dort fühlen sie sich oft sogar angekommen und lehnen sich behaglich zurück. Sie können und wollen abweichende Argumente nicht mehr wahrnehmen. Um was es geht? Um Politik, um Anerkennung, Erringung und Verteidigung von Selbstgewissheit, um Geltungssucht, Macht und Geld usw. Und was sind die Werkzeuge? Ideologien, Gottesbilder, Religionen, heilige Schriften, die für Wahrheiten stehen, verführende Ästhetik, theatralische Auftritte, Gewalt, Hinterhältigkeit, Lügen usw. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch verstörend. Hin und wieder erzeugt es aber auch Spott und Gelächter. Das aber nur, wenn man über die Mauern klettert. Diese Zehn Essays sind eine Leiter dafür.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das Gute und das Böse
„Der“ Satz des René Descartes
Der Irrtum der Kreationisten
Ein Lob der Gewalt
„Ist das Kunst oder… kann das weg?“
Die Macht der offenen, der heimlichen und der unheimlichen Ästhetik
Stolperstein Menschenwürde
Gebrauchsanweisungen für Religionen
Der Biss in den Apfel
Erkenntnisreiche Suche nach Gottvater
Anhang
Vorwort
Die folgenden Versuche „beschreiben“, dass …
… der „liebe“ Gott nicht nur Gutes, sondern auch Böses tut oder Letzteres seinen „Kumpel“ tun lässt;… ein weltberühmter Philosoph das, was er beweisen will, für den Beweis voraussetzt;… eine Unzahl von religiösen Menschen das Berichtete „ergeben“ glaubt und ihm „ergeben“ folgt;… berühmte Wissenschaftler auch Stuss schreiben;… anerkannte Künstler die „Schneider der neuen Kleider des Kaisers“ spielen, um sich so hochjubeln zu lassen;… die Ästhetik oft ein Werkzeug ist, das vieles vortäuscht oder versteckt;… Politiker auch Festlegungen formulieren, obwohl sie wissen, dass sie nicht wissen, wovon sie reden;… man vielen Menschen erklären muss, dass auch Religionen Nebenwirkungen haben können;… dass wir Menschen sowohl Feinde als auch Sünde erben können;… wie man mit wenigen Strichen und ein wenig Denken beweisen kann, dass Moses kein Heiliger, sondern ein Listiger war.Sie werden das kennen: Es ist nicht zu verhindern, dass man immer mal wieder – mental und/oder emotional – stolpert über das, was man über die digitalen Medien, durch die Menschen um einen herum, und über Fernsehen, Radio, Zeitungen und Bücher vermittelt bekommt.
Glücklicherweise vergisst man die dabei entstehenden Irritationen oft schnell wieder, allein deshalb, weil die Nachrichtenflut alles wegschwemmt und die Nachrichtenwellen der Folgetage alles Gestrige schnell erschlagen und aus der Aufmerksamkeit hinausspülen.
Doch bleibt oft Unzufriedenheit zurück, weil man von dieser Flut der ungeheuren Vielfalt an Meinungen, Ansichten, Einschätzungen und Urteilen mitgerissen zu werden droht, darin fast wehrlos treibt und die unangenehme Empfindung hat, nichts ändern zu können, sich nicht einmal vernehmlich äußern zu können mit Zweifel, Zurückweisung, Richtigstellung, kritischer Hinterfragung.
Vor allem dann, wenn man immer wieder mit strittigen Themen konfrontiert wird, die mit oft unbrauchbaren Methoden der Unterstellung und Voreingenommenheit abgearbeitet werden.
„Dagegen muss man doch etwas tun?!“
Der Gedanke liegt nahe. Aber was und wie? In die Politik gehen?! Sozialpädagoge werden? Prediger werden, wenn man gläubig ist?! Oder Lehrer, wenn man jung genug ist? Es drängt auch hin und wieder, wenigstens die Freunde am Kaffeetisch, und abends beim Glas Wein oder Bier, wenn die tägliche Anspannung etwas nachgelassen hat, diese Freunde also aus den Fangnetzen ihrer ideologischen, religiösen, politischen, verschwörungstheoretischen, querdenkenden Meinungszellen, zumindest aber in den Hof ihrer Gefängnisse zu holen, wo sie sich mit Blick auf Sonne und Wolken von ihrer Wutfessel, ihrem Empörungskeller, ihrem Schnupfen der Voreingenommenheit zumindest soweit lösen können, dass sie wieder etwas lockerer und gelassener werden.
Nun ja, aber das wäre nur ein ferneres Ziel. Denn selbstverständlich ruft ein solcher Drang nicht nur Zustimmung, sondern auch schnell den Vorwurf der belächelnswerten, arroganten Besserwisserei, der verbohrten Rechthaberei, der eitlen Geltungssucht und vieles mehr hervor.
Deshalb sei hier (im Vorwort!) klargestellt: Die folgenden kurzen Essays (Versuche also) sind Ergebnisse eines gedanklichen Zankens mit mir selbst. Eines innerlichen Streitens über das, was die Medien in die Welt schreien oder das, was ich von Eltern, Lehrern, Priestern, Politikern … in jungen Jahren zuerst einmal bereitwillig übernommen und abgespeichert hatte. Mit zunehmendem Alter kamen mehr und mehr Zweifel in mir auf: Kann das und das und das überhaupt richtig, kann es wahr sein?
Ich beschloss, über „das und das und das“ nachzudenken. Gründlich. Das wird hier für einige wenige Themen versucht, die mir neben vielen anderen ‚aufgestoßen‘ sind.
Nun habe ich die Wahrheit allerdings auch nicht gepachtet. Deshalb gräbt eigener Zweifel die Ergebnisse solcher ‚Gehirnakrobatik‘ auch immer mal wieder um: Liege ich richtig mit dieser und jener Schlussfolgerung, dieser und jener Einschätzung?
Hier versichere ich: Ich halte meine Bereitschaft für weitere Zweifel offen. Das Ziel aber bleibt: Nicht einfach nur hinnehmen, nur weil es bequem ist. Nicht hinter jedem Hype, hinter jedem Geschrei, hinter jedem Dogma, jeder Meinung, jeder politischen, ideologischen, religiösen Vorstellung herlaufen in dem Gefühl „angekommen“ zu sein Nicht alles bedenkenlos glauben, womit man überschwemmt wird. Nicht vorschnell bereitwillig dem folgen, was andere erkannt zu haben glauben und behaupten! Sich selbst Erkenntnis erarbeiten. Aber auch bereit sein, eigene „Erkenntnis“ immer wieder zu hinterfragen, zu überarbeiten und zu korrigieren, wenn sich neue Argumente und daraus neue Erkenntnisse ergeben.
Das erst verschafft mir ein Mindestmaß an Sicherheit bei der Begegnung mit Irritationen. Und es zeigt mir, was ich tun kann, wie ich mich verhalten sollte, wenn man auf einen Menschen stößt, der (beispielsweise) wie gelähmt am Angelhaken der Dogmatik der Kreationisten hängt. Der also allen Ernstes dem vorgegebenen Glauben folgt, dass das Weltall, die Menschen, Tiere und Pflanzen in wenigen Tagen als ‚Kreation‘ eines Gottes entstanden sind, wie es in der etwa dreitausend Jahre alten Story der Genesis in der Bibel steht (hier Seite 45). Sollte mir das einfach gleichgültig sein? Soll ich nicht wenigstens den Versuch machen, Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen, die ich darin gefunden zu haben glaube?
Wenn man auf Ansichten trifft, die im Rahmen einer besonders strengen Form des Pazifismus jedwede Gewalt verurteilen: Soll man dazu nur die Schultern zucken (hier Seite 55)? Soll man akzeptieren, dass vielen Menschen ihr selbstgesetztes Dogma, dass alle Menschen grundsätzlich gut sind, wenn man sich ihnen gegenüber nur lieb genug verhält, und dass man dann auf Gewalt grundsätzlich verzichten könne, unwidersprochen lassen? Soll man der Behauptung, dass Gewalt grundsätzlich etwas ist, das man nicht akzeptieren dürfe, folgen?
Sollen wir unseren Ärger einfach hinunterschlucken, wenn wir feststellen, dass wir verulkt werden, wenn ein Wichtigtuer behauptet zu ‚dichten‘, indem er gleichzeitig ankündigt, mit seinen Gedichten „nichts sagen und nichts tun“ zu wollen und der das dann auch tatsächlich durchzieht (hier Seite 75)? Wollen wir auch einen Pianisten, der nur dramatisch die Hände über dem Piano schweben und dann sinken lässt und keinen Ton spielt, tatsächlich beklatschen?
Das waren nur einige Beispiele!
Hin und wieder versuche ich deshalb, über die jeweilige Ursache solcher Irritation nachzudenken. Denn ich (mit zweiundachtzig fast frei) kann mir dafür die Zeit nehmen. Vielleicht reizt es Sie – die Leserin oder den Leser – sich auch die Zeit zum Lesen und zur Überprüfung der jeweiligen Argumentationsketten zu nehmen und zudem durch die Ironie, den Sarkasmus, den Zynismus der Texte zum Lachen gebracht zu werden. Ich hoffe, dass Sie Freude haben, und dass auch Sie – wie ich, der Autor – hin und wieder in den Apfel der Erkenntnis beißen.
Das ist keine Sünde! Denn der Ihnen das verböte, würde Sie kindlich dumm halten wollen. Denn Dumme sind leichter autoritär zu beherrschen. Das hätte ein allmächtiger Gott nicht nötig.
1. Das Gute und das Böse
Sind die Begriffe „Gut“ und „Böse“ absolute oder relative Begriffe?
Und:
1. Warum verschwimmt das oft in unserem Sprachgebrauch?
2. Wissen wir eigentlich, was „das Gute“ und was „das Böse“ ist?
3. Warum tun wir dann oft das „Böse“? Weil wir es als „gut für mich“ einstufen?
Und schließlich:
4. Kann es ‚Institutionen‘ geben (beispielsweise Gott und Teufel), die jeweils nur für das Gute oder das Böse stehen?
Die Taten von Verbrechern, Betrügern und Terroristen erzeugen selbstverständlich bei friedlichen und sozial denkenden Menschen meist Fassungslosigkeit und manchmal auch Wut, denn diese Taten werden zu Recht als böse eingestuft. Es kommen nach dem Empfang entsprechender Nachrichten selbst bei friedlichen Menschen aber oft auch Rachegedanken, und damit auch die innerliche Bereitschaft zu rächenden Gewalttaten auf („die müssten, wie im Mittelalter, ausgepeitscht werden“). Bestünde diese Möglichkeit, würden etliche auch dazu bereit sein, und dies als „gut“ einstufen.
Politiker befehlen – so sind heute leider unsere Zeiten – mit mehr als fragwürdigen Begründungen, und der hinausposaunten Behauptung als „Gute“ zu handeln, Angriffskriege, in denen abertausende Menschen sterben, sowie Kulturgüter und Lebensgrundlagen zerstört werden. Ist das gut oder böse? Diese Politiker und die von ihnen beeinflussten Menschenmassen halten es für gut!
Weitet man den Blick auf die Vertretung von Gut und Böse in den monotheistischen Religionen durch Gott und Teufel aus, verkommen „Heilige Schriften“ zu Märchenerzählungen, die nicht ernst genommen werden können, obwohl sie als „Heilige Schriften“ die wichtigsten Belege für die Basis des Glaubens von Milliarden Menschen gelten. Denn wofür steht ein Gott, der in seinen „Zehn Geboten“ das Töten verbietet (das ist gut!), aber auch die Tötung von „Erstgeborenen“ befiehlt? Letzteres ist nach unserer heutigen Einschätzung eindeutig böse! Irgendetwas stimmt da nicht mit der Logik.
Wie unterscheiden wir Menschen zwischen „Gut“ und „Böse“? Der Betrüger empfand seine für ihn gewinnbringende Tat als gut. Das gilt auch für den Mörder, der seine Rachsucht befriedigen konnte, und den Selbstmordattentäter, der glaubt, seinem Gott gedient zu haben (von den Jungfrauen im Paradies soll hier nicht gesprochen werden. Wir sind hier nicht im Kindergarten).
Zerreißt es da nicht einen „lieben Gott“, der angeblich „alles“ – das Licht, das Universum und das Leben – erschaffen hat, und somit auch das Gute und das Böse? Und der die bösen Geschehnisse schon immer – und auch heute noch – zulässt?
_______
Aus einem Geplauder wird eine Diskussion. Begriffe schwirren durch den Raum, von denen die Gesprächspartner lange nicht merken, dass sie diese mit unterschiedlichen Inhalten versehen und vortragen, von denen aber jeder für sich in Anspruch nimmt, dass das, was er oder sie damit meint, von ihm/ihr absolut gültig und eindeutig verwendet wird, und nur so verstanden werden kann.
Von was spricht man beispielsweise, wenn man von einem „lieben Gott“, der angeblich alles erschaffen hat, sagt, dass er nur für das absolut Gute stehe? Er hat doch auch Raubtiere, Unwetter, Krankheiten, Schmerzen, Trauer, Kriege, Morde, Massaker und Grausamkeit und damit auch das Böse erschaffen.
Und: Warum vernichtet er das Böse nicht, da er doch angeblich allmächtig ist?
Oder: Was ist in unserer Realität nur gut oder nur böse? War Robin Hood ein guter oder ein böser Mensch? War er ein „guter Bösewicht“? Oder das Gegenteil, ein „böser Gutewicht“? Kann das Böse gleichzeitig gut sein? Wer entscheidet über das, was gut und was böse ist? Stehen die Begriffe ‚Gut‘ und ‚Böse‘ für etwas jeweilig Absolutes? Oder sind es nur Relationen auf unterschiedlich begründeten Standpunkten und Wertesetzungen, weil das, was für den einen Menschen gut, für den anderen oft böse ist oder zumindest sein kann?
Dass es das Gute gibt, wissen wir. Auch das Böse kennen wir zur Genüge. Beides zusammen sind Antipoden unseres menschlichen Bewusstseins. Doch ist das, was wir für das Gute halten, tatsächlich – wenigstens hin und wieder – das reine Gute und das Böse das reine Böse? Gibt es das? Oder gibt es nur unreine Formen von beidem und/oder Übergänge? Wenn es das „gute Böse“ geben sollte – denn das wäre solch ein Übergang – gäbe es auch das „böse Gute“ und damit auch den gerechten Krieg, um einen Tyrannen zu vertreiben. Es gäbe auch die Berechtigung zur (bösen!) Folter eines Entführers durch die Ermittlungsbehörden, in der (guten!) Absicht, das Leben eines Dritten, des Entführten zu retten … usw.
Dieser Essay, dieser Versuch also, ist selbstverständlich nicht der erste seiner Art, weil viele zehntausend Jahre nach den Höhlenzeichnungen die Schrift erfunden wurde, und es zumindest seitdem, in einer menschlichen Kulturgeschichte von vielen tausend weiteren Jahren, tatsächlich kaum mehr etwas gibt, über das nicht schon nachgedacht und geschrieben worden ist.
Wenn man sich den Begriffen nähert, stellt man schnell fest, dass Gut und Böse eine Grundfrage unseres Menschseins ist. Seit tausenden von Jahren denken die Philosophen, die Theologen, die Dichter, die Juristen, die Mediziner, die Politiker und darüber hinaus viele andere Menschen über Gut und Böse nach, und sind dabei untereinander und über die Jahrhunderte zu sehr unterschiedlichen Ansichten gekommen. Das alles aufzuzählen und darzulegen, soll hier gar nicht erst versucht werden, obwohl Hinweise auf Zitate oft schneller und nachhaltiger Zustimmung bekommen, weil das, was „geschrieben steht …!“ seit jeher als glaubwürdiger gilt als das eigene Denkergebnis.
Doch eigene Denkakrobatik ist zeitnaher und spannender. Es macht immer wieder Freude, wenn man feststellt, dass man wieder einmal „in den Apfel gebissen“ (Erbsünde) und Erkenntnis „gegessen“ hat. Das im Folgenden erarbeitete Ergebnis werden einige Lesende hoffentlich akzeptieren können. Doch vermute ich, es wird viele wohl eher erschrecken. Letztere seien tröstlich daran erinnert: Es handelt sich um einen Essay, also einen Versuch, von dem dann jeder selbst entscheiden kann, ob er gelungen ist oder nicht, und ob er dem Ergebnis folgen kann und will.
_______
Beim wiederholten Ablaufen meines nachdenklichen Dreiecks vom Bildschirm des PCs durch die Räume an den Gartenfenstern vorbei zum Badezimmer und zurück, kam ich immer wieder an dem großen Spiegel im Flur vorbei. Während ich so mit dem Laufen und Grübeln beschäftigt war, muss ich wohl – ‚beiläufig‘ – hineingeschaut haben. Da sah ich ihn – den guten Bösewicht.
Befürchten Sie bitte nicht, dass nun irgendeine Beichte folgt. Obwohl der Spiegel nur mich zeigte, habe ich an mir vorbei den Spiegel gesehen und damit die Problematik der Frage nach Gut und Böse. Da habe ich erkannt, wer der größte gute Bösewicht oder böse Gutewicht ist, wem allein man also diese Rolle zuordnen kann.
Das verlangt selbstverständlich Erklärung! Die will ich versuchen. Doch sei hier vorab erläutert, mit welchen Mitteln und in welcher Form ich das versuchen bzw. erklären will.
Zuerst einmal muss geklärt werden, was hier unter dem Guten und dem Bösen verstanden werden soll.
Dann werden hier Thesen, also Behauptungen über das Wesen von Gut und Böse aufgestellt. Danach werde ich
Argumente zur Begründung der Thesen bringen und dabei auch versuchen, Gegenthesen zu finden. Einleuchtende Argumente aus dem menschlichen Erkenntnisvermögen und der menschlichen Erfahrung können dabei helfen festzustellen, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit die Thesen stimmig erscheinen.
Schließlich wird der Versuch unternommen, die so gebildeten Hypothesen durch analytische Logik zu stabilisieren und damit zu faktischen Feststellungen zu kommen.
Sollte das gelingen, dann ergeben sich:
… aus den erarbeiteten Feststellungen weitreichende Bezüge zu unserer Vorstellung vom Menschen, also unserem Menschenbild und darüber hinaus in den metaphysischen Bereich hinein, also auch zu den vielen schwurbeligen Vorstellungen, die sich die Menschen (die zwar nicht allmächtig, aber oft eigenmächtig denken und handeln) von einem göttlichen Wesen machen. Es zeigt sich dabei die Irrationalität unseres ach so menschlichen Bildes, das wir uns von einem Gott machen, den wir in unserem christlichen Abendland so naiv wie leichtfertig – und gleichzeitig ignorant unserer eigenen Logik gegenüber – als den „lieben Gott“ bezeichnen. Diese Sätze zwingen zu einer selbstkritisch-relativierenden Fußnote. 1:
Hier nun der Versuch, zu einer eindeutigen Definition der Begriffe ‚Gut‘ und ‚Böse‘ zu kommen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter ‚gut‘ etwas Positives, Förderliches, Angenehmes, Erhaltendes usw. verstanden. Der Sprachgebrauch setzt allerdings ‚böse‘ nicht allein mit dem Gegenteil, also mit dem Negativen, Hinderlichen, Unangenehmen, Zerstörenden usw. gleich, sondern mischt weit mehr als bei ‚gut‘ eine Absicht, also das aktive Handeln einer Person oder einer Macht bei. Das zufällig geschehene Schlechte, z.B. ein Unfall, wird oft nicht als böse tituliert, wenn keine Absicht eines der Beteiligten vorliegt. Damit zeigt sich eines deutlich: Hinter dem Bösen wird ein freier Wille, eine willentliche Bösartigkeit eher vermutet als hinter dem Guten eine willentliche Gutartigkeit.
Wenn dieser Unterschied im Sprachgebrauch durchgängig als richtig angesehen werden müsste, wäre damit die Betrachtung der beiden Begriffe als Antipoden unserer menschlichen Existenz relativiert. Dann wären die beiden Begriffe keine Antipoden, sondern gehörten als Begriffe zu unterschiedlichen Kategorien.
Nun ist es zudem noch so, dass zwischen dem Erleiden und dem Tun von etwas Bösem hinsichtlich der Betrachtung noch ein weiterer Unterschied gemacht wird. Ein Opfer einer Gewalttat empfindet diese als Böses. Der Täter handelte aber – wenn der oben beschriebene Unterschied tatsächlich bestehen sollte – nicht in allen Fällen böse, dann nämlich nicht, wenn er beispielsweise nicht aus freiem Willen, sondern unbedacht oder unkontrolliert triebhaft handelte, wenn er also nicht anders handeln konnte, weil er keine Kontrolle über sich hatte. Unsere Rechtsprechung berücksichtigt dies.
Um den Schwierigkeiten zu entgehen, die für die folgenden Überlegungen aus dieser Unschärfe erwachsen würden, muss hier eine Festlegung der beiden Begriffe erfolgen:
Unter dem Bösen soll hier alles verstanden werden, was dem Menschen als negativ, hinderlich, unangenehm, zerstörend usw. geschieht oder was er tut, ohne Eingrenzung durch böse Absicht.
Für das Gute soll Entsprechendes gelten, also: positiv, förderlich, angenehm, aufbauend oder bewahrend usw., ohne Eingrenzung durch gute Absicht.
Erste These:
Das Gute ist das Spiegelbild des Bösen! Ebenso, wie es ohne Angst keinen Mut geben kann, gäbe es ohne das Böse das Gute nicht. Das Gute hat das Böse zur Voraussetzung, sonst könnten wir es nicht erkennen. Dies gilt auch umgekehrt.
Zweite These:
Selbst in der reinen Theorie gibt es das absolut Gute ebenso wenig, wie das absolut Böse.
Dritte These:
‚Gut‘ und ‚Böse‘ sind von Menschen geschaffene relative Begriffe, über die es folglich auch keine absoluten Urteile, sondern nur relative Urteile geben kann.
Argumente für die erste These:
Der Mensch kann mit den Augen nur einen Gegenstand erkennen, der sich von der Umgebung in irgendeiner Art, sei es durch seine stoffliche Qualität, seine räumliche Form oder seine Farbe unterscheidet. Gleiches gilt auch für alle anderen Sinneseindrücke. Würde er beispielsweise immer nur einen einzigen immer gleich starken Ton hören, würde er nur diesen einen Ton kennen. Dieser Ton wäre für ihn der Normalzustand, den er nicht einmal mehr wahrnehmen würde. Erst ein anderer Ton oder aber Stille würde ihn in die Lage versetzen, den erstgenannten Ton überhaupt zu erkennen. Das gilt für alle Sinneseindrücke. Und es gilt auch für das Erkennen all dessen, was er nur mit seiner Vernunft oder auch mit seinen Emotionen erlebt, z.B. Liebe, Hass, Furcht, Freude, Gefahr, Sicherheit und eben auch Gut und Böse. Würde er das Böse gar nicht kennen, weil es ihm verborgen bleibt oder es tatsächlich nicht existierte, würde er das Gute als den nicht mehr erkennbaren, weil nicht unterscheidbaren Normalfall ansehen, für den er nicht mal einen Namen hätte.
Etwas aber, das der Mensch nicht erkennen kann, für das er also auch keinen Begriff, keinen Namen hat, ist für ihn nicht existent. Die Existenz, das Erkennen und Benennen des Guten, setzt also voraus: die Existenz, das Erkennen und Benennen des Bösen. Ohne das Böse ist das Gute also nicht existent und für uns Menschen nicht denkbar.
Ein mögliches Gegenargument wäre, dass das Gute wie das Böse absolute, vor aller menschlichen Erfahrung und aller menschlichen Erkenntnis liegende, also transzendente Begriffe oder Kategorien seien, die von einem höheren Wesen (also einem Gott) gesetzt sind. Wer ein solches Argument für richtig ansieht, wird die Existenz eines solchen Gottes voraussetzen müssen, da sonst niemand da wäre, bei dem diese Begriffe in Obhut wären. Wie aber könnte ein solcher Gott folgenden Vorgang werten, wie ich ihn hier als selbst erlebtes Beispiel beschreibe?
Ein Habicht hatte eine Amsel geschlagen. Er hielt sie mit seinen Klauen auf dem Boden fest und begann, sie bei lebendigem Leib zu rupfen. Bei jeder Feder, die er der Amsel auszog, öffnete diese gequält den Schnabel, ohne jedoch klagen zu können. Ich konnte dem Geschehen nicht zuschauen und machte mich dem Habicht bemerkbar, worauf der seine Beute fahren ließ und floh.
Der Fang der Amsel war für den Habicht gut, denn er brauchte Nahrung. Der drohende qualvolle Tod war für die Amsel böse. Mein Eingreifen war für die Amsel gut und für den Habicht böse. Und für mich? Ich habe dem Habicht die mühsam gefangene Nahrung entzogen und der Amsel das Leben gerettet, die daraufhin aber einen Schmetterling gefressen hat. Möglicherweise habe ich zudem so den Tod eines Kaninchens verursacht, das sich der Habicht als Ersatz gefangen haben könnte, welches aber Junge im Bau hatte, die nun verhungern mussten, weil die Milch der Mutter fehlte.
Nicht einmal ein Gott kann hier eine schlüssige und allgemein gültige Antwort geben, was denn hier gut und was böse ist. Daraus folgt, dass die Begriffe nicht transzendent anzusiedeln sind, also nicht unter der Obhut einer übersinnlichen und damit göttlichen Kraft stehen können, sondern dass der Mensch sie sich leichtfertig transzendental ausgeliehen hat mit der Unterstellung, dass sie jenseits aller Erkenntnisfähigkeit und Erfahrung des Menschen absolut existent seien.
Auch ist die Zuordnung zu einer Institution (z.B. Gott) nur für eine der beiden Kategorien – also für das Gute – nicht möglich, da er ja gleichzeitig das Böse zugelassen hat und nicht verurteilt. Er kann es auch nicht verurteilen, weil er ja das Fressen und Gefressenwerden mit dem ganzen Universum zusammen geschaffen hat. Denn wenn beispielsweise der Habicht im Sinne dieses Gottes handelte, indem er Nahrung für sich und seine Nestlinge beschaffte, hat zum gleichen Zeitpunkt und Anlass der Gott den Tod der Amsel geduldet.
Das Beispiel zeigt also, dass das Argument greift und das Gegenargument nicht greifen kann. Folglich kann die erste These fortan als Hypothese gelten, bei der zwar die Randbedingungen noch zu klären sind, die sich aber einem Versuch des Beweises stellen kann.
Argumente zur zweiten These: Diese wird ebenfalls zur Erinnerung noch einmal formuliert: Selbst in der reinen Theorie gibt es das absolut Gute ebenso wenig, wie das absolut Böse.
Es gibt keine praktischen, aber auch keine theoretischen Fälle, die das Gute oder auch das Böse in einer absoluten, völlig reinen Form darstellen könnten. Wenige Beispiele können das zeigen. Die Bauernweisheit: „Ist der Mai feucht und nass, füllt es dem Bauern Scheune und Fass“ sagt, dass dem Bauern wohl der Regen im Mai als gut erscheint, weil der Regen im Mai den Pflanzen sehr wichtig ist. Ist Regen im Mai also etwas absolut Gutes? Keineswegs! Dem Liebespaar in den Wiesen am Rhein kommt der Regen sehr ungelegen und der Häsin werden die Jungen in der Sasse krank. Und weiter: Selbst die größten Verbrechen der Menschheit wurden von den Verbrechern selbst oft als gut und notwendig angesehen (das ist nicht die Einstellung des Verfassers!). Und auch: Selbst der Sexualmörder hat wohl bei seinem scheußlichen Tun ein für ihn selbst sehr gutes Gefühl von tiefer Befriedigung empfunden. Für ihn war die Tat also nicht nur schlecht also böse, sondern „nur“ für das Opfer.
Ein mögliches Gegenargument wäre, dass es die Begriffe Gut und Böse gar nicht geben könne, wenn sie nicht wenigstens in der Theorie als rein angenommen werden könnten. Doch überzeugt das Argument nicht, weil diese Begriffe nur menschliche Fiktionen sind, die, wie wir eben gesehen haben, von den Menschen nur als transzendental (hier übersetzt mit „aus dem Bereich außerhalb unseres menschlich Erfahrbaren entliehen“) aber nicht als transzendent (hier übersetzt mit „göttlich verursacht und verwaltet“) angesehen werden können. Wer gibt uns dann aber die Sicherheit, dass unsere Begriffsprägungen nicht in sich widersprüchlich sind, dass es also so etwas wie das absolut Gute (oder Böse) allein schon deshalb geben muss, weil wir es uns denken? Als Hinweis auf einen solchen in sich widersprüchlichen Begriff, der wie alle Begriffe von Menschen geschaffen wurde, soll hier kurz der Begriff der „Allmacht“ genommen werden:
Die Menschen monotheistischen Glaubens ordnen ihrem Gott die Eigenschaft der Allmacht zu, womit gemeint ist, dass dieser Gott alle Macht hat, und alles kann. Der Widerspruch in diesem Begriff ist leicht zu finden durch die Frage: Kann „der Allmächtige“ etwas erschaffen, das er selbst nicht beherrschen kann?
Kann er etwas für ihn selbst nicht Beherrschbares nicht erschaffen, ist er nicht allmächtig.
Wenn er etwas erschaffen kann, das er dann nicht beherrschen kann, ist er ebenfalls nicht allmächtig.
Der gedankliche Fehler, der Widerspruch, ist entstanden durch menschliche Ignoranz unserer eigenen Logik gegenüber. Wir können uns selbst nicht trauen! Wir befrachten diesen Gott mit unsinnigen Eigenschaften! Sind Gut und Böse ebensolche Dummheiten? Zumindest ist das Gegenargument gescheitert, allein das Argument zieht. Aus der zweiten These wird folglich ebenfalls eine Hypothese, die es allerdings ebenfalls noch zu beweisen gilt, nachdem man sie in eine „Wenn-Dann-Beziehung“ hat setzen können.
Argumente zur dritten These:
Diese wird zur Erinnerung ebenfalls noch einmal formuliert: ‚Gut‘ und ‚Böse‘ sind von Menschen geschaffene relative Begriffe, über die es auch keine absoluten, sondern nur relative Urteile geben kann.
Vieles von dem, was bisher über die beiden ersten Thesen an Argumenten und Beispielen gesagt wurde, weist darauf hin, dass auch diese dritte These eine hohe Wahrscheinlichkeit hinsichtlich ihres Bestandes aufweist. Dass die Begriffe Gut und Böse von Menschen gemacht wurden, dass Gut und Böse keine göttlichen Begriffe oder sogar Eigenschaften sein können, wurde schon gezeigt. Dass es sich zudem um relative Begriffe handelt, wird sehr deutlich, wenn man die Urteile verschiedener Menschen zu gleichen Sachverhalten vergleicht. „Was dem einen sein‘ Uhl, ist dem anderen sein‘ Nachtigall“ ist ein volkstümliches (Sprich-) Wort dafür. Billig gekauft ist für den Käufer gut, doch für den Verkäufer bedeutet es unter Umständen den Ruin. Gut und Böse ist immer nur gut oder böse bezogen auf irgendetwas oder irgendwen. Damit fallen auch die Urteile entsprechend aus.
Das mögliche Gegenargument, dass Gut und Böse durch schriftliche Niederlegung z.B. in der Bibel, im Koran oder auch in den säkularen Gesetzbüchern festgelegt sei, unterschlägt gleich mehrerlei. So wird unterschlagen, dass alle diese schriftlichen Niederlegungen von Menschen gemacht sind. Dabei wurden die säkularen Gesetze aus gutem Grund über die Zeit immer wieder geändert. Von den Religionsbüchern wird zwar immer noch oft behauptet, sie seien Gottes Wort und damit ewig gültig, doch wenn man allein die Texte unterschiedlicher Zeiten vergleicht, wird man feststellen, dass es Veränderungen gibt. Damit ist in dieser Behauptung („ewig gültig!“) der logische Fehler offensichtlich. Von diesen angeblich ewig gültigen Worten Gottes sind so viele eindeutig in den jeweiligen historischen Zusammenhang eingebunden, dass sie nur von Menschen stammen können. Deshalb können sie nicht ewig gelten, wie es für Gottes Worte gelten muss und auch beansprucht wird. Die niedergeschriebenen Texte fallen über die Jahrtausende immer wieder „aus der Zeit“.
Auch bei der dritten These ist also die Metamorphose zur Hypothese berechtigt: Gut und Böse sind relative Begriffe. Sie ändern sich mit der Zeit und mit den Menschen.
Ich will nun versuchen, die drei erarbeiteten Hypothesen zu beweisen. Für die erste Hypothese, dass sich Gut und Böse gegenseitig bedingen, kann als Beweis eine Abfolge von logischen Denkschritten dienen:
Das ‚Gute‘ wie auch das ‚Böse‘ sind keine Eigenschaften von irgendwem oder -was, sondern nur ein Mehr oder Weniger in einem willkürlich gewählten Bezugssystem. Dieses Bezugssystem ist von jenen, die es gestalten, immer sehr wohl begründbar. Sei es, um soziale Systeme zu stabilisieren oder um Machtstrukturen zu festigen oder Ähnliches. Die Bezüge richten sich nach Interessenlagen und verändern sich mit der Zeit, sind also nicht absolut fixierbar.
Für die zweite Hypothese, dass es selbst in der reinen Theorie das absolut Gute ebenso wenig gibt, wie das absolut Böse, kann als Beweis folgende Abfolge von logischen Denkschritten dienen:
Für die dritte Hypothese, ‚Gut‘ und ‚Böse‘ seien von Menschen geschaffene relative Begriffe, über die es auch keine absoluten Urteile, sondern nur relative Urteile geben kann, kann als Beweis folgende Abfolge von Denkschritten dienen:
Gut und Böse sind nach all unserer Erfahrung existent. Das absolut Gute und das absolut Böse jedoch kann es nicht geben, wie zuvor erarbeitet worden ist. So verbleibt nur, dass es Gut und Böse nur in verschieden großen Ausprägungen geben kann. Größe und Relevanz dieser Ausprägungen sind zwangsweise von der Betrachtung abhängig. Betrachtungen aber verlangen zumindest einen Standpunkt, von dem aus betrachtet wird. Der betrachtete Sachverhalt, der unter diesen Begriffen einzuordnen ist, steht in einem innerlichen oder tatsächlichen Abstand zum Standpunkt, woraus sich die Relativität ableitet. Die Relativität der Betrachtung ergibt zwingend eine Relativität in den Urteilen. Auch diese logische Feststellung kann nicht widerlegt werden. Was zu beweisen war.
Dass aus den gemachten Feststellungen weitreichende Bezüge zu unserer Vorstellung vom Menschen, also unserem Menschenbild und darüber hinaus in den metaphysischen Bereich hineingezogen werden können, soll im Folgenden gezeigt werden.
Dass Gut und Böse keine bei den Menschen einheitlich bewerteten Begriffe sind, ist den Völkerkundlern ebenso geläufig wie den Religionswissenschaftlern, den Soziologen, den Politikern usw. Es ist erst sehr wenige Jahrzehnte her, dass bestimmte Volksgruppen noch Menschenfresserei zelebrierten. Das war für diese Menschen keine böse Tat, sondern ein geradezu heiliges Ritual, mit dem sie unter anderem erreichen wollten, dass der Mut der besiegten Feinde auf sie überging oder möglicherweise auch, dass die Besiegten auf diese Weise sich nicht in einer Nachwelt an den Siegern rächen konnten. Diese Menschenfresser hatten stabile Sozialstrukturen und ein geordnetes Leben. Waren sie böse?
Heute noch existieren sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Bewertung der Menschenrechte zwischen (z.B.) den Chinesen und der so genannten „westlichen Wertegemeinschaft“. Sind die Chinesen deshalb böse, ist der Westen gut?
Fragen: Warum ist eine Abtreibung böse? Selbstverständlich gibt es darüber sehr unterschiedliche Ansichten. Aber warum ist das so? Ist es nur das Böse, was strafbar ist? War Homosexualität böse, als es noch strafbar war? Würde es heute auch dann nicht als böse gelten, selbst wenn es noch strafbar wäre? Hier brauchen keine weiteren Beispiele aufgezählt werden, sie sind allermeist durchaus bekannt und sie zeigen die Relativität unseres Bildes vom Menschen.
Und Gott? Wie rechtfertigen wir unser Gottesbild? Gott als die Inkarnation des Guten und der Teufel als die des Bösen? Also zwei Götter, ein guter und ein böser? Warum kann der gute und zudem allmächtige Gott den bösen nicht endgültig bezwingen? Oder ist der böse Gott auch allmächtig?
Anmerkung: Auch deshalb kann der „liebe“ Gott nach den Gesetzen der Logik, die er auch gemacht haben muss, wenn er alles erschaffen hat, nicht allmächtig sein. Wenn überhaupt etwas „erschaffen“ worden ist, wer erschuf dann das Böse, wenn nicht Gott, der doch angeblich alles erschaffen hat? Der Mensch kann es keinesfalls gewesen sein, weil er dann so mächtig wäre, wie seiner eigenen Definition nach, sein Gott sein soll. Also ist Gott das Gute und das Böse zugleich und kann deshalb nicht siegen, weil er sich selbst nicht besiegen kann? Wenn das so sein sollte: Kann dann ein Mensch diesen Gott, diesen guten Bösewicht oder bösen Gutewicht „gutgläubig“ um irgendetwas bitten?
Und hier noch einmal der Mensch: Warum bittet er diesen Gott um irgendwelche Ressourcen, von denen er wissen kann und muss, dass sie dann einem anderen fehlen werden? Wäre die Bitte dann nicht ein „me first“ und damit böse? Und darf man eine böse Bitte an einen „lieben Gott“ richten?
Nun höre ich die verächtliche Kritik einiger Gläubiger: Man bitte doch nicht um „Ressourcen“. Man bitte um Schutz, um Zuwendung, man möchte Gott „ins Antlitz schauen“. Letzteres wollte nicht einmal Moses.
Ohne an dieser Stelle näher darauf eingehen zu wollen, sei hier angemerkt, dass aufgrund der hier gefundenen und dargelegten Ergebnisse auch Weiteres ad Absurdum geführt werden kann, so unser übliches Gottesbild, die Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod und von einem „Jüngsten Gericht“; es stürzen weiter die Schöpfungsgeschichte und damit die Gedankenwelt der Kreationisten mit ihrer Behauptung des „Intelligent Designs“ in den Abgrund infantiler Erzählkunst. Gleichzeitig stürzen auch alle monotheistischen Religionskonstruktionen aus ihren Gewissheiten hinsichtlich der Wahrhaftigkeit, der Unumstößlichkeit und der Allgemeingültigkeit ihrer Vorstellungen von einem Gott, weil alle nur selbsterrichtete Gedankengebäude sind.
Um Trugschlüsse zu vermeiden: Mit dieser sarkastischen Kritik wird kein möglicherweise tatsächlich existierender Gott gestürzt oder auch nur negiert. Von der realen Existenz oder Nichtexistenz kann auch der Verfasser nichts wissen.
Nur die hoffärtige Einfalt vieler Menschen wird mit diesen Ergebnissen von ein wenig Nachdenklichkeit in den Hintern getreten. Das wird kaum einen Menschen scheren, da er/sie/es durchweg geneigt ist, fehlendes Wissen, den Mangel an Einsicht, die Brüche in der Logik der Gedankengebäude und damit den Missbrauch der menschlichen Vernunft durch den Hinweis auf den Glauben zu kompensieren. Und er/sie/es wird das mit treuherzigem Augenaufschlag unterstreichen und sich das gleichzeitig als Demutsgeste eitel zugutehalten mit Sätzen wie: „Ich brauche Spiritualität. Ich will, dass es einen Gott gibt. Ich brauche den Trost, dass es nach dem Leben noch etwas gibt. Deshalb glaube ich an diesen Gott! Punktum“!
Antwort: „Okay! Aber erkläre Andersgläubige und Ungläubige nicht zu deinen Feinden und Gegnern. Nimm keine Tötungsund Eroberungsbefehle von deinem Gott an und führe sie nicht aus. Weder als Eroberer noch als Terrorrist, nicht als Volksverführer noch als Weltverbesserer. Erkläre Frauen nicht zu zweitklassigen Menschen, die dem „Manne untertan sind“, und dessen Weisungen folgen müssen. Und so weiter, … usw. Das ist alles in unglaublichem Ausmaß schon geschehen und geschieht auch heute noch.
Wenn die Menschheit damit aufhört, dann: „Ist alles gut“! ______
Die Hoffnungslosigkeit schreit aber an dieser Stelle und ich drohe zu resignieren, wogegen ich ankämpfen muss. Doch halte ich es für gut, zu wissen und einzusehen, dass wir Menschen bei vielen Gelegenheiten zu dumm reagieren. Dagegen will ich bei mir vorgehen.
Deshalb beispielhaft hier mit den zehn Essays zehn solcher kleinen Schritte.
1Ich beginne weiter oben den Satz mit: „Sollte das gelingen …“. Diese Formulierung erscheint als albern vorgetäuschte Bescheidenheit. Natürlich weiß ich schon – während ich das schreibe – ob es und wie weit es aus meiner Sicht heraus (!) gelingt. Schließlich schreibe ich erst, nachdem ich nachgedacht habe und zu einem Ergebnis gekommen bin. Gleichzeitig bitte ich um Entschuldigung dafür, dass ich diese selbstgefällig anmutende Anmerkung nicht unterdrücken konnte.
2. „Der“ Satz des René Descartes
„Ich zweifle, also bin ich“
Die Varianten des Satzes
„Cogito, ergo sum“ „Ich denke, also bin ich“
„Je pense, donc je suis“ „Ich denke, folglich bin ich“
„Cogito, ego sum“ „Ich denke, ich bin“
Der berühmteste Satz des Philosophen, Mathematikers und Naturwissenschaftlers René Descartes (*31.03.1596 in La Haye en Touraine; †11. Februar 1650 in Stockholm) ist seine dogmatisch anmutende Behauptung „Ich zweifle, also bin ich“
Für ihn war diese Festlegung ein „archimedischer Punkt“ 2 , eine unbezweifelbare Tatsache also. Auf diesem Satz basiert seine Philosophie, die sich mit dem Selbstbewusstsein im Sinne von „sich seiner selbst bewusst sein“ beschäftigt. Für ihn war das eigene Denken die einzige unbezweifelbare Entität.
Es gibt weitere Varianten des berühmten Satzes (siehe links), die alle das Gleiche ausdrücken sollen. Und so ist die bekannteste seiner Formulierungen
„Ich denke, also bin ich“
Das Zweifeln des Ich basierte nach seiner Überlegung auf dem Denken des Ich und daraus zu gewinnenden Erkenntnissen.
Gegen diesen Satz von Descartes hat sich vom ersten Moment an, in dem ich mit ihm in Berührung kam, in mir alles gesträubt. Ich war fünfzehn Jahre alt, damals vor mehr als einem halben Jahrhundert. Ich hörte diesen Satz in der Schule und war noch nicht in der Lage, meine eigenen Einwände, ja, meinen Widerwillen gegen diesen Satz für mich selbst eindeutig und verständlich zu formulieren. Was aber hat mich dann gestört? Zuerst einmal war mir unklar, was der Satz sein sollte: Eine Vermutung? Eine Erkenntnis? Ergebnis eines logischen Beweises? Oder einfach nur ein Diktum, also eine festlegende Aussage?
Immerhin hat Descartes darauf seine Philosophie des Dualismus aufgebaut, die noch bis heute fortwirkt. Damit benannte er seine Aufteilung des Menschen in Körper und „Seele“, eine Unterscheidung, die bis heute fortwirkt.
Alle oben aufgezeigten Varianten dieses seines Satzes haben mich schon sehr früh irritiert. Keine konnte ich also akzeptieren. Hierfür war eine Mixtur aus mehreren Gedankengängen ursächlich.
Mein erster, sozusagen instinktiver Eindruck war, dass dieser Satz ein – aus einer Art intelligibler Not heraus entstandener – schon fast verzweifelt anmutender Versuch war, einer existenziellen Ungewissheit hinsichtlich der Basis der eigenen Denkprozesse nach langem, vergeblichem Suchen zu entkommen. Descartes war offensichtlich von Zweifeln geplagt hinsichtlich seiner Erkenntnisfähigkeit, womit er nicht so sehr seine eigene, individuelle menschliche Begrenztheit meinte, derer er sich als hochintelligenter Mensch wohl sehr bewusst gewesen sein wird, als vielmehr die Begrenztheit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit an sich. Er musste sich fragen, auf welchem Fundament sein ganzes Denken – wie überhaupt das Denken jedes vernünftigen Menschen – gegründet sein könne, wenn er sich seiner eigenen realen Existenz als vernunftbegabtes „Wesen“, das da denkt, nicht völlig sicher sein könne.
Er war – so vermute ich bis heute – in einer Situation, vergleichbar der eines Metaphysikers, welcher über Gott, dessen Wesen und Eigenschaften, Absichten und Wertvorstellungen nachdenken will, ohne sich vorweg versichern zu können, dass es einen solchen Gott überhaupt gibt. Ja, diese Problematik der Gewissheit seiner selbst scheint mir bei Descartes sogar größer noch zu sein im Vergleich zu einem Metaphysiker. Denn wer Gott als existent setzt und darauf ein Gedankengebäude aufbaut, kann immer noch festhalten und für sich in Anspruch nehmen, dass das von ihm um diese Grundannahme herum Erdachte in sich schlüssig sei oder zumindest sein könne, solange kein Widerspruch im System selbst gefunden werden kann. Jemand aber, der sich selbst in Frage stellt, stellt damit auch sein eigenes Denken in Frage. Die Logik der Gedankenabfolge und die Schlüsse sind dann von vornherein mit der sich immer wieder neu aufdrängenden Unsicherheit und Befürchtung einer möglichen Unstimmigkeit behaftet. Das konnte Descartes – meiner damaligen jugendlichen Empfindung nach – nicht ertragen, wie es auch für jeden anderen Philosophen – zumindest jener Zeit – vermutlich unerträglich war.
Diese Empfindung, dass hier ein Satz möglicherweise aus intelligibler Not entstanden war, wies mich aber auch auf den zusätzlich möglichen Makel hin, dass dieser Satz ein von Anfang an selbst gesetztes Dogma sein könne, eine einfache Festlegung also, und dass er folglich keine Konklusion, keine wirkliche Schlussfolgerung beinhalte. Damit hatte in meinen Augen Descartes den gleichen Fehler gemacht, der vor allem bei den Metaphysikern immer wieder zu registrieren ist: Die Gesamtheit solcher Gedankengebäude beruht immer auf mindestens einer unbewiesenen und unbeweisbaren Grundannahme, die – weil im Metaphysischen, also jenseits alles Physischen gesetzt – auch prinzipiell unbeweisbar ist. Damit aber verkommt es zum bloßen geistreichen Gedankenspiel, das sich um sich selbst im Kreise dreht, und das wohl unterhaltend sein kann, letztlich aber bedeutungslos ist, obwohl das Gegenteil behauptet wird.
Mein Lehrer hatte zwar auch damals schon zu erklären versucht, dass Descartes eigentlich von der Gegenseite, also vom Zweifel her zu diesem Gedanken gekommen war mit der Überlegung, dass, selbst wenn alles zweifelhaft sei, derjenige, der zweifelt, doch zwangsläufig existent sein müsse, doch sah ich in dieser Begründung keinen wesentlichen qualitativen Unterschied zu den Formulierungen von Descartes, auch nicht, wenn man zwischen Existenz und einem „Existieren“ noch einen Unterschied zu erkennen behauptete. Mir war auch bekannt, dass der von Descartes geprägte Satz ursprünglich etwas anders lautete, nämlich „cogito, ego sum“ (wörtlich übersetzt: „Ich denke, ich bin.“). Das hört sich schon eher nach einem Dogma an, nach einer Festlegung in Sinne von: „Ich lege hiermit fest, dass ich denke und dass ich bin, damit ich überhaupt weitermachen kann als Mensch und Philosoph“.
Anmerkung: Die weitere Möglichkeit, dass die Formulierung „Ich denke, ich bin“ heißen könnte „Ich vermute, dass ich bin“ kann wohl ausgeschlossen werden, da die heute vielfach übliche Doppeldeutigkeit der Wortkombination „ich denke“ mit „ich vermute“ wohl seinerzeit nicht üblich war und zudem eines Philosophen unwürdig gewesen wäre.
Erst in der französischen Übersetzung des Lateinischen wurde aus dem „ego“ das schlussfolgernde „donc“ und in der erneuten Rückübersetzung ins Lateinische das „ergo“. War das ein Übersetzungsfehler? War es Absicht? Hat Descartes im Angesicht des so veränderten Satzes selbst ein „Aha-Erlebnis“ gehabt so in der Art: „Teufel auch, das ist ja noch besser. So formuliert werde ich mit diesem Satz unsterblich!“? Auch Philosophen waren damals schon eitel! Doch ist das im Nachhinein unwichtig, denn Descartes hat diese Veränderung gebilligt, weshalb es so ist, als ob er es selbst auch ursprünglich so formuliert hätte. Er wollte diesen Satz, und sei es erst im Nachhinein, ganz offensichtlich als Schlussfolgerung verstanden wissen.
Als mir das klar wurde, manifestierte sich meine Ablehnung, weil es mir als rechtfertigende Argumentation zu weit ging und ich dem auch heute nicht folgen will.