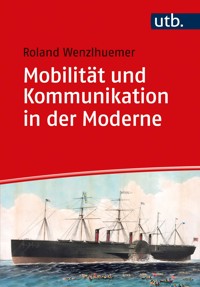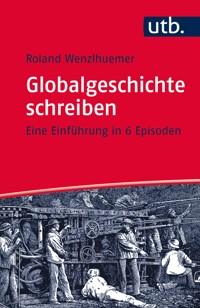
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit dem schnell wachsenden Zuspruch, den die Globalgeschichte in der historischen Forschung findet, haben sich auch ihre Ansätze und methodischen Zugänge vervielfacht. Dieses Lehrbuch verbindet erstmals zentrale Begriffe der Geschichtswissenschaft mit konkreten Beispielen aus der Praxis und zeigt in sechs unterhaltsam zu lesenden Episoden, was Globalgeschichte leistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
utb 4765
utb.
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK/Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
Waxmann · Münster · New York
Roland Wenzlhuemerist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Heidelberg (Foto: Oliver Fink)
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urhberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2017
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Einbandmotiv: Edward Whymper. Escalades dans les alpes. 1873,
Seite 67 (Übersetzung aus dem Englischen)
Druck: CPI · Ebner & Spiegel, Ulm
UVK Verlagsgesellschaft mbHSchützenstr. 24 · D-78462 KonstanzTel.: 07531-9053-0 · Fax 07531-9053-98www.uvk.de
UTB-Band Nr. 4765
ISBN 978-3-8252-4765-2 (Print)
ISBN 978-3-8463-4765-2 (EPUB)
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Globalgeschichte …
Was kann Globalgeschichte?
Globalgeschichte als Perspektive
Globalgeschichte als Verbindungsgeschichte
Globalgeschichte und Globalisierung
Zur Forschungspraxis der Globalgeschichte
Verbindungen: Der große Mondschwindel
Verbindungen in der Globalgeschichte
Der Mond …
… und die Sonne
Verbindungen und Nicht-Verbindungen
Redux: Verbindungen in der Globalgeschichte
Raum: Anbindung und Isolation
Raum in der Globalgeschichte
Der Telegraf und die angebliche Vernichtung des Raums
Fanning und Cocos: Zur Pluralität von Kommunikationsräumen
Redux: Raum in der Globalgeschichte
Zeit: Telegrafie und Zeitstrukturen
Zeit in der Globalgeschichte
Telegrafie und Zeit
Telegrafie, Raum und Zeit
Telegrafie und Zeitempfinden
Redux: Zeit in der Globalgeschichte
Akteure: Meuterei auf der Bounty
Akteure in der Globalgeschichte
Huzza for Otaheite
Die Brotfruchtmission
Südsee und Karibik
Globale Akteure
Redux: Akteure in der Globalgeschichte
Strukturen: Durchbruch am Mont Cenis
Strukturen in der Globalgeschichte
Der Mont Cenis
Tunnelbau am Mont Cenis
Die Mont Cenis Pass Railway
Akteure und Strukturen
Redux: Strukturen in der Globalgeschichte
Transit: Die Flucht von Dr. Crippen
Transit in der Globalgeschichte
Schiffspassagen
Der Crippen-Fall
Weltinteresse
Gefangen im Transit
Die Verhaftung
Redux: Transit in der Globalgeschichte
… schreiben
Globalgeschichten
Redux: Was kann Globalgeschichte?
Nachweise
Quellen
Forschungsliteratur
Abbildungen
Personenregister
Sachregister
Danksagung
In diesem Buch kommen Gedanken und Vorarbeiten aus ganz unterschiedlichen Forschungs- und Diskussionskontexten zusammen. Es ist über viele Jahre gewachsen, mal langsamer und mal schneller. Während dieser Zeit haben sich zu meinem großen Glück eine Menge kluger, kreativer und duldsamer Menschen in das Projekt mithineinziehen lassen. Martin Dusinberre musste sich viele meiner frühen Ideen anhören und hat mich vor so mancher bewahrt. Andreas Hilger, Christoph Streb und Benedikt Stuchtey haben das Manuskript aufmerksam kommentiert und mir wertvolle Blickwinkel eröffnet. Unser hervorragendes Team an der Professur für Neuere Geschichte der Universität Heidelberg hat weder sich noch mich geschont. Uta C. Preimesser vom UVK -Verlag hat Autor und Idee auch zu Zeiten vertraut, als dazu wenig Anlass bestand. Ihnen und vielen anderen gilt mein bester Dank.
Die Grundlage für meine Arbeit ist meine Familie. Ihr widme ich dieses Buch.
Roland Wenzlhuemer
März 2017
Globalgeschichte …
Was kann Globalgeschichte?
Globalgeschichte wird gemeinhin überschätzt – und zwar in ihren Möglichkeiten. Mit dem schnell wachsenden Zuspruch, den die Globalgeschichte im breiteren Feld der historischen Forschung findet, haben sich auch die Erwartungen, die an sie herangetragen werden, vervielfacht. Wie unter anderem Sebastian Conrad in seiner jüngsten, bestens gelungenen Einführung in die Globalgeschichte festhält, ist das ursprüngliche Interesse an einem globalhistorischen Ansatz aus der Überzeugung vieler Historikerinnen und Historiker hervorgegangen, dass die bekannten Analyseinstrumente für eine adäquate Interpretation der Geschichte im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr ausreichen. Conrad sieht vor allem zwei Defizite, mit denen sich die Globalgeschichte nicht abfinden wollte: die Festlegung auf den Nationalstaat als primären (mitunter einzigen) Beobachtungsrahmen und den damit einhergehenden „methodologischen Nationalismus“1 sowie einen tief sitzenden Eurozentrismus, der für die Geschichtswissenschaft einen unverrückbaren Blickpunkt und festen Maßstab darstellte. Für Conrad war und ist die Globalgeschichte zuallererst ein Versuch, diese beiden „Geburtsfehler“ der modernen Geschichtswissenschaften zu adressieren.2
Das ist ein überaus ehrenvoller, aber schon einmal kein kleiner Anspruch für ein im Entstehen begriffenes Feld. Und mit der festen Etablierung der Globalgeschichte im historischen Feld sind kontinuierlich neue Aufgaben und Herausforderungen dazugekommen. So hat beispielsweise Patrick O’Brien in seinem Prolegomenon zur ersten Ausgabe des Journal of Global History angemerkt, dass Globalhistorikerinnen und -historiker sich dafür entscheiden würden, sich frei zu machen von „disciplinary boundaries, established chronologies and textual traditions for the construction of European, American, Indian, Japanese, Chinese or other national histories.“3 Martin Dusinberre hat kürzlich auf eindrucksvolle Weise davon gesprochen, dass die Globalgeschichte eine Pluralität von verschiedenen Stimmen zulassen müsse.4 Und nicht zuletzt wird auch darauf hingewiesen, dass all dies mit einer Internationalisierung der Forschungspraxis einhergehen müsse.5
Aus all diesen jeweils völlig berechtigten Forderungen, die allesamt schwerwiegende Lücken und Unwuchten der Geschichtswissenschaft ansprechen, ergibt sich in ihrer Gesamtheit ein dermaßen anspruchsvolles theoretisch-methodisches Programm, dass die Einlösung desselben zu einer schweren Last auf den Schultern der Globalgeschichte wird. Die Defizite, die es durch die Globalgeschichte zu überwinden gilt, verweisen im Kern auf die grundlegenden theoretisch-methodischen Probleme der Geschichte als Wissenschaft: auf Fragen der Standortgebundenheit, der Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Objektivität, auf den Zuschnitt von Beobachtungsrahmen und Fächergrenzen. Konsequent zu Ende gedacht ergibt sich aus diesem Programm das Verlangen nach einer grundlegenden Neuperspektivierung der Geschichtswissenschaft, die letztlich auch mit neuen Organisations- und Arbeitsformen einhergehen muss. Aus einem solchen Anspruch heraus kann es auch nicht genügen, wenn die Globalgeschichte alleine sich müht zu dezentrieren,6 den nationalen Rahmen aufzubrechen oder Disziplinengrenzen zu überwinden. Ihr Beispiel muss von der Geschichtswissenschaft insgesamt aufgenommen werden.
Es ist nicht verwunderlich, dass aus einem solchen Anspruch – oder tatsächlich eigentlich aus einem Bündel von Ansprüchen – schnell eine grundlegende Überforderung folgen kann. Stellt sich doch sofort die Frage, auf welchem Wege und mit welchen Werkzeugen man dies auch nur ansatzweise einlösen kann. Wie genau kann es die Globalgeschichte schaffen, die von ihr identifizierten Defizite und Problemlagen zu adressieren und darüber hinaus auch noch eine grundlegende Rekalibrierung der Geschichtswissenschaft insgesamt anzuschieben? Man könnte nochmals zuspitzen und fragen: Was will die Globalgeschichte eigentlich wissen? Was ist ihr eigenes Erkenntnisinteresse? Und wichtiger noch, wie will sie aus dem gewonnen Wissen, aus der neuen Erkenntnis heraus, zur Überwindung zum Beispiel des Eurozentrismus oder eines methodologischen Nationalismus beitragen? Insbesondere die Frage nach dem Erkenntnisinteresse der Globalgeschichte ist in Wort und Schrift bereits auf vielfältige Weise diskutiert worden, die Rückbindung an die größere Zielsetzung des Feldes ist dabei üblicherweise aber kaum vollzogen worden. Dominic Sachsenmaier hat auf die „notwendige Unmöglichkeit“, Globalgeschichte zu definieren, hingewiesen.7 Diese Unmöglichkeit verweist auf die Lücke, die sich in der globalhistorischen Forschung zwischen geschichtstheoretischer Zielsetzung und geschichtswissenschaftlichem Erkenntnisinteresse auftut. Es ist viel darüber nachgedacht und auch geschrieben worden, was die Globalgeschichte eigentlichist – und mitunter ist diese gemeinsame Frage sehr unterschiedlich beantwortet worden.8 Viel weniger explizit wurde bisher danach gefragt, was die Globalgeschichte eigentlich innerhalb des breiten Ensembles der Geschichtswissenschaft leisten kann, was in diesem Zusammenhang ihre Mittel sind und wie sie mit ihrem Blick, mit ihrem Instrumentarium letztlich dazu beitragen kann, ihre eigenen Ansprüche einzulösen.
Daraus ergeben sich die Leitfragen dieses Buches: Was kann Globalgeschichte leisten und wie kann sie das? Die oben skizzierten Ansprüche einlösen zu wollen, überfordert das Forschungsund Lehrprogramm der Globalgeschichte insofern, als sich daraus kein klarer Zugang, keine Fragestellung ableiten lässt. Schon deshalb sollte man globalhistorische Forschung nicht als Lösungsweg verstehen, sondern als Problematisierung und kritische (Selbst)Reflexion, die im Idealfall zu einer Teillösung werden kann. Ein gutes Beispiel findet sich in Andrea Komlosys Einführung in die Globalgeschichte. Hinsichtlich etwa des Eurozentrismus sieht Komlosy die Aufgabe des Feldes zunächst einmal in der Freilegung eurozentrischer Bilder und Denkmuster. „Globalhistoriker bemühen sich, regional bedingte Weltsichten in ihrem jeweiligen Kontext zu verstehen.“9 Der Globalgeschichte fällt aus dieser Warte eine aufzeigende, nicht unbedingt eine überwindende Funktion zu. Es sollte darum gehen, mithilfe einer klaren und operationalisierbaren Fragestellung die persistenten Unwuchten historischen Denkens jenseits einfacher Generalisierungen deutlich aufzuzeigen, den Blick der Geschichtswissenschaften dahin zu lenken, wo etablierte Interpretationsmuster zu kurz greifen. Ein solcher Anspruch ist für die Globalgeschichte, die heute zumeist als spezifische Perspektive auf die Geschichte gesehen wird,10 auch einzulösen. Ein Perspektivenwechsel oder eine Perspektivenerweiterung können den Blick auf die oben skizzierten Probleme freigeben, können so Standort- und Maßstabsgebundenheit immer wieder kritisch in Erinnerung rufen. Das kann die Globalgeschichte als Perspektive leisten. Überwinden aber kann sie diese grundlegenden Bedingungen historischen Denkens nicht – nicht einmal durch die Multiplikation von Standorten und Maßstäben.
Globalgeschichte als Perspektive
Es bleibt die Frage, wie die Globalgeschichte das leisten kann. Welches Erkenntnisinteresse liegt ihr zugrunde? Was soll sie zeigen? Aber auch, welche Mittel stehen ihr dafür zur Verfügung und wie lassen sich ihre Fragen an die Geschichte operationalisieren? Dieses Buch wird versuchen, diese und andere Fragen zu adressieren. Es ist natürlich nicht das erste Werk, das sich damit auseinandersetzt. Historikerinnen und Historiker machen sich bereits seit einigen Jahren darüber Gedanken, was die Globalgeschichte eigentlich genau wissen will. Und auch über die Ansätze und Methoden der Globalgeschichte gibt es mittlerweile eine rege Diskussion. Selten aber werden diese beiden Teile – also die Frage nach dem globalhistorischen Erkenntnisinteresse und die Frage nach dem diesbezüglichen Vorgehen – direkt miteinander in Abstimmung gebracht. Oft stehen sie eigenartig separiert voneinander. Es mangelt an der Operationalisierung globalhistorischer Fragestellungen, an der Brücke zwischen theoretischem Anspruch und empirischer Umsetzung. In diesem Buch möchte ich Bausteine für genau diese Brücke zur Verfügung stellen, ohne dabei aber der Illusion zu verfallen, auf den wenigen Seiten und mit einer Handvoll Konzepten und Fallstudien diese bereits fertig bauen zu können.
Vielmehr will ich aufzeigen, wie die Globalgeschichte einzelne ihr bereits zur Verfügung stehende Begriffe und Konzepte so anwenden kann, dass die Wirkmächtigkeit eines globalen Handlungs- und Bezugsrahmens für das Denken und Handeln historischer Akteure nicht nur deutlich wird, sondern dieser in seiner Bedeutung auch in einen breiteren historischen Kontext eingebettet werden kann. Dieses Buch bringt dabei verschiedene Konzepte zur Anwendung, auf die im Folgenden noch näher einzugehen sein wird. Allesamt verweisen sie im Kern aber auf den Begriff der Verbindung – im Zusammenhang der Globalgeschichte im Sinne einer globalen oder transregionalen Verbindung –, der den konzeptuellen Dreh- und Angelpunkt der vorliegenden Überlegungen bildet. Nun ist der Begriff der Verbindung in der Globalgeschichte alles andere als neu oder ungewöhnlich. Im Gegenteil, er gehört zum meistverwendeten Vokabular des Feldes und ist nicht zuletzt deshalb zu einer Art terminologischem Passepartout geworden. Will man den Begriff aber nicht nur als gefälliges Label nutzen, sondern wissenschaftlich produktiv machen, so steht seine analytische Zuspitzung an. Was ist eine globale Verbindung und wie können wir sie theoretisch-methodisch fassen? Was unterscheidet globale Verbindungen von anderen Verbindungsarten? Wie können solche Verbindungen geschichtsmächtig werden? Letztlich, welche Rolle spielen sie hinsichtlich des Erkenntnisinteresses der Globalgeschichte? Verschiedene Verständnisse globalhistorischer Forschung warten mit jeweils unterschiedlichen Antworten auf diese Fragen auf. Eine Auseinandersetzung mit diesen Antworten lohnt, um das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Verbindung nachvollziehbar herzuleiten.
Sebastian Conrads in den letzten Jahren vorgelegte Einführungen in die Globalgeschichte stellen die im Moment wohl gelehrtesten und umsichtigsten Arbeiten in diesem Zusammenhang dar. Daher bilden seine Systematisierungsversuche und Zusammenführungen einen wesentlichen Referenzpunkt für viele der im Folgenden skizzierten Überlegungen. Entsprechend oft werde ich auf den nächsten Seiten auf sein Verständnis von Globalgeschichte Bezug nehmen und versuchen, darauf aufzusetzen.
Conrad identifiziert in der deutschsprachigen,11 noch ausführlicher aber in der englischsprachigen12 Einführung drei Hauptvarianten globalhistorischer Forschung, in denen globale Verbindungen jeweils unterschiedliche Rollen und Gewichtungen haben. Der ersten von ihm vorgestellten Variante liegt ein Verständnis globalhistorischer Forschung als Syntheseleistung zugrunde. Die Globalgeschichte, so Conrad, würde aus diesem Blickwinkel heraus als Weltgeschichte im wörtlichen Sinn verstanden. Sie umfasse alles, was jemals weltweit passiert sei. Die Versuche, diesen größtmöglichen Rahmen auszufüllen, können aber unterschiedlich ausfallen. So gibt es Großsynthesen, die tatsächlich versuchen, die wesentlichen historischen Entwicklungen einer bestimmten Zeit oder Epoche weltweit zu erfassen und integrativ darzustellen. Solche Darstellungen müssen notwendigerweise stark auswählen, welche Phänomene sie für relevant halten. Sie bleiben an der Oberfläche, sind sehr selektiv. Auf ein ähnliches Verständnis der Globalgeschichte bauen auch jene unzähligen Studien auf, die einem bestimmten Gegenstand durch Zeit und Raum der Weltgeschichte folgen. Für Pamela Crossley stellt diese Form der Globalgeschichte in ihrer Gesamtheit sogar den ultimativen Zugang dar. In ihrer Einführung in das Feld verwendet sie die Metapher eines context spinners, also eines natürlich nur hypothetischen Instruments, das die globale Geschichte jeweils aus der Warte eines bestimmten Materials, Produkts, Konzepts oder Naturphänomens sequenzieren könnte. Entstehen würden dabei jeweils integrierte globale Darstellungen zum Beispiel der Geschichte der Seide oder der Auswirkungen von Erdbeben, um nur zwei der von Crossley genannten Beispiele wiederzugeben.13 Die Kontextspinnmaschine würde uns anhand einzelner Themen durch die Geschichte der Welt führen und so eine Globalgeschichte ermöglichen. Dass ein solcher Ansatz überaus interessante Arbeiten hervorbringen kann, ist unbestritten. Aus globalhistorischer Warte handelt es sich aber auch hier um eine Syntheseleistung. Conrad weist schließlich auch darauf hin, dass Studien zu einzelnen, klar umrissenen Themen – er nennt die Geschichte der Arbeiterklasse in Buenos Aires, Dakar oder Livorno als Beispiel – aus dem skizzierten Verständnis heraus ebenfalls zu einer Globalgeschichte – in diesem Fall jener der Arbeit – beitragen können, ohne selbst den globalen Horizont ihres Gegenstandes zu untersuchen.14 Auch das ist eine Form der Synthese, und zwar einer arbeitsteiligen. All diesen Einzelansätze innerhalb dieses synthetischen Verständnisses von Globalgeschichte ist gemein, dass ihre Geschichten von gemeinsamen großen Rahmen zusammengehalten werden, nicht aber von einer inneren Kohärenz. Globale Verbindungen kommen in dieser Variante von Globalgeschichte natürlich vor, allerdings üblicherweise nicht als erkenntnisleitende Elemente.
In der zweiten von Conrad skizzierten Variante von Globalgeschichte spielen globale Verbindungen eine ganz zentrale Rolle. Dieses Verständnis des Feldes baut auf der Annahme auf, dass keine Kultur, keine Gesellschaft in völliger Isolation existiert, und Austauschprozesse eine wesentliche Bedeutung für ihre historische Entwicklung haben.15 In dieser Hinsicht gehört ein Fokus auf Verbindungen zu den wenigen wirklich konsensfähigen Eigenschaften der jüngeren Globalgeschichte. Die meisten Autorinnen und Autoren, die sich über die theoretisch-methodische Ausrichtung des Feldes Gedanken gemacht haben, verweisen an irgendeiner Stelle darauf, dass die Globalgeschichte sich mit der Rolle globaler oder transregionaler Verbindungen und den auf ihnen beruhenden, sich wechselseitig beeinflussenden Prozessen in der Geschichte beschäftigen soll.16 Allerdings wird dies nur selten in einer Form weiter ausgeführt, die es erlauben würde, daraus Rückschlüsse über die tatsächliche analytische Bedeutung von globalen Verbindungen zu ziehen. Was ein solcher Fokus auf Verbindungen konkret heißt, was die Globalgeschichte in dieser Hinsicht genau wissen will, welchen Erkenntnisgewinn sich das Feld davon erhoffen kann oder selbst die scheinbar simple Frage danach, was eigentlich als globale Verbindung zu werten ist – all das sind Fragen, auf die kaum einmal explizit eingegangen worden ist. Darum ist der Verweis auf die zentrale Bedeutung von Verbindungen, um abermals einen Gedanken von Sebastian Conrad zu borgen, unter Globalhistorikern als eine Art Schibboleth zu verstehen,17 das jenseits seiner Rolle als Zugehörigkeitszeichen relativ leer und vage bleibt, dadurch aber von jedem nach Gusto gefüllt und interpretiert werden kann. Für die globalgeschichtliche Forschung muss das ein nicht zufriedenstellender Zustand sein. Denn einerseits schiebt der stete Verweis auf die grundlegende Bedeutung von globalen Verbindungen diese ins Rampenlicht. Auf ihnen ruht der forschende Blick der Globalgeschichte. Gleichzeitig bleibt aber zumeist unklar, was damit konkret gemeint ist und wie man mit Verbindungen in der Forschungspraxis umgehen könnte. Damit werden Verbindungen zwar einerseits als zentraler Gegenstand der Globalgeschichte identifiziert, sie können zugleich aber keine erkenntnisleitende Funktion entfalten. Das ist bedauerlich, weil die analytische Konzentration auf globale Verbindungen und ihre Bedeutung in der Geschichte der globalgeschichtlichen Forschung gute Dienste leisten kann, wie im weiteren Verlauf dieses Buches ausführlich argumentiert wird.
Globalgeschichte als Verbindungsgeschichte
Kehrt man zu Sebastian Conrads Diskussion der drei Hauptvarianten von Globalgeschichte zurück, so zeigt sich dort ein ähnliches Unbehagen mit der Vagheit des Verbindungsbegriffs. Conrad zweifelt nicht grundsätzlich an der Wichtigkeit eines Fokus auf Verbindungen, für ihn kann das aber nur der Ausgangspunkt globalhistorischer Forschung sein.18 Vor allem aber müsse es der Globalgeschichte um die Bedingungen und beständigen Strukturen gehen, unter denen Verbindungen entstehen und wirken. „Exchange, in other words, may be a surface phenomenon that gives evidence of the basic structural transformations that made the exchange possible in the first place.“19 Conrad verweist darauf, dass die ersten beiden von ihm skizzierten Varianten der Globalgeschichte – also die Synthese und der reine Fokus auf Verbindungen – prinzipiell auf alle Zeiten und alle Orte,20 und man möchte ergänzen: alle Gegenstände, angewandt werden können. Die Globalgeschichte ist in diesem Zusammenhang eine Perspektive. Sie sei – und das ist Conrads dritte Variante – aber eben auch ein Gegenstand. Die sinnvolle Anwendbarkeit der Perspektive hängt aus dieser Sicht unter anderem von den strukturellen Bedingungen globaler Integration ab, also im Kern von der Frage, ob globale Verbindungen sich bereits strukturell verfestigt haben.21 In Conrads Argumentation macht nur eine solche Kombination von Perspektive und Gegenstand einen differenzierten analytischen Umgang mit globalen Verbindungen möglich. Ausgeführt wird dies unter anderem anhand des Beispiels der Einführung westlicher Uhren in Japan. Als dies im 17. Jahrhundert erstmals geschah, hätte dies praktisch keine Auswirkungen auf das soziale Zeitregime gehabt. Vielmehr wären die Uhren in das lokale Zeitregime integriert worden. Ganz anders im 19. Jahrhundert: Durch den höheren Grad globaler struktureller Verflechtung wären westliche Zeitmessungsinstrumente nun zu Symbolen der Modernisierung geworden. Das lokale Zeitregime hätte sich dramatisch verändert.22
Dieses und andere Beispiele für die Bedeutung struktureller globaler Integration sind in vielerlei Hinsicht instruktiv. Insbesondere, weil sie tatsächlich unterschiedliche Bedingungen von Verflechtung und Austausch aufzeigen und damit völlig zu Recht auf die Notwendigkeit einer Kontextualisierung von globalen Verbindungen hinweisen. Allerdings zeigt sich hier auch, welche konzeptuellen Schwierigkeiten sich aus der Gleichzeitigkeit von Perspektive und Gegenstand für eine analytische Schärfung der Globalgeschichte ergeben. Während Conrad in dieser dritten Variante den ergiebigsten Pfad globalhistorischer Forschung sieht und darauf hinweist, dass die meisten differenzierten Studien der letzten Zeit einen solchen Weg verfolgen würden,23 argumentiere ich in diesem Buch, dass es dadurch schwierig wird, ein Erkenntnisinteresse und damit auch einen konzeptuellen Kern der Globalgeschichte zu formulieren.
Prinzipiell ist Sebastian Conrad zuzustimmen, dass globale Verbindungen nicht alles erklären, nicht der Dreh- und Angelpunkt jeder Argumentation sein können. Wie jedes andere historische Phänomen sind sie in ihren Kontext einzubetten und in ihrer Bedeutung zu gewichten. Die Frage ist in diesem Zusammenhang daher vielmehr, wie eine solche sorgfältige Einordnung der Geschichtsmächtigkeit und damit verbunden die Herausarbeitung der spezifischen Qualität von globalen Verbindungen am besten erreicht werden kann. Eine Schwerpunktsetzung auf das, was Conrad „globale Integration“ nennt, erscheint mir in dieser Hinsicht nur bedingt hilfreich, weil dadurch analytischer Kern und interpretativer Kontext miteinander vermischt werden und sofort neue Ungewissheiten auftauchen. So stellt sich unmittelbar die Frage nach der Schwelle, an welcher Globalgeschichte zum Gegenstand wird. Wie sehr müssen sich globale Verbindungen verfestigen, wie dicht und tragfähig müssen globale Strukturen sein, damit wir von einem globalhistorischen Gegenstand sprechen können? Nehmen wir das ansonsten instruktive Beispiel westlicher Uhren in Japan. An welchem Punkt im 19. Jahrhundert ist Meiji-Japan genügend dicht mit der (westlichen) Welt integriert, dass wir fortan einen globalhistorischen Sachverhalt vor uns haben? Waren westliche Uhren in Japan vor diesem Punkt kein Fall für die Globalgeschichte, danach aber schon?
Die Frage nach der (im Übrigen schwer zu fixierenden) Schwelle mag banal klingen. Sie zeigt aber, wie sehr ein Fokus auf Integration, Verfestigung und Strukturbildung von der analytischen Schärfung globaler Verbindungen selbst ablenkt. Im Kern sollte es der Globalgeschichte darum gehen, wie durch das Handeln von Menschen globale Verbindungen entstehen und wie diese wiederum auf das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zurückwirken. Das kann innerhalb und außerhalb von strukturell verfestigten Bedingungen stattfinden. Diese zählen daher zu einem multifaktoriellen Kontext, in den das Wechselspiel zwischen menschlichen Akteuren und globalen Verbindungen selbstverständlich einzubetten ist. Das Erkenntnisinteresse und damit der analytische Fokus der Globalgeschichte sollte aber nicht auf diesem Kontext ruhen, sondern sich auf die Schnittstelle zwischen menschlichem Handeln und globalen Verbindungen konzentrieren.
Conrad, so kann man an dieser Stelle annehmen, würde hier entgegenhalten, dass globale Verbindungen natürlich entscheidende Elemente sind und in der Globalgeschichte immer eine zentrale Rolle einnehmen werden, ihre Absolutsetzung einem Erkenntnisgewinn aber nicht zuträglich ist. Er sieht in diesem Zusammenhang die Gefahr der Nivellierung und Gleichsetzung gänzlich unterschiedlicher Verbindungszusammenhänge und nennt auch ein Beispiel dafür. So hätte der gewaltsame Tod des letzten Maurya-Königs im Jahr 185 BCE und der damit verbundene Zusammenbruch seines Reiches zwar dramatische Auswirkungen auf Südasien und die hellenistische Welt gehabt, mit den Folgen des Attentats auf Franz Ferdinand im Jahr 1914 sei das aber nicht zu vergleichen, weil die Welt mittlerweile einen gänzlich anderen Integrationsgrad erreicht hätte.24 Dem Befund selbst kann man natürlich nur zustimmen. Aber auch hier handelt es sich letztlich um eine Frage der Einordnung und Gewichtung globaler Verbindungen und nicht um einen fundamentalen analytischen Unterschied hinsichtlich ihrer Geschichtsmächtigkeit. Man kann den gänzlich unterschiedlichen Grad globaler Integration in den beiden Vergleichsfällen nicht leugnen. Aber wer würde das überhaupt versuchen? Die wirklich spannende Frage ist doch, wie ein Ereignis – hier jeweils ein Attentat – sich über globale bzw. transregionale Verbindungen auf das Denken und Handeln anderer Menschen auswirkt.
Conrad, so kann man seine wohlüberlegte Argumentation zusammenfassen, meint, die Globalgeschichte hätte sich bisher zu viel mit bloßen Verbindungen auseinandergesetzt und zu wenig mit deren strukturellen Verfestigungen. Er plädiert dafür, die Globalgeschichte als Perspektive um die Globalgeschichte als Gegenstand zu erweitern. Das vorliegende Buch hingegen behauptet, dass die Globalgeschichte sich bisher viel zu wenig mit globalen Verbindungen auseinandergesetzt hat; und zwar zu wenig genau, zu wenig analytisch differenziert. So hat die Globalgeschichte bisher eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang praktisch völlig übergangen: Was macht globale oder transregionale Verbindungen eigentlich besonders? Was hebt sie von lokalen oder regionalen Verbindungen, die formgebende Elemente jeder Gemeinschaft sind, analytisch ab? Inwiefern funktionieren sie unterschiedlich? Wo liegt ihre besondere Qualität, die es rechtfertigt, überhaupt von der Globalgeschichte als eigenständiger Perspektive zu sprechen? Auch diese Fragen mögen auf den ersten Blick selbstevident erscheinen, sind es aber in keiner Weise.
Im Gegenteil, nimmt man sie ernst, so stellen sie sich als ungewöhnlich schwierig zu erörtern und zu beantworten heraus. Die konsequente Auseinandersetzung mit ihnen hat aber für die globalhistorische Forschung zumindest zwei hilfreiche Effekte. Erstens verweist die Frage nach dem analytisch Besonderen globaler Verbindungen automatisch auch auf andere Faktoren und deren Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen. Eine weitreichende Kontextualisierung und differenzierte Gewichtung der untersuchten Phänomene ist die Folge. Globale Integrations- und Strukturbildungsprozesse und letztlich auch die Frage nach der Wirkmächtigkeit globaler Strukturen, die in diesem Buch in einem eigenen Kapitel ausführlich erörtert wird, müssen in diesem Zusammenhang als einer unter vielen Faktoren berücksichtigt werden. Zweitens schafft die Konzentration auf die Qualität der Verbindung selbst ein konzeptuelles Abstraktum, das den Kern des Erkenntnisinteresses der Globalgeschichte umfasst, diesen aus seinen spezifischen Kontexten zuerst einmal isoliert, um ihn dann wieder einbetten zu können. Dieses Abstraktum soll für die Globalgeschichte forschungsleitend sein. Es macht das Feld konzeptuell eigenständig und erlaubt es ihm, einen genuinen Beitrag zur Geschichtswissenschaft zu leisten, der über eine weltgeschichtliche Synthese oder ein reines Aufnehmen des Erkenntnisinteresses anderer Forschungsfelder – wie zum Beispiel der postcolonial studies oder der area studies – hinausgeht.
Eine solche Konzentration auf globale Verbindungen stellt keine Einengung der globalhistorischen Perspektive dar, sie unterschlägt nicht die Gegenständlichkeit globaler Integrationsprozesse, sondern ermöglicht es im Gegenteil, den globalhistorisch geschulten Blick in ganz unterschiedlichen Bereichen schweifen zu lassen und dennoch eine stete Rückbindung an das grundlegende Explanandum zu spüren. Wie und warum schaffen Menschen in ganz unterschiedlichen Lagen und Kontexten globale oder transregionale Verbindungen? Und wie wirken diese auf den Menschen zurück? Diese simple Fragestellung hat es in sich. Es geht um das Ausloten der Geschichtsmächtigkeit globaler Verbindungen. Dass dabei das Lot irgendwann den Grund berührt, dass die Grenzen des Einflusses von Transfer und Austausch in vielen Fällen vielleicht sehr schnell erreicht sind, das gehört zum Prozess der Gewichtung dazu. Das Ziel muss die Einordnung von globalen Verbindungen in ein Faktorenensemble sein, auch wenn das manchmal bedeutet, dass sie kaum eine oder keine Rolle spielten.
Um auf die eingangs angeführten Aufgaben der Globalgeschichte zurückzukommen, so erlaubt es ein durch ein Abstraktum geschärfter und geführter Fokus auf globale Verbindungen der Globalgeschichte vielleicht klarer als anderen Forschungsfeldern aufzuzeigen, dass eine Engführung auf die Nationalgeschichte zu kurz greift, dass ein eurozentrischer Blick der Geschichte nicht gerecht wird, das viele Stimmen schweigen oder überhört werden. Letztlich sind dies aber keine globalhistorischen Problemlagen, sondern Herausforderungen jeder historiografischen Arbeit. Aufgenommen werden müssen diese Einsichten daher von der Geschichtswissenschaft insgesamt.
Globalgeschichte und Globalisierung
Dieses Buch ist keine typische Einführung in die Globalgeschichte. Es ist nicht der Versuch einer systematischen Erschließung des globalhistorischen Forschungsfeldes, wie ihn viele namhafte Autorinnen und Autoren in den letzten Jahren unternommen haben. Dieses Buch bietet keinen Überblick über die Geschichte der Globalgeschichtsschreibung.25 Es diskutiert auch keine spezifischen Methoden der Globalgeschichte26 oder stellt in geordneter Weise mögliche Themen globalhistorischer Forschung vor.27 Noch weniger setzt es sich mit der Institutionalisierung der Globalgeschichte und der damit verbundenen Forschungslandschaft auseinander.28 Letztlich lotet es nicht einmal systematisch die Potentiale und Stolperfallen globalhistorischer Ansätze aus.29 Stattdessen versteht sich dieses Buch als Einführung in die Forschungspraxis – und zwar in der Form einer konzeptuellen Schärfung des Feldes und durch den Versuch, Theorie und Empirie soweit wie möglich zusammenzubringen.
Theorie meint in diesem Zusammenhang vor allem die Schaffung eines konzeptuellen Abstraktums und damit den Versuch, begrifflich über eine reine Oberflächenbeschreibung globalhistorisch relevanter Phänomene hinauszukommen. Ausgehend von einem verallgemeinerbaren Erkenntnisinteresse der Globalgeschichte will dieses Buch in theoretischer Hinsicht Leitfragen entwickeln, entlang derer in den Sozial- und Geisteswissenschaften bereits eingeführte analytische Begriffe in globalhistorischen Zusammenhängen fruchtbar gemacht werden können. Durch Adaption dieser Begriffe erfolgt die notwendige Operationalisierung der Forschungsfragen. Sie schließen die Lücke zwischen Theorie und Empirie, die sich in der Globalgeschichte erfahrungsgemäß immer wieder auftut. Ihre empirische Anwendung finden die so weiterentwickelten Konzepte in konkreten, jeweils klar umrissenen Fallstudien.
In den Fallstudien, die den zentralen Teil dieses Buches ausmachen, spielt auch der Begriff der Globalisierung immer wieder eine wichtige Rolle. Zwar gehört er nicht zu den sechs im Rahmen dieser Einführung exemplarisch ausgewählten Konzepten, die in den Fallstudien ihre Anwendungen finden, er schließt aber in vielerlei Hinsicht an diese an und verleiht ihnen Dynamik. Darüber hinaus eignet sich der Begriff der Globalisierung in besonderem Maße, um hinleitend zu den sechs ausgewählten Konzepten schon einmal zu zeigen, wie hilfreich es ist, solche Leitbegriffe vom Deskriptiven ins Analytische zu heben, vom Speziellen ins Allgemeine. Der Begriff der Globalisierung ist in globalhistorisch informierten Studien allgegenwärtig. In vielen Fachdiskussionen wird die Globalgeschichte implizit hauptsächlich als eine Geschichte von Globalisierungsprozessen verstanden.30 Manche Fachvertreter gehen über diese implizite Schwerpunktsetzung hinaus und fordern, dass sich globalhistorische Forschung explizit mit der Geschichte der Globalisierung beschäftigen soll.31 Trotz dieses offensichtlich engen Verhältnisses zwischen Globalgeschichte und Globalisierung gibt es im Feld kein auch nur halbwegs einheitliches Verständnis des Begriffs. Dies ist nicht der Ort, um die unzähligen, teilweise miteinander konkurrierenden Interpretationen wiederzugeben oder zu bewerten. Einen Eindruck von der Spannweite der Ansätze vermittelt aber zum Beispiel die bekannte Debatte zwischen Dennis Flynn und Arturo Giráldez auf der einen Seite32 und Kevin O’Rourke und Jeffrey Williamson auf der anderen.33 Erstere sehen Globalisierung als die Zunahme nachhaltiger Interaktion zwischen allen besiedelten Kontinenten. Letztere verstehen den Begriff als die globale Integration von Märkten. Beide Seiten schauen aus einer hauptsächlich wirtschaftshistorischen Perspektive auf die Geschichte der Globalisierung und kommen dennoch zu grundlegend unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs. Erweitert man dies um Einschätzungen, zum Beispiel aus einer politik-, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Richtung,34 so entsteht bald ein bunter Strauß von Definitionsangeboten. Um diese Spannweite zu illustrieren, weist Lynn Hunt in ihrem Aufsatz über Globalisierung und Zeit beispielhaft auf die Vorschläge von Jan Scholte oder Robert Keohane und Joseph Nye hin.35 Während Scholte in der Globalisierung nichts anderes als den Aufstieg von Supraterritorialität sieht,36 verweisen Keohane und Nye vor allem auf die globalisierende Wirkung neuer Technologien, die Entfernungen jeglicher Art schmelzen lassen.37
Nun ist das Fehlen eines eindeutig geklärten Begriffsverständnisses, einer gemeinsamen Definition in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein hinreichend bekannter Sachverhalt. Hinsichtlich des Begriffs der Globalisierung halten Bruce Mazlish und Akira Iriye explizit fest, dass uns das Fehlen einer klaren Definition in keiner Weise beunruhigen sollte.38 Und auch Barry Gills und William Thompson eröffnen ihren Versuch, das Verhältnis von Globalgeschichte und Globalisierung zu klären, mit der Feststellung, dass sie, was unterschiedliche Ansätze und Begriffsverständnisse angeht, grundsätzlich „ecumenical and tolerant“ seien.39 Diese begriffliche Offenheit ist insgesamt sicherlich eine Stärke der Geistes- und Sozialwissenschaften und soll hier nicht prinzipiell in Frage gestellt werden. Ich will lediglich darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie der Globalisierungsbegriff in der Globalgeschichte benutzt wird, zumindest zwei klare analytische Nachteile hat. So macht es die große definitorische Schwankungsbreite erstens schwer, sich in der Geschichtswissenschaft über Epochen- oder Perspektivengrenzen hinweg über Globalisierungsprozesse austauschen zu können. Ein Beispiel dafür ist die immer wieder gerne geführte Diskussion, ab wann man in der Geschichte denn überhaupt von Globalisierung sprechen kann. Um diese Frage dreht sich nicht nur die bereits erwähnte Debatte zwischen Flynn/Giráldez und O’Rourke/Williamson im Kern. Sie verhindert häufig auch eine produktive Zusammenarbeit zwischen globalhistorisch interessierten Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Epochen, die hier oft gänzlich unterschiedliche Auffassungen vertreten. Letztlich ist die Frage, wann Globalisierung beginne, nur eine Funktion der Frage, was Globalisierung eigentlich ist. Ein geteiltes Begriffsverständnis könnte demnach helfen, einen breiteren Dialog zu globalhistorischen Fragen zu ermöglichen. Ein zweites Defizit des momentanen, offenen Begriffsgebrauchs in der Globalgeschichte liegt in der Tatsache, dass die meisten Definitionen situativ gemeint sind und auf relativ eng umrissene Fragestellungen und Themengebiete zugeschnitten sind. Sie bleiben dadurch oft sehr deskriptiv, sind gleichzeitig aber außerhalb ihres eigentlichen Geltungsbereichs schwer zu operationalisieren. Dadurch ist es schwierig, Globalisierungsprozesse in der Globalgeschichte genau zu verorten – über die Beobachtung hinaus, dass sie darin eine wichtige Rolle spielen. Auch hier kann ein klareres, gleichzeitig aber auch abstrakteres Verständnis des Begriffs helfen.
Wie aber könnte das aussehen? Jürgen Osterhammel und Niels Petersson erkennen in den vielen verschiedenen Ansätzen zumindest einen gemeinsamen Bedeutungskern. „In den meisten Definitionsangeboten spielen die Ausweitung, Verdichtung und Beschleunigung weltweiter Beziehungen eine zentrale Rolle“, sagen sie.40 Anthony Giddens geht mit seiner mittlerweile über 25 Jahren alten Definition in eine grundsätzlich ähnliche Richtung, setzt die Betonung aber anders. Globalisierung ist für Giddens „the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa.“41 Will man den Begriff weiter abstrahieren, so könnte man auf Osterhammel/ Petersson und Giddens aufsetzend sagen, dass Globalisierung im Kern nichts anderes ist, als der Prozess der Loslösung sozialer Interaktion von räumlicher Nähe. Für diesen Prozess gibt es jeweils einen abstrakten Anfangs- und Endpunkt. Der Anfangspunkt ist, dass jede Form sozialer Interaktion zwischen Menschen nur in unmittelbarer räumlicher Nähe stattfindet. Der Endpunkt ist, dass zwischen sozialer Interaktion und räumlicher Nähe überhaupt kein Zusammenhang mehr besteht. Beides sind natürlich fiktive Punkte, die so in der menschlichen Lebenswelt nicht vorkommen. Sie können uns als Vorstellung aber dabei helfen, den Prozess dieser Loslösung, für den der Globus den Möglichkeitsraum darstellt, besser zu greifen.
Will man es etwas weniger abstrakt formulieren und trotzdem die Breite der Definition erhalten, so könnte man Folgendes sagen: Globalisierung ist ein Prozess, in welchem sich in die Interaktionsmuster von Menschen zunehmend mehr Verbindungen über lange Distanzen und damit indirekt über Grenzen ganz unterschiedlicher Art einfügen. In einem solchen Verständnis sagt der Begriff der Globalisierung erst einmal noch nichts über die Intensität und Wirkmächtigkeit dieser Verbindungen, sondern verweist lediglich auf eine Zunahme derselben, die aber natürlich auch sehr gering und graduell ausfallen kann. Globalisierung verweist hier also letztlich auf eine Veränderung in Verbindungs- und Interaktionsmustern.
Zur Forschungspraxis der Globalgeschichte
Dieses Abstraktum hat meiner Meinung nach zumindest zwei Vorteile. Erstens macht es einen über Epochen und Perspektiven übergreifenden Dialog erheblich einfacher. Es handelt sich nicht nur um die Betonung der Prozesshaftigkeit. Behält man die abstrakten Anfangs- und Endpunkte als Orientierungshilfen im Kopf, so wird deutlich, dass dieser Prozess ganz unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt sein kann, aber einen gemeinsamen qualitativen Kern hat. Das Abstraktum verweist darauf, dass Globalisierung als Prozess nicht zu verwechseln ist mit zum Beispiel einem Zeitalter der Globalisierung. Letzteres verweist auf eine Zeit oder Epoche, für welche Globalisierungsprozesse eine gesamtgesellschaftlich prägende Rolle einnehmen. Für welche Gesellschaften das zu welcher Zeit der Fall gewesen ist, darüber können Historikerinnen und Historiker vortrefflich streiten. Darüber verliert man aber häufig aus dem Blick, dass auch außerhalb solcher gesamtgesellschaftlich prägenden Zusammenhänge Globalisierungsprozesse für das Denken und Handeln von vielen Menschen hochrelevant gewesen sind.
Darüber hinaus trägt ein dergestalt heruntergebrochenes Begriffsverständnis auch zur Klärung des Verhältnisses zwischen Globalgeschichte und Globalisierung bei und verweist damit letztlich zurück auf das Erkenntnisinteresse globalhistorischer Forschung. Versteht man Globalisierung als Prozess und stellt sie sodann in den Fokus globalhistorischer Forschung, so bedeutet dies, dass man vor allem an dieser Prozessualität interessiert ist, an Dynamiken, also an Wandel und Veränderung über die Zeit. Das ist die Globalgeschichte unzweifelhaft – aber nicht mehr als jede andere Form der historischen Forschung auch. Ein solcher Wandel im Sinne der Zunahme (oder im Umkehrschluss der Abnahme) transregionaler Verbindungen ist ein globalhistorisch hochinteressantes Phänomen. Aber wieder handelt es sich im Kern um eine Funktion des eigentlichen Erkenntnisinteresses der Globalgeschichte, nämlich um die Frage der Entstehung und Geschichtsmächtigkeit globaler Verbindungen. Verbindungen können für die Menschen auch prägend und handlungsleitend sein, wenn sie sich nicht verdichten oder in einer anderen Weise verändern. In der Praxis, das ist richtig, werden die allermeisten Fallstudien im Kontext von Globalisierungsprozessen angesiedelt sein. In solchen Zusammenhängen entfalten globale Verbindungen die größte Wirkung, beeinflussen Menschen und ihr Denken und Handeln am stärksten (wie immer, wenn Menschen mit etwas Neuem konfrontiert sind). Das heißt aber nicht, dass globale Verbindungen nur in solchen Kontexten geschichtsmächtig sind.
Blickt man hauptsächlich auf Globalisierungsprozesse und damit auf die Dynamiken globaler Verbindungen, so verliert man allzu leicht die konzeptuellen Bausteine dieser Prozesse aus den Augen. Die Verdeutlichung des Verhältnisses zwischen Globalgeschichte und Globalisierung führt daher letztlich zurück zum Erkenntnisinteresse des Feldes und zu den konzeptuellen Linsen, durch die wir auf der Suche danach blicken können. Dieses Buch schlägt in dieser Hinsicht sechs mögliche forschungsleitende Begriffe vor. Es handelt sich dabei um eine mehr oder weniger eklektische Auswahl, der nicht der Anspruch zugrunde liegt, auf ihrer Basis Globalgeschichte erschöpfend und vollumfänglich betreiben zu können. Zwar bilden diese sechs Begriffe in ihrer Summe eine gewisse konzeptuelle Breite ab, letztlich widerspiegeln sie aber auch das Forschungsinteresse dessen, der sie ausgewählt hat. Wenn dieses Buch daher im Folgenden über Verbindungen, Raum, Zeit, Akteure, Strukturen und Transit spricht, so ist dies nicht als Versuch der Kanonbildung zu verstehen, sondern als beispielhafte Annäherung an ein Interessenfeld. Diesem Buch geht es immer mehr um das wie als um das was.
Ebenso wenig sollte man die folgenden Kapitel als Einführung völlig neuer Begrifflichkeiten und revolutionärer Interpretationen verstehen. Im Gegenteil, vielleicht mit Ausnahme der Idee des Transits handelt es sich um in den Geistes- und Sozialwissenschaften hinlänglich bekannte und bestens eingeführte Begriffe. Was dieses Buch versucht zu leisten, ist eine Zuspitzung dieser Begriffe und ihre Fruchtbarmachung für globalhistorische Untersuchungen. Auch wenn in manchen Fällen, am deutlichsten vielleicht bei der Verbindung und beim Transit, einige Vorschläge gemacht werden, wie man diese Begriffe umdeuten könnte, so handelt es sich in keinem Fall um eine tiefgreifende Neuinterpretation etablierter Konzepte. Im Mittelpunkt stehen eher Fragen der Konzeptualisierung und Systematisierung bei gleichzeitiger Sorge um die analytische Anwendbarkeit, die für jeden Begriff auch anhand eines eigenen Fallbeispiels ausführlich demonstriert wird. Während die ausgewählten Konzepte aus unterschiedlichen Kontexten kommen und hinsichtlich ihres Abstraktionsniveaus nicht unbedingt auf einer Stufe stehen, so haben sie – zumindest wie sie in diesem Buch verwendet werden – gemeinsam, dass sie genau auf dem Grat zwischen Theorie und Empirie balancieren. Das heißt, meine Vorschläge zur Interpretation dieser Begriffe zielen darauf, soweit abstrakt und generalisierbar zu sein, dass über die einzelne Fallstudie hinaus Aussagen möglich werden und ein anschlussfähiger Beitrag zu den Fragen der Globalgeschichte bzw. der Geschichtswissenschaft allgemein erkennbar ist. Gleichzeitig aber sollen die Begriffe ihre Operationalisierbarkeit behalten und auf die jeweiligen Beispiele erkenntnisleitend anwendbar sein. Ein solches Begriffsverständnis gibt uns analytische Begriffe im eigentlichen Wortsinn an die Hand – also Ideen und Konzepte, mit deren Hilfe man einen Untersuchungsgegenstand in seine Einzelteile zerlegen kann, gleichzeitig aus dem Studium dieser Einzelteile aber auch Rückschlüsse auf den Untersuchungszusammenhang und seine größeren Mechanismen ziehen kann. Diese Ausrichtung und Zielsetzung ist den hier ausgewählten Begriffen gemeinsam.
Ein erster Abschnitt widmet sich dem auch in diesem einleitenden Kapitel bereits besprochenen Begriff der globalen Verbindung und identifiziert diesen als Grundbeobachtungselement der Globalgeschichte. Dem zentralen Erkenntnisinteresse des Forschungsfeldes, also der Entstehung und Wirkmächtigkeit globaler Verbindungen, nachspüren zu wollen, verlangt ein differenzierteres Verständnis des Verbindungsbegriffs als dies selbst in der Globalgeschichtsforschung zumeist vorhanden ist. Verbindungen dürfen daher nicht nur von ihren Enden her gedacht werden, sondern müssen als eigenständige historische Phänomene erstgenommen werden – ein Punkt, der später in der Idee des Transits wieder aufgenommen wird. Zudem entfalten globale Verbindungen ihre Bedeutung erst im Zusammenspiel mit anderen Verbindungsarten. Das sind die zentralen Argumente der Diskussion des Verbindungsbegriffs, die in der Folge anhand des Beispiels des sogenannten „großen Mondschwindels“ von 1835 ihre Anwendung finden. Im Sommer dieses Jahres veröffentlichte die New Yorker Zeitung Sun eine Reihe von Artikeln, in denen detailliert geschildert wurde, wie der angesehene britische Astronom Sir John Herschel mit Hilfe eines riesigen Teleskops menschenähnliches Leben auf dem Mond entdeckt hätte. Tatsächlich stammte der Text vom Chefredakteur der Sun Richard Adams Locke, der mit dem Schwindel vor allem die Auflage seiner Zeitung steigern wollte. Trotz so mancher Zweifel verfing der in vielerlei Hinsicht täuschend echt wirkende Bericht aber bei vielen Lesern, wurde in die ganze Welt hinausgetragen und von unzähligen Menschen enthusiastisch aufgenommen. Ich versuche in diesem Abschnitt aufzuzeigen, dass das Funktionieren des Mondschwindels unter anderem eine Konsequenz von Lockes geschicktem Spiel mit globalen Verbindungen und Nicht-Verbindungen war, die in ihrem Zusammenspiel eine neue, ungewohnte Situation und damit einen unerprobten Handlungsspielraum schufen.
Die beiden folgenden Kapitel schöpfen, was die Fallstudien angeht, aus der Geschichte der Telegrafie, die sich in besonderem Maße dazu eignet, die analytischen Qualitäten der Begriffe Raum und Zeit zu illustrieren. Im Abschnitt über den Raum versuche ich zu zeigen, dass sich die Art und Weise, wie globale Verbindungen wirkmächtig werden, mit Hilfe eines pluralen, relationalen Raumverständnisses verdeutlichen lässt. Als relationale Konstrukte bestehen Räume aus Verbindungen. Kommen globale oder transregionale Verbindungen hinzu, verändern sich Räume und verschieben sich dadurch in ihrem Verhältnis zu anderen Räumen. In dieser Verschiebung, so das zentrale Argument, manifestiert sich die qualitative Bedeutung von globalen Verbindungen und Globalisierungsprozessen für die involvierten Akteure. Deutlich spürbar wird dies zum Beispiel in der räumlichen Spannung, in der Telegrafisten in manchen Kabelstationen Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Dienst verrichteten. Viele dieser Relaisstationen befanden sich in scheinbar idyllischen, geografisch aber weit abgelegenen Orten – etwa auf kleinen Inseln im Indischen oder Pazifischen Ozean. Das dort stationierte Personal erlebte die Gleichzeitigkeit gänzlich unterschiedlicher Räume tagtäglich in der Diskrepanz zwischen enger kommunikativer und loser geografischer Anbindung an die Welt. Zu welchen ungewöhnlichen Handlungs- und Ereignishorizonten, zu welcher eigenen Wahrnehmung der Welt das führen konnte, versuche ich anhand der deutschen Angriffe auf die britischen Kabelstationen auf Fanning Island und den Kokosinseln zu Beginn des Ersten Weltkriegs nachzuzeichnen.
Die Idee der Zeit ist von jener des Raums kaum losgelöst zu denken. Ähnlich wie dies auch bei einem dynamischen Verständnis von Raum der Fall ist, geht Zeit als soziokulturelles Phänomen aus den zeitlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren, Objekten, Ideen oder Ereignissen hervor. Globale Verbindungen und Austauschprozesse wirken sich auch auf zeitliche Beziehungen aus und werden so für einzelne Akteure oder auch für ganze Gesellschaften spürbar. Das zeigt sich zum einen in einem sich verschiebenden Verhältnis zwischen Raum und Zeit, das ich anhand einiger Beispiele von telegrafischem Betrug in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu illustrieren versuche. Wir kennen viele Fälle, in denen es Betrügern auf die eine oder andere Weise gelungen ist, mit Hilfe der Telegrafie entweder früher als alle anderen an wichtige Informationen zu kommen oder aber andere mit falschen Informationen zu füttern. So schufen sie kleine Zeitfenster, in denen sie selbst als einzige von einem bestimmten Wissen profitieren konnten. Globale Verbindungen haben sich aber auch im individuellen und kollektiven Zeitempfinden der Menschen niedergeschlagen. Dies wird neben vielen anderen Beispielen etwa im Handeln und Denken eines britischen Telegrafenbeamten in Indien deutlich, dessen Zeiterleben maßgeblich durch das für ihn neue Gefühl allzeitiger Erreichbarkeit geprägt wurde – eine Tatsache, mit der er im Übrigen heftig haderte.
In den beiden darauffolgenden Abschnitten werden die sozial- und kulturwissenschaftlichen Leitbegriffe Akteur und Struktur – und damit auch deren Verhältnis – auf globalhistorische Untersuchungszusammenhänge umgelegt. In der Diskussion des Akteursbegriffs will ich zum einen zeigen, wie menschliche Akteure solche Strukturen navigieren können, lege das Augenmerk aber vor allem auf die Frage, wie die Akteure durch ihre Handlungen globale Verbindungen schaffen und dadurch selbst zu Scharnieren zwischen verschiedenen Räumen werden. Veranschaulicht wird dies anhand der berühmt-berüchtigten Meuterei auf der Bounty des Jahres 1789. In diesem unerhörten Ereignis auf einem kleinen Schiff mitten im Pazifik liefen die verschiedensten Handlungsund Interpretationsstränge zusammen und machten die Meuterei damit erst möglich. Die Empfindungen und Handlungen der involvierten Menschen waren dabei von den Erfahrungen und Erwartungen völlig unterschiedlicher Gebiete und Gegenstände geprägt, die in den Akteuren selbst zusammenkamen. Die sozioökonomische Situation auf den britischen Plantagen in der Karibik spielte dabei ebenso eine Rolle wie das europäische Bild der Südsee oder die Bounty als Lebensraum.
Im Kapitel zu Strukturen versuche ich zu erörtern, wie globale Verbindungsmuster durch die Handlungen von Akteuren entstehen und gleichzeitig handlungsleitend und damit verfestigend auf diese zurückwirken können. Als Fallbeispiel dient dabei die verkehrstechnische Bezwingung des Mont Cenis. Das Bergmassiv, das schon immer den Waren- und Personenverkehr zwischen Savoyen und dem Piemont beeinträchtigt hatte, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von einem eher regionalen zu einem globalen Verkehrshindernis. Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt, der Erweiterung des Eisenbahnnetzes in Europa und schließlich dem Bau des Suezkanals stellte der Mont Cenis plötzlich das einzige größere verbleibende Hemmnis für den Verkehr zwischen Großbritannien und Indien dar. Daraus resultierte ein erheblicher struktureller Druck, auch dieses letzte Hindernis zu beseitigen. Dieser Druck führte schließlich nicht nur zum Graben eines Tunnels, sondern auch zum Bau einer waghalsigen Eisenbahn über den Berg.
Ein letztes inhaltliches Kapitel ist dem Begriff des Transits gewidmet. Hier nehme ich einige Gedanken aus den vorhergehenden Abschnitten – insbesondere aus der Diskussion des Verbindungsbegriffs – auf und versuche diese zusammenzuführen. Die Idee des Transits geht davon aus, dass Verbindungen tatsächlich etwas anderes sind als das Verbundene, die Globalgeschichte diesen Sachverhalt aber weitestgehend übergangen hat. Globale Verbindungen haben ihren eigenen Raum und ihre eigene Zeit. Sie sind keine neutralen Zwischenglieder zwischen zwei oder mehreren verbundenen Punkten, sondern wirken als Mediatoren. Die Idee des Transits versucht diese Wirkmächtigkeit über die Rekombination des Verbunden hinaus begrifflich zu fassen. Zur Verdeutlichung dient das Beispiel der Flucht und schlussendlichen Gefangennahme von Hawley Harvey Crippen im Jahr 1910. Crippen wurde in London des Mordes an seiner Frau verdächtig, konnte aber zusammen mit seiner Geliebten vor der drohenden Festnahme fliehen. Die beiden schifften sich auf dem Dampfer Montrose ein, der sie von Antwerpen nach Montreal bringen sollte. Die vermeintliche Überfahrt in die Freiheit entwickelte sich aber zu einem „Käfig aus Glas“, in welchem die beiden Flüchtigen, sozusagen gefangen in der Passage, einer interessierten Weltöffentlichkeit präsentiert wurden. In dieser Fallstudie wird die Bedeutung des Zusammenspiels unterschiedlichster Verbindungsarten ebenso wie die eigene räumliche und zeitliche Dimension der Verbindung im Transit besonders spürbar.
Die Auswahl der hier vorgestellten Fallstudien ist in keiner Weise zwingend. Vielmehr spiegelt ihre Zusammenstellung meine eigenen Forschungsinteressen, meinen Zugang zum Fach und auch meine Zufallsfunde der letzten Jahre wider. Nur deshalb stammen die Beispiele allesamt aus dem sogenannten „langen 19. Jahrhundert“, dessen zeitliche Spanne ich aber immerhin versucht habe weitestgehend auszuschöpfen. Nur deshalb haben alle Beispiele einen mal mehr, mal weniger ausgeprägten Bezug zum britischen Weltreich. Nur deshalb kommen sie aus einem europäischen oder europäisch-kolonialen Zusammenhang. Nur deshalb spielen Themen wie die Telegrafie oder die Dampfschifffahrt eine überproportional große Rolle. Die Auswahl ist damit Spiegel der beschränkten Möglichkeiten meines eigenen Repertoires und nicht etwa eine zwingende Folge des analytischen Zugangs. Im Gegenteil, alle vorgestellten Konzepte hätten sich auch auf unzählige andere Untersuchungszusammenhänge aus anderen Epochen und anderen Kulturen anwenden lassen. Genau das ist einer der zentralen Punkte des hier vorgestellten Verständnisses von Globalgeschichte.
Verbindungen
Der große Mondschwindel
Verbindungen in der Globalgeschichte
Christopher Baylys grundlegendes Werk über die Geburt der modernen Welt trägt im englischen Original den Untertitel Global connections and comparisons.1 Daran direkt oder indirekt anschließend ist in der Folge häufig ein historiografischer Zugang der Globalgeschichte insgesamt beschrieben worden, in dessen „Mittelpunkt […] grenzüberschreitende Prozesse, Austauschbeziehungen, aber auch Vergleiche im Rahmen globaler Zusammenhänge“2 stehen, wie Sebastian Conrad es in seiner deutschsprachigen Einführung in die Globalgeschichte zusammenfasst. Patrick O’Brien hat dieselbe Definition in seinem Prolegomenon zur ersten Ausgabe des Journal of Global History im Jahr 2006 unternommen.3 Hierzu ist grundlegend anzumerken, dass die Begriffe Verbindung (connection) und Vergleich (comparison) hinsichtlich ihrer Bedeutung in der Geschichtswissenschaft von gänzlich unterschiedlicher Natur sind. Der Vergleich ist eine Methode und damit ein Untersuchungsinstrument.4 Damit bleiben globale Verbindungen als grundlegende Untersuchungseinheiten der Globalgeschichte. Sie sind die Bausteine für jede Form von Kontakt, Austausch und Vernetzung. Ein zentrales Interesse gilt dabei Fragen nach der Entstehung solcher Verbindungen und nach ihrer Bedeutung für die historischen Akteure. Sie werden als geschichtsmächtig identifiziert und hinsichtlich ihrer Bedeutung innerhalb der wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Entwicklungszusammenhänge einer bestimmten Region oder Zeit untersucht. Im Zentrum eines solchen Zugangs steht die Überzeugung, dass wir eben das Denken und Handeln historischer Akteure – und damit die Geschichte selbst – nicht verstehen und erklären können, wenn wir nicht auch die überregionalen Verbindungen, ihre lokalen Manifestationen und ihr Zusammenspiel mit intrinsischen Faktoren verstehen.
Transregionale Verbindungen sind demnach die Grundbeobachtungselemente der Globalgeschichte. Sie sind zentrale Elemente in einflussreichen Konzepten wie dem Transfer5, der connected oder entangled history6 oder der contact zone.7 Kaum eine globalhistorische Untersuchung kommt ohne den Begriff der Verbindung aus. Und auch in den verschiedenen, in diesem Buch behandelten Beispielen stehen sie analytisch im Mittelpunkt. Sie werden durch Akteure geschaffen (siehe Meuterei auf der Bounty), in Strukturen gegossen und wirken so auf die Akteure zurück (siehe Mont Cenis). Sie schaffen neue Räume und zeitliche Gefüge (siehe Telegrafie). Globale Verbindungen sind also unzweifelhaft von ganz zentraler Bedeutung hinsichtlich des Erkenntnisinteresses der Globalgeschichte.