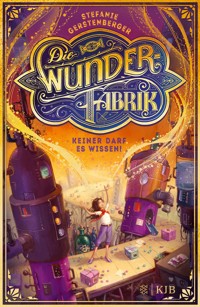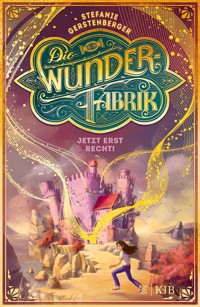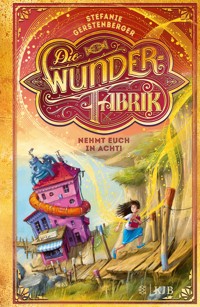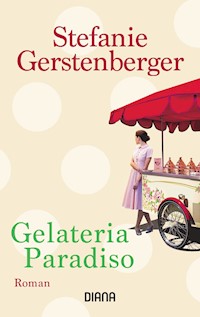12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Aufregender und lustiger Liebesroman für Teenies ab 12 Jahren mit einem Hauch Magie und italienischem Charme! Wenn sie ihren Vater in Italien besucht, wird aus der sechzehnjährigen Lucy: Luciiiiiaaa! Aber, mamma mia, was soll sie nur im November in Venedig anfangen? Es regnet, es ist grau, und es gibt nur uralte Menschen und Touristen. Außer diesem wahnsinnig süßen Wollmützen-Jungen auf dem Boot, aber der würdigt sie keines Blickes. Stattdessen trifft sie auf einen Typen, der behauptet, aus dem 18. Jahrhundert zu stammen – ein blond gelockter Junge in Brokatjacke. Ja, klaaaar. In den engen Gassen von Venedig beginnt für Lucia ein magisches Abenteuer. Mit einem romantischen Picknick mit heißem Kakao auf einem Bootssteg vor Murano – und vielleicht sogar mit einem Happy End? - Romantische Komödie ab 12 Jahren im traumhaften Venedig - Eine sympathische Heldin, zwei unterschiedliche Verehrer und ein magisches Geheimnis - Für Leserinnen von Dagmar Bach, Yvonne Struck und Kerstin Gier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stefanie Gerstenberger
Gondelküsse und Zeitensprünge
Über dieses Buch
Lucia geht die Liebe suchen
Wenn sie ihren Vater in Italien besucht, wird aus der sechzehnjährigen Lucy: Luciiiiiaaa! Aber, mamma mia, was soll sie nur im November in Venedig anfangen? Es regnet, es ist grau, und es gibt nur uralte Menschen und Touristen. Außer diesem wahnsinnig süßen Wollmützen-Jungen auf dem Boot, aber der würdigt sie keines Blickes. Stattdessen trifft sie auf einen Typen, der behauptet, aus dem 18. Jahrhundert zu stammen – ein blond gelockter Junge in Brokatjacke. Ja, klaaaar. In den engen Gassen von Venedig beginnt für Lucia ein magisches Abenteuer. Mit einem romantischen Picknick mit heißem Kakao auf einem Bootssteg vor Murano – und vielleicht sogar mit einem Happy End?
Eine romantische Komödie mit einem Hauch Magie und italienischem Charme!
Weitere Bücher von Stefanie Gerstenberger bei Fischer Sauerländer:
Emmas Herzdilemma – Alle Umwege führen zu dir
Plötzlich vertauscht!
Die Wunderfabrik – Keiner darf es wissen!
Die Wunderfabrik – Nehmt euch in Acht!
Die Wunderfabrik – Jetzt erst recht!
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Stefanie Gerstenberger begann nach dem Studium und verschiedenen beruflichen Stationen, unter anderem bei Film und Fernsehen, selbst zu schreiben. Neben zahlreichen erfolgreichen Romanen für Erwachsene hat sie sich längst auch einen Namen als Kinder- und Jugendbuchautorin gemacht. Stefanie Gerstenberger lebt meistens in Köln, aber manchmal auch in Rom oder anderswo.
Impressum
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
© 2025 Fischer Sauerländer GmbH,
Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover
Lektorat: Frank Griesheimer, Starnberg
Vignetten: Adobe Stock
Covergestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Adobe Stock und Shutterstock
ISBN 978-3-7336-0900-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
1. Kapitel
»Look! Look!«
»Schau mal!«
»That’s amazing!«
»Guck doch! Da unten!«
»Wie schön!«
Die Stimmen im Flugzeug klangen so begeistert, dass ich tatsächlich ein klein wenig den Kopf drehte, denn Papa Michele hatte einen Fensterplatz für mich gebucht. Eigentlich unnötig, ich hatte seit dem Start in München kein einziges Mal hinausgeschaut. Aber jetzt warf ich doch mal einen Blick aus dem ovalen Fensterchen.
Der Seufzer kam ganz automatisch. Warum die Aufregung? Richtig cool war das von hier oben nun wirklich nicht. Außerdem sah man ja kaum etwas, so weit weg waren wir. Der Himmel war dunkelgrau, und es regnete. Da gab es eine lange, schnurgerade Straße, die die Stadt mit dem Festland verband, von oben sah es aus wie ein Stock, auf den sie aufgespießt war. Eine Insel aus Stein. Umgeben von einem grauen Meer und durchzogen von ebenso grauen Kanälen, die sich mit ihrem Wasser überall zwischen die Gebäude mit den blassroten Ziegeldächern zu drängen schienen und sie dadurch irgendwie zerstückelten. Komische Stadt. Auf Italienisch: Venezia. Auch La Serenissima wurde sie noch genannt. Die Durchlauchtigste. Was sollte das überhaupt heißen? Mein Italienisch war zwar recht gut, aber diesen Namen kapierte ich nicht mal auf Deutsch.
Das Flugzeug drehte in einer steilen Linkskurve ab. Die Passagiere jauchzten auf. Ich hielt den Atem an, als mein Magen zwischen meine Knie sackte, und krallte die Finger in die Armlehne. Gott sei Dank war die Maschine ziemlich leer, und ich hatte die Sitzreihe für mich. Ich flog nicht gerne, aber mit dem Zug hatte Mama mich nicht fahren lassen wollen. Warum das denn nicht? Ich war schließlich seit Kurzem sechzehn! Nein, Mama, die sonst immer so viel Wert legte auf die Umwelt und den ökologischen Fußabdruck, hatte auf dem Flug bestanden. Denn die Zugfahrt dauert über acht Stunden, wenn alles normal läuft, und stell dir vor, der Zug bleibt stehen, und das in deinem Zustand, ach, weißt du … Wenn du schon dort hinmusst …
Doof, aber irgendwie hatte sie recht, normal lief bei mir in letzter Zeit gar nichts.
»Lucia, komm zu mir, komm nach Venedig«, hatte Papa am Telefon gesagt. Bei ihm wurde mein Name Lucy automatisch zu Lucia. »Vergiss mal die Schule, vergiss München, vergiss einfach alles, was war. Denk für ein paar Wochen nicht mehr daran. Autos und Fahrräder gibt es hier übrigens auch nicht!«
Ich spürte, wie meine Lippen sich zu einem Lächeln verzogen. Mein Vater kannte mich immer noch sehr gut, obwohl wir uns seit der Scheidung vor drei Jahren nicht mehr so oft sahen. Er musste gespürt haben, dass Autos und Fahrräder seit Monaten meine Albträume bevölkerten. Ich stieß die angehaltene Luft aus und atmete endlich wieder tief ein. Es war bestimmt cool, beides eine Zeit lang nicht sehen zu müssen. Und vergessen, oh ja, das konnte ich, seit diese Sache passiert war, sowieso fantastisch!
Mein Vater Michele … so sweet! Natürlich war er pünktlich und stand winkend hinter dem Geländer, als ich mit meinem Koffer durch die gläserne Schiebetür trat. Wir fielen uns in die Arme. Er roch so gut, seine Schultern waren stark, er war eben mein Babbo von früher, der mich immer auf den Schultern getragen hatte, auch als ich schon etwas zu alt dafür war.
»Was in letzter Zeit auch alles passiert sein mag, es hat dich nicht vom Wachsen abgehalten«, sagte er in seinem weichen Italienisch. »Madonna mia, du bist ja beinahe so groß wie ich!« Babbo hielt mich von sich ab. »Und du hast die Haare anders.« Er strahlte mich an. Klar, er hatte mich nur mit dem Kopfverband gesehen, und das war schon wieder über sechs Monate her. »Ziemlich kurz, steht dir aber gut!«
Ich zuckte mit den Schultern. Du weißt doch, warum, wollte ich schon sagen. Hier an der Seite habe ich sogar einen Undercut, bis auf die Kopfhaut abrasiert und noch nicht wieder richtig nachgewachsen … Doch ich blieb stumm.
»Ich habe noch öfter in München vorbeikommen wollen, aber Barbara hat mich abgehalten, du weißt ja, wie sie ist.«
Die Barbara, von der er sprach, war natürlich meine Mutter. »Mama hat sich dauernd nur Sorgen gemacht.« Ich schüttelte genervt den Kopf. »Macht sie immer noch, sie kann gar nicht mehr anders.«
»Okay, das vergessen wir jetzt auch. Willkommen, Lucia, benvenuta a Venezia.« Er sprach es Vänäzia aus, wie alle Italiener. »Lass dich verzaubern von der Magie der Serenissima!«
Ich verdrehte die Augen. Da war sie wieder, die Serenissima. Alle schwärmten von Venedig, es gab tausend Filme und Bücher darüber, aber was sollte ich in einer Stadt voller Wassergräben, in der ich niemanden kannte außer meinem Vater? Mich erholen, ausruhen, Kraft schöpfen …? Danke, sehr nett, und jede andere Sechzehnjährige hätte ein paar weitere Wochen schulfrei sicherlich gefeiert, aber ich verlangte nur eins: Mein Leben sollte gefälligst wieder sein wie vorher!
»Wir nehmen die Linea Arancia, hier entlang.« Mein Vater schob meinen altrosafarbenen Koffer mit der linken Hand, den anderen Arm hatte er sanft und vorsichtig auf meine Schulter gelegt, gemeinsam verließen wir die Ankunftshalle. Papa, süß wie immer, tat, als merkte er mein leichtes Hinken nicht, ging aber langsamer als sonst.
»Mit dem Boot kannst du die Stadt gleich vom Wasser aus begrüßen, wie sich das gehört! Wir haben Glück, es fährt in wenigen Minuten ab!«
Papa! Ich mag doch keine Boote, und vor allen Dingen kein Wasser, beschwerte ich mich im Stillen. Schon vergessen? Ich habe manchmal richtig Panik davor. Wasser ist meistens dunkel und unberechenbar, und besonders gut schwimmen kann ich auch nicht … und guck mal raus! Ich zog die Stirn in Falten, als wir jetzt auf die durchnummerierten Bootsanleger am Ende der Halle zugingen. Es regnete in Strömen, es war grau, der Wind pfiff durch die Pfeiler, warum sollte es jetzt im November auch anders sein. Ich würde nichts sehen können, gar nichts.
Doch ich sah etwas anderes, als wir an der Reihe der Passagiere entlangliefen, um uns hinten anzustellen. Einen Jungen, groß, mit einem auffälligen Mantel, der weit und schwarz, beinahe wie ein Cape geschnitten war. Er trug eine Wollmütze, die darunter hervorlugenden Haare waren dunkelblond, an den Schläfen scheinbar etwas länger, er war so alt wie ich, oder vielleicht ein, zwei Jahre älter, das Gesicht war … wow, es war richtig hübsch, der ganze Typ war richtig hübsch, mit diesen ernsten Augen und der geraden Nase, überhaupt war alles ziemlich gerade an ihm, registrierte ich in den Sekunden, während ich auf ihn zuging. Bis auf seinen Mund, der war geschwungen, breit und wunderschön … Nicht nur der weite kurze Mantel war auffällig. Die anderen Gestalten in der Reihe hatten alle den Nacken gebeugt und starrten gebannt auf die Displays in ihren Händen. Er dagegen stand einfach nur da. Frei und ruhig um sich schauend, keine Kopfhörer in den Ohren, nicht mal Musik hörte er. Unsere Blicke trafen sich kurz, helle Augen, grau oder blau, keine Ahnung, er lächelte nicht, doch er schaute freundlich, ja, er zog sogar ein ganz kleines bisschen eine Augenbraue hoch, und ich grinste und senkte den Blick, während ein warmer Blitz durch meinen Magen schoss; dann war ich auch schon an ihm vorbei. Der erste richtig süße, coole Typ seit einem halben Jahr! Schade.
Das Boot war knallgelb von außen, von innen eng und schon beinahe voll, wir stiegen ein paar schmale Stufen herab, drängten uns auf den ledernen Bänken im Inneren zusammen. Koffer, Rucksäcke und Reisetaschen der Passagiere standen oben an Deck, wenn auch geschützt unter einem Dach, denn es regnete immer noch heftig und schien auch nie wieder aufhören zu wollen. Der Bootsmann bretterte mit uns durch die Wellen, der Motor brummte laut, und es roch nach Diesel und nasser Wolle, die Fenster knapp über unseren Köpfen waren beschlagen, ich konnte nichts sehen. Gar nichts.
»Die Stadt richtig begrüßen, ja klar«, raunte ich Papa zu. Er lächelte nur und drückte meine Hand. »Ich bin sehr froh, dass du da bist!«
Die Japaner um uns herum sahen alle nach unten, auch für die anderen Mitreisenden schienen ihre Handys der wichtigste Besitz zu sein. Und er, mein schöner Wollmützen-Junge aus der Warteschlange? Als ich sah, dass er auf derselben Seite wie ich, direkt neben der Treppe saß, war das Kribbeln wieder da. Er hatte ein kleines Buch hervorgezogen und schrieb irgendetwas hinein. Ich lehnte mich wie zufällig vor, um ihn anzuschauen. Mehrfach. Unauffällig. Doch er blickte nicht mehr zu mir herüber.
Mein Wollmützen-Junge?! Eine fiese kleine Stimme lachte in mir auf. Wohl kaum! Er hat deinen Gang gesehen, immer noch etwas schief und vorsichtig, wie eine lahme Gazelle, zwar ohne die auffälligen Krücken, die haben sie dir in der Reha ja einfach weggenommen. Aber gerade eben auf den Stufen abwärts hast du dich ziemlich unbeholfen angestellt. Auch das hat er garantiert mitbekommen.
Ich wurde rot bei der Vorstellung und starrte auf meine Jogginghose und die bequemen Schuhe ohne Schnürsenkel an meinen Füßen, völlig unpassend für die Jahreszeit, aber easy anzuziehen. Dazu die hässlichste meiner dicken Winterjacken, in der ich wie eine verpackte Wurst aussah, eine Wurst, umhüllt von Currysauce indische Art. Vor einem Jahr hatte ich die Farbe noch cool gefunden, jetzt, zwölf Monate später, gefiel sie mir nur noch so mittel. Doch bei meiner Abreise in München war mir mein Aussehen nicht wichtig vorgekommen. Hauptsache, meine Klamotten waren bequem und hielten warm!
In den letzten Monaten war es absolut egal gewesen, wie mein Äußeres wirkte, viel dringender war es, jederzeit für die Übungen bereit zu sein, ich hatte dreimal Physio am Tag gehabt. Und wenn ich nicht laufen übte oder mein Handgelenk stärkte, hatte ich mich in den Sachen auf mein Bett gelegt, um auszuruhen. Sorry, da war keine Zeit zum Umziehen. Üben, ausruhen, weiter üben. So sah mein Leben immer noch aus, Dr. Gudrun Gralla hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, mir am letzten Tag persönlich einen Plan in die Hand zu drücken. Vier Seiten lang. Ich hasste sie dafür nicht, ich hasste nur mein Leben!
Warum nur kann nicht alles so wie früher sein …, begann in diesem Moment mal wieder die endlose Fragerei in meinem Kopf. Ich hörte ihr ein paar Sekunden zu, versuchte dann aber, mich auf meinen Vater zu konzentrieren, der von dem Bistro erzählte, das er seit einem Jahr führte, und von den aufregenden Dingen, die wir zusammen machen würden.
»Und es gibt auch ganz viele Sachen, die du allein unternehmen kannst!« Er zählte irgendwelche Plätze, Palazzi und Kirchen auf. Ich nickte, als ob mich das alles interessieren würde … Der Motor war laut und eintönig, und weil ich mir streng verboten hatte, ein weiteres Mal zu dem cuten Typ, der mich aber nicht cute fand, hinüberzuglotzen, fielen mir in der feuchten Wärme die Augen zu.
Zwanzig Minuten später wurde das Boot langsamer.
»Komm, die erste Haltestelle ist gleich unsere.« Mein Papa – er wollte seiner ungelenken Tochter etwas mehr Zeit verschaffen, weil sie für alles immer noch länger brauchte. Kein Wunder also, dass auch Wollmützen-Junge sein Notizbuch interessanter fand als mich. Alle Jungs fanden irgendetwas interessanter als mich. Besonders, seit die Sache passiert war.
»Madonna dell’Orto!«, rief es von draußen, als wir uns dem Landesteg näherten. Wir waren die Einzigen, die aussteigen wollten. Der Bootsmann drosselte den Motor, die schwarz-gelbe Kante des Anlegers kam dennoch bedenklich schnell auf uns zu. »Halt dich gut fest!«, sagte mein Vater. Mit einer letzten Welle wurden wir mit der Breitseite des Bootes dagegen geschleudert, rumms! Ich verlor fast das Gleichgewicht! Das Gitter der Reling öffnete sich kurz.
»Vorsicht, nass und glitschig!«, rief jemand auf Italienisch, zwei Hände halfen mir von dem schwankenden Boot, aber auch der Steg, auf dem ich nun stand, bewegte sich ächzend unter uns. Mein Vater wuchtete meinen Koffer hinüber. Schon legte das Boot wieder ab und verschwand im grauen Vorhang des Regens. Keine halbe Minute hatte es gedauert, weg war es, und mit ihm auch der Mützenjunge. Ein für alle Mal aus meinem Leben verschwunden.
Zwei Sekunden später standen wir unter dem schützenden Dach des Wartehäuschens, doch die Zeit hatte gereicht, um meine Haare ordentlich zu durchnässen. Vor uns ragten braun abgeblätterte Häuserfronten in den grauen Himmel, unten waren die winzigen Fenster vergittert, oben hingen alte Gardinen dahinter. Nicht gerade schick, vielleicht sogar unbewohnt. Ich sah mich um, das sollte das großartige Vänäzia sein …? Strömender Regen, Kälte, und es roch … nach Wasser und Schlamm und nach etwas Modrigem, das ich nicht benennen konnte. Na toll, dachte ich nur. Hier bleibe ich nicht!
»Benvenuto a Vänäzia«, wiederholte Papa.
Mist. Was habe ich mir nur dabei gedacht, hierherzukommen? Papa schien der Regen nichts auszumachen. »Ich würde uns ja ein Taxi auf vier Rädern spendieren, aber wie du weißt, gibt es hier bei uns weder Autos noch Fahrräder. Und um einen dieser kleinen nervigen Roller fahren zu dürfen, muss man in dieser Stadt unter acht Jahre sein!« Er strich mir liebevoll die nasse Haarsträhne, die an meiner Wange klebte, aus dem Gesicht. »Drei Minuten zu Fuß, Lucia, schaffst du das? Na ja, vielleicht fünf. Ich habe auch einen Schirm für dich!« Er zog einen hellblauen ombrella aus der Tasche seines Mantels und spannte ihn auf.
»Mit mir dauert es mindestens zehn Minuten länger!«, sagte ich und bemühte mich um ein cooles Grinsen, doch ich hörte selbst die Tränen in meiner Stimme.
»Ach, komm, so eingeschränkt, wie der gute Dr. Dr. Klaus dich beschrieben hat, bist du doch gar nicht!« Mein Vater betonte das Wort »eingeschränkt«, wie mein Stiefvater es getan hätte. »Du musst jetzt nur …«
»…üben, üben, üben!«, fiel ich in Papas restlichen Satz mit ein, und schon musste ich gegen meinen Willen lachen, und die Tränen verzogen sich. »Ich bemühe mich ja, aber ich mag ihn nicht«, sagte ich leise, während wir das Häuschen auf dem Steg verließen.
»Wahl deiner Mutter.« Typisch Babbo, er sagte nie etwas Schlechtes über andere Personen, selbst über Mama nicht, die ihn für den blöden Dr. Dr. Klaus verlassen hatte.
Meine etwas bessere Laune dauerte nur ein paar Sekunden an, denn schon beim nächsten Schritt zerrte der Wind so übertrieben wild an meinem Minischirm, dass er umklappte und ich bei dem Versuch, ihn festzuhalten, beinahe auf den glatten Steinen ausgerutscht wäre. Ich war erschöpft, ich war nass, ich blieb stehen.
Papa warf mir einen fragenden Blick zu, und da war sie auch schon über ihm: die Wolke! Eine Wolke, die niemand sehen konnte, nur ich. Als diese komischen Erscheinungen zum ersten Mal auftauchten, wusste ich nicht, was sie zu bedeuten hatten. Ich lag in meinem Krankenhausbett, eingegipst, Riesenkopfverband, und wunderte mich. Ich sah Wolken, die wie auseinandergezerrte Zuckerwatte aussahen und auch noch in unterschiedlichen Farben leuchteten? Erst dachte ich, ich halluziniere, Schädel-Hirn-Trauma eben, gerne von meinen Ärztinnen als SHT abgekürzt. Aber nach und nach wurde es immer offensichtlicher: Seit dem Unfall sah ich Gefühle.
Ja, sorry, ich habe mich nicht um diese Fähigkeit gerissen, lieber wollte ich normal sein. Ich sah die Farben und spürte dann ziemlich schnell, was sie zu bedeuten hatten. Wut wurde vor meinen Augen zu einer metallblauen Wolke, Eifersucht zu einer grüngelben, starke Abneigung loderte als orange Zuckerwatte über den Köpfen. Und egal, was die Menschen in dem Moment aussprachen – ich wusste, ob sie es wirklich so meinten.
Mittlerweile gab es nur noch selten eine Farbschattierung, mit der ich zunächst nichts anfangen konnte, das kam vor, wenn mir der Mensch fremd war und er oder sie sich gut verstellen konnte. Doch für alle anderen führte ich mittlerweile ein richtiges Farblexikon in meinem Kopf. Angst, Schadenfreude, Arroganz, blutrot, grün, blau, alles hatte einen eigenen Eintrag.
Manchmal hörte ich aber auch direkt ihre Worte, ungefiltertes Zeug, das hervorströmte, ohne Punkt und Komma, wie man eben so denkt.
Ist doch toll, könnte man meinen, so wusste ich also immer, ob die Leute mich anlogen. Aber nein, mich nervte es nur noch. Es war total unangenehm, als ob ich jemanden beim Telefonieren belauschte oder die geheimsten Seiten ganz privater Tagebücher lesen würde. Und wer möchte solche Peinlichkeiten schon wissen? Ich jedenfalls nicht! Deswegen war ich froh, dass das mit dem Gedankenhören nur sehr selten vorkam.
Bei meinem Vater war die Wolke jetzt hellgrau. Dank meines Lexikons wusste ich, dass er nur leicht besorgt war, denn je dunkler das Grau, desto schwerer die Besorgnis.
Würde ich ihm von meiner seltsamen Fähigkeit, die nach dem Unfall aufgetreten war, je erzählen? Hatte ich es meinen Ärztinnen oder sonst einem Menschen erzählt? Mama vielleicht? Absolut nicht! Die Untersuchungen in der riesigen Röhre hatten mir schon gereicht – was, wenn sie feststellen würden, dass ich jetzt auch noch »fantasierte«? Dass ich Stimmen hörte, seltsame Farben sah und behauptete, das seien die Gefühle und Gedanken anderer Menschen. Zu verrückt, oder? Eben.
Es war also nicht nur meine gebrochene Hüfte, die noch nicht wieder richtig funktionierte, es waren auch die Dinge in meinem Kopf, die mich fertigmachten!
»Es ist alles …« Zu viel, wollte ich sagen, mich in Papas Arme werfen und dort erst einmal richtig heulen, aber gleichzeitig hatte ich Angst, er würde sich dann noch mehr Sorgen machen. »… in Ordnung, geht gleich wieder.«
Mit meinem durchgedrehten Kopf würde ich allein klarkommen müssen. Dass diese uralte Stadt mit ihren milliardenfachen Geschichten dafür absolut nicht der richtige Ort war, spürte ich in diesem Moment so stark wie nie zuvor. Venedig, das war klar, würde alles nur noch schlimmer machen. Eine Woche, mehr nicht, dachte ich, dann fahre ich nach München zurück. Sorry, Papa. Und, sorry auch an dich Mama, diesmal nehme ich den Zug!
Wir entfernten uns vom Ufer, gingen über einen Platz, der sich zwischen den abweisenden Häusern öffnete, und kamen an einen Kanal. Super, schon wieder Wasser! Diesmal zwischen zwei gemauerten Ufern. Papa wandte sich nach links, wir gingen an einer Kirche aus rötlich braunen Backsteinen vorbei, von der er behauptete, dass sie sehr berühmt für die Bilder sei, die ein gewisser Tintoretto gemalt hatte.
Wir überquerten den Kanal auf einer Brücke, mittlerweile war es dunkel geworden, Häuserreihen, der nächste Kanal, Wasser, in dem sich die gelben Lichter der Laternen verschwommen spiegelten, noch mehr Brücken mit Stufen, ein Platz mit einem Brunnen, eine verrammelte orangefarbene Bude, die die besten Sommerdrinks versprach, all das nass und kalt im strömenden Regen. Meine Schuhe waren durchweicht, die Kälte kroch mir an den Beinen hoch.
»Ecco, la Fondamenta de la Sensa, jetzt sind es nur noch ein paar Meter. Da vorne ist es schon!« Papa wies auf das schmale Haus, in dessen Untergeschoss sich anscheinend ein kleines Café befand. »Il Boccadoro!«, sagte Babbo stolz. Das Goldmund. Er hatte mir sogar ein T-Shirt mit dem Schriftzug »Tochter des Chefs vom Il Boccadoro!« bedruckt und ins Krankenhaus geschickt. Auf die Karte hatte er geschrieben: Das gibt es nicht zu kaufen, das ist nur für dich! Mittlerweile war es so ausgeleiert, dass ich es nur noch zum Schlafengehen anzog. Aber eingepackt hatte ich es, denn es würde ihn freuen, es an mir zu sehen.
In diesem Moment fing es noch stärker an zu regnen, die Tropfen wurden von einer Windböe waagrecht durch die Luft unter unsere Schirme gepeitscht, wir suchten dicht an den Häusern Schutz und fingen an zu laufen, so schnell es mit mir eben ging. Da wurde kurz vor dem Café eine Tür aufgerissen, und jemand rief auf Italienisch: »Herein, kommt schnell herein!«
»Cosimo!« Mein Vater stoppte überrascht und rettete sich dann samt Schirm und Koffer durch die Tür ins Trockne. Ich schmiss den kaputten Minischirm von mir und folgte ihm. Keuchend schaute ich mich um und schüttelte meine nassen Haare.
Was sollte das hier bitte schön sein? Ein höchst chaotischer Antiquitätenladen? Ich betrachtete die unzähligen hässlichen Tonfigürchen, die in der Auslage des Schaufensters neben Madonnenfiguren und einem Wecker standen. Zwei orange Haartrockner hingen an verdröselten Kabeln von oben herab, davor ein oller Toaster. Schick, sehr schick!
»Darf ich vorstellen, das ist unser Nachbar und Vermieter Cosimo«, sagte Babbo. »Lucia, meine Tochter!«
Cosimo war ein uralter Typ, er trug Clogs mit dicken Socken an den Füßen, seine grauen Haare waren zu einem schütteren Pferdeschwanz zusammengebunden, und den lila-grünen Trainingsanzug hatte er ganz sicher schon dreißig Jahre vor meiner Geburt getragen. Bei dem Gedanken musste ich ein bisschen grinsen, wir schüttelten uns die Hand, und während Cosimo aufgeregt auf meinen Vater einredete, irgendwas mit Geld, das die Stadt von ihm wollte, checkte ich den Laden ab.
In jeder Ecke stapelten sich Bücher, schiefe Türme, die in der nächsten Sekunde zusammenkrachen konnten. Alte Lampen, Bilder in verschmutzten Goldrahmen, ein Garderobenständer, schief und krumm, mit abgebrochenem Fuß. Dies war ganz offenbar ein auf Sperrmüll spezialisiertes Fachgeschäft.
»Schau dich um, Lucia, nur eine Minute, dann gehen wir!« Mein Vater nickte mir entschuldigend zu. Okay, aber bitte nicht zu lange, dachte ich und schlenderte durch den völlig zugestellten Laden.
»Such dir doch was Hübsches aus!«, rief Cosimo hinter mir her, dann redete er weiter auf Babbo ein.
Die Mauern waren unverputzt, über die recht hohe Decke zogen sich zerfaserte Holzbalken, Neonröhren tauchten alles in ein grelles Licht. Um Cosimo nicht zu beleidigen, nahm ich mal den einen, mal den anderen Gegenstand in die Hand.
Was sollte ich mir hier schon aussuchen?! Ein angelaufenes Messingtablett? Oder eine Kuhglocke? Ein gewelltes Mickey-Mouse-Heft von 1995 oder ein rötlich braunes, staubiges Apothekerglas, auf dessen Boden sich ein paar getrocknete Würmer befanden? Na toll. Verpuppte Seidenraupen, stand seltsamerweise in akkurater deutscher Handschrift auf dem Etikett. Wie waren die wohl hierhin geraten?
Schnell stellte ich das Glas wieder an seinen Platz, suchte vergeblich nach etwas, an dem ich mir die Finger abwischen konnte, und schob mich langsam an Holzschränken und übervollen Regalen vorbei, bis ich weiter hinten im Gewölbe vor einer Tür stand, die nur angelehnt war. Neugierig drückte ich sie auf, sie öffnete sich aber nur ein Stück weit, gerade breit genug, um hindurchzuschlüpfen. Ich machte einen Schritt in den kleinen, unbeleuchteten Raum, aber meine Neugier war unbegründet gewesen; sobald meine Augen sich an das wenige Licht gewöhnt hatten, sah ich mich bloß noch mehr unnützem Schrott gegenüber. Ein auseinandergenommenes, altes Bettgestell, ein paar Kartons, vor allem aber mehr Bilder. Nebeneinander lehnten sie an der Wand, große Formate, in bröckelnden Rahmen.
Es roch muffig, nach Dingen, die vor langer Zeit einmal nass und wieder trocken und wieder nass geworden waren, und ich wollte schon umdrehen, als ich etwas hinter der Tür hörte. Eine Ratte? Mich überlief eine Gänsehaut, ich hatte keine Angst vor Mäusen oder Spinnen, aber bei Ratten hörte der Spaß auf! Trotzdem lugte ich hinter die Tür, bereit, jede Sekunde davonzurennen.
Jetzt erst sah ich, dass die Tür von einem Sessel mit hoher Rückenlehne gestoppt worden war, und darin saß … ein Mensch, ein Junge!!! Er glotzte mich mit großen, runden Augen an, ohne zu blinzeln.
Wow! Ich machte einen Satz zurück und stieß dabei an irgendwelchen alten Krempel. Mein Herz klopfte wie wild, meine Arme und Beine waren schlaff. Er musste mich doch gesehen haben! Aber er sagte ja gar nichts! »What the f…«, flüsterte ich, brach aber mitten im Satz ab, denn jetzt verstand ich. Es musste eine Puppe sein. Wie gruselig – eine lebensgroße Puppe! Ich lauschte, was schwierig war, weil mein Herz immer noch brüllend laut, bis in meine Ohren schlug: Pattatumm, pattatumm! Hörte ich da was hinter der Tür atmen? Nichts!
Ich stieß die Luft aus, um mich zu beruhigen. Mann, was bewahrte Babbos Vermieter für creepy Zeug in dieser Kammer des Schreckens auf? Doch ich wollte nicht wie ein kleines Kind zu ihm und meinem Vater rennen, also wagte ich mich noch mal vorsichtig hinter die Tür …
… iiirrghs, die Haare von dem Ding wirkten so echt, die Haut war milchig weiß, es sah wirklich übelst realistisch aus! War das Teil aus Wachs? Ich traute mich nicht, es anzustupsen. Die Puppe trug eine kurze Jacke und komische Hosen, die über den Knien zusammengeschnürt waren, so viel konnte ich sehen. Dazu lange Strümpfe und Schuhe mit einer fetten Schnalle vorne drauf, die im Dunkeln schimmerte. Ich hatte genug und rannte hinaus.
»Was ist das dahinten in der kleinen Kammer für ein Ding?« Außer Atem kam ich bei den beiden an.
»Was meinst du?«, fragte Cosimo. »Die Bilder? Das Bettgestell? Oh, das ist schon uralt, aber aus Messing, müsste man aufarbeiten lassen … Hast du dir was Hübsches ausgesucht?«
»Nee, noch nicht … Ich meine diese gruselige Figur …« Noch war es etwas ungewohnt, hier öffentlich die Sprache zu benutzen, die immer nur zu mir und meinem Vater gehört hatte. Ich war stolz, dass mirdie Wörter figura spaventosa eingefallen waren.
»Welche Figur? Auf einem der Bilder? Ach, die Gemälde habe ich bei der Auflösung eines Lagers gekauft.«
»Mimmo, wir müssen jetzt los, Lucia ist ja gerade erst angekommen, durchnässt und müde …«, sagte mein Vater, doch Cosimo redete weiter: »Wenn diese Aasgeier von der Regierung Ernst machen, muss ich alles verkaufen. Wenn die wirklich die Haussteuer erhöhen, muss ich es tun, verstehst du, Michele«, sagte Cosimo-Mimmo, seine Hand lag auf Babbos Unterarm, »da bleibt mir nichts anderes übrig!«
»Nein, Papa, ich bin zwar nass, aber gar nicht so müde«, sagte ich. »Aber können Sie bitte mal kurz mitkommen, Herr Cosimo?« Ich brachte es nicht fertig, ihn einfach zu duzen, weil er so alt war, dafür wollte ich unbedingt wissen, warum er diese lebensechte Puppe in der Kammer herumsitzen hatte.
»Für dich bin ich Mimmo!« Cosimo-für-mich-Mimmo klopfte auf Babbos Schulter und kam mit mir. Ich war froh, denn noch mal hätte ich mich nicht allein in die Kammer gewagt.
»Welches Bild meinst du denn?«, fragte Cosimo. »Eins von denen hinter den Kisten?«
»Äh, nee, da …?« Ich zeigte auf die Lehne des Samtsessels, auf der – sehr spooky – eine weiße regungslose Hand lag, die aus einem Ärmel mit Spitzenmanschetten ragte.
Cosimo zog den Bauch ein und quetschte sich hinter die Tür. »Die hinter dem Sessel? Ja, wie gesagt, die kamen alle aus der Lagerauflösung, ich habe die danach zwar begutachten lassen … war aber nichts wirklich Wertvolles dabei, alles nur Kopien von einer Kopie.«
Ich schaute zwischen ihm und der fiesen Figur hin und her. Keine Reaktion! Er sah sie nicht! Das war doch unmöglich!
»Ein paar unechte Schinken hab ich mir da andrehen lassen. Angeblich aus dem Barock, aber nix da.« Cosimo zog eines der Bilder halb hervor und strich rau über die Oberfläche. »Die vergoldeten Rahmen sind ja ganz hübsch, aber fast alle wurmstichig, nichts Besonderes, und die Leinwände …? Vielleicht sind die alten Leinwände ja noch zum erneuten Bemalen gut. Malst du?«
Ich schüttelte den Kopf und blickte zu der Puppe mit der grünen Brokatjacke. Sie rührte sich immer noch nicht, aber eines ihrer runden Augen, das rechte, hatte leicht gezuckt und die Augenbraue darüber auch, hundertpro! Ich starrte sie entsetzt an, sie starrte seelenruhig zurück, als ob sie erst mal gründlich über mich nachdenken müsste.
Wie unheimlich, wie grässlich! Mein Hirn hatte also beschlossen, komplett verrückt zu spielen, und zeigte mir etwas Lebloses, Totes, das aber blinzeln konnte, danke, Gehirn! Oder waren es die vielen Medikamente? Wie sollte ich denn weniger davon nehmen, wenn die Schmerzen immer noch jeden Tag und jede Nacht da waren?
»Und sonst?« Meine Stimme zitterte leicht. »Gibt es in diesem Raum nicht doch noch etwas anderes … dessen Wert man auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennen kann?«
»Nun ja …« Cosimo schaute sich um, als ob er den kleinen Abstellraum zum ersten Mal sah.
»Geben Sie sich keine Mühe, Signorina«, sagte die Blinzelpuppe plötzlich leise, »er sieht mich nicht!«
»Scheiße, wer bist du?!«, rief ich auf Deutsch, denn vor Schreck war mein Italienisch weg.
»Was?«, fragte Cosimo, der neben mir ein wenig zusammengezuckt war.
»Haben Sie, äh, hast du das eben gehört?«, fragte ich auf Italienisch, obwohl ich die Antwort schon ahnte.
»Er hört mich auch nicht«, sagte die Figur und lehnte sich jetzt auch noch ein Stück vor. »Niemand sieht oder hört mich außer Ihnen!« Er sprach ein seltsam klingendes Italienisch, das ich trotzdem verstand.
»Na toll, du blödes, zusammengestauchtes Hirn«, sagte ich heiser auf Deutsch. »Bitte sag sofort, dass das nicht wahr ist!« Aber mein Hirn sagte gar nichts mehr, dafür meldete sich Mimmo.
»Was denn ›gehört‹?« Babbos Nachbar kratzte sich unter seiner Kappe am Kopf. »Ich geb ja zu, hier steht ziemlich viel Gerümpel. Müsste man mal sichten, aussortieren, ausräumen, vielleicht sogar einiges wegtun. Komm, dein Vater wartet auf dich!« Schon klapperte er auf seinen Clogs davon. »Morgen, das mache ich morgen«, hörte ich ihn sagen. »Oder übermorgen. Schauen wir mal …«
Oh Mann, ich hatte es doch sofort gewusst! Hier in Venedig sah ich noch verrücktere Sachen als in Deutschland! Ich atmete tief aus, machte die Tür hinter mir fest zu und drehte den verrosteten Schlüssel zweimal um.
2. Kapitel
Zunächst blieb alles ruhig, ich schaute mich mehrfach um, aber keine lebensechte Puppe kam aus der Mauer hervorgeschwebt, um mir zu folgen. Glück gehabt! Wir verabschiedeten uns von Cosimo-nenn-mich-Mimmo und traten wieder hinaus in den Regen.
»Entschuldigung für die Verzögerung, Cosimo ist ein toller Mensch! Im ersten Jahr, als das Boccadoro eröffnet wurde, hatte er eine sehr geringe Miete von mir verlangt, und jetzt, im zweiten Jahr, hat er anscheinend vergessen, sie zu erhöhen. Es ist nicht fair, dass die Stadt ihm solche Probleme macht! Schwierig genug, das alles zu erhalten!« Babbo zeigte auf die Fassade des Nachbarhauses, an der wir jetzt hastig im Regen vorbeieilten. Sie war blassblau, ziemlich schäbig und fleckig. Rechts und links der Tür hingen zwei Schaukästen mit Büchern, daneben jeweils ein Fenster, aus dem Licht schimmerte. Ich erwartete, jeden Moment irgendwo das Gesicht von Blinzelpuppe auftauchen zu sehen und dass ich deswegen schreien müsste; doch ich riss mich zusammen, ich tat es für Papa, der ja so megastolz auf das abgeblätterte Ding war.
»Wow, das sieht toll aus!« Ich lächelte schwach. »Ist es denn nun ein Café oder ein Buchladen?«
»Libreria e Bistro!« Er ging an dem Buchladen-Bistro vorbei und bog in eine Gasse, die gleich dahinter begann. Nein, keine Gasse, eher ein verdammt schmaler Gang, der das Haus vom Nebenhaus trennte. Man könnte auch sagen, kofferbreit, denn mein Koffer passte gerade so hindurch. Ich bekam leichte Platzangst zwischen den Mauern und versuchte, ruhig zu atmen.
»Viel Arbeit, aber jetzt im November ist weniger los, also haben wir ein bisschen Zeit.« Babbo schloss die Haustür auf. »Komm, ich zeig dir erst mal dein Zimmer! Oben ziehst du dir trockene Sachen an, und dann gehen wir runter in den Laden, was Warmes trinken, eine Kleinigkeit essen, wie du willst!«
Bis jetzt war Vänäzia ein ziemlicher Horror gewesen, zu viel Wasser von oben und unten, und mein Gehirn gaukelte mir sprechende Horrorpuppen vor, mille grazie, aber im Haus wurde es besser: Ich hatte ein eigenes Zimmer! Winzig, aber richtig gemütlich, mit einem breiten Bett, einem Kleiderschrank und einem Fenster, das auf den Kanal hinausging. Wohin sonst, hier ging alles auf einen Kanal hinaus, denn sie waren ja überall, diese üblen Kanäle voller Wasser. Das Schönste war das kleine Badezimmer, das dazugehörte, nur für mich! Es war kuschelig warm darin und die Wände von braunen und kupferfarbenen Mosaiksteinchen bedeckt. Echt toll sah das aus, mit dem glitzernden Kronleuchter an der hohen Decke und der gläsernen Duschkabine.
Ich wusch mir die Hände und sah mich dabei in dem großen Spiegel an. Beruhig dich, sagte ich mir, der Typ da unten in der Kammer war nicht echt! Eine Idee deines durchgeknallten Gehirns, ein schlechter Tagtraum, mehr nicht.
Und jetzt raus den nassen Klamotten! Bequeme Jogginghose an und trockene Strümpfe und Schuhe! Vorsichtig kippte ich den Koffer und ließ ihn auf den Perserteppich gleiten. Warum ist das Ding so schwer, so viel habe ich doch gar nicht eingepackt, dachte ich, und ist das Rosa schon immer so blass gewesen, oder liegt das nur am Licht des Kronleuchters, das vom Bad ins Zimmer scheint?
Ich ließ die Schlösser aufschnappen und hob den Deckel an. Was? Nein! Das waren nicht meine Sachen, ganz bestimmt nicht! Oh shit, auch das noch!! Hatte Papa auf dem Boot den Koffer vertauscht, oder hatte ich bereits am Gepäckband im Flughafen nach dem falschen Gepäckstück gegriffen? Aufgeregt wühlte ich in den fremden Klamotten herum. Alles war dunkel, alles schwer, weich, warm. Die Stoffe fühlten sich teuer an, und dieser Pullover da, ich strich darüber, war das etwa Kaschmir? Dazwischen steckten ein Ladekabel, ein kleiner Tuschkasten, ein Zeichenblock, ein Etui mit Kohlestiften, eine Einmalkamera, eine graue Wollmütze, genau das Modell, das auch … und nun war mir plötzlich klar, wem der Koffer gehören musste! Dem Wollmützen-Jungen! Seltsame Farbe allerdings, für einen coolen Typ wie ihn …
Obwohl, warum sollte ein Mann nicht auch mit einem rosa Koffer reisen dürfen? Er war ja eher altrosa, fast grau, egal. Wie in Trance zog ich eine schmale schwarze Hose mit leicht ausgestellten Beinen hervor, danach einen von den superweichen, dünnen Rollkragenpullovern, von denen es eine Menge gab, in Dunkelgrün und auch in einem dunklen Violett. Ich fand kein Schild, keinen Hinweis, wo vorne und hinten war, keine Marke. Auch in den anderen Kleidungsstücken nicht. Doch ich wusste, auch wenn sie mir viel zu groß sein sollten, ich würde diese Sachen tragen – und freiwillig nicht so schnell wieder hergeben!
Langsam ging ich die zwei Stockwerke hinab, bloß nicht mit den riesigen Turnschuhen stolpern. Größe 45 stand darin, aber sie waren wenigstens trocken. Attenzione! Ich wollte mir nicht noch mal die Hüfte brechen, bei meinem Glück wäre es diesmal die andere, die linke …
Unten im Foyer hielt ich einen Moment lang inne. Vor mir lag die Tür zum Bistro, dahinter hörte ich Stimmengewirr. Normalerweise wäre ich jetzt aufgeregt, fremden Leuten begegnete ich nach dem Unfall höchst ungern. Mein Kopf schmerzte dann schnell, weil alle Eindrücke ungefiltert auf mich einprasselten; doch die fremden Klamotten, die ich trug, schienen eine weiche Schutzschicht zwischen mir und dem, was ich nicht kannte (und auch nicht kennen wollte), zu bilden.
Beherzt grinsend öffnete ich die Tür und wappnete mich schon mal dagegen, die komische Gruselpuppe von nebenan vor mir sitzen zu sehen … Doch ich landete nur direkt in einem dunkelgrünen Filzvorhang. Als ich ihn auseinanderschob, stand ich im Café. An den Backsteinwänden gab es Regale, die mit unzähligen Büchern gefüllt waren, dazwischen Bilder, auf den blanken Holztischen Vasen mit Blumen, ein buntes, gemütliches Durcheinander. Die gigantische Kaffeemaschine brummte und fauchte, und draußen klatschte noch immer der Regen an die Scheiben.
Die Frau hinter der Theke hatte schwarze Locken und trug auffällige, goldene Ohrringe. Ihre Haut war dunkel, ihr Mund rot geschminkt, und als sie mich entdeckte, ließ sie den Topf mit der aufgeschäumten Milch sinken und zeigte ein breites Lächeln.
»Du musst Lucia sein!«
Ich nickte und schüttelte über den Tresen hinweg ihre Hand. »Ich bin Amanda!«, sagte sie, und da war auch schon mein Vater, der mich mit stolzem Blick in Empfang nahm und sich räusperte, um die Kaffeemaschine zu übertönen: »Lucia, darf ich dir vorstellen, das Boccadoro! Boccadoro, mia figlia, Lucia!«
Die wenigen Gäste, die an den kleinen Holztischen saßen, hoben zwar den Kopf und nickten mir freundlich zu, aber … Mann, waren die alle alt hier! Das amerikanische Pärchen dort vorne, das sich lautstark die Karte vorlas, war mindestens hundert. Das daneben bestimmt achtzig, so runzelig, wie die aussahen! Der Rest so um die fünfundvierzig, wie Papa und Amanda, ich konnte das schwer einschätzen, aber unter zwanzig war hier niemand, und Leute in meinem Alter gab es schon mal gar nicht.
Doch die Stimmen, die mich sonst ungefragt mit den Gedanken der alten Menschen versorgt hätten, schwiegen. Was für eine herrliche Ruhe! Kam das wirklich von dem, was ich anhatte? Langsam strich ich über den weichen Kaschmirstoff an meinem Unterarm.
»Schönes Outfit, so …« Mein Vater suchte nach Worten. »So …«
»Du meinst, zu groß für mich?« Ich zuckte mit den Schultern. Die zu langen Hosenbeine verdeckten die riesigen Turnschuhe, die Ärmel hatte ich extra nicht umgeschlagen, ich mochte es, dass meine Hände daraus nur halb hervorragten. Außerdem war die Hose oben am Bund schön weit, ohne zu rutschen. Die Narbe an meiner rechten Seite war höllisch rot und immer noch sehr empfindlich.
»Trägt man jetzt so!«, behauptete ich. Niemals würde ich ihm von meiner albernen Vision in der Kammer erzählen, und ich hatte auch nicht vor, ihm von dem Koffertausch zu berichten, jedenfalls noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht. Denn zu viel Aufregung sollte ich ja auch vermeiden, hatte die allwissende Frau Dr. Gralla aus der Reha empfohlen. Danke, Dr. Gralla! Ich musste über mich selbst und meine Ausreden lächeln.
»Was möchtest du essen?« Mein Vater führte mich zu einem der Tische und reichte mir die Speisekarte. »Wir haben Kuchen, wir haben vegane Snacks, die crostini mit Auberginenmus sind besonders zu empfehlen!«
Die Erinnerung an die fiese Blinzelpuppe verblasste hinter dem coolen Gefühl, Tochter des Chefs zu sein.
Wenn jetzt noch Wollmützen-Junge neben mir säße, dachte ich … der war schon ziemlich sweet, gib’s zu! Du kannst ja versuchen, ihn zu finden, müsstest dann allerdings auch seine Klamotten wieder hergeben. Ich umarmte mich selber, um den weichen Pullover noch besser auf der Haut spüren zu können. Nein, alles zurückzugeben, darauf hatte ich im Moment dann doch keine Lust! Und hatte er nicht mehr als deutlich demonstriert, dass er nichts von mir wollte? Auf dem Flughafenboot hatte er mich kein zweites Mal angeschaut. Also würde er wohl auf seine Sachen verzichten müssen. Und ich auf meine. Was er wohl gedacht hat, als er den falschen Koffer öffnete?
Bei dem Gedanken an meine drei Jogginganzüge, in Grau, Gelb und Flaschengrün, die verwaschenen Hoodies, die ausgeleierten T-Shirts mit den Aufdrucken des Schulmarathons von vor drei Jahren und den komischen Flamingos, rutschte ich unruhig auf dem Stuhl hin und her. Meine geliebten Gummilatschen inklusive Schriftzug der Klinik, die vielen Packungen Schmerztabletten, von denen ich Gott sei Dank auch einige im Handgepäck untergebracht hatte. Wahrscheinlich dachte er, ich bin süchtig oder so was.
Und ach nee, das nicht auch noch: meine Unterwäsche! Mein Gesicht wurde ganz heiß. Oh Gott, wenigstens die abgetragenen Unterhosen und die etwas angegrauten BHs hätte ich durch ein paar neue hübsche Teile ersetzen sollen, so wie Mama es mir angeboten hatte. Warum sollte ich?, hatte ich gedacht. In Venedig sieht doch niemand mehr von mir als meine dicke, currygelbe Winterjacke. Tja, falsch! Der Wollmützen-Junge hatte vermutlich schon die oberpeinlichen Details gesehen und wusste jetzt alles von mir, na ja, vieles.
Besser, wenn ich ihn nie mehr träfe. Zwei Dinge waren mir klar: Ich würde Venedig auf keinen Fall nach ihm absuchen und auch keinen Schritt mehr in Cosimos Laden setzen! Und in einer Woche wäre ich schon wieder weg.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem wohligen Grunzen und streckte mich vorsichtig, ausnahmsweise taten mir weder die rechte Hüfte noch das rechte Handgelenk besonders weh. Doch ich würde heute natürlich trotzdem meine Schmerzmittel brauchen, ich musste mir meinen Vorrat aus dem Rucksack also gut einteilen. Dr. Gralla hatte gesagt, es wäre an der Zeit, die Menge zu reduzieren. Ich bewegte mein Handgelenk in kleinen Kreisen und besah mir die Narbe. Darunter lag jetzt eine Metallplatte, fixiert mit drei Schrauben, auch an meiner Hüfte waren zwei von den Dingern angebracht worden, die mussten alle irgendwann wieder raus.
Um nicht schon wieder an Krankenhaus, OP oder Reha zu denken, duschte ich erst einmal heiß und hüllte mich dann in den weißen Bademantel, der für mich im Bad gehangen hatte. An den Füßen trug ich warme Socken, natürlich von Wollmützen-Junge, die schwer nach »selbst gestrickt« aussahen. So verpackt, hängte ich mich aus dem offenen Fenster und sah nach draußen, während ich mir gut gelaunt die Zähne putzte. In seinem Koffer hatte ich gestern Abend eine neue Zahnbürste gefunden, dazu eine superminzige, leckere Zahnpasta.
Es war zwar kühl, doch die Sonne schien vom knallblauen Himmel und das Wasser im Kanal zwei Stockwerke unter mir war nicht mehr dunkelgrau und bedrohlich, sondern leuchtete sauber und türkisfarben. Auf unserer Seite gab es ein breites, mit alten Marmorsteinen gepflastertes Ufer, drüben nur Hauswände in Gelb und Terrakotta. Bei allen blätterte am Sockel die Farbe ab, vielleicht vom Wasser? Stieg es wirklich manchmal so hoch? Doch die Fenster waren mit Blumenkästen geschmückt, in denen sich jetzt, Ende November, rote Weihnachtssterne mit vertrocknetem Gestrüpp abwechselten. Dazwischen eine alte Lagerhalle aus Backsteinen, mit einem breiten Tor, dessen Schwelle vom Wasser überspült wurde.
Ich hörte das Geräusch eines Motors. Ein langes, schmales Boot kam ziemlich schnell durch den Kanal gefahren, der Typ darauf schien es echt eilig zu haben, die Umzugskartons, das Bettgestell und die Matratze, die im Heck zu sehen waren, irgendwohin zu bringen. Als er vorbei war, schwappte das Wasser unheilvoll an den Hauswänden hoch und über das Ufer. Noch ein Boot. Diesmal aus der anderen Richtung. Die zwei kräftigen Typen in schwarzen Latzhosen, die rauchend am Steuer standen, hatten mehrere gelbe und blaue Tonnen an Bord. Ihm folgte, mit heulender Sirene und Blaulicht, eine knallorange Ambulanz. Meine Güte – Umzüge, Müll, Krankentransporte … die machten hier ja wirklich alles auf dem Wasser!
Ich gab meinen Platz am Fenster auf, zog die Gardinen vor und begann, mich anzuziehen. Schnell schlüpfte ich in eine der vermutlich von Wollmützen-Junge sorgsam gefalteten Unterhosen, na und, sie war frisch gewaschen, schwarz und von Calvin Klein. Die einzige Marke übrigens, die ich unter seinen Klamotten hatte entdecken können. Ich zog ein langärmeliges T-Shirt an, darüber wieder den schönen Pullover und stieg in die Hose von gestern. Ich hatte seine Sachen systematisch durchsucht. Nirgendwo war sein Name zu finden, auch nicht in den zwei Romanen über Venedig, die er mitgeschleppt hatte. Er schien altmodisch zu sein, denn er las noch auf Papier, nicht wie ich auf dem Reader. Auch in der italienischen Architekturzeitschrift von 1995 fand ich keinen Namen. Was wollte er bloß damit? Der einzige Artikel über Venedig handelte von einer Kirche und war schon uralt!
Außer mehreren schwarzen Hosen, extrem schönen Pullovern in dunklen Farben und einer coolen Jacke hatte ich noch ein weiteres Paar Schuhe gefunden, schwarz, Leder, verpackt in einem extra Schuhsäckchen, eine Tube Schuhcreme dabei, ein ordentlicher Mensch, jawohl! Sogar an Gummistiefel für das Hochwasser hatte er gedacht.
Es war schon fast elf Uhr, als ich endlich unten im Café ankam und leise die Tür hinter mir zuzog. Doch ich hätte mir die Rücksicht sparen können, es waren noch keine Gäste da, dafür ertönte in dieser Sekunde lauter Reggae aus den Boxen.
»Buon giorno, Lucia!« Amanda kam aus der Küche mit einem Tablett cornetti, stellte es auf die Theke und machte die Musik leiser. »Hast du Hunger? Willst du frühstücken? Michele macht Einkäufe für das Bistro, ich soll dich grüßen, er ist gegen eins wieder da!«
Ich lächelte. »Ein Cappuccino wäre großartig«, antwortete ich auf Italienisch.
»Setz dich, setz dich! Wir öffnen gleich, doch noch habe ich Zeit!«
Es war warm hier drin, ich zog den Pullover über den Kopf und suchte mir einen der Tische aus. Dabei entdeckte ich mich in einem der Spiegel, die an der Wand zwischen den Regalen hingen, und hielt inne. Mein dunkelbraunes, dickes Haar umhüllte meinen Kopf wie ein Helm, die Spitzen bogen sich wie von allein nach innen, mein Pony war lang und fransig cool, fast ragte er über meine schwarzen Augenbrauen. Tatjana aus meinem Zimmer hatte ihn mir oft geschnitten, sie konnte das ziemlich gut, klar, sie wollte ja auch Friseurin werden. Plötzlich musste ich auch an Paula und Kajsa und alle, mit denen ich wochenlang zusammengelebt hatte, denken. Wir hatten oft zusammen geweint, hatten uns gegenseitig getröstet, besonders nachts, wenn alles so schwer und hoffnungslos und scheiße erschien, und waren dann wieder total albern gewesen. Die »Gäng von Station vier« hatten sie uns genannt, und manchmal waren sie mir auch auf die Nerven gegangen. Aber nun vermisste ich sie! Noch stärker als meine Freundinnen aus der Schule. Unglaublich!
Ich ging näher an den Spiegel heran. Mein Schminkzeug hatte ich schlauerweise auch in meinem Rucksack bei mir gehabt, darauf brauchte ich also nicht zu verzichten, mehr als ein bisschen Abdeckpuder und Lipgloss hatte ich zwar nicht benutzt, doch ich fühlte mich so gut wie lange nicht mehr.
»Du siehst toll aus«, sagte nun auch Amanda, die mit einem Tablett an meinen Tisch kam und meine prüfenden Blicke bemerkt haben musste. Sie stellte einen Cappuccino, ein Glas mit frisch gepresstem Orangensaft und einen Teller voller kleiner Tramezzini-Dreiecke auf den Tisch, und dann ging es los: Aha, aha, das ist sie also … Als ich das erste Mal hörte, dass Michele eine Tochter hat, habe ich ja gedacht, das wird Probleme geben. Wer weiß, wie sie es findet, wenn ihr Vater mit einer Frau zusammen ist, die eine dunkle Hautfarbe hat und dazu noch ein paar Jahre älter ist als er. Aber diese Lucia hier sieht recht nett aus …
Es war mal wieder so weit: Ohne Pauseströmten Amandas Erinnerungen und Gedanken durch mein Gehirn, und das war wirklich zu viel Information für meinen Kopf!
Sie ist sogar sehr hübsch, genau wie er, er ist auch so gut aussehend, ja, sie sieht ihm ähnlich, ach, ich liebe diesen Mann … allein, wie er mich manchmal … STOPP!
Schnell zog ich den Pullover wieder an und rollte den Kragen bis zu den Ohren hoch, gleich wurde das Gebrabbel leiser.
»Käse, Schinken, pikantes Auberginenmus«, sagte Amanda jetzt. »Dein Vater hat gesagt, du liebst es salzig zum Frühstück, so wie er!«
Ich nickte und sog den köstlichen Kaffeeduft ein, der in der Luft lag. Sie wusste ganz schön viel über meinen Vater, denn sie war mit ihm zusammen, und ich war mir nicht sicher, ob mir das gefiel. Amanda musterte mich von oben bis unten und wieder zurück. »Ich mag deinen Style!«
Okay, das waren nicht bloß Komplimente, um sich bei mir einzuschleimen … Ich spürte, dass sie meinte, was sie sagte, und das war eigentlich ganz cool, sie war eigentlich ganz cool. Sollte mein Vater doch auch eine Freundin haben, schließlich hatte Mama ihn verlassen, und nicht er sie …
»Und ich mag deinen!«, sagte ich.
Wir grinsten uns an, wir konnten unterschiedlicher nicht aussehen. Sie klein und mit vielen Rundungen, gehüllt in bunte, afrikanische Kleidung mit großen Mustern, wieder mit den großen Ohrringen geschmückt und heute auch noch mit einem zur Schleife gefalteten grüngelben Tuch auf dem Kopf. Ich dagegen eher dünn und groß, in dunkle Farben gehüllt. Ohne Schmuck.
»Willst du später rausgehen? Venedig entdecken?« Sie zeigte auf meinen kleinen Rucksack und die Jacke (von Wollmützen-Junge), die ich dabeihatte.
»Siiiii, forse«, antwortete ich gedehnt. Ja, vielleicht. »Ich habe nur keine Schuhe.« Ich wies auf die Wollsocken an meinen Füßen. Bisher hatte ich niemandem von dem vertauschten Koffer erzählt. »Meine sind immer noch nass, ich habe vergessen, sie auf die Heizung zu legen, und auch, ein zweites Paar einzupacken.« Ich vergaß echt viel, seitdem der Unfall passiert war, vielleicht hatte Babbo Amanda ja eingeweiht.
»Welche Größe?«
»Neununddreißig.«
»Könnte passen.« Sie eilte davon und kam mit einem Paar grüner Gummigaloschen wieder. »Haben wir immer hier rumliegen, bei dem ewigen Hochwasser kommen wir hier morgens gerne mal mit nassen Füßen an!« Sie kniete sich mit den Schuhen vor mich hin.
»Ich kann das allein«, sagte ich. »Aber danke!«
»Ich wusste nicht …« Sie sah mich von unten mit ihren großen dunklen Augen an. »Michele hat nur ein bisschen erzählt. Wie ist es passiert? Tut dir was weh? Jetzt? Im Moment? Wie geht es dir damit? Träumst du noch davon?«
Ich zögerte. Noch nie hatte sich jemand so offen nach dem, was passiert war, erkundigt. Doch dann musste ich lächeln, und obwohl ich sie gar nicht kannte und sie ziemlich viel älter als ich war, griff ich nach ihrer Hand und zog sie nach oben. Ich mochte ihre Neugier, die war ehrlicher als das blöde Rumgedruckse, das mir bisher begegnet war.
»Es war ein Unfall, jemand hat mich übersehen und angefahren, Auto gegen Fahrrad, na ja, das war übel, ich bin ziemlich weit geflogen.«
»Oh Dio!« Sie setzte sich neben mich und schob mir die Tasse zu, ohne mich aus den Augen zu lassen.
»Ja. Das war schon echt krass … Meine Hüfte rechts war gebrochen und mein rechtes Handgelenk, und obwohl ich einen Helm aufhatte, habe ich mir beim Aufprall auf der Straße ordentlich den Kopf angestoßen. Schädel-Hirn-Trauma.«
»Ach, wie fürchterlich!«
»Ja, Horror! Keine Ahnung, warum ausgerechnet mir das passiert ist. Ich war safe auf dem Fahrradweg unterwegs, bin nicht bei Rot gefahren, hab keine Musik per Kopfhörer gehört, trotzdem hat das Auto mich voll erwischt. Der Typ wollte rechts abbiegen und hat mich übersehen …«
Amanda schüttelte wortlos den Kopf, während sie mich anschaute, die Hand vor dem Mund.
»Die Brüche waren heftig und der am Handgelenk ziemlich kompliziert, aber am schlimmsten war das mit dem Kopf. Als ich nach ein paar Tagen im Krankenhaus aufwachte, saß Mama an meinem Bett und Babbo auch, beide weinend und mit dieser furchtbaren Angst in den Augen, in meinem Kopf könnte durch die schwere Gehirnerschütterung alles nur noch Brei sein.«
»War es aber nicht!« Amanda tätschelte begeistert meine Hand.
»Na ja, als ich so langsam wieder normal wurde, habe ich festgestellt, dass Mathe weg war, nur plus und minus rechnen konnte ich noch, aber ab den Hunderterzahlen wurde auch das schwierig … Viele andere Sachen von früher waren zunächst auch nicht mehr da.« Dafür kamen plötzlich diese anderen Fähigkeiten dazu, dachte ich, und die scheinen auch nicht mehr verschwinden zu wollen … Fähigkeiten, die ätzend, unnötig, nervig waren. Doch das sagte ich ihr natürlich nicht.
»Ich wurde viermal operiert, zweimal am Kopf, einmal an der Hüfte, einmal am Handgelenk, es tut immer noch weh, ich muss ziemlich oft Tabletten gegen die Schmerzen nehmen.«
»Jeden Tag?«
»Jeden Tag.« Ich sah zu meinem Rucksack und dachte an die Tabletten darin, irgendwann, ziemlich bald sogar, würde ich Babbo von dem vertauschten Koffer erzählen müssen, hoffentlich konnte er mir mehr Schmerzmittel besorgen und mehr Magentabletten und natürlich auch das Zeug, von dem ich schlafen konnte.
»Und ich musste danach vieles wieder neu lernen, zum Beispiel laufen.«
»Aber jetzt geht das doch wieder ganz wunderbar, man sieht es gar nicht.«
Na klar sieht man es, dachte ich und wurde wütend, ich wusste nur nicht, auf wen eigentlich. »Aber der liebe Dr. Dr. Chefarzt Klaus, zufällig auch …« Mein Mund fing an zu mahlen und zu zucken, wie immer, wenn ich nach Worten suchte, ich hatte mich dabei mal im Spiegel gesehen, es sah grässlich aus! Ich hielt meinen Kiefer mit beiden Händen fest, tat so, als ob ich mein Kinn abstützte. Was hieß»mein Stiefvater« auf Italienisch? Keine Ahnung. Sowieso ein Scheißwort, das ich auch auf Deutsch nie benutzte.
»Na ja, jedenfalls redet der neue Typ von meiner Mutter nur über mein wahnsinniges Glück, überhaupt überlebt zu haben, und er labert von Feinmotorik und ›üben, üben, üben‹, und auch Mama liegt mir mit ›Dankbarkeit verspüren‹ und ›Geduld haben‹ in den Ohren und mit ›das wird schon wieder‹.«