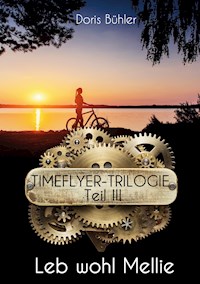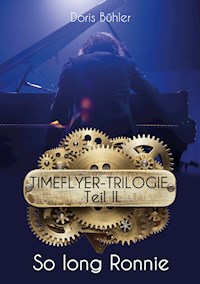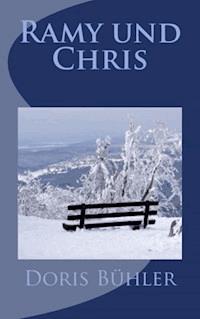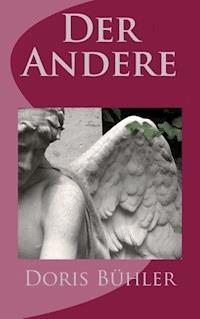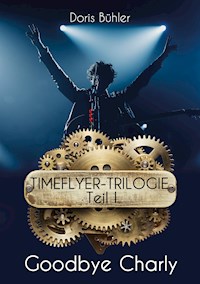
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Timeflyer-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Als Assistentin des Physikers Dr. Weißgerber erlebt Karin Wieland die Entstehungsgeschichte des Timeflyers, einer kleinen Zeitmaschine am Handgelenk zu tragen, hautnah mit. Zuerst als Protokollführerin bei den ersten Experimenten, später als Testperson bei ersten Versuchen. Während sie in der Vergangenheit die vorgeschriebenen Tests durchführt, sucht sie heimlich nach dem mittellosen Jungen Karl-Heinz Schwarzkopf, der in ihrer Zeit als der große Rock-Star Blackhead-Charly weltbekannt, für sie jedoch unerreichbar ist. Sie begegnet Kalle, wie er von seinen Freunden genannt wird und findet in ihm die Liebe ihres Lebens. Doch es kann keine gemeinsame Zukunft für sie geben, weil beide in ihrer eigenen Zeit gefangen sind. Mit einem Trick versucht Karin, diese Liebe in ihre Gegenwart zu retten, - doch das kann nicht gelingen, denn... das Schicksal läßt sich nicht manipulieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nur wenige Forscher besitzen die Kühnheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die massiv gegen die politische Korrektheit der Physikerzunft verstoßen
Start in ein neues Leben
Der erste Job
Im Wohnturm
Carlo
Angela
Abschied
Whatever will be will be
Berlin
Auf der Suche nach Angela
Erste Schritte
Blackhead-Charly
On the Top - Ganz oben
Zwei Jahre später
Goodbye Charly
EPILOG
Nur wenige Forscher besitzen die Kühnheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die massiv gegen die politische Korrektheit der Physikerzunft verstoßen. Stephen Hawking
Das Hotelzimmer lag im achten Stock, vom Balkon aus bot sich ihnen ein herrlicher Blick über das nächtliche Hamburg, und es schien, als präsentiere sich die Stadt extra für sie in einem so unbeschreiblich festlichen und faszinierenden Lichtermeer. Ein Halbrund diffusen Lichtes lag wie eine große Kuppel über der gesamten Stadt. Vereinzelt mogelten sich die Flugzeuge, die vom Flughafen aus starteten oder dort landeten, unter die Millionen von Sternen, - kleine bewegliche Lichtpunkte, die lautlos aufstiegen oder herabsanken. Nur ganz leise war der lärmende Verkehr von der Straße her zu hören: Heimkehrende Hotelgäste, hupende Autos, ein Martinshorn, irgendwo eine Schiffssirene…
Sie atmete tief aus und begann dann, ihm ihre Geschichte zu erzählen:
„Es war kein Zufall, dass wir uns begegnet sind, Kalle. Schon damals habe ich dir gesagt, dass ich dich gesucht habe, - erinnerst du dich? Mir war klar, dass du mir nicht glauben würdest. Dass du dich trotzdem in mich verliebt hast, war wie ein Geschenk für mich.
Damit du verstehst, warum ich mich in den vergangenen Jahren nicht bei dir melden konnte, muss ich dir die Geschichte von Anfang an erzählen. Doch womit soll ich anfangen? Mit dem Tag, an dem mir Dr. Weißgerber anbot, seine Assistentin zu werden? Oder mit den Wochen danach, in denen ich seine Aufzeichnungen abtippte, die eigentlich gar nicht zu seinem Arbeitsbereich gehörten? Wochen in denen ich allmählich begriff, worum es darin ging und was es mit seinen geheimen Zusammenkünften mit dem Physiker Prof. Riechling aus Heidelberg auf sich hatte?
Es war eine aufregende Zeit damals, Anfang des Jahres 1986, und einer der Höhepunkte war das erste Experiment, an dem ich teilnehmen durfte.
Obwohl dieser erste Versuch geheim bleiben sollte und nur eine Handvoll auserwählter Wissenschaftler dazu eingeladen worden war, fand er im Büro des Doktors im Institut statt. Er verließ sich darauf, dass sich jeder von ihnen an das Versprechen hielt, um das man sie gebeten hatte: Nämlich absolutes Stillschweigen zu bewahren.
Nachdem er an diesem denkwürdigen Tag alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte, ging er zur Tür, verschloss sie sorgfältig, zog den Schlüssel ab und ließ ihn demonstrativ in seiner Jackentasche verschwinden. Er trat an die Stirnseite des Mosaiktisches, überblickte die kleine Runde und meinte, mit einem Blick auf seine Armbanduhr: „Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt beginnen.“
Die Gäste, zwei Herren und eine Frau in den Fünfzigern, die ich allesamt nicht kannte, hatten sich gedämpft unterhalten, schwiegen nun aber und schauten dem Doktor erwartungsvoll entgegen. Neugierig sah ich zu der fremden Frau hinüber, die nach dem Aufruf des Doktors eine Mappe mit Unterlagen, in der sie geblättert hatte, beiseitelegte, die Brille abnahm und sie an einer dicken silbernen Kette um den Hals baumeln ließ.
Ich saß auf der Ledercouch zur Rechten des Doktors, vor mir ein aufgeschlagener Schreibblock, ein Kugelschreiber und eine Taschenuhr mit besonders übersichtlichem Zifferblatt.
„Zunächst einmal möchte ich Sie mit meiner Assistentin, Frau Karin Wieland bekanntmachen,“ stellte mich der Doktor vor. „Als meine rechte Hand wird sie das Protokoll führen und alles, was in den nächsten Stunden in diesem Raum geschieht, schriftlich festhalten.“
Sie nickten mir kurz zu.
„Bitte, Karin, beginnen Sie folgendermaßen: Berlin, den 24. Januar 1986. Büro Dr. Erich Weißgerber im Friedrich-Bott-Institut, Neustätter Str. 14. Uhrzeit…“, es folgte ein erneuter Blick auf seine Armbanduhr: „…genau 20 Uhr 16. Der Versuchsraum ist verschlossen, Tricks und Manipulationen…“, er lächelte, ging noch einmal zur Tür und drückte demonstrativ die Klinke hinunter „…sind also völlig ausgeschlossen.“ Dann rückte er seine Brille zurecht und fuhr fort: „Außer den Versuchsleitern Dr. Erich Weißgerber und Prof. Herbert Riechling sowie der Protokollführerin Karin Wieland sind anwesend: Frau Dr. Renate Ebenstreit, Herr Robert Fröbel und Dr. Franz Degenhardt. - Haben Sie’s, Karin?“
Ich nickte. „Ja, es ist alles notiert.“
Um Missverständnisse beim Übertragen zu vermeiden, hatte er darauf bestanden, dass ich, anstatt zu stenografieren, von Hand alles einigermaßen leserlich mitschrieb. „Ich werde Ihnen genügend Zeit lassen“, hatte er am Vortag zu mir gesagt, „wir werden die Sache ganz langsam angehen. Schritt für Schritt.“
Nun nahm er die Brille ab, putzte sie mit seinem Taschentuch und begann mit einigen Vorbemerkungen, mit denen ich als Laie nichts anzufangen wußte. „Fassen Sie einfach zusammen, Karin“, unterbrach er sich kurz, „schreiben Sie: ‚Einleitungsworte von Dr. Weißgerber an die anwesenden Gäste‘, das genügt.“
Seine Vorrede fiel länger aus, als ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, dass er vor lauter Ungeduld nicht schnell genug beginnen könnte, aber er brachte es fertig, seine Ausführungen ganz gelassen und beherrscht vorzutragen.
Prof Riechling dagegen konnte seine innere Unruhe kaum verbergen. Während die anderen aufmerksam zuhörten, wippte er mit den Fußspitzen, presste nervös die Handflächen gegeneinander oder klopfte mit den Fingern auf den Tisch, als bearbeite er eine imaginäre Tastatur.
Solange es für mich noch nichts zu tun gab, beobachtete ich die Gäste, insbesondere Frau Dr. Ebenstreit. Trotz ihres Alters und ihrer ein wenig zu lang geratenen Nase hätte man sie fast als hübsch bezeichnen können. Ihr Gesicht war schmal und feingeschnitten, in den Augenwinkeln saßen ein paar Fältchen, die darauf schließen ließen, dass sie gern lachte. Die grauen Augen unter den hochgeschwungenen Brauen hingen gebannt an Dr. Weißgerbers Lippen. Dennoch schien sie bemerkt zu haben, dass ich sie unentwegt anschaute, denn auf einmal blickte sie kurz zu mir herüber und zwinkerte mir lächelnd zu. Ich fühlte mich ertappt, lächelte verlegen zurück und machte mir schnell an meinen Notizen zu schaffen.
Dann schließlich war es soweit: Dr. Weißgerber trat an seinen Schreibtisch, nahm ein kastenförmiges Köfferchen heraus und stellte es mit einer feierlichen Geste in die Mitte des Tisches. Die Zuschauer konnten sich ein geflüstertes „Oh!“ nicht verkneifen, obwohl es noch gar nichts zu sehen gab. Das Köfferchen war aus braunem glattem Leder und sah ganz nichtssagend aus. Als der Doktor den Verschluss aufknipste und den Deckel zurückklappte, stockte allen der Atem, und ich vergaß fast, aus welchem Grund ich eigentlich an dieser Runde teilnehmen durfte. Ich besann mich und schrieb, wie es der Doktor von mir erwartete: ‚20.55 Uhr, - Dr. Weißgerber stellt den noch verschlossenen Koffer auf den Tisch. 20.56 Uhr, er öffnet ihn.‘
Eingebettet in dunkelroten Samt erkannte man ein metallenes Etwas, das der Doktor nun vorsichtig mit beiden Händen heraushob und neben den Koffer auf den Tisch stellte. ‚20.57 Uhr, er nimmt das Gerät heraus.‘
Ich war enttäuscht. Diese geheimnisvolle Apparatur war ein einziges Durcheinander aus zusammengefügten Spulen, Drähten und Kabeln, aus kleinen Metallstreben und Hebeln. Irgendwo an der Seite, - oder war es vorn? - war eine verhältnismäßig große Skala angebracht, davor eine Reihe von Knöpfen und Schaltern. Es gab nichts, woraus man in irgendeiner Weise hätte schließen können, wozu es zu gebrauchen war. Der Apparat war unförmig und hässlich.
„Das ist es also“, sagte Dr. Weißgerber stolz, und Prof. Riechling stand schnell auf und hielt schützend die Hände davor. Und obwohl niemand den Versuch gemacht hatte, etwas anzufassen, meinte er ängstlich: „Bitte nicht berühren, meine Damen und Herren! Es ist sehr empfindlich.“
Dr. Degenhardt lehnte sich tief ausatmend zurück, während sich Frau Dr. Ebenstreit erst einmal die Nase putzte. Herr Fröbel lachte sogar respektlos. „Das Ding hab ich mir wahrhaftig anders vorgestellt“, meinte er kopfschüttelnd.
Dr. Weißgerber lächelte nachsichtig. „Wir wissen, dass es nicht sehr hübsch aussieht. Wir hielten es aber nicht für notwendig, eine Verkleidung dafür zu finden, da es sich eh‘ nur für eine Zwischenstufe handelt. Es ist noch viel zu groß und zu wuchtig, inzwischen arbeiten wir bereits an einem sehr viel kleineren Modell. Die Hauptsache ist doch aber, dass es funktioniert. Und dass es das tut, meine Damen und Herren, davon können sie sich in Kürze überzeugen.“
Er blickte in die Runde. „Bestimmen Sie den Gegenstand, mit dem wir experimentieren sollen. - Frau Dr. Ebenstreit, wollen Sie bitte so nett sein und etwas vorschlagen?“
„Ich?“ Sie tippte sich mit dem Zeigefinger an die Brust, und nachdem ihr der Doktor aufmunternd zugenickt hatte, schaute sie sich unschlüssig im Raum um, bis ihr Blick an einem marmornen Aschenbecher auf dem Schreibtisch des Doktors hängenblieb. „Nehmen Sie den da“, sagte sie.
Dr. Weißgerber nahm ihn in die Hand, hob ihn hoch und zeigte ihn allen. „Diesen Aschenbecher werden wir nun also in die Zukunft schicken. Und wenn er nicht zurückkommen sollte“, meinte er scherzend, „dann macht das gar nichts, ich habe nämlich zwei davon.“
An den Enden zweier Drähtchen, die aus dem Gerät herausragten, waren kleine flache Kontaktplättchen angebracht, die er nun sorgfältig am oberen Rand und an der Unterseite des Aschenbechers mit Isolierband befestigte. Er tauschte einen kurzen Blick des Einvernehmens mit dem Professor, kippte einen der Schalter nach unten, und irgendwo im Inneren des Metallgebildes leuchtete ein winziges Lämpchen auf. „So“, sagte er, „jetzt ist das Gerät betriebsbereit.“
Nun beugten sich die Zuschauer doch ein wenig weiter vor, um besser sehen zu können.
„Die genaue Einstellung ist noch sehr schwierig“, erklärte der Doktor. „Die Skala, die sie hier sehen, umfasst einen Zeitraum von etwa zwei Monaten, - einen Monat in die Zukunft und einen Monat in die Vergangenheit. Die Null in der Mitte steht quasi für das ‚Jetzt‘, für die Gegenwart.“
Er drehte an einem der Knöpfe, und der Zeiger, der wie eine Nadel spitz zulief, schwenkte auf die linke Seite hinüber. „Mit dieser Einstellung würden wir unseren Aschenbecher in die Vergangenheit schicken, meine Damen und Herren, und jetzt…“, er drehte den Zeiger nach rechts, „…jetzt verschwindet er in der Zukunft. Sicher können Sie sich vorstellen, wie kompliziert es ist, nur so wenig in die Zukunft vorauszugehen, damit der Aschenbecher noch heute Abend zurückkommt. Da geht es um Millimeter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Zeitpunkt des Wiederauftauchens nicht auf die Minute, ja, nicht einmal auf die Stunde genau vorherbestimmen können. Unser nächstes Modell wird sicher präziser arbeiten. Solange wir warten werden wir Ihnen anhand von Skizzen genau erklären, wie das Gerät im Einzelnen funktioniert, und selbstverständlich werden wir auch all Ihre Fragen beantworten, soweit es uns möglich ist. - Bitte, Professor, stellen Sie jetzt die Zeit ein.“
Prof. Riechlings Hand zitterte vor Aufregung. Er bewegte den Zeiger von der Nullstellung eine Winzigkeit nach rechts. „Ich glaube, so ist es gut“, meinte er. „Wir werden den Aschenbecher in eine Zeit schicken, die etwa zwei oder drei Stunden in unserer Zukunft liegt. Gemeinsam werden wir dann hier in diesem Raum warten, bis wir selbst diesen Zeitpunkt erreicht haben und er vor uns wieder erscheinen wird.“
„Genug der Vorrede, Professor. Lassen Sie ihn endlich verschwinden“, sagte Herr Fröbel ungeduldig. „Das allein wäre schon Wunder genug.“
Die anderen nickten zustimmend.
Dr. Weißgerber hatte die Hand bereits am Hebelchen, das den Zeitsprung auslösen sollte. „Sind Sie soweit, Professor?“ Dann warf er auch mir noch einmal einen raschen Blick zu. „Vergessen Sie auch nicht, mitzuschreiben, Karin?“
„Aber nein, natürlich nicht“, antwortete ich schnell, obwohl ich tatsächlich Mühe hatte, es nicht zu vergessen. Ich wäre viel lieber nur Beobachter gewesen und ertappte mich immer wieder dabei, dass ich nur dasaß, den mysteriösen Apparat anstarrte und gespannt wartete, was als Nächstes geschah.
„Alles in Ordnung“, sagte Prof. Riechling laut und deutlich.
„Achtung! Dann starrte ich… jetzt!“
Aber der Professor hatte die Hand noch einmal ausgestreckt, fuhr dann bei Dr. Weißgerbers „Jetzt!“ so heftig zusammen, dass er die Nadel versehentlich bis an den linken Anschlag versetzte. „Moment!“, rief er mit schriller Stimme, „Ich habe etwas verstellt.“ Doch es war schon zu spät, seine Hand griff ins Leere. Der Doktor hatte bereits den Hebel betätigt und das metallene Monster mitsamt dem Aschenbecher war verschwunden. Der leere Koffer war das einzige, was noch auf dem Tisch stand. Es war genau 21.01 Uhr. „Was war denn los?“, fragte er Doktor besorgt.
„Um Gottes Willen“, murmelte der Professor. Er war noch blasser, als gewöhnlich.
Die Zuschauer staunten, denn Gerät und Aschenbecher waren ja tatsächlich fort, dennoch spürten sie, dass etwas schiefgegangen sein mußte.
„Ich habe den Zeiger verstellt“, sagte der Professor tonlos. Er zitterte am ganzen Körper
„Um wieviel?“, wollte der Doktor wissen.
„Ich weiß es nicht. Aber vermutlich ziemlich viel.“
„In welche Richtung?“
„In die Vergangenheit.“
„Wie konnte das nur passieren!“
„Ich war so erschrocken, als Ihr Kommando kam, da ist mir die Hand ausgerutscht. Ich verstehe das selbst nicht. - Mein Gott, dass ich mich aber auch so dumm anstellen mußte! Das ist die Aufregung, Doktor. Ich glaube, ich bin zu alt für solche Experimente. Was machen wir denn jetzt?“
Dr. Weißgerber überlegte. „Ich glaube, es ist halb so schlimm“, meinte er und legte dem Professor beschwichtigend die Hand auf die Schulter. „Die Abwesenheitsdauer war sicherheitshalber auf zwei Stunden eingestellt. Das bedeutet, dass das Gerät nach zwei Stunden automatisch wieder auftauchen wird. Wir können dann in aller Ruhe mit dem geplanten Experiment beginnen. Da wir eh‘ nicht genau vorherbestimmen können, wie lange wir heute Nacht noch zusammensitzen werden, kommt es auf zwei Stunden mehr oder weniger auch nicht an.“
Der Professor beruhigte sich ein wenig und atmete tief aus. Müde ließ er sich auf einen Stuhl fallen und sah auf einmal klein und sehr alt aus.
Frau Dr. Ebenstreit war aufgestanden. „Kann ich Ihnen helfen, Professor?“
Er schüttelte den Kopf, griff in seine Jackentasche und zog ein Arznei-Schächtelchen heraus. „Danke, ich habe hier meine Tabletten.“
„Darf ich mal sehen?“
Er reichte es ihr. „In Ordnung. Nehmen sie zwei davon. – Bleiben Sie sitzen, ich hole Ihnen ein Glas Wasser.“
Er winkte ab. Noch immer zitternd drückte er zwei Tabletten aus der Folie auf seine Handfläche, schob sie in den Mund und schluckte sie hinunter.
„Meine Damen und Herren“, ergriff nun Dr. Weißgerber das Wort, „es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Unser Experiment ist zwar etwas anders verlaufen, als geplant, doch wie Sie sehen ist es geglückt. Nur, dass der Zeiger nicht, wie eigentlich gewollt, auf der Zukunftsseite stand, sondern auf der der Vergangenheit.“ Er hielt inne und nahm die Brille kurz ab, dann fuhr er fort: „Wenn wir das Gerät in eine Zeit schicken, die über einen Monat hinausgeht, entzieht es sich leider unserer Kontrolle. Das bedeutet, sollte der Zeiger tatsächlich bis zum Anschlag bewegt worden sein, können wir nicht sagen, wann in der Vergangenheit das Gerät ‚gelandet‘ ist. Glücklicherweise haben wir für solche Fälle vorgesorgt. An dem Gerät gibt es nämlich eine Vorrichtung, die bewirkt, dass es genau zwei Stunden in der Zeit bleibt, in die wir es katapultiert haben. Danach kehrt es automatisch zu uns zurück.“ Er machte eine kurze Pause und lächelte. „Also wird der Aschenbecher pünktlich nach zwei Stunden wieder hier sein.“
Während der Wartezeit las ich noch einmal meine Aufzeichnungen durch und fügte hier und da eine Ergänzung ein. Friedrich Bott, der weißhaarige alte Herr auf dem Portrait über dem Schreibtisch, lächelte sein verhaltenes Lächeln. Ich fragte mich, was er wohl dazu sagen würde, wenn er wüsste, dass seine Nachfolger inzwischen sogar mit der Zeit experimentierten. Aber er wußte es nicht, er schaute freundlich und gelassen auf die Gruppe seiner Kollegen herab, die sich lebhaft miteinander diskutierend ihre innere Spannung von der Seele redeten.
Ich lehnte mich auf der braunen Ledercouch zurück, beobachtete sie eine Weile und ging dann meinen eigenen Gedanken nach. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem mich Dr. Weißgerber kurz vor Feierabend in sein Büro gebeten hatte, um mir den Posten einer Assistentin anzubieten. Bis dahin hatte ich mich mit meinen Kolleginnen Frau Rempfer und Gaby Sommerfeld im Schreibzimmer um die Arbeiten aller Doktoren des Instituts gekümmert. Als ich in sein Büro kam, saß er an seinem Schreibtisch und machte sich Notizen in seinen Kalender. Er bat mich um etwas Geduld und forderte mich auf, in seinem mächtigen Sessel Platz zu nehmen. Während er noch schrieb, schaute ich mich neugierig im Raum um. Schon damals wunderte ich mich über die uralte und verstaubte Einrichtung, denn ebenso antik, wie der Sessel erschienen mir auch die übrigen Teile der dunklen, hässlichen Ledergarnitur, der große schwere Holztisch mit dem eingelegten Mosaik und die zwei mit Büchern vollgestopften Schränke. In der Ecke, zwischen Schreibtisch und Fenster stand auch damals schon der riesige Philodendron mit den dunkelgrünen verstaubten Blättern. Ich hab nie verstanden, wie sich der Doktor in dieser düsteren Umgebung wohlfühlen konnte, schließlich war er erst um die fünfzig und somit nicht einmal so alt wie mein Vater. Allerdings wirkte er zu jener Zeit noch sehr viel vitaler, sein Gesicht zeigte noch nicht diese fahle Blässe, die ihm später manchmal das Aussehen eines kranken alten Mannes verlieh, und auch sein dunkelblondes Haar war noch dichter und nur hier und da von ein paar silbernen Fäden durchzogen.
Ich war erstaunt gewesen, dass er ausgerechnet an mich gedacht hatte, als er sich nach einer Assistentin umgeschaut hatte. Gleichzeitig war ich aber auch stolz, weil es mir zeigte, dass er mir vertraute und mit mir und meinen Arbeiten bisher zufrieden gewesen sein mußte.
„Selbstverständlich müssen Sie sich nicht gleich entscheiden“, hatte er gesagt, „überlegen Sie es sich in aller Ruhe.“ Doch was gab es da zu überlegen? „Danke, Herr Doktor“, beeilte ich mich zu sagen, „natürlich bin ich einverstanden.“
Während ich anschließend die Treppe des Hauptportals hinuntergestürmt war, machte ich mir bereits Gedanken darüber, wie ich den kleinen Abstellraum, den er mir als Büro in Aussicht gestellt hatte, einrichten könnte. In der Mitte der Treppe blieb ich stehen und überlegte, ob mein Schreibtisch überhaupt hineinpassen würde in die kleine Kammer. Doch wenn nicht, davon war ich überzeugt, würde mir der Doktor ganz sicher einen anderen besorgen. Mir gefiel der Gedanke, nun bald einen Raum ganz allein für mich zu haben, und ich nahm mir vor, ihn hübsch auszustatten, mit viel Grünem, und mit Bildern… Und Dr. Weißgerber sollte niemals bereuen, dass er sich für mich entschieden hatte. Glückselig sprang ich den Rest der Treppe hinunter. Ich wußte, mein Freund Klaus Kunstmann würde eine Straßenecke weiter in seinem roten Sportwagen auf mich warten, und ich brannte darauf, ihm von der großen Neuigkeit zu berichten.
Seltsam, wenn ich an jenen Tag zurückdachte, fiel mir auch immer eine andere kleine Episode ein, die ich manchmal schon vergessen zu haben glaubte. Denn gerade in dem Augenblick, als ich zu Klaus ins Auto steigen wollte, hörte ich eine fremde Stimme hinter mir. „Angela!“
Ich wandte mich um und sah einen jungen Mann auf mich zukommen. „Angela!“, rief er noch einmal, und als er mich eingeholt hatte, und ich ihn fragend anschaute, nahm er meinen Am und sagte: „Weißt du denn nicht mehr wer ich bin, Angie?“
Ich zog meinen Arm weg. „Tut mir leid, Sie müssen sich irren. Ich bin nicht Angela.“
„Aber du mußt dich doch an mich erinnern.“ Er sah blass und verstört aus, unendlich hilflos und traurig.
Ich hob bedauernd die Schultern und lächelte mitfühlend. „Sie verwechseln mich. Tut mir wirklich leid.“
Klaus hatte den Motor angelassen, und ich beeilte mich, einzusteigen. Durch die Unterredung mit dem Doktor hatte er lange genug auf mich warten müssen. Er begrüßte mich mit einem Kuss. „Wer war denn das?“, fragte er und wies mit einer Kopfbewegung auf den Fremden, der auf dem Gehweg stand und mir nachschaute. „Was hat er von dir gewollt?“
„Er hat mich verwechselt“, antwortete ich, während ich mich anschnallte, „er nannte mich Angela.“
„Engel“, übersetzte Klaus, „Das passt ja nun wirklich nicht zu dir.“ Er grinste und duckte sich schnell, weil er vorausahnte, dass ich ihm einem Knuff verpassen würde.
Nachdem er den Wagen gestartet hatte, war mein Blick noch einmal auf den fremden jungen Mann gefallen, der mir noch immer verzweifelt nachschaute. Er tat mir leid, doch ich war viel zu glücklich, um mich um die Sorgen anderer zu kümmern. Und strahlend erzählte ich Klaus von meinem neuen Job.
Inzwischen hatten Dr. Weißgerber und Prof. Riechling viele der im Raum stehenden fachlichen Fragen beantwortet, und Dr. Degenhardt hatte schließlich wissen wollen, wie die Herren Erfinder ihren Apparat nun nennen wollten. Der Doktor meinte, darüber hätten sie sich noch keine Gedanken gemacht, er hielt jedoch eine Bezeichnung wie ‚Time-Pilot‘ für passend. Prof. Riechling dagegen plädierte eher für etwas Lateinisches. Herr Fröbel schlug grinsend ‚Timehopper‘ vor, worauf Frau Dr. Ebenstreit meinte, dann klänge ‚Timeflyer‘ doch wesentlich hübscher.
Ich nickte zustimmend. ‚Timeflyer‘, das gefiel mir: ‚Zeitenflieger‘. Das war wahrhaftig ein passender Name für dieses Wunderding.
Ganz plötzlich war das Gerät dann wieder da. Kurz vor Ablauf der zwei Stunden starrten wir alle gespannt auf die Stelle, wo es zuvor gestanden hatte. Jeder wollte der erste sein, der es bemerkte, und dann sah es doch keiner wirklich ‚ankommen‘. Er war nur auf einmal wieder da, der Timeflyer. Die Uhr zeigte 23.01 Uhr.
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Der Doktor und der Professor atmeten erleichtert auf und schauten einander lächelnd an. Frau Dr. Ebenstreit blinzelte und kniff die Augen zusammen, als fürchte sie, auf eine Sinnestäuschung hereingefallen zu sein. „Darf man es nicht doch einmal anfassen, Doktor?“, fragte sie, und ohne eine Antwort abzuwarten, tastete sich ihre Hand über die Metallstreben. „Tatsächlich, es ist da. Ich kann es fühlen.“
Herr Fröbel pfiff durch die Zähne und nickte anerkennend. „Das is’n Ding, Professor!“, meinte er staunend. „Hätt‘ ich nie für möglich gehalten. Alle Achtung!“
„Es ist einfach fantastisch“, sagte Dr. Degenhardt leise. „Fantastisch, aber auch beängstigend.“ Dann beugte er sich zu Dr. Weißgerber hinüber. „Ist Ihnen eigentlich klar, was das bedeutet, Doktor? Können Sie sich ausmalen, was passieren würde, wenn dieser Apparat in die falschen Hände geraten würde? Kann man es überhaupt verantworten, mit solchen Dingen zu arbeiten und zu experimentieren?“
„Genau deshalb sind Sie heute hier, Herr Dr. Degenhardt. Sie, und nicht irgendwer“, war die Antwort. „Und genau deshalb baten wir Sie, - jeden einzelnen von Ihnen, - um striktes Stillschweigen. Wir sind nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten, und so soll es vorerst auch bleiben. Wir werden das Gerät vervollkommnen, der Professor und ich, doch nicht um in den Zeitablauf der Menschheit einzugreifen und ihn zu verändern, sondern nur, um zu beobachten. Und irgendwann in ferner Zukunft werden die Menschen Zeugen der Geschichte sein. Sie werden kontrollieren können, ob die Ereignisse der Vergangenheit tatsächlich so vonstatten gegangen sind, wie es in unseren Geschichtsbüchern geschrieben steht. Sie werden sie sogar miterleben können, verstehen Sie?“ Trotz seiner Brille war das Leuchten in seinen Augen zu erkennen. „Und irgendwann wird die Menschheit reif genug sein, auch einen Blick in die Zukunft zu werfen.“
Plötzlich stutzte er. Er lief zum Tisch hinüber und starrte auf das Gerät. Verwundert schaute ich ihm nach und sah, wie ihm langsam die Farbe aus dem Gesicht wich. Er murmelte etwas, was ich nicht verstehen konnte. Außer mir schien niemand davon Notiz zu nehmen, denn jeder war auf seine Weise damit beschäftigt, das eben Erlebte zu verarbeiten. Der Doktor berührte Prof. Riechlings Arm, beugte sich zu ihm hinunter und redete leise auf ihn ein, worauf auch der ein sehr bestürztes Gesicht machte und sich für einen Augenblick mit einer müden Handbewegung die Stirn hielt.
Ich stand auf und ging neugierig um den Tisch herum, um den Timeflyer besser sehen zu können. Und dabei bemerkte ich es dann auch: Der Aschenbecher fehlte! An den beiden Drähten hing nur noch das Isolierband, doch vom Aschenbecher war keine Spur zu sehen.
Herr Fröbel, der mich beobachtet hatte, war meinem Blick gefolgt. „Ist was?“, fragte er, als er neben mich trat. Aber bevor ich ihm eine Antwort geben konnte, kam der Doktor zu uns herüber, und auch Dr. Degenhardt und Frau Dr. Ebenstreit waren hellhörig geworden.
„Stimmt was nicht? - Was ist denn los? - Ist vielleicht doch was schiefgegangen?“, fragten sie.
„Nicht direkt“, erwiderte der Doktor, „das Experiment ist geglückt. Das Gerät ist wieder da, nur…, der Aschenbecher ist nicht mit zurückgekommen.“
Jetzt erst bemerkten es auch die anderen. „Tatsächlich!“, „Der Aschenbecher ist nicht mehr da!“ und „Spurlos verschwunden!“, redeten sie durcheinander, und Herr Fröbel meinte: „Es sieht aus, als hätte ihn jemand ganz bewußt entfernt.“
Dr. Weißgerber gab auf einmal einen erstickten Laut von sich und schlug sich die Hand vor den Mund. Dann griff er so fest nach meinem Arm, dass es schmerzte. „Karin, ich hab’s“, sagte er, aber ich wußte nicht, was er meinte.
„Sie müssen sich doch daran erinnern. Es ist jetzt etwa vier Monate her.“ Doch ich sah ihn noch immer fragend an.
Er wandte sich an die Gäste, und begann, ihnen zu erzählen, was sich vor vier Monaten zugetragen hatte: „Eines Morgens kam ich in mein Büro und sah einen seltsamen Apparat auf meinem Tisch stehen. Damals hatten wir noch nicht angefangen, diesen hier zusammenzusetzen, deshalb hatte ich keine Ahnung, was für ein Ding das sein sollte. Zuerst glaubte ich, einer der Praktikanten hätte sich einen Scherz mit mir erlaubt. Als ich dann aber den Aschenbecher daran kleben sah, vermutete ich, es könnte sich eher um das Werk von Kindern handeln. Ich war ziemlich ärgerlich, weil mir der Gedanke, Kinder könnten in meiner Abwesenheit in meinem Büro herumtollen, gar nicht gefiel. Ich wollte mir die Reinigungsfrau vorknöpfen und ihr strengstens verbieten, ihre Enkel zur Arbeit mitzubringen und sie in unseren Räumen spielen zu lassen. Ich löste den Aschenbecher von den Drähten, doch als ich ihn auf seinen Platz auf den Schreibtisch stellen wollte, stand dort bereits ein gleicher. Dabei hatte ich nie zuvor einen zweiten gesehen. - Erinnern Sie sich jetzt, Karin?“
Ich nickte, es war mir wieder eingefallen. Urplötzlich konnte ich mich ganz deutlich daran erinnern, wie er an jenem Tag in mein Büro gekommen war und mir von einem selbstgebastelten Monstrum erzählt hatte, das ihm jemand über Nacht auf den Tisch gestellt hatte. Doch bevor er mir das Ding hatte zeigen können, war es wieder verschwunden. Damals hatte ich geglaubt, er sähe vor lauter Überarbeitung bereits Gespenster, seine Nerven könnten ihm einen Streich gespielt haben. Nun war mir allerdings klar, was der seltsame Zwischenfall zu bedeuten hatte.
„Der geheimnisvolle Apparat von damals war dieser hier“, sagte der Doktor und zeigte auf den Timeflyer. Und ich selbst habe den Aschenbecher entfernt, weil ich keine Ahnung hatte, was das sein sollte.“
„Und Sie haben sich niemals an diesen Vorfall erinnert?“, fragte Prof. Riechling verblüfft. „Auch nicht später, als wir an diesem Gerät gearbeitet haben?“
„Nein, niemals! - Das heißt, wahrscheinlich nicht. Doch auf einmal bin ich mir da gar nicht mehr so sicher…“
„Erstaunlich“, meinte der Professor, „ein höchst interessantes Phänomen.“ Er winkte mich zu sich. „Kommen Sie, Karin, dazu sollten wir uns einiges notieren.“ Und dann diktierte er mir den Verlauf dieser merkwürdigen Geschichte und fügte eine endlose Reihe von Vermutungen und Erklärungsversuchen hinzu.
Das eigentliche Experiment, die Reise eines Gegenstandes in die Zukunft, fand mit knapp drei Stunden Verspätung statt und verlief ohne weitere Zwischenfälle. Diesmal wurde ein Briefbeschwerer an den Drähten befestigt, und nach genau einer Stunde und zweiunddreißig Minuten des Wartens, die Dr. Weißgerber mit Erläuterungen über die einzelnen Funktionen des Gerätes ausfüllte, tauchte er unbeschadet vor unseren Augen wieder auf.
Tief beeindruckt trennte sich die kleine Runde kurz vor halb drei Uhr. Jeder einzelne von uns tat sich schwer damit, das fantastische Erlebnis mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen.
In dieser Nacht war es mir unmöglich, gleich einzuschlafen. Ich lag im Dunkeln, schaltete den Plattenspieler ein und setzte die Kopfhörer auf. Einige Tage zuvor hatte ein neuer Song die Charts erobert. Jeder Radiosender spielte ihn, aus jedem Lautsprecher war er zu hören. In kürzester Zeit pfiffen ihn buchstäblich die Spatzen von den Dächern. Der Song hieß Twilight, und er erzählte von einer unglücklichen Liebe, die jemand gefunden und dann gleich wieder verloren hatte. Der Sänger hieß Blackhead-Charly, ich kannte ihn nicht, hatte nie zuvor von ihm gehört. Aufgrund des Fotos auf dem Cover, das den jungen Mann in eigenwilligem bizarrem Outfit zeigte, hätte ich mir die Platte vielleicht niemals gekauft, wäre ich nicht längst von seinem Lied völlig verzaubert gewesen. Seine ein wenig raue und doch so sanfte Stimme, die Traurigkeit und die Sehnsucht, die herauszuhören waren, berührten mich auf seltsame Weise. Sie weckten den Wunsch in mir, ihn in die Arme zu nehmen und zu trösten. Ich verstand ihn. Ich konnte mit ihm fühlen, weil es auch tief in meinem Inneren diese unbeschreibliche Sehnsucht gab, die ich mir oft nicht erklären konnte. Sehnsucht, die es für mich eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, denn ich hatte ja Klaus.“
1. Start in ein neues Leben
Sommer 1983
Der Himmel war grau und verhangen, und als der Zug Durlach in Richtung Karlsruhe-Hauptbahnhof verließ, fielen die ersten Tropfen. Sie hinterließen kleine durchsichtige Spritzer auf den staubigen Scheiben.
Der junge Mann im letzten Abteil lehnte sich mit dem Rücken gegen das Fenster und streckte die langen Beine aus. Er trug verwaschene Jeans und eine abgetragene schwarze Lederjacke, darunter ein T-Shirt, auf dem noch schemenhaft der Schriftzug von Supertramp zu erkennen war. Den hohen blau-weißen Turnschuhen war anzusehen, dass sie schon weit gelaufen sein mussten.
Sein Gepäck stand auf dem Sitz gegenüber: Eine vollgestopfte rote Sporttasche mit abgestoßenen Ecken und eine Umhängetasche aus dunkelblauem Denim. Daneben, versteckt in einer fleckigen Stoffhülle, eine Gitarre. An der Jeanstasche baumelte ein Namensschildchen, hinter dessen trübem Plastikfenster mit Filzstift Karl-Heinz Schwarzkopf geschrieben stand.
Der junge Mann pfiff ein paar Takte, schaute aus dem Fenster und verfolgte die vorüberziehende Häuserreihe der Stuttgarter Straße, bis der Zug in das Dunkel der Bahnhofshalle eintauchte wie in den Rachen eines riesigen Untiers. „Karlsruhe Hauptbahnhof - Karlsruhe Hauptbahnhof. Bitte aussteigen, der Zug endet hier.“
Der Waggon war vollbesetzt gewesen, nun wälzte sich eine lange Schlange von Fahrgästen im Mittelgang dem Ausgang zu. Der junge Mann nahm sein Gepäck auf und zwängte sich dazwischen.
Auf dem Bahnsteig blieb er einen Augenblick lang stehen. Für Sekunden tauchten Bilder in seiner Erinnerung auf. Bedrückende Bilder aus seiner Kindheit. Seine Mutter ganz in Schwarz gekleidet, mit verweinten Augen. Er war fünf Jahre alt gewesen, damals, als sein Vater starb. Fast spürte er wieder den festen Griff von Tante Veras Hand, mit dem sie ihn festhielt, aus Angst, er könnte davonlaufen, denn er hatte sich heftig dagegen gewehrt, mit ihr nach Rastatt zu fahren und seine Mutter in ihrem Kummer alleinzulassen.
Nun blinzelte er und versuchte, die Erinnerungen von sich abzuschütteln wie ein lästiges Insekt. Das war lange her, seit damals hatte sich vieles verändert. Viel zuviel, dachte er. Und nicht nur zum Guten.
In der Bahnhofshalle schaute er sich fasziniert um. Er mochte Bahnhöfe. Sie machten vergessen, wer man war, woher man kam und wohin man ging. Man war ein Reisender unter Reisenden, ein Tropfen im Strom des Geschehens. Er mochte das bunte Durcheinander von Läden und Ständen, von Automaten und Telefonzellen, Werbeplakaten und Lichtern.
Mitten in der Halle blieb er stehen und schaute hinauf zum Kuppeldach, von dem das vielfältige Stimmengewirr widerhallte: Rufe, Schreie, Lautsprecherstimmen. Die Luft war erfüllt von Sehnsucht und Fernweh, als könnte man sie greifen. Und von Freiheit. Vor allem war es die Freiheit, die er tief in sich hineinsog.
Am Ausgang, neben den Ankunfts- und Abfahrtstafeln, stellte er die Tasche ab, lehnte die Gitarre behutsam dagegen und zog ein zusammengefaltetes Zettelchen aus seiner Jackentasche. Schwanenstraße 6, las er. In Gedanken hörte er Josch sagen: „Ganz in der Nähe der Pyramide, nicht weit weg vom Marktplatz. Findest du bestimmt.“
Inzwischen war der Regen stärker geworden und platschte auf die Überdachung der Rolltreppe, die unter die Straße führte und zu den Haltestellen der Straßenbahnen. Dabei trat ihm eine junge Frau in den Weg, die an einem Stand Schmuck verkaufte. „Sieh mal, wie gefällt dir das?“, fragte sie und hielt ihm ein silbernes Kreuz an einem dünnen Kettchen entgegen. Er sah sich den Anhänger an, hob den Kopf und fing einen Blick aus ungewöhnlich blauen Augen auf. Er lächelte, hob bedauernd die Schultern und lief weiter.
Es war Feierabendzeit. Unter dem Glasdach der Haltestelle drängte sich eine Traube wartender Menschen, die Schutz vor dem Regen suchten. Zwischen einer alten Frau und einem dicken Herrn mit Brille war gerade noch so viel Platz, dass er sich dazwischenzwängen konnte. Weiter hinten beschwerte sich jemand lautstark darüber, dass man sich nun kaum mehr rühren konnte. Die alte Frau neben ihm lächelte ihm zu, und verwundert bemerkte er ein paar Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Ihr Anblick rührte ihn, ohne dass er gewußt hätte, warum. Sie mußte kranke Augen haben, dachte er sich, oder sie war einfach nur traurig. Vielleicht erinnerte er sie an ihren Sohn, oder an einen Enkel, den sie lange nicht gesehen hatte. Nicht nur, weil ihm die Großstadt fremd und ungewohnt war und er sich mit Bussen und Bahnen nicht auskannte, sondern aus einem Gefühl heraus, das er sich selbst nicht erklären konnte, sprach er die alte Frau an und fragte sie nach der richtigen Straßenbahn in Richtung Marktplatz und Pyramide. „Ich habe den gleichen Weg“, sagte sie, ich werde Ihnen sagen, wenn die richtige Bahn kommt, und auch, wann und wo sie aussteigen müssen.“
Die Pyramide war kleiner, als er sie in Erinnerung hatte. Als er davorstand und sich unschlüssig umschaute, regnete es noch immer, und er wußte nicht, in welche Richtung er gehen sollte. Ein paar Kinder in gelben Regenmänteln hüpften über die Pfützen auf dem Gehsteig, doch wo es zur Schwanenstraße ging, wussten auch sie nicht. Erst eine Gruppe junger Mädchen konnte ihm weiterhelfen. Sie hatten ihn eine Weile kichernd und tuschelnd hinter ihren Regenschirmen hervor beobachtet und bekamen rote Köpfe, als er sie ansprach.
Ziemlich durchnässt erreichter er schließlich das Haus Nur. 6 in der Schwanenstraße: Eine hässliche graue Fassade, die ihn aus dunklen Fensterhöhlen drohend anzustarren schien. Die Haustüre war nur angelehnt, sie ließ sich nicht schließen, weil jemand das Schloss herausgebrochen hatte. Im Hausflur war es schmutzig, roch nach Essen und Urin, die Ölfarbe an den Wänden war abgeblättert und hatte bizarre Muster aus brüchigen Resten hinterlassen, und Schmierfinken hatten Sprüche und Parolen darübergekritzelt und -gesprüht. Am Fuße der Treppe gab es acht verbeulte Briefkästen, aus deren Schlitzen Reklamezettel und Zeitungen unordentlich heraushingen. Einige der Namensschildchen waren unleserlich, andere fehlten ganz. Der junge Mann wußte nicht, auf welcher Etage Josch wohnte. Zögernd schaute er die Holztreppe hinauf, bevor er den ersten Schritt tat. Sie knarrte, während er langsam höherstieg.
Als er die beiden Türen im ersten Stock erreichte, wurde eine von ihnen heftig aufgerissen, und eine junge Frau kam heraus. Ärgerlich zuerst, - sie mochte ihn für einen anderen gehalten haben. Dann hellte sich ihr Blick auf. „Hi“, sagte sie. „Zu wem willst’n?“
„Ich suche Josch“, antwortete er.
„Ah!“ Sie nickte und zog an einer Zigarette.
„Der wohnt doch hier, oder?“
„Ja“, sagte sie und wies mit dem Kopf die Treppe hinauf. „Einen Stock höher. Aber der ist noch nicht zu Hause. Und Biene auch nicht.“
„Und wann kommt er zurück?“
„Spät.“ Sie lachte ohne jeden Grund.
„Okay.“ Er wandte sich um und stieg weiter hinauf.
„Wenn du willst, kannste solange bei mir auf ihn warten.“ Er hob abwehrend die Hand. „Nein, danke. Nicht nötig.“
„Aber du bist ja ganz nass“, rief sie ihm nach.
Er gab ihr keine Antwort mehr.
Inzwischen hatte er die nächsten beiden Türen erreicht. Auf der einen klebte ein Zettel mit der Aufschrift Wagenhals, in die andere hatte jemand mit einem spitzen Gegenstand Müller eingeritzt. Er kannte Joschs Nachnamen nicht, und nachdem er auf beiden Seiten geläutet und sich nichts gerührt hatte, stellte er seine Taschen und die Gitarre ab und setzte sich auf die oberste Treppenstufe. An das Geländer gelehnt döste er vor sich hin, und die merkwürdigsten Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Vielleicht würde sein Leben eine ganz andere Richtung nehmen, jetzt, da er es selbst in die Hand genommen hatte. Mit ein bisschen Glück konnte er vielleicht wieder eine Arbeit in einer Schreinerei finden und die abgebrochene Lehre zu Ende bringen. Wer weiß, vielleicht würde er sogar irgendwann seine eigene kleine Werkstatt haben. Eine wahnwitzige Idee, zugegeben, aber warum nicht? Er mochte die Arbeit mit Holz. Das Schreinern hatte ihm immer viel Spaß gemacht, es war nur der Meister gewesen, mit dem er nicht zurechtgekommen war. Eigentlich war ihm schon damals der Gedanke gekommen, aus Bretzingen wegzugehen, er war nur wegen Mama und den Mädchen geblieben. Wenn er jedoch geahnt hätte, dass sich die Probleme mit Walter derart zuspitzen würden…
Er wußte nicht wieviel Zeit vergangen sein mochte, als ihn das Quietschen der Haustüre aus seinen Gedanken riss. Inzwischen war es fast dunkel im Treppenhaus geworden, und als jemand das Licht anknipste, blinzelte er in den trüben Schein der nackten Glühbirne an der Decke und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen.
Mit leichten schnellen Schritten kam eine junge Frau die Treppe herauf. Sie blieb stehen, als sie ihn sitzen sah. Es schien, als fürchtete sie sich, an ihm vorüberzugehen.
„N’Abend!“, sagte er, stand auf und schob mit dem Fuß seine Taschen zur Seite, um ihr Platz zu machen.
„N’Abend“, antwortete sie, blieb aber weiterhin stehen.
Er trat bis zur Wand zurück. „Bitte!“
Die junge Frau zögerte noch immer.
Sie war nicht sehr hübsch, ihr schmales, fast knochiges Gesicht war von kurzem dunklem wuscheligem Haar umgeben, ihre tiefliegenden Augen schauten ihn fast ängstlich an.
„Wohnst du hier?“, fragte er sie.
Sie nickte. „Ja.“
„Dann mußt du Josch kennen.“
„Ja.“ Zögernd kam sie eine Stufe weiter herauf.
„Er hat mir seine Adresse gegeben. Wir kennen uns von Supertramp.“ Er hielt ihr den Zettel mit der Anschrift hin. Jetzt kam sie vollends herauf, nahm ihm den Zettel aus der Hand und nickte. „Ja, das ist seine Schrift“, sagte sie. „Was willst du denn von ihm?“
„Ich dachte… Josch hat mir angeboten, dass ich eine Weile bei ihm wohnen kann, wenn ich mal von zuhause weggehe. Für den Anfangt jedenfalls, bis ich was anderes finde.“
Nun lächelte sie. „Dann mußt du der Kalle sein, stimmt’s?“ Sie lief an ihm vorbei, schloss die Tür auf, an der Wagenhals stand und sah sich nach ihm um. „Komm rein“, sagte sie freundlich, „ich bin Biene. Josch hat mir von dir erzählt.“
Kalle folgte ihr und betrat einen langen fast leeren Korridor. Sie stellte ihren Schirm aufgespannt in eine Ecke und hängte ihren nassen Anorak an einen Haken in der Wand. Sie forderte ihn auf, seine Jacke ebenfalls auszuziehen, nahm sie ihm ab und hängte sie daneben.
„Er war sich sicher, dass du eines Tages kommen würdest“, sagte sie lächelnd, dann führte sie ihn in einen Raum, der Küche und Wohnzimmer in einem war. Ärmlich eingerichtet, aber doch einigermaßen sauber. „Setz dich, Josch wird in etwa einer halben Stunde hier sein, wenn nichts dazwischenkommt.“
Während er sich auf einem alten Sofa niederließ, nahm Biene eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank, öffnete sie und stellte sie vor ihm auf den Tisch, dann zog sie sich einen Stuhl aus der Ecke herüber und setzte sich zu ihm.
„Was macht Josch zurzeit eigentlich?“, fragte er, um eine Unterhaltung zu beginnen. Sie machte eine Handbewegung, die fast alles bedeuten konnte. „Mal dies, mal das“, meinte sie, „irgendwas findet sich immer.“
„Und du? Was machst du?“
„Schmuck“, antwortete sie und wies auf einen kleinen Tisch vor dem Fenster, auf dem, ausgebreitet auf einem Stück dunkelblauem Samt, verschiedene Schmuckstücke, Teilchen aus Silber und das dazugehörige Werkzeug lagen.
„Schmuck?“
„Ja, wir sind eine Gruppe von fünf Leuten. Wir stellen den Schmuck selbst her und verkaufen ihn dann.“
Kalle erinnerte sich an das Mädchen mit den blauen Augen. „Am Bahnhof?“
Sie nickte. „Ja, auch am Bahnhof. Aber ich gehöre zum Stand in der Kaiserstraße.“
„Und wie läuft das Geschäft?“ Kalle nahm einen Schluck aus der Flasche. „Verkauft ihr tatsächlich so viel von dem Zeug, dass es sich lohnt?“
Sie zog ein Gesicht. „Naja, es könnte besser sein, aber unser Schmuck ist billig. Billiger jedenfalls, als der im Laden. Und trotzdem sehr hübsch. Und wenn es auch nur ein paar Mark sind, die wir verdienen, so ist es doch immer noch besser, als gar nichts. Leider bin ich nicht ganz gesund, das Stehen fällt mir ziemlich schwer. Ich bin auch nicht so gut in der Fertigung, wahrscheinlich hab ich zu wenig Fantasie. Deshalb habe ich mich auch mehr auf die einfachen Sachen spezialisiert“. Sie lachte, wurde aber gleich wieder ernst. „Und bei dieser Puzzle-Arbeit hab ich auch Schwierigkeiten mit den Augen. Für mich wäre es besser, wenn ich was ganz anderes machen könnte. Es ist nur nicht einfach, etwas zu finden, wenn man nichts gelernt hat. Ich möchte ja auch nicht unser Team im Stich lassen.“
Er nickte und schwieg eine Weile.
„Glaubst du, Josch kann mir Arbeit besorgen?“, nahm er die Unterhaltung schließlich wieder auf, weil es ihm unangenehm war, schweigend neben diesem fremden Mädchen zu sitzen.
Sie hob die Schultern. „Es ist nicht leicht zurzeit, aber Josch hat allerhand Beziehungen. Er wird sich bestimmt darum kümmern.“ Kalle nickte und gähnte. Er merkte auf einmal, wie müde er war. Biene beobachtete ihn und fragte: „Hast du Hunger? Willst du was essen?“, fügte dann aber schnell hinzu: „Oder wartest du lieber bis Josch kommt?“ Aus ihren Worten war herauszuhören, dass es ihr lieber wäre, wenn er auf Josch warten würde. „Nein, es geht schon“, sagte er deshalb, obwohl sich sein Magen schon mehrmals gemeldet hatte. „Schließlich habe ich keine Weltreise hinter mir.“
„Woher kommst du denn?“
„Aus Bretzingen.“
„Ah.“ Ganz offensichtlich hatte sie keine Ahnung, wo Bretzingen lag. Und er hatte keine Lust, es ihr zu erklären.
Kurz nach halb zehn kam Josch nach Hause. Groß und breitschultrig stand er auf einmal in der Tür und musterte den fremden Besucher mißtrauisch. „Wer is’n das?“, fragte er unfreundlich.
Kalle stand auf. „Mensch Josch, sag bloß, du kennst mich nicht mehr! Ich sag nur: Wildpark Stadion! Supertramp!“
Über Joschs Gesicht zog ein breites Grinsen. „Das gibt’s doch nicht, der Kalle! Hab dich fast nicht wiedererkannt. Hast dein Haar jetzt länger, stimmt’s? Menschenskind, dass du da bist!“ Er boxte ihn freundschaftlich in die Seite, zog sich die nasse Jacke aus, warf sie achtlos über einen Stuhl und sah sich nach Biene um. „Bring noch Bier.“ Und als das Mädchen eilig hinauslief, rief er ihr nach: „Und was zu essen. Hab einen Bärenhunger. Und der Kalle bestimmt auch.“ Er zog sich einen Stuhl neben das Sofa. „Jetzt erzähl‘ mal, was hast’n vor? Hast Ärger zu Hause gehabt, was?“
„Naja, das Übliche“, nickte Kalle. „Aber irgendwann reicht’s einem einfach. Ich hatte die Schnauze voll, verstehst du?“
„Klar Mann, versteh‘ ich doch! Dein Alter…, war doch dein Stiefvater, stimmt’s? Hast mir ja von ihm erzählt. Hast recht gehabt, dass du weg bist. Kannst erst mal bei uns bleiben, später sehen wir weiter.“
Biene stellte einige Bierflaschen auf den Tisch und brachte einen Laib Brot und ein großes Stück Schinken. Von beidem schnitt sich Josch mit seinem Taschenmesser ein paar unförmige Stücken herunter und schob dann beides zu Kalle hinüber. Und der langte nun auch kräftig zu.
Josch sah sich nach Biene um, die halb hinter ihm stand und auf neue Anweisungen zu warten schien. „Kannst jetzt ruhig verschwinden. Du bist doch müde, oder nicht?“, sagte er zu ihr, „wir haben eh‘ noch zu reden.“ Und dann schlug er Kalle erneut auf die Schulter und lachte. „Mann, ist das ne Überraschung! Aber ich hab’s gewußt, dass du eines Tages hier aufkreuzen würdest!“
„Glaubst du, dass ich Arbeit finden werde? Kannst du da was machen?“
„Klar doch! Hab Beziehungen. Wird schon klappen irgendwie. Kannst solange hier bei uns pennen, hab ne leere Kammer.“ Mit dem Kopf wies er auf eine Tür neben der Spüle, die in einen angrenzenden Raum führte. „Hat schon so manchen vor der Parkbank bewahrt.“ Er lachte, hob seine Bierflasche und stieß mit Kalle an. „Auf dein neues Leben“, sagte er, und Kalle nickte. „Ja, auf mein neues Leben.“
Später, als er in der engen kleinen Kammer auf der übelriechenden Matratze lag und in die Dämmerung starrte, zog Kalle Bilanz über seinen Start in dieses neue, selbständige Leben. Noch hatte er sich nicht ganz von zu Hause gelöst, noch erschien ihm alles wie ein kurzer Ausflug in eine andere fremde Welt, aus der er morgen wieder verschwinden und in den Kreis seiner Familie zurückkehren konnte, wenn er wollte. Aber er wollte nicht. Er ballte die Faust unter der schmutzigen Wolldecke, mit der er sich zugedeckt hatte. Er war sich der Tragweite seines Entschlusses noch nicht ganz bewußt, deshalb störte ihn weder die Leere noch die Hässlichkeit des kleinen Zimmers, in dem er lag, und auch nicht die zerfetzten Seiten aus Pornoheften, die an der Wand klebten. Noch vermisste er sein Bett nicht, die saubere Bettwäsche, das Badezimmer… Noch schwirrten tausende großartiger Ideen in seinem Kopf herum und Pläne darüber, was er alles tun und wie er alles machen wollte. Er stellte sich Walter, seinen Stiefvater vor, wie er zu Hause in der kleinen Küche saß. Mager, mit schütteren blonden Haaren, unrasiert und mit schweren Augenlidern vom letzten Rausch. Eines Tages würde er zurückkehren, ihm ein paar Scheine auf den Tisch blättern und gönnerhaft zu ihm sagen: „Da! Kauf was! Was Hübsches für Mama und die Mädchen.“
Bei dem Gedanken an seine Schwestern mußte er lächeln. Er hing sehr an ihnen, an allen dreien. Aber ganz besonders an Biggie, der jüngsten, die so empfindsam und sensibel war. Eines Tages, wenn er es geschafft haben würde, wollte er zurückkehren und sie alle verwöhnen. Eines Tages.
Schon am nächsten Morgen machten sie sich auf die Suche nach Arbeit für Kalle. Der erste auf Joschs Liste war ein Kunststudent, der in einer Dachkammer zwischen Saffeleien, Bildern und Farbtöpfen hauste. Er hatte rotes, ungepflegtes Haar und sah krank aus. Josch hatte ein paarmal für ihn Modell gesessen. Das brachte zwar nicht viel ein, aber es war leicht verdientes Geld, weil man kaum etwas dafür tun mußte. Doch der Student hob bedauernd die Schultern. Im Augenblick brauchte er niemanden.
Der Nächste war Verkäufer in einer Boutique in der Kaiserstaße. Er trug eine hautenge schwarze Lederhose, dazu ein weinrotes Rüschenhemd. An seinem linken Ohr glänzte ein winziges goldenes Kettchen mit einem Rubin als Anhänger. Das lange mahagonifarben getönte Haar hatte er im Nacken mit einem Seidenband zusammengebunden. Für ihn hatte Josch wiederholt Pakete ausgetragen und andere Botengänge erledigt. „Wie sieht’s mit Arbeit aus, Fabian?“, fragte er. „Haste nich was für meinen Freund hier?“
Der junge Mann betrachtete Kalle abschätzend, während er sich mit einer eleganten Handbewegung eine Haarsträhne aus der Stirn strich.
„Sieht doch Klasse aus, findste nich?“, meinte Josch zwinkernd, und Kalle trat erschrocken einen Schritt zurück. Fast war er erleichtert, als der Schönling den Kopf schüttelte. „Tut mir leid, aber im Augenblick brauche ich niemanden. Vielleicht in einigen Wochen zum Sommerschlussverkauf. Meldet euch doch einfach mal wieder.“
Gegen Mittag trafen sie sich mit einem alten Mann in einem Straßencafé. Er trug einen verwaschenen Pullover mit einem großen Loch im Ärmel und roch ungewaschen und nach Knoblauch. Er arbeitete auf einem Schrottplatz, wo er sich in einem rostigen, ausrangierten Kleinlaster eingenistet hatte. Mitunter, wenn es viel zu tun gab, erlaubte er auch mal einem anderen, sich dort ein paar Mark zu verdienen. Er musterte Kalle eingehend und mit unverhohlener Neugier aus kleinen flinken Raubvogelaugen. Dann entschied er sich gegen ihn, ohne zu erklären, warum. „Im Moment ist nichts drin, mein Lieber“, sagte er und schüttelte den Kopf mit den weißen zotteligen Haaren. Er stand auf, und ohne seine Rechnung zu bezahlen verschwand er mit schlurfenden Schritten zwischen den Passanten. Josch wurde immer einsilbiger. Von nun an ließ er Kalle auf der Straße warten, wenn er mit jemandem verhandelte. Und Kalle fragte auch nichts mehr. Ihm schien, als beträfe das alles gar nicht ihn, sondern einen ganz anderen. Es interessierte ihn immer weniger, worüber geredet wurde, wenn Josch wieder einmal irgendwo läutet und dann hinter einer Tür verschwand. Um sich darüber Gedanken zu machen, sagte er sich, war noch Zeit, wenn es tatsächlich einmal klappen sollte. - Doch dazu kam es nicht.
Gegen Abend aßen sie eine Kleinigkeit an einer Imbissbude. Als Josch sein Portemonnaie zückte, kam ihm Kalle zuvor. Noch hatte er genügend Geld in der Tasche, denn er hatte einen großen Teil seiner Ersparnisse von seinem Konto in Bretzingen abgehoben. „Laß gut sein, ich mach das schon“, meinte er. „Du hast heute schon genug Ärger gehabt durch mich.“
Josch lächelte süßsauer und nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas. „Hast ne schlechte Zeit erwischt“, erklärte er achselzuckend.
Kalle nickte. „Morgen früh werd‘ ich mir eine Zeitung kaufen. Irgendwas wird sich schon finden.“
Josch fühlte sich in seinem Stolz verletzt. „Brauchst keine Zeitung“, warf er ein, „kenne genügend Leute. Müssen nur die richtigen finden. Wir geben nicht auf, Kalle, noch ist nichts verloren. Morgen suchen wir weiter.“
Kalle nickte wieder und gähnte. Die Füße taten ihm weh und sein T-Shirt war durchgeschwitzt. „Okay“, sagte er, „wenn ich nur erst mal bei dir wohnen bleiben kann.“
Josch lachte und klopfte ihm auf die Schulter. „Klar, Mann, ist doch Ehrensache. Solange du willst. Mach dir darüber keine Sorgen.“
2. Der erste Job
Sommer 1983
„…vierzehn, sechzehn, achtzehn, neunzehn“, zählte Kalle laut, „einer fehlt noch. Noch einmal verschwand er in der Lagerhalle und kam mit einem weiteren Sack Zement auf den Schultern zurück. Schwungvoll setzte er ihn auf dem weißverstaubten Pritschenwagen eines Stuckateurs ab. „Okay, das war’s“, sagte er und half dem Fahrer, die Rückwand des Wagens zu befestigen.
Während er dem Auto nachsah, das, dicke graue Staubwolken hinter sich zurücklassend, vom Hof in die Straße einbog, zog er die derben Handschuhe aus und fuhr sich mit dem Handrücken über die nasse Stirn. Trotz des späten Nachmittags stach die Sonne noch immer erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel und schmerzte auf der rotverbrannten Haut seines nackten Oberkörpers. Er war müde, und die Knochen taten ihm weh. Gottlob war bald Feierabend, wie er mit einem Blick auf seine Armbanduhr erleichtert feststellte.
Als der Lagerverwalter aus seinem Büro kam und winkte, begriff er nicht gleich, dass er gemeint war. Erst, als er ihm laut: „Schwarzkopf!“ über den Hof zurief und mit den Armen fuchtelte, antwortete er ihm. „Ja?“
Der Mann wartete, bis Kalle herangekommen war. Er war mittleren Alters, von kleiner gedrungener Statur. Das Firmenlogo der Fischer KG auf der linken Brusttasche seines grauen Kittels trug er wie einen Orden. „Kannst du heute länger bleiben, Schwarzkopf?“, fragte er.
Kalle konnte seine Enttäuschung kaum verbergen. „Warum? Was gibt’s denn?
„Drüben steht der Laster von Schmitt & Co., der sollte heute noch beladen werden.“
Kalle öffnete den Mund und wollte protestieren, doch dann besann er sich und schluckte seinen Einwand hinunter. Überstunden wurden in der Regel gut bezahlt, da durfte man nicht wählerisch sein. „Kann ich den Gabelstapler nehmen?“, fragte er stattdessen. „Hab eben schon zwanzig Sack Zement auf dem Buckel geschleppt.“
Der Lagerverwalter wiegte den Kopf hin und her. „Kannst du damit umgehen?“
„Ich glaub schon.“
Der Mann schaute noch immer zweifelnd, nickte dann aber. „Na gut, nimm den vom Lagerplatz drüben. Eigentlich dürfte ich dich gar nicht dranlassen, also sei bloß vorsichtig!“ Er drückte ihm den Durchschlag eines Lieferscheines in die Hand. „Ich schick dir den Hartmann rüber, der soll dir helfen. Muß aber ruck-zuck gehen, klar?“
„Klar, Mann.“
Kalle machte sich auf den Weg zum Lagerplatz auf der anderen Seite der Halle. Vorsichtig berührte er seine geröteten Schultern, auf denen sich bereits erste Bläschen bildeten. Es war wahrhaftig kein Vergnügen, bei diesen Temperaturen Putz und Zement zu schleppen, doch der Job war nur bis Ende Oktober befristet und wurde gut bezahlt. Da mußte man durchhalten, da durften Sonnenbrand und schmerzende Knochen keine Rolle spielen. Wer weiß, wie es danach mit ihm weiterging. Es war reiner Zufall gewesen, dass er diese Arbeit gefunden hatte. Eines Nachmittags, er war ziellos durch die Kaiserstraße geschlendert, hatte er beobachtet, wie jemand an einer Straßenbahnhaltestelle eine Zeitung in den Abfallbehälter steckte. Wie von einem inneren Zwang gelenkt war er darauf zugegangen, hatte sie wieder herausgezogen, durchgeblättert und war über die Anzeige der Fischer KG gestolpert. Ihm war klar, dass seine Ersparnisse schneller aufgebraucht sein würden, als ihm lieb war, wenn nicht bald ein regelmäßiger Verdienst dazukam, deshalb hatte er sich ohne Zögern in die Bahn nach Hagsfeld gesetzt, um sich vorzustellen. Vermutlich hatte ihm der Lagerverwalter angesehen, dass er tüchtig zupacken konnte und sich vor keiner Arbeit scheute, denn schon nach kurzer Absprache war die Sache perfekt gewesen. Man erwartete ihn bereits am nächsten Morgen, pünktlich um sieben. Kalle hatte es kaum fassen können. Noch immer mußte er lächeln, wenn er daran dachte, wie stolz er gewesen war. Kalle Schwarzkopf aus Bretzingen hatte endlich einen Job gefunden. Und ganz ohne fremde Hilfe. Nun brauchte er sich, zumindest für die nächsten Wochen, keine Sorgen mehr zu machen.
Es schien, als sei Josch ein wenig verärgert gewesen, weil er zu diesem Erfolg nichts beigetragen hatte, dennoch hatte er brummend den blauen Schein eingeschoben, den Kalle ihm später von seinem ersten Lohn in die Hand gedrückt hatte.
Von der anderen Seite kam nun der Hartmann über den Hof geschlendert. Kalle mochte ihn nicht, weil er ein Großmaul war. Vor allem gefiel ihm nicht, wie er den Kollegen zur Frühstückspause seine Frauengeschichten in allen Einzelheiten auftischte. Von seiner Einstellung zur Arbeit ganz zu schweigen. Es hieß, er bemühe sich immer erst dann um einen Job, wenn totale Ebbe in seinem Geldbeutel herrschte, und in seiner Freizeit, so erzählte man, gehöre er einer Gang an, die sich Big Jack‘s Warriors nannte, und die in der Stadt und im Umkreis ihr Unwesen trieb und immer wieder für Angst und Schrecken sorgte. Einmal hatte er Kalle sogar die Mitgliedschaft in dieser Gang angeboten. „Wer so anpacken kann, wie du, der kann doch bestimmt auch kräftig zuschlagen, wenn’s drauf ankommt, oder? Solche Leute können wir brauchen.“
Kalle hatte nur verächtlich den Kopf geschüttelt. Mit Leuten wie dem Hartmann wollte er nichts zu tun haben. Außerdem hielt er nichts von Cliquenwirtschaft. Nicht, dass er keine Freunde gehabt hätte, aber zur Not kam er auch ganz gut allein zurecht. In einer Herde mitzulaufen, wo alle nur das taten, was der Anführer wollte, das lag ihm nicht. Und ein Verein, der sich durch Krawall Respekt zu verschaffen suchte, kam für ihn schon gar nicht in Frage.
Während Kalle den Gabelstapler wieder und wieder belud und Posten für Posten auf dem Lastwagen absetzte, trieb sich der Hartmann in der Halle herum oder saß rauchend im Schatten auf einem Steinblock, der vom Büro aus nicht zu sehen war. Als sie später zusammen den Umkleideraum betraten, - Kalle verschwitzt und schmutzig, der Hartmann unverbraucht und guter Laune, - meinte der Warrior grinsend: „Hoffentlich lässt die Hitze in den nächsten Tagen ein bisschen nach. Wie soll man da sonst abends noch fit und frisch sein und das bringen, was die Weiber von einem erwarten.“ Noch immer lachend zündete er sich die nächste Zigarette an und hielt Kalle die Schachtel hin. Der schüttelte den Kopf. „Ich rauche nicht“, sagte er unfreundlich, „und die schon gar nicht.“
Hartmann warf einen verwunderten Blick auf die Zigarettenpackung, dann musterte er Kalle aus zusammengekniffenen Augen. „Wie meinst’n das?“
Kalle wandte sich ab und schloss seinen Schrank auf. „Wie ich’s sage“, war seine Antwort.
Ohne sich weiter um den Hartmann zu kümmern, zog er sich die staubigen Sachen aus und ging unter die Dusche. Es dauerte eine Weile, bis er allen Staub und Schweiß von sich abgespült hatte, denn aus den kalk- und rostverstopften Öffnungen der Brause kam nur ein spärliches, lauwarmes Rinnsal. Danach stieg er in die sauberen Jeans, die ihm Biene mitgegeben hatte, und er nahm sich vor, ihr für diesen Service zum nächsten Ersten ein paar Mark extra zu geben.
Diesmal war Josch schon zu Hause, als Kalle in der Schwanenstraße ankam. Biene war noch blasser, als gewöhnlich und lag, trotz der Hitze mit einer Decke zugedeckt, auf dem Sofa und zitterte. Sie schien geweint zu haben. Währenddessen lief Josch aufgebracht im Zimmer auf und ab. „Was ist denn los?“, wollte Kalle wissen und schaute von einem zum andern.
Josch wies mit einer Kopfbewegung auf Biene. „Sie ist krank.“
„Was hat sie denn?“
„Das Übliche, ist wieder umgekippt.“
„Was heißt das?“
„Nichts Besonderes, hat sie öfter.“
„Und was sagt der Arzt dazu?“
Josch schnaubte. „Quatsch Arzt. Wir brauchen keinen Arzt. Das geht vorbei, dann ist alles wieder in Ordnung.“
„Ist sie schwanger?“ Kalle war alt genug gewesen, als sich seine Schwestern ansagt hatten. Alt genug, um zu begreifen, dass es seiner Mutter während dieser Zeit nicht immer gut gegangen war.
Josch warf ihm einen gereizten Blick zu. „Nein, sie ist nicht schwanger, sie ist krank. Ist aber nichts Schlimmes, das vergeht wieder.“
„Josch, man kippt nicht einfach um, dafür muß es einen Grund geben. Meinst du nicht, sie sollte doch mal zum Arzt gehen?“
„Ist nur zu schwach. Guck sie dir dich an, sie isst zu wenig.“
Kalle schüttelte den Kopf. „Daran allein kann es nicht liegen.“
„Ärzte wollen nur Geld machen, von den Schmarotzern brauchen wir keinen. Wenn sie sie in ein Krankenhaus stecken, das kostet dann auch nur wieder.“
„So ein Unsinn.“ Kalle begriff nicht, wie Josch so stur sein konnte, wenn es um Bienes Gesundheit ging. „Das kostet nichts, wenn man nichts hat. Und die Hauptsache ist doch, dass sie wieder gesund wird.“
Josch warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. „Wird sie auch so, muß nur wieder richtig essen. Außerdem braucht sie Ruhe, hat bisher immer bei dem albernen Schmuckzeug geholfen. Muß mal einen Tag Pause machen.“
„Es geht mir schon viel besser“, meldete sich nun auch Biene vom Sofa her. Schuldbewusst sah sie Josch nach, der seine Wanderung durchs Zimmer wieder aufgenommen hatte. „Morgen früh bin ich wieder ganz in Ordnung“
„Morgen früh bleibst du noch mal zu Hause, verstanden?“, sagte Josch streng.
„Nein, das geht nicht.“
„Und ob das geht!“
Biene schaute ihn ängstlich an. „Josch…“, bat sie lese.
„Nix Josch!“ Er wurde jetzt lauter und hob drohend den Zeigefinger. „Die kommen auch mal ohne dich klar.“
Kalle lehnte sich an den Wasserstein, in dem ein paar ungespülte Schüsseln und Tassen standen. Eine dicke schwarze Fliege machte sich an den Resten zu schaffen. „Josch hat recht, Biene,“ sagte er, „bleib noch mal einen Tag zu Hause und kurier dich aus.“
„Das geht wirklich nicht“, jammerte sie. „Ich bin doch heute schon ausgefallen. Wie soll es denn weitergehen, wenn ich morgen auch wieder fehle? Fritz liegt mit gebrochenem Bein im Krankenhaus, und Barbara flippt jedesmal aus, wenn sie ganz alleine am Stand ist. Fredy hat genug anderes zu tun, der kann ihr auch nicht immer helfen. Und es ist wirklich nicht gut, wenn man allein am Stand ist, das ist viel zu gefährlich. Da sollte immer zusätzlich jemand da sein, der ein bisschen aufpasst.“ Und etwas leiser fügte sie hinzu: „Außerdem können wir es uns nicht leisten, für einen weiteren Tag auf das Geld zu verzichten.“
Kalle überlegte. „Und wenn ich einspringe?“, fragte er dann. „Ich meine, aufpassen kann ich auch. Dadurch ginge dir zumindest deine Tagesprämie nicht verloren.“
Bienes Gesicht hellte sich auf. Sie wollte etwas sagen, aber Josch kam ihr zuvor. „Wie willst’n das machen? Du hast doch deine Arbeit.“
„Ich könnte Urlaub nehmen.“
„Kriegste denn welchen?“
Kalle hob die Schultern. „Ein paar Tage stehen mir zu, glaube ich. Ich könnte mal fragen.“
Biene lächelte. „Das wäre wirklich nett von dir, Kalle.“
Josch brummte, was ebenso Zustimmung wie Ablehnung bedeuten konnte.
„Ich werde mich morgen früh erkundigen“, sagte Kalle noch einmal, „und jetzt mach dir mal keine Sorgen mehr, Biene. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen.“
Das Mädchen lehnte sich in die Kissen zurück und seufzte erleichtert. Auch Josch hatte sich inzwischen wieder beruhigt. Er öffnete die Kühlschranktür. „Trinkst’n Bier mit mir?“, fragte er Kalle über die Schulter. Der aber schüttelte den Kopf. „Ich will noch eine Weile in den Schwarzen Kater“, sagte er und schaute auf die Uhr.
Josch grinste und boxte ihn freundschaftlich in die Seite. „Gehst verdammt oft hin In letzter Zeit. Hast wohl was aufgerissen, was?“
Kalle hob abwehrend die Hand, aber Josch lachte gönnerhaft. „Warum nicht? Wünsch dir jedenfalls viel Spaß.“
Der Schwarze Kater