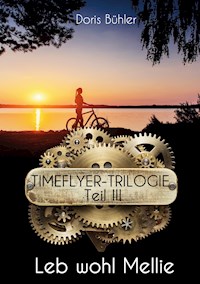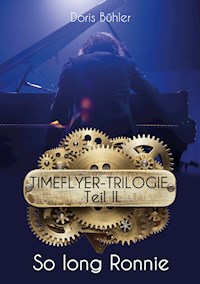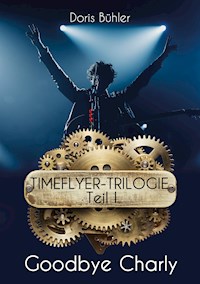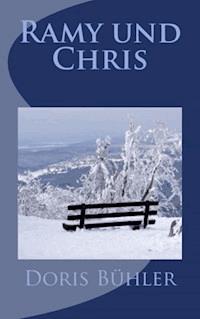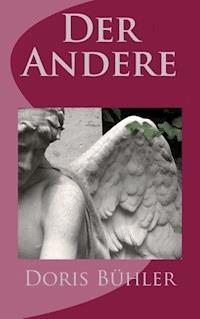Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche Gabe macht es Marion Nowak möglich, durch die Kraft ihrer Gedanken ihren Geist auf die Reise zu schicken. Zusammen mit ihrer Liebe, dem Arzt Bernd Ahrweiler, versucht sie, ihre Fähigkeiten immer weiter zu vervollkommnen, ohne zu ahnen, daß ihre Lehrmeisterin Anna Heger einst daran gescheitert ist. Wird sie das gleiche Schicksal erleiden müssen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Doris Bühler
Irrlichter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. SIE
2. ER
3. SIE
4. ER
5. SIE
6. ER
7. SIE
8. ER
9. SIE
10. ER
11. SIE
12. ER
Impressum neobooks
1. SIE
Freitag, der 13.
Nein, ich war nicht abergläubisch. Wirklich nicht. Dennoch wunderte ich mich, daß an einem einzigen Tag so viel passieren konnte, wie normalerweise nicht einmal in einem ganzen Jahr. Es begann schon am frühen Morgen, als es zu einem heftigen Wortwechsel mit Eisenhuth, unserem Bürovorsteher kam und ich ihm Sachen an den Kopf warf, die ich ihm schon lange vorher hätte sagen sollen. Zur optischen Untermalung knallte ich ihm dann auch noch einen Stoß Akten auf seinen Schreibtisch, daß es Zettel und Notizen regenete und sein Arbeitsplatz danach aussah, als wollte er für sechs Wochen in Urlaub. Zwei Stunden später fiel mir die Glaskanne der Kaffeemaschine in den Ausguß und zersprang zu tausend Scherben. Sogar Katja, das sanfte Schäfchen unter meinen Kollegen, nannte mich kopfschüttelnd einen Schussel.
Wenn das nur alles gewesen wäre! Doch es folgte die endlose Sucherei nach einem Ordner, den angeblich ich verlegt haben sollte, zweimal gab mir unser Juniorchef einen fehlerhaften Brief zurück, und zuguterletzt rief mich der Big Boss zu sich und ließ eine Gardinenpredigt auf mich hernieder über eine Angelegenheit, die länger als ein halbes Jahr zurücklag.
Gerade in diesem Augenblick schlug die Turmuhr der Kirche auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwölfmal, und das bedeutete, es war Mittagspause. Erleichtert atmete ich auf, ich wollte nur noch fort aus diesem vermaledeiten Büro, wollte mich eine Weile auf eine Bank im nahegelegenen Park setzen und eine Stunde lang an gar nichts mehr denken. Auf dem Weg dorthin würde ich mir beim Bäcker eine Butterbrezel kaufen und dann nur noch abschalten und genießen. Doch es war schwer, meine innere Aufruhr zu drosseln und mich wieder zu beruhigen, deshalb stürmte ich ein bißchen zu schnell die blankgebohnerte Holztreppe hinunter, rannte ein bißchen zu schnell die Einfahrt entlang, über den Bürgersteig, bis vor zur Straße... Ein bißchen zu schnell für das Auto, das auf mich zukam und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.
Das einzige, was ich wahrnahm, war ein Krachen und Quietschen, danach war es dunkel um mich.
Wie ich später erfuhr, soll der Fahrer des Wagens noch versucht haben, das Steuer herumzureißen, dadurch traf er mich linksseitig mit der Stoßstange und dem Kotflügel, und ich blieb vor seinen Vorderrädern liegen. Ein Unfallwagen brachte mich mit Blaulicht in das Konrad-Hupbauer-Krankenhaus. Vier Stunden dauerte es, bis sie mich wieder einigermaßen zusammengeflickt hatten: Ein paar unbedeutende Schrammen am Kopf, eine kleine Fleischwunde am linken Oberarm, hier und da ein paar Kratzer und Prellungen, - und dann eben das Bein. Mit dem sah es schlimm aus. Als ich zu mir kam, war es schon operiert, geschient, schön weiß eingepackt und an einer Vorrichtung am Bett aufgehängt. Doch zu diesem Zeitpunkt wußte ich von all dem noch gar nichts.
"Weiß man Namen und Adresse der jungen Frau?", fragte jemand mit einer unendlich tiefen Stimme. Ich stellte mir die dazugehörende Person uralt und weißhaarig vor, es gelang mir aber nicht, die Augen zu öffnen, um mich davon zu überzeugen, ob ich recht hatte.
"Ja. Sie heißt Marion Nowak, zweiundzwanzig Jahre alt", antwortete eine andere Stimme. "Frau Schmied, eine Kollegin von ihr, hat uns die Daten gegeben."
Ich seufzte ungehört. Ausgerechnet die Schmied, dachte ich, da wird sie sich wieder wichtig gemacht haben, wie das so ihre Art ist.
"Ledig? Verheiratet?", fragte die tiefe Stimme wieder, "sind die Angehörigen verständigt worden?"
"Sie ist ledig. Soviel ich weiß sitzen die Eltern draußen im Wartezimmer."
"Gut, ich werde mit ihnen reden."
Arme Mama, dachte ich. Hatte ich mir nicht immer alle Mühe gegeben, ihr so wenig wie möglich Sorgen zu machen?
Als ich später das erste Mal blinzelte, gewahrte ich eine unangenehm grelle Neonlampe über mir an der weißen Decke.
"Mein Gott, das arme Kind!"
Das war Mamas Stimme. Ich wollte mich nach ihr umsehen, doch die Neonlampe wollte nicht aus meinem Blickfeld weichen.
"Marion, Liebes..." Sie strich mir behutsam über Stirn und Wangen.
"Laß gut sein, Martha, sie ist doch noch gar nicht bei sich."
Ich wollte widersprechen. Und weinen. Aber ich konnte nicht einmal das. 'Doch, Papa, doch! Ich höre euch!'
"Sie hat die Lippen bewegt. Ich habe es genau gesehen."
"Komm, Martha. Jetzt setzt du dich mal hier hin und regst dich nicht mehr auf. Es ist ja noch einmal gutgegangen. Du hast gehört, was der Arzt gesagt hat, sie hatte großes Glück im Unglück."
Mama seufzte. "Sie hatte schon immer einen Schutzengel."
Guter Schutzengel, dachte ich, wo bist du dann heute den ganzen Vormittag über gewesen?
Es war genau 16.51 Uhr, als ich endlich die Augen aufschlug. Ich weiß es so genau, weil ich den Kopf zur Seite drehte, weg von der grellen Lampe, die mich blendete. Mein Blick ging die grüngekachelte Wand entlang..., und dann sah ich die Uhr, die von der Decke herabhing.
"Mama." Ich konnte nur flüstern, aber sie hatte mich gehört. Sie fuhr herum und kam auf mich zugelaufen.
"Marion, Kind! Geht es dir gut? Siehst du mich? Erkennst du mich?"
Ich lächelte, - und das klappte tatsächlich. "Mir ist noch ein bißchen schummerig", sagte ich schwach, "aber ja, ich sehe dich."
Mein Vater kam an ihre Seite. "Wie schön, daß du auch da bist, Papa."
Er hatte sonst immer so wenig Zeit für mich. Heute hatte er.
Ich wurde auf die Station C23 gelegt. Das C stand für Chirurgie, die 2 für den zweiten Stock und die 3 für die Abteilung mit den Knochenbrüchen. Um es gleich vorwegzunehmen, diese gründliche Aufklärung erhielt ich erst später von meiner Mitpatientin Petra, die sich beim Sport eine komplizierte Schulterverletzung zugezogen hatte.
Man schob mein Bett in das Zimmer mit der Nummer 224. Es war ein sehr hübsches Zimmer, hell und sonnig und viel schöner als die meisten, die ich im Laufe der Zeit bei Krankenhausbesuchen kennengelernt hatte. Das Konrad-Hupbauer-Krankenhaus galt als eines der modernsten Krankenhäuser im Umkreis, und ich war dankbar, daß man mich gerade hierher gebracht hatte.
Mein Bett kam in die Mitte, ich wurde flankiert von eben jener erst dreizehn Jahre alten Petra, die am Fenster lag und neugierig den Hals nach mir reckte, und einer schon älteren grauhaarigen Dame, die mir freundlich lächelnd und mitfühlend zunickte.
Petra begann sogleich, mir alles über sich zu erzählen, was sie für interessant und wissenswert hielt. Ich hatte Mühe, ihrem Redeschwall zu folgen, weil ich noch immer leicht benommen war, und weil nun allmählich auch der Schmerz in meinem Bein einsetzte. Doch sie ließ nicht locker, bis sie alles über mich in Erfahrung gebracht hatte. Eine der Schwestern mußte ihr sogar meinen Geburtstag in einen kleinen roten Kalender eintragen, den sie in ihrer Nachttischschublade aufbewahrte, durch ihren unförmigen Gips aber nicht aus eigener Kraft erreichen konnte.
Frau Neubert, die ältere Dame auf der anderen Seite, erzählte mir ihre Geschichte erst im Laufe des nächsten Tages. Sie war die Treppe hinuntergefallen und hatte den Oberschenkelhals gebrochen. Fast zwei Stunden hatte es gedauert, bis sie von einem der Hausbewohner gefunden worden war.
Am nächsten Morgen lernte ich alle guten Geister der Station kennen. Außer der Nachtschwester Christa, einer rundlichen mütterlichen Person mit schwarzgraumeliertem Pagenkopf, die ich bereits kennengelernt hatte, waren da noch Schwester Rita und Schwester Margret, - beide etwa in meinem Alter, - der Pfleger Hartmut mit roten Haaren, Sommersprossen und einer Nickelbrille, und Rosi, die Schülerin, die mir ganz besonders imponierte, weil sie immer gleichbleibend lieb und geduldig war und alle ihr aufgetragenen Handgriffe erledigte, als hätte sie nie im Leben etwas anderes getan.
Zur Visite, so gegen neun, bewegte sich eine Woge von weißen Kitteln in unser Zimmer. Bei Petra fingen sie an, so hatte ich Zeit genug, sie mir genauer anzusehen. Damals behielt ich ihre Namen noch nicht, ich lernte erst in den darauffolgenden Tagen, sie auseinanderzuhalten. Doch ich erkannte die tiefe Stimme, mußte aber feststellen, daß sie keinem weißhaarigen uralten Greis gehörte, sondern einem sehr gutaussehenden Mann mittleren Alters, der sich mir als Prof. Jonas vorstellte, und der mir erzählte, daß er es gewesen sei, der mich operiert habe.
Die anderen waren Frau Dr. Bergeiner, Dr. Ahrweiler, Dr. Winter und Dr. Brodbek. Letzterer war übrigens derjenige gewesen, der mich nach dem Unfall als erster in der Ambulanz in Empfang genommen hatte. Während der Visite waren zwar alle sehr freundlich zu mir, in erster Linien aber schien ich für sie doch nur ein 'Fall' zu sein. Mit gedämpfter Stimme unterhielten sie sich über meine Verletzungen, und ich, die es mich ja eigentlich am meisten anging, konnte ihnen kaum folgen, weil sie mit medizinischen und lateinischen Ausdrücken so um sich warfen, daß mir angst und bange wurde. Allein vom Zuhören.
Nur einer der Ärzte wandte sich direkt an mich. "Nur keine Aufregung", sagte er freundlich, als er meinen ängstlichen Blick bemerkte und zwinkerte mir zu, "das kriegen wir schon wieder hin."
Auf dem Namensschildchen, das an der Brusttasche seines weißen Kittels steckte, stand 'Dr. Bernd Ahrweiler'.
Schnell hatte ich mich in den Krankenhausalltag eingefunden. Ich genoß das Nichtstun und den Gedanken daran, daß nun die Schmied meine Briefe tippen durfte, daß ich den alten Eisenhuth eine Weile nicht mehr sehen mußte und auch nicht den eingebildeten Juniorchef, der heute schon so tat, als gehöre im bereits die Firma allein. Und der sanften Katja wünschte ich, daß ihr wenigstens ein einziges Mal eine Glaskanne aus der Hand fallen möge.
Es gefiel mir, daß mich Freunde und Verwandte besuchen kamen mit Blumensträußen, Keksen und Schokolade, daß sie um mein Bett herumstanden und mich bemitleideten und bedauerten.
Doch es gab nicht nur die rosige Seite des Krankenhausaufenthaltes, denn da waren ja auch noch die Verletzungen, die mir Probleme bereiteten: Die Wunde am linken Oberarm, die sich entzündet hatte und schlecht heilen wollte, die Abschürfungen und Prellungen, und vor allem das gebrochene Bein. Manchmal waren die Schmerzen fast unerträglich, und auch das dauernde 'Auf-dem-Rücken-liegen' setzte mir zu, weil ich mich gern, wie zu Hause, eingerollt hätte wie eine Katze.
Ich mochte die Ärzte und Schwestern, denn sie waren freundlich und fürsorglich, und mit der Zeit waren sie für uns Patienten fast schon vertraute Freunde geworden. Wir alle waren wie eine große Familie, die auf Gedeih und Verderb miteinander auskommen mußte. Rosi, die Schülerin hatte ich besonders gern, und von den Ärzten war mir Dr. Ahrweiler, unser Stationsarzt, am liebsten, weil er auf alle Fragen eine Antwort wußte. Petra schwärmte sogar ein bißchen für ihn und fand ihn 'süß'. Und ja, irgendwie konnte ich sie verstehen.
Obwohl mir meine Cousine Lilo, eine alte Leseratte, eine Tasche mit Büchern brachte, kam ich kaum dazu, mich damit zu beschäftigen, weil mir Petra nur selten Ruhe ließ. Neben ihrem Geplapper löste ich Kreuzworträtsel und Sudokus, und der Fernseher lief fast den ganzen Tag. Dennoch war mir oft langweilig, weil ich nicht aufstehen konnte. Und so sehnte ich den Tag herbei, an dem Prof. Jonas endlich seinen Segen zum Beginn der Physiotherapie und somit zu meinen ersten Gehversuchen geben würde und ich, wenn auch nur mit Hilfe von Krücken, wieder beweglicher wäre und die Umgebung erkunden durfte.
Doch dann kam alles anders. Ich begriff recht bald, daß es kein gewöhnlicher Bruch war, den ich mir zugezogen hatte, und ich mußte mich damit abfinden, daß der Krankenhausaufenthalt wohl oder übel ein bißchen länger dauern würde, als man zunächst angenommen hatte. Das Schienbein war zersplittert gewesen, und es war schwierig, es zu richten, zu nageln und wieder in Ordnung zu bringen. Dennoch war mir nie in den Sinn gekommen, es könnte unvorhergesehene Komplikationen geben. Im Gegenteil, - nach zwei Wochen hatte ich den Kopf schon wieder voller Pläne und freute mich auf das, was ich zu Hause alles würde tun können, bevor ich wieder zurück ins Büro mußte.
Umso härter traf es mich, als ich erfuhr, daß eine zweite Operation notwendig war. Aufgrund einer neuen Röntgenaufnahme war festgestellt worden, daß der Bruch nicht richtig zusammenwachsen wollte. Ich war erschrocken, damit hatte ich nicht gerechnet.
Bei der Visite setzte sich Prof. Jonas auf meine Bettkante, tätschelte meine Hand und versuchte, mir so ausführlich wie möglich zu erklären, was schiefgelaufen war und was bei einer neuen Operation anders gemacht werden sollte. Doch es fiel mir schwer, es wirklich zu verstehen. Frau Dr. Bergeiner schob mir ein Formular und einen Kugelschreiber zu und wartete auf meine Unterschrift, mit der ich mein Einverständnis für die neue OP erklären sollte. Ich zögerte. Warum war denn bloß noch immer nicht alles in Ordnung? Wie hatte das passieren können? Was, um Himmelswillen, hatten sie falsch gemacht? - Hatte ich nicht geduldig alles ertragen und all ihre Anweisungen befolgt?
Ich sah Dr. Ahrweiler an, als sei er der einzige, der mir Antworten geben konnte, die ich auch verstand. Zumindest war er der einzige, dem ich vertraute, weil er bisher immer ehrlich zu mir gewesen war. Im Grunde vertraute ich ihm sogar mehr als dem Professor.
Er fing meinen Blick auf und hielt ihm stand. Er schaute nicht betreten zu Boden, wie die anderen, sondern nickte mir aufmunternd zu, als wollte er sagen: 'Kopf hoch. Wir schaffen das schon.' Allein dadurch machte er mir Mut und gab mir das Gefühl, nicht allein zu sein mit meinen Sorgen, - jemanden hinter mir zu wissen, mit dem ich jederzeit rechnen konnte.
"Also gut, in Ordnung", sagte ich leise und unterschrieb, und der Professor war erleichtert und glaubte, seine Erklärungen hätten mich überzeugt und seien der Grund dafür gewesen, daß ich zustimmte. Er stand auf, tätschelte noch einmal meine Hand, und schon wandte er sich Frau Neubert zu. Der Fall Nowak war soweit er ledigt, - startklar zur OP Nr.2.
Dr. Ahrweiler blieb noch einen Augenblick länger an meinem Bett stehen, lächelte und zwinkerte mir zu, bevor auch er sich der weißbekittelten Gruppe wieder anschloß.
"Bist du wirklich so cool und hast keine Angst?", fragte mich Petra, als das Ärzte-Team wieder fort war. "Oder versuchst du nur, stark zu sein?"
"Ich hab schon Angst", gab ich zu.