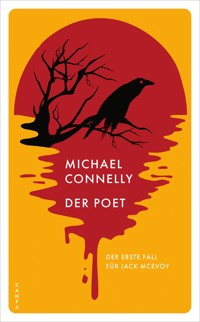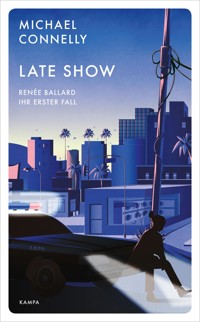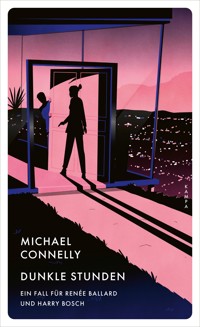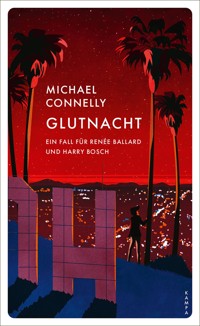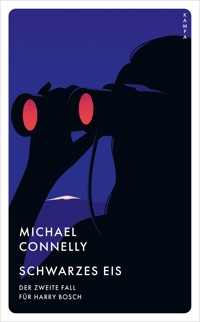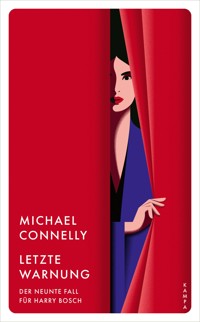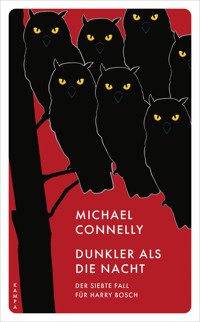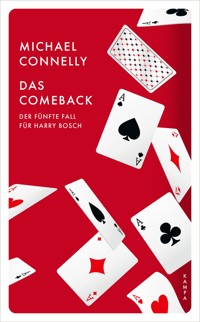14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für den Lincoln Lawyer
- Sprache: Deutsch
Wenn ein Anwalt im Gerichtssaal einen Faustschlag ins Gesicht bekommt, könnte der ungeübte Beobachter meinen, er hätte seinen Mandanten nicht im Griff. Aber der Lincoln Lawyer ist kein gewöhnlicher Anwalt und die Prügelei samt Kunstblut nur Teil seiner Strategie. So rund wie vor Gericht läuft es für Mickey Haller privat nicht: Seine Tochter hält ihn für skrupellos und hat den Kontakt abgebrochen. Und dann noch ein harter Schlag: Der Lincoln Lawyer soll Andre La Cosse vertreten, der des Mordes beschuldigt wird – des Mordes an Hallers alter Mandantin Gloria Dayton. Jahrelang hatte Haller versucht, Dayton beim Ausstieg aus der Drogensucht zu helfen. Er hat geglaubt, sie habe ihre Vergangenheit und L. A. hinter sich gelassen – und jetzt liegt sie in ebendieser unglückseligen Stadt tot in einem Hotelzimmer. Der Lincoln Laywer muss sich der Frage stellen, wer Gloria Dayton wirklich gewesen ist – und ob er derjenige war, der sie in Gefahr gebracht hat, statt sie zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Connelly
Götter der Schuld
Ein Fall für den Lincoln Lawyer
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für Charlie Hounchell
Teil einsGlory Days
Dienstag, 13. November
1
Ich näherte mich dem Zeugenstand mit einem offenen undfreundlichen Lächeln. Das sollte natürlich über meine wahre Absicht hinwegtäuschen. Ich wollte die Frau, die dort saß und ihren Blick unverwandt auf mich gerichtet hielt, mit allen Mitteln diskreditieren. Claire Welton hatte meinen Mandanten gerade als den Mann identifiziert, der sie am Heiligen Abend des vergangenen Jahres mit vorgehaltener Waffe gezwungen hatte, aus ihrem Mercedes E60 zu steigen. Er sei der Mann, sagte sie, der sie damals zu Boden gestoßen habe, bevor er mit dem Auto, ihrer Handtasche und den Einkaufstüten, die sie in der Mall auf den Rücksitz gelegt hatte, weggefahren sei. Außerdem habe er sie, wie sie dem Staatsanwalt gerade bei der Befragung erklärt hatte, um ihr seelisches Gleichgewicht und ihr Selbstvertrauen gebracht, auch wenn er für diesen sehr persönlichen Diebstahl nicht angeklagt war.
»Guten Morgen, Mrs. Welton.«
»Guten Morgen.«
Sie sagte diese Wörter, als wären sie gleichbedeutend mit Bitte, tun Sie mir nichts. Doch jeder im Gerichtssaal wusste, dass es meine Aufgabe war, ihr jetzt etwas anzutun und dadurch an der Beweisführung der Anklage gegen meinen Mandanten Leonard Watts zu kratzen. Welton war eine matronenhafte Mittsechzigerin. Sie wirkte nicht fragil, aber ich musste hoffen, dass sie es war.
Welton war eine Hausfrau aus Beverly Hills und eins von drei Opfern, die im Zuge einer vorweihnachtlichen Überfallserie, die den neun Anklagepunkten gegen Watts zugrunde lag, misshandelt und ausgeraubt worden waren. Die Polizei hatte ihm den Namen »Autoscooter-Räuber« verpasst, weil er seinen Opfern von einer Mall folgte, sie in einer Wohngegend an einem Stoppschild von hinten rammte und sie dann, wenn sie ausstiegen, um den Schaden zu begutachten, mit vorgehaltener Waffe um ihr Auto und ihre sonstigen Habseligkeiten brachte. Anschließend verpfändete oder verkaufte er das Raubgut, behielt das erbeutete Bargeld und verhökerte die Autos in diversen »Chop Shops«, Werkstätten, die auf die Verwertung gestohlener Fahrzeuge spezialisiert waren.
Das alles fußte jedoch auf Vermutungen und hing davon ab, dass jemand Leonard Watts vor Gericht als den Übeltäter identifizierte. Das war, was Claire Welton so besonders und zur Schlüsselzeugin des Prozesses machte. Sie war das einzige der drei Opfer, das vor Gericht auf Watts zeigte und steif und fest behauptete, dass er es gewesen war, dass er es getan hatte. Sie war die siebte Zeugin, die in den letzten zwei Tagen von der Anklage aufgerufen worden war, aber für mich war sie die einzige Zeugin. Sie war der Einserkegel. Und wenn ich sie im richtigen Winkel umwarf, riss sie alle anderen Kegel mit sich.
Ich musste unbedingt alle neune abräumen, sonst würden die Geschworenen, die alles aufmerksam verfolgten, Leonard Watts sehr lange hinter Gitter bringen.
Ich nahm ein einziges Blatt Papier zum Zeugenstand mit. Ich wies es als das ursprüngliche Protokoll des Streifenpolizisten aus, der nach dem Überfall als Erster am Tatort eingetroffen war, nachdem Claire Welton mit einem geliehenen Handy die Polizei verständigt hatte. Es war bereits Bestandteil der Beweismittel der Anklage. Nachdem ich den Richter um Erlaubnis gebeten und diese erteilt bekommen hatte, legte ich das Dokument auf die Ablage vor dem Zeugenstand. Welton wich vor mir zurück, als ich das tat. Ich war sicher, dass die meisten Geschworenen das mitbekommen hatten.
Während ich zum Pult zwischen den Tischen von Anklage und Verteidigung zurückging, stellte ich meine erste Frage.
»Mrs. Welton, Sie haben das erste Protokoll vor sich liegen, das am Tag des bedauernswerten Vorfalls aufgenommen wurde, dessen Opfer Sie geworden sind. Wissen Sie noch, ob Sie mit dem Streifenpolizisten gesprochen haben, der damals an den Tatort gekommen ist?«
»Natürlich habe ich mit ihm gesprochen.«
»Sie haben ihm erzählt, was passiert ist, richtig?«
»Ja. Ich war noch ziemlich durcheinander …«
»Aber Sie haben ihm erzählt, was passiert ist, damit er ein Protokoll aufnehmen konnte wegen des Mannes, der Sie ausgeraubt und Ihr Auto gestohlen hat, ist das richtig?«
»Ja.«
»Das war Officer Corbin, richtig?«
»Ich denke mal. An seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber er steht im Protokoll.«
»Aber Sie erinnern sich, dem Officer geschildert zu haben, was passiert ist, richtig?«
»Ja.«
»Und er hat eine Zusammenfassung dessen geschrieben, was Sie gesagt haben, richtig?«
»Ja, hat er.«
»Und er hat Sie sogar gebeten, diese Zusammenfassung zu lesen und dann zu unterschreiben, richtig?«
»Ja, aber ich war noch ziemlich durcheinander.«
»Ist das Ihre Unterschrift auf dem Protokoll, am Ende der Zusammenfassung?«
»Ja.«
»Mrs. Welton, würden Sie den Geschworenen bitte laut vorlesen, was Officer Corbin nach dem Gespräch mit Ihnen geschrieben hat?«
Welton zögerte zunächst und überflog die Zusammenfassung.
Diese Pause nutzte Kristina Medina, die Staatsanwältin, um aufzustehen und Einspruch zu erheben.
»Euer Ehren, ungeachtet dessen, dass die Zeugin die Zusammenfassung des Officers unterschrieben hat, versucht die Verteidigung, ihre Aussage mit einem Schreiben infrage zu stellen, das nicht von ihr stammt. Die Anklage erhebt Einspruch.«
Richter Michael Siebecker kniff die Augen zusammen und wandte sich mir zu.
»Euer Ehren, mit ihrer Unterschrift unter dem Protokoll des Officers hat die Zeugin die Aussage bestätigt. Es ist eine aktuelle Erinnerung, die schriftlich festgehalten wurde, und die Geschworenen sollten sie zu hören bekommen.«
Siebecker gab dem Einspruch nicht statt und forderte Mrs. Welton auf, die unterzeichnete Aussage aus dem Protokoll vorzulesen. Daraufhin kam sie der Aufforderung nach.
»›Opfer erklärte, dass sie an der Kreuzung Camden und Elevado anhielt und kurz darauf von einem von hinten auffahrenden Fahrzeug gerammt wurde. Als sie die Tür öffnete, um auszusteigen und nach dem Schaden zu sehen, stand ein Mann mit schwarzer Hautfarbe und einem A von dreißig bis fünfunddreißig vor ihr …‹ Was damit gemeint ist, weiß ich nicht.«
»Alter«, sagte ich. »Lesen Sie bitte weiter.«
»›Er packte sie an den Haaren und zerrte sie ganz aus dem Auto und drückte sie mitten auf der Straße zu Boden. Er richtete einen kurzläufigen schwarzen Revolver auf ihr Gesicht und drohte, sie zu erschießen, wenn sie sich von der Stelle rührte oder einen Laut von sich gab. Dann sprang der Verdächtige in ihr Auto und fuhr, gefolgt von dem Fahrzeug, das ihr Auto von hinten gerammt hatte, in nördlicher Richtung davon. Weiter konnte …‹«
Ich wartete, aber sie las nicht weiter.
»Euer Ehren, könnten Sie die Zeugin auffordern, die vollständige Aussage vorzulesen, wie sie am Tag des Vorfalls schriftlich festgehalten wurde?«
»Mrs. Welton«, seufzte der Richter, »lesen Sie uns bitte die ganze Aussage vor.«
»Aber, Herr Richter, das ist nicht alles, was ich gesagt habe.«
»Mrs. Welton«, sagte der Richter mit Nachdruck. »Lesen Sie die ganze Aussage vor, wie der Herr Verteidiger Sie gebeten hat.«
Welton lenkte ein und las den letzten Satz der Zusammenfassung.
»›Weiter konnte Opfer zu diesem Zeitpunkt den Verdächtigen nicht beschreiben.‹«
»Danke, Mrs. Welton«, sagte ich. »Sie konnten zwar den Verdächtigen nicht näher beschreiben, aber was die Waffe angeht, die er benutzte, war Ihre Beschreibung sehr detailliert. Oder sehe ich das falsch?«
»Ich weiß nicht, wie detailliert ich sie beschrieben habe. Jedenfalls hat er sie mir ins Gesicht gehalten, und deshalb konnte ich sie sehr gut sehen und entsprechend gut beschreiben. Der Officer hat mir insofern dabei geholfen, als er mir den Unterschied zwischen einem Revolver und einer Pistole erklärt hat. Eine Automatik nennt man das, glaube ich.«
»Und Sie konnten beschreiben, was für eine Schusswaffe es war, welche Farbe sie hatte und sogar wie lang ihr Lauf war.«
»Sind denn nicht alle Revolver schwarz?«
»Lassen Sie doch bitte vorerst mich die Fragen stellen, Mrs. Welton.«
»Jedenfalls hat mir der Officer viele Fragen zu der Waffe gestellt.«
»Aber den Mann, der sie auf Sie gerichtet hat, konnten Sie nicht beschreiben. Doch als Ihnen zwei Stunden später eine Reihe von Karteifotos vorgelegt wurde, haben Sie auf einem davon sein Gesicht erkannt. Habe ich das richtig verstanden, Mrs. Welton?«
»Nur um das klarzustellen: Ich habe den Mann gesehen, der mich ausgeraubt und mit der Waffe bedroht hat. Aber ihn beschreiben und ihn wiedererkennen zu können ist nicht dasselbe. Als ich dieses Foto gesehen habe, war mir sofort klar, dass er es war. Genauso sicher, wie ich weiß, dass er der Mann ist, der dort am Tisch sitzt.«
Ich wandte mich dem Richter zu.
»Euer Ehren, ich würde das gern als nicht sachdienlich streichen lassen.«
Medina stand auf.
»Euer Ehren, der Verteidiger stellt mit seinen angeblichen Fragen lediglich sehr allgemeine Behauptungen auf. Er hat eine Behauptung aufgestellt, und die Zeugin hat darauf reagiert. Der Antrag auf Streichung entbehrt jeder Grundlage.«
»Antrag auf Streichung ist abgelehnt«, erklärte der Richter rasch. »Stellen Sie Ihre nächste Frage, Mr. Haller, und damit meine ich auch eine Frage.«
Das tat ich. In den nächsten zwanzig Minuten arbeitete ich mich an Claire Welton und ihrer Identifizierung meines Mandanten ab. Ich fragte sie, wie viele Schwarze sie in ihrem Leben als Beverly-Hills-Hausfrau kennengelernt hatte, und öffnete damit die Tür für gemischtrassige Identifizierungsprobleme. Alles ohne Erfolg. Es gelang mir kein einziges Mal, ihre Überzeugung oder ihren Glauben zu erschüttern, dass Leonard Watts der Mann war, der sie beraubt hatte. Stattdessen schien sie eins der Dinge zurückzugewinnen, die sie ihren Aussagen zufolge bei dem Raubüberfall verloren hatte: ihr Selbstvertrauen. Je mehr ich ihr zusetzte, umso besser schien sie meinen verbalen Attacken standzuhalten und mir Paroli zu bieten. Sie war unerschütterlich. Ihre Identifizierung meines Mandanten blieb stehen. Und mir gelang es nicht, alle Kegel umzuwerfen.
Ich sagte dem Richter, ich hätte keine weiteren Fragen, und kehrte an den Tisch der Verteidigung zurück. Medina teilte dem Richter mit, sie habe noch ein paar ergänzende Fragen an die Zeugin, und ich wusste, dass sie lediglich dem Zweck dienten, Claire Weltons Identifizierung meines Mandanten zu erhärten. Als ich mich neben Watts auf meinen Platz setzte, hielt er nach Anzeichen von Hoffnung in meiner Miene Ausschau.
»Tja«, flüsterte ich ihm zu. »Das war’s. Wir können einpacken.«
Wie abgestoßen von meinem Atem oder meinen Worten oder beidem, wich er vor mir zurück.
»Wir?«
Das sagte er so laut, dass sich Medina umdrehte und zum Tisch der Verteidigung schaute. Ich machte mit nach unten gerichteten Handflächen eine beruhigende Geste in Richtung Watts und artikulierte stumm die Wörter Nur keine Aufregung.
»Nur keine Aufregung?«, stieß er laut hervor. »Wollen Sie mich hier verarschen oder was? Sie haben gesagt, Sie kriegen das geregelt, sie macht uns keinen Ärger.«
»Mr. Haller!«, schnauzte mich der Richter an. »Bringen Sie Ihren Mandanten zur Räson, oder ich …«
Watts wartete nicht ab, womit der Richter drohen wollte. Er warf sich wie ein Cornerback, der einen Pass unterbinden will, mit dem Oberkörper gegen mich. Ich kippte mitsamt meinem Stuhl um, und wir purzelten vor Medinas Füße. Um keinen Schlag abzubekommen, sprang die Staatsanwältin zur Seite, als Watts mit dem rechten Arm ausholte. Ich lag auf meiner linken Seite auf dem Boden, und mein rechter Arm war unter Watts’ Körper eingeklemmt. Ich schaffte es, meine linke Hand zu heben und seiner auf mich zuschießenden Faust entgegenzurecken. Das schwächte jedoch nur die Wucht des Schlags ab. Seine Faust rammte meine Hand gegen mein Kinn.
Ganz am Rand bekam ich Geschrei und Getümmel um mich herum mit. Watts zog seine Faust zurück, um zum nächsten Schlag auszuholen. Aber bevor er zuschlagen konnte, hatten sich die Gerichtsdeputys auf ihn gestürzt. Gemeinsam packten sie ihn und stießen ihn mit ihrem Schwung von mir, sodass er auf dem Fußboden vor den Tischen der Anwälte landete.
Alles schien in Zeitlupe abzulaufen. Der Richter brüllte Anweisungen, aber niemand hörte auf ihn. Medina und der Gerichtsdiener zogen sich von dem Handgemenge zurück. Die Protokollführerin war hinter ihrer Schranke aufgestanden und verfolgte bestürzt das Geschehen. Watts lag bäuchlings auf dem Boden, sein Kopf wurde von einem der Deputys auf die Fliesen gedrückt. Um seine Lippen spielte ein eigenartiges Lächeln, als ihm hinter dem Rücken Handschellen angelegt wurden.
Und im nächsten Moment war alles vorbei.
»Deputys, entfernen Sie ihn aus dem Saal!«, ordnete Siebecker an.
Watts wurde durch die Stahltür an der Seite des Gerichtssaals in die Arrestzelle für die inhaftierten Angeklagten geschleppt. Mich ließ man auf dem Boden sitzen und den Schaden begutachten. Mein Mund, meine Zähne und mein frisch gebügeltes weißes Hemd waren voll Blut. Meine Krawatte lag unter dem Tisch der Verteidigung. Es war das Klipsteil, das ich immer dann trage, wenn ich Mandanten in Arrestzellen besuche und nicht durch die Gitterstäbe gezogen werden möchte.
Ich fuhr mit der Hand über mein Kinn und mit der Zunge über meine Zähne. Alles schien intakt und funktionstüchtig. Ich holte ein weißes Taschentuch aus der Innentasche meines Jacketts und begann, mein Gesicht zu säubern. Gleichzeitig zog ich mich mit der freien Hand am Tisch der Verteidigung hoch.
»Jeannie«, sagte der Richter zur Protokollführerin. »Rufen Sie den Notarzt für Mr. Haller.«
»Nein danke, nicht nötig«, sagte ich rasch. »Mir fehlt nichts. Ich muss mich nur ein bisschen sauber machen.«
Ich hob meine Krawatte auf und klemmte sie in einem kläglichen Versuch, den äußeren Schein zu wahren, an meinen Kragen, obwohl ein leuchtend roter Fleck meine Hemdbrust verunzierte. Während ich die Klips an meinem zugeknöpften Hemdkragen zu befestigen versuchte, stürmten infolge des Alarms, den der Richter mit dem Notrufknopf zweifellos ausgelöst hatte, mehrere Deputys durch den Haupteingang auf der Rückseite des Saals. Siebecker bat sie rasch, sich zurückzuziehen, ihr Eingreifen sei nicht mehr nötig. Die Deputys stellten sich an der Rückwand des Gerichtssaals auf; eine Machtdemonstration, falls sonst noch jemand Faxen machen sollte.
Ich wischte mit dem Taschentuch ein letztes Mal über mein Gesicht und ergriff das Wort.
»Euer Ehren. Ich bedaure das Verhalten meines Mandanten zu …«
»Schon gut, Mr. Haller. Nehmen Sie Platz und Sie bitte auch, Ms. Medina. Beruhigen Sie sich erst mal alle wieder und setzen Sie sich.«
Ich kam der Aufforderung nach und beobachtete, das gefaltete Taschentuch auf die Lippen gedrückt, wie der Richter seinen Sessel zur Geschworenenbank drehte. Zuerst entließ er Claire Welton aus dem Zeugenstand. Sie stand zaghaft auf und ging zum Durchgang hinter den Tischen der Anwälte. Ihr schien der Vorfall nähergegangen zu sein als sonst jemandem im Saal. Zweifellos aus gutem Grund. Wahrscheinlich dachte sie, dass sich Watts genauso gut auf sie hätte stürzen können. Und wenn er schnell genug gewesen wäre, hätte er sie erwischt.
Welton setzte sich in die erste Reihe der Zuschauergalerie, die für Zeugen und Gerichtspersonal reserviert war, und der Richter wandte sich den Geschworenen zu.
»Meine Damen und Herren, es tut mir außerordentlich leid, dass Sie Zeuge dieser Szene werden mussten. Der Gerichtssaal ist kein Ort der Gewalt. Er ist der Ort, an dem eine zivilisierte Gesellschaft gegen die Gewalt, die auf unseren Straßen herrscht, Stellung bezieht. Es tut mir im Innersten weh, so etwas mit ansehen zu müssen.«
Ein metallisches Schnappen ertönte, und die zwei Deputys kamen aus der Arrestzelle in den Gerichtssaal zurück. Ich fragte mich, wie rabiat sie mit Watts umgesprungen waren, als sie ihn in die Zelle gebracht hatten.
Der Richter hielt kurz inne, bevor er sich wieder den Geschworenen zuwandte.
»Bedauerlicherweise hat Mr. Watts’ Entschluss, seinen Anwalt anzugreifen, unsere Befähigung beeinträchtigt, die Verhandlung fortzusetzen. Ich glaube …«
»Euer Ehren«, unterbrach ihn Medina. »Dürfte die Anklage dazu etwas sagen?«
Medina wusste genau, worauf der Richter hinauswollte, und dagegen musste sie etwas unternehmen.
»Nicht jetzt, Ms. Medina, und unterbrechen Sie das Gericht nicht.«
Doch Medina ließ nicht locker.
»Euer Ehren, dürften die Anwälte an die Richterbank kommen?«
Der Richter schien verärgert, gab aber nach. Ich ließ Medina den Vortritt, und wir gingen zur Richterbank. Damit die Geschworenen unsere geflüsterte Unterhaltung nicht mithören konnten, schaltete der Richter einen Akustikventilator ein. Bevor Medina ihr Anliegen vorbringen konnte, fragte mich der Richter noch einmal, ob ich ärztliche Hilfe benö-tigte.
»Mir fehlt nichts, Herr Richter, aber danke für Ihr Angebot. Ich glaube, das Einzige, was in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist mein Hemd.«
Der Richter nickte und wandte sich Medina zu.
»Ich weiß, was Sie einwenden wollen, Ms. Medina, aber mir sind die Hände gebunden. Aufgrund dessen, was sie gerade gesehen haben, sind die Geschworenen befangen. Mir bleibt keine andere Wahl.«
»Euer Ehren, Gegenstand dieses Verfahrens ist ein extrem gewalttätiger Angeklagter, der äußerst brutale Straftaten begangen hat. Das wissen die Geschworenen. Sie werden aufgrund dessen, was sie gesehen haben, nicht über Gebühr befangen sein. Die Geschworenen haben das Recht, das Verhalten des Angeklagten selbstständig zu beobachten und zu bewerten. Da er aus freien Stücken gewalttätige Handlungen begangen hat, ist die Befangenheit gegenüber dem Angeklagten weder unberechtigt noch unfair.«
»Wenn ich dazu etwas sagen dürfte, Euer Ehren, möchte ich doch mit äußerstem …«
»Außerdem«, überfuhr mich Medina einfach, »steht zu befürchten, dass das Gericht vom Angeklagten bewusst manipuliert wird. Ihm war sehr wohl bewusst, dass er auf diesem Weg ein neues Gerichtsverfahren bekommen kann. Er …«
»Moment, Moment«, protestierte ich. »Der Einspruch der Anklage strotzt geradezu vor haltlosen Unterstellungen und …«
»Ms. Medina, dem Einspruch wird nicht stattgegeben«, erklärte der Richter und unterband damit jede weitere Diskussion. »Selbst wenn die Befangenheit weder unberechtigt noch unfair ist, hat Mr. Watts seinem Anwalt de facto gerade das Mandat entzogen. Unter diesen Umständen kann ich Mr. Haller nicht bitten, weiterzumachen, und was meine Person angeht, habe ich nicht die Absicht, Mr. Watts noch einmal in diesen Saal zu lassen. Und jetzt treten Sie zurück. Beide.«
»Euer Ehren, ich möchte, dass der Einspruch der Anklage zu Protokoll genommen wird.«
»Das können Sie gern haben. Aber jetzt entfernen Sie sich.«
Wir kehrten an unsere Tische zurück, und der Richter schaltete den Ventilator aus und richtete sich an die Geschworenen.
»Meine Damen und Herren, wie bereits gesagt, hat der Zwischenfall, dessen Zeugen Sie eben geworden sind, eine für den Angeklagten nachteilige Situation geschaffen. Meiner Ansicht nach wird es zu schwer für Sie sein, sich weit genug von dem eben Gesehenen zu distanzieren, wenn Sie sich ein Urteil über Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu bilden versuchen. Aus diesem Grund muss ich das Verfahren für fehlerhaft erklären und Sie mit dem Dank des Gerichts und des Volkes von Kalifornien Ihrer Aufgabe entbinden. Deputy Carlyle wird Sie nach hinten in den Aufenthaltsraum begleiten. Dort können Sie Ihre persönlichen Dinge abholen und anschließend nach Hause gehen.«
Die Geschworenen schienen unschlüssig, was sie tun sollten und ob wirklich alles vorbei war. Schließlich erhob sich ein entschlossener Mann von seinem Platz. Kurz darauf folgten auch die anderen seinem Beispiel und gingen durch eine Tür auf der Rückseite des Saals.
Ich schaute zu Kristina Medina hinüber. Sie saß mit gesenktem Kopf niedergeschlagen am Tisch der Anklage. Der Richter vertagte abrupt die Verhandlung und verließ die Bank. Ich faltete mein ruiniertes Taschentuch zusammen und steckte es ein.
2
Ich hatte den ganzen Tag für den Prozess eingeplant.Plötzlich davon entbunden, musste ich weder einen Mandanten aufsuchen noch einen Staatsanwalt bearbeiten noch irgendwo sein. Ich verließ das Gericht und ging die Temple Street hinunter zur First. An der Ecke war ein Abfallkorb. Ich nahm mein Taschentuch heraus, hielt es an die Lippen und spuckte den ganzen Schleim aus meinem Mund hinein. Dann warf ich es weg.
Ich bog nach rechts in die First Street und sah die Town Cars am Straßenrand stehen. Es waren sechs in einer Reihe, wie bei einem Begräbnis. Die wartenden Fahrer standen auf dem Gehsteig und ratschten miteinander. Angeblich ist Nachahmung die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Jedenfalls sind seit dem Film eine ganze Menge Lincoln Lawyers aus dem Boden geschossen, die regelmäßig die Bordsteine vor den Gerichten von L.A. bevölkern. Ich war sowohl stolz als auch genervt. Mehr als einmal war mir zu Ohren gekommen, dass es Anwälte gab, die behaupteten, als Vorlage für den Film gedient zu haben. Außerdem war ich im letzten Monat mindestens dreimal in einen falschen Lincoln gestiegen.
Diesmal würde mir dieser Fehler nicht unterlaufen. Ich holte mein Handy heraus und rief meinen Fahrer Earl Briggs an, den ich ein Stück weiter vorn im Gespräch mit anderen sehen konnte. Er ging sofort dran, und ich bat ihn, den Kofferraum zu entriegeln. Dann legte ich auf.
Ich sah den Kofferraumdeckel des dritten Lincoln in der Reihe aufklappen und wusste, wohin ich musste. Als ich die Limousine erreichte, stellte ich meinen Aktenkoffer ab und zog Sakko, Krawatte und Hemd aus. Da ich darunter ein T-Shirt anhatte, verursachte ich keinen Verkehrsstau. Ich nahm ein blaues Oxfordhemd von dem Ersatzhemdenstapel im Kofferraum, entfaltete es und schlüpfte hinein. Earl kam von seinem Klatschkränzchen herüber. Mit Unterbrechungen war er schon beinahe zehn Jahre mein Chauffeur. Jedes Mal, wenn er mit dem Gesetz in Konflikt geriet, kam er zu mir und arbeitete anschließend mein Honorar ab, indem er mich fuhr. Diesmal bezahlte er mich nicht für selbst verschuldete Probleme. Ich hatte die Zwangsversteigerung des Hauses seiner Mutter abgewendet und so verhindert, dass sie obdachlos wurde. Das trug mir etwa sechs Monate Chauffeursdienste von Earl ein.
Ich hatte mein versautes Hemd auf den Kotflügel gelegt. Earl griff danach und sah es sich an.
»Hat Ihnen da jemand ein Glas Hawaiian Punch übergekippt oder was?«
»So ähnlich. Kommen Sie, fahren wir.«
»Ich dachte, Sie sind heute den ganzen Tag im Gericht.«
»Dachte ich ursprünglich auch. Es ist aber was dazwischengekommen.«
»Wo soll’s hingehen?«
»Erst mal zum Philippe’s.«
»Alles klar.«
Er stieg vorne ein und ich hinten. Nach einem kurzen Zwischenhalt in dem Sandwich-Shop in der Alameda fuhren wir in westlicher Richtung weiter. Unser nächstes Ziel war das Menorah Manor in der Nähe von Park La Brea im Fairfax District. Dort angekommen, sagte ich Earl, ich sei in etwa einer Stunde wieder zurück, und stieg mit meinem Aktenkoffer aus. Das frische Hemd hatte ich mir in die Hose gesteckt, aber die Krawatte klemmte ich nicht mehr an den Kragen. Sie war nicht nötig.
Das Menorah Manor war ein viergeschossiges Altenheim in der Willoughby Avenue östlich vom Fairfax District. Ich trug mich an der Rezeption ein und fuhr mit dem Aufzug in den zweiten Stock, wo ich der Frau am Empfang sagte, dass ich mit meinem Mandanten David Siegel in seinem Zimmer eine rechtliche Angelegenheit zu klären habe und nicht gestört werden wolle. Sie war eine sympathische Frau, die an meine regelmäßigen Besuche gewöhnt war. Sie nickte zustimmend, und ich ging den Flur hinunter zu Zimmer 334.
Ich hängte das NICHT-STÖREN-Schild an den äußeren Türgriff, bevor ich das Zimmer betrat und die Tür hinter mir schloss. David »Legal« Siegel lag im Bett. Sein Blick war auf den Bildschirm eines stumm geschalteten Fernsehers geheftet, der an der Wand gegenüber dem Bett befestigt war. Seine schmalen weißen Hände lagen auf der Bettdecke. Der Schlauch, der Sauerstoff in seine Nase leitete, zischte leise. Er grinste, als er mich sah.
»Mickey.«
»Legal, wie geht’s dir heute?«
»Nicht anders als gestern. Hast du mir was mitgebracht?«
Ich zog den Besucherstuhl von der Wand fort und stellte ihn so hin, dass ich in Legals Blickfeld saß. Mit seinen einundachtzig Jahren war er nicht mehr der Beweglichste. Ich legte meinen Aktenkoffer auf das Bett, öffnete ihn und drehte ihn so, dass Legal hineinfassen konnte.
»Ein French Dip von Philippe the Original. Na?«
»O Mann«, sagte er.
Das Menorah Manor war ein koscheres Heim, und um keinen Ärger zu bekommen, erzählte ich am Empfang immer, dass wir eine rechtliche Angelegenheit zu besprechen hatten, wenn ich etwas einschmuggelte. Legal Siegel vermisste die Lokale, in denen er während seiner vierzigjährigen Anwaltstätigkeit in Downtown gegessen hatte. Ich machte ihm diese kulinarische Freude gern. Er war der Sozius meines Vaters gewesen. Während er der Stratege war, war mein Vater der Frontmann gewesen, der Akteur, der diese Strategien im Gericht umsetzte. Nach dem Tod meines Vaters, ich war damals fünf, nahm mich Legal unter seine Fittiche. Als kleinen Jungen nahm er mich mit zu meinem ersten Dodgers-Spiel, und als ich größer wurde, schickte er mich zum Jurastudium auf die Uni. Nachdem ich vor einem Jahr bei der Wahl zum District Attorney mit Glanz und Gloria durchgefallen war, hatte ich mich auf der Suche nach einer neuen Lebensstrategie an Legal Siegel gewandt und war nicht von ihm enttäuscht worden. So gesehen, waren unsere Treffen tatsächlich Besprechungen zwischen Anwalt und Mandant, nur dass den Leuten an der Rezeption nicht bewusst war, dass ich der Mandant war.
Ich half ihm, das Sandwich auszupacken, und öffnete den Plastikbehälter mit dem jus, dessentwegen die Sandwiches aus dem Philippe’s so etwas Besonderes waren. Außerdem war, verpackt in Alufolie, eine geschnittene Essiggurke dabei.
Nach dem ersten Bissen grinste Legal und pumpte mit seinem mageren Arm, als hätte er gerade einen großen Sieg errungen. Ich lächelte. Es freute mich, ihm eine Freude machen zu können. Er hatte zwei Söhne und einen Haufen Enkelkinder, aber außer an Weihnachten kamen sie ihn nie besuchen. Wie Legal es ausdrückte: »Sie brauchen einen, bis sie einen nicht mehr brauchen.«
Wenn ich Legal besuchte, redeten wir meistens über Fälle, und er schlug mir Strategien vor. Wenn es darum ging, die Pläne der Anklage und den Ausgang eines Prozesses vorherzusagen, war er unschlagbar. Da spielte es keine Rolle, dass er in diesem Jahrhundert keinen Gerichtssaal mehr betreten hatte oder dass sich die Strafgesetze seit seiner Zeit geändert hatten. Er hatte enorme Erfahrung und immer etwas Brauchbares auf Lager. Er nannte es seine »Nummern« – die Doppelblindnummer, die Richterrobennummer und so weiter. Ich war in der finsteren Zeit nach der Wahl zu ihm gekommen, um etwas über meinen Vater zu erfahren und wie er auf die Widrigkeiten des Lebens reagiert hatte. Aber letztlich lernte ich dabei vor allem etwas über das Recht und dass es wie weiches Blei war. Dass es sich formen ließ.
»Das Recht ist nachgiebig«, sagte Legal Siegel immer. »Es ist biegsam.«
Ich betrachtete ihn als Teil meines Mitarbeiterstabs, und das erlaubte mir, meine Fälle mit ihm zu besprechen. Er steuerte seine Ideen und »Nummern« dazu bei. Manchmal griff ich darauf zurück, und manchmal erfüllten sie ihren Zweck, manchmal nicht.
Er aß langsam. Ich hatte gelernt, dass er, wenn ich ihm ein Sandwich mitbrachte, bis zu einer Stunde brauchen konnte, um es in kleinen Bissen und beständig kauend hinunterzubekommen. Er ließ nichts übrig und aß alles auf, was ich ihm mitbrachte.
»Die Kleine in Drei-dreißig ist gestern Nacht gestorben«, sagte er zwischen zwei Bissen. »Schade.«
»Ja, traurig. Wie alt war sie?«
»Sie war noch jung. Anfang siebzig. Einfach im Schlaf gestorben. Heute Morgen haben sie sie weggebracht.«
Ich nickte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Legal nahm einen weiteren Bissen und fischte eine Serviette aus meinem Aktenkoffer.
»Du nimmst ja den jus gar nicht, Legal. Das ist doch das Beste.«
»Ich glaube, ich mag ihn trocken lieber. Übrigens, hast du eigentlich die Fahnennummer abgezogen? Hat sie funktioniert?«
Als er nach der Serviette gegriffen hatte, hatte er den Ziplock-Beutel mit der zweiten Blutkapsel gesehen. Ich hatte sie für den Fall, dass ich die erste versehentlich verschluckte, als Ersatz dabeigehabt.
»Wie auf Bestellung«, sagte ich.
»Hast du dein fehlerhaftes Verfahren bekommen?«
»Ja. Da fällt mir ein, dürfte ich kurz dein Bad benutzen?«
Ich fasste in den Aktenkoffer und nahm einen weiteren Ziplock-Beutel mit meiner Zahnbürste heraus. Damit ging ich ins Bad und putzte mir am Waschbecken die Zähne. Zuerst wurde die Bürste von der roten Farbe rosa, aber rasch war alles in den Abfluss gespült.
Als ich zu meinem Stuhl zurückkehrte, stellte ich fest, dass Legal sein Sandwich erst zur Hälfte gegessen hatte. Mir war klar, dass der Rest längst kalt sein musste. Aber ich konnte es unmöglich in den Aufenthaltsraum bringen und dort in der Mikrowelle aufwärmen. Legal schien das jedoch nicht zu stören.
»Details«, verlangte er.
»Na ja, ich habe die Zeugin zu demontieren versucht, aber sie war nicht kleinzukriegen. Eine richtig harte Nuss. Sobald ich wieder an unserem Tisch zurück war, habe ich ihm das verabredete Zeichen gegeben, und er hat seine Show abgezogen. Hat zwar etwas fester zugeschlagen als erwartet, aber ich will mich nicht beklagen. Das Beste daran war, dass ich nicht mal einen Antrag stellen musste, das Verfahren für fehlerhaft zu erklären. Das hat der Richter von sich aus getan.«
»Gegen den Einspruch der Anklage?«
»Klar.«
»Gut. Diese blöden Ärsche.«
Legal Siegel war mit Leib und Seele Strafverteidiger. Für ihn ließ sich jedes ethische Problem und jede Grauzone damit bewältigen, dass sich der Verteidiger mit einem Eid dazu verpflichtet hatte, seinem Mandanten die bestmögliche Verteidigung zukommen zu lassen. Und wenn das hieß, im Notfall ein fehlerhaftes Verfahren herbeizuführen, versuchte man eben genau das.
»Jetzt ist natürlich die Frage: Lässt er sich auf einen Deal ein?«
»Es ist übrigens eine Sie, und ich glaube, sie wird einlenken. Du hättest nach unserer Rauferei die Zeugin sehen sollen. Sie hatte richtig Angst, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich noch mal für einen Prozess zur Verfügung stellen wird. Ich warte erst mal eine Woche, und dann lasse ich Jennifer die Staatsanwältin anrufen. Ich glaube, dann ist sie zu einem Deal bereit.«
Jennifer war meine Partnerin Jennifer Aronson. Sie würde Leonard Watts’ Vertretung übernehmen müssen. Wenn ich Watts nämlich weiter verteidigte, sähe es zu sehr nach dem faulen Trick aus, der es war und auf den Kristina Medina vor Gericht angespielt hatte.
Weil Watts sich geweigert hatte, seinen Partner zu verraten, der das Auto gefahren und die Opfer gerammt hatte, war Medina vor dem Prozess nicht bereit gewesen, sich auf einen Deal einzulassen. In einer Woche, glaubte ich, sähe die Sache aus verschiedenen Gründen anders aus: Ich hatte im ersten Prozess Einblick in weite Teile von Argumentation und Beweisführung der Anklage bekommen; Medinas Hauptzeugin hatte es wegen der heutigen Vorfälle im Gericht mit der Angst zu tun bekommen; und die Einleitung eines zweiten Verfahrens wäre ein kostspieliger Einsatz von Steuergeldern. Dazu kam, dass ich Medina einen ersten Vorgeschmack verschafft hatte, was auf sie zukäme, wenn die Verteidigung den Geschworenen den Sachverhalt aus ihrer Sicht präsentierte – insbesondere wenn ich Gutachter auffuhr, die sich vor den Geschworenen zu der Frage Wiedererkennen und Identifizierung zwischen unterschiedlichen Ethnien äußerten. Das war etwas, womit sich kein Ankläger in Anwesenheit der Geschworenen herumschlagen wollte.
»Wahrscheinlich ruft sie sogar an, bevor ich mich bei ihr melden muss«, sagte ich.
Das war zwar Wunschdenken, aber ich wollte, dass sich Legal gut fühlte wegen der Taktik, die er sich für mich ausgedacht hatte.
Weil ich gerade stand, nahm ich die Ersatzblutkapsel aus dem Aktenkoffer und warf sie in den Sondermüllbehälter des Zimmers. Ich würde sie nicht mehr brauchen und wollte nicht riskieren, dass sie aufplatzte und meine Unterlagen versaute.
Mein Handy begann zu summen, und ich zog es aus der Tasche. Es war meine Sekretärin Lorna Taylor, aber ich ging nicht dran. Ich würde sie nach meinem Besuch bei Legal zurückrufen.
»Was hast du zurzeit sonst noch laufen?«, fragte Legal.
Ich breitete die Hände aus.
»Im Moment steht kein Prozess an. Deshalb habe ich wahrscheinlich den Rest der Woche frei. Vielleicht gehe ich morgen zu den Anklageerhebungen im Arraignment Court und sehe, ob ich den einen oder anderen Mandanten an Land ziehen kann. Ich könnte wieder Arbeit brauchen.«
Nicht nur wegen des Honorars. Die Arbeit beschäftigte mich auch und hielt mich davon ab, über die Dinge nachzudenken, die in meinem Leben schiefliefen. So gesehen, war die Juristerei mehr geworden als Beruf und Berufung. Sie half mir, mein seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Wenn ich im Gericht in Downtown im Sitzungssaal 130 vorbeischaute, wo die Anklageerhebungen des Arraignment Court stattfanden, konnte ich vielleicht ein paar Mandanten akquirieren, die von den Pflichtverteidigern wegen eines Interessenkonflikts abgelehnt wurden. Eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren mit mehreren Angeklagten, durfte der Pflichtverteidiger nur einen der Angeklagten vertreten, die übrigen brauchten einen eigenen Anwalt. Hatten diese anderen Angeklagten keinen privaten Strafverteidiger, wies ihnen der Richter einen solchen zu. Wenn ich dann Däumchen drehend im Gerichtssaal herumsaß, konnte ich relativ einfach ein Mandat an Land ziehen. Bezahlt wurde ich dafür zwar nur nach behördlichem Tarif, aber besser als keine Arbeit und keine Bezahlung war es allemal.
»Und das vor dem Hintergrund«, sagte Legal, »dass du letzten Herbst in den Umfragen fünf Prozent zugelegt hast. Und jetzt sitzt du bei Anklageerhebungen herum und hoffst, dass das eine oder andere Mandat für dich abfällt.«
Mit zunehmendem Alter waren Legal die meisten sozialen Filter abhandengekommen, die normalerweise den höflichen Umgang mit anderen Menschen regelten.
»Vielen Dank, Legal«, sagte ich. »Auf deine ehrliche und zutreffende Einschätzung meines Platzes im Leben ist einfach immer Verlass. Richtig aufbauend.«
In einer Geste, die vermutlich als Entschuldigung gelten sollte, hob Legal Siegel seine knochigen Hände.
»Ich sage ja nur.«
»Klar.«
»Und was ist jetzt mit deiner Tochter?«
Das war, wie Legals Verstand funktionierte. Manchmal wusste er nicht mehr, was er zum Frühstück gegessen hatte, aber dass ich im vergangenen Jahr mehr als nur die Wahl verloren hatte, schien ihm immer gegenwärtig zu sein. Der Skandal hatte mich nicht nur die Liebe meiner Tochter und jeden Kontakt mit ihr gekostet, sondern auch alle Chancen, meine zerbrochene Familie wieder zu kitten.
»Was das angeht, ist alles beim Alten«, sagte ich. »Aber können wir dieses Thema heute vielleicht ausklammern?«
Ich spürte, wie das Handy in meiner Tasche zu vibrieren begann, und holte es wieder heraus, um nach der eingegangenen SMS zu sehen. Sie war von Lorna. Sie ging davon aus, dass ich im Moment keine Anrufe entgegennehmen und die Mailbox nicht abhören konnte. Eine SMS war etwas anderes.
Ruf schnellstens an – 187
Der Hinweis auf den kalifornischen Strafgesetzparagrafen für Mord ließ mich aufmerken. Es wurde Zeit zu gehen.
»Ich komme doch nur deshalb auf sie zu sprechen, Mickey, weil du es nicht tust.«
»Ich will aber nicht über sie reden. Es ist zu schmerzhaft, Legal. Ich besaufe mich jeden Freitagabend, damit ich fast den ganzen Samstag schlafe. Und weißt du, warum?«
»Nein, ich weiß nicht, warum du dich besaufen solltest. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast nur deinen Job gemacht bei diesem Galloway oder wie der Typ hieß.«
»Ich besaufe mich freitagabends immer, damit ich die Samstage nicht mitbekomme. Die Samstage habe ich nämlich immer mit meiner Tochter verbracht. Er hieß übrigens Gallagher, Sean Gallagher, und es tut nichts zur Sache, dass ich nur meinen Job gemacht habe. Es sind Menschen gestorben, Legal, und das geht auf meine Kappe. Man kann sich nicht darauf hinausreden, dass man seinen Job gemacht hat, wenn auf einer Kreuzung zwei Menschen von dem Kerl totgefahren werden, den man vor Gericht rausgehauen hat. Aber wie auch immer, ich muss jetzt los.«
Ich stand auf und deutete auf das Handy, als wäre es der Grund, dass ich gehen musste.
»Also hör mal. Du lässt dich einen Monat lang nicht blicken, und dann machst du dich schon wieder aus dem Staub? Ich bin noch nicht mal mit meinem Sandwich fertig.«
»Ich war erst letzten Dienstag hier, Legal. Und ich komme irgendwann nächste Woche wieder vorbei. Wenn nicht nächste Woche, dann die Woche drauf. Lass dich nicht unterkriegen und halt dich gut fest.«
»Gut festhalten soll ich mich? Was soll das bitte heißen?«
»Es heißt, dass du dich an das klammern sollst, was du hast. Das hat mir mein Halbbruder, der Cop, mal gesagt. Iss dein Sandwich auf, bevor sie kommen und es dir wegnehmen.«
Ich ging zur Tür.
»Nicht so schnell, Micky Maus.«
Ich drehte mich zu ihm um. Das war der Name, den ich von ihm bekommen hatte, als ich ein Baby mit einem Geburtsgewicht von vier Pfund war. Normalerweise hätte ich ihm gesagt, dass er mich nicht mehr so nennen soll. Aber um endlich gehen zu können, sah ich darüber hinweg.
»Ja, was?«
»Dein Vater hat die Geschworenen immer die Götter der Schuld genannt. Weißt du noch?«
»Klar. Weil sie entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht. Was willst du damit sagen, Legal?«
»Damit will ich sagen, dass es jede Menge Leute gibt, die jeden Tag unseres Lebens wegen allem, was wir tun, über uns urteilen. Es gibt also, weiß Gott, genügend Götter der Schuld. Denen muss man nicht noch zusätzlich welche hinzufügen.«
Ich nickte, konnte mir aber eine Antwort nicht verkneifen.
»Sandy Patterson und ihre Tochter Katie.«
Legal sah mich verständnislos an. Die Namen sagten ihm nichts. Dagegen würde ich sie nie vergessen.
»Die Mutter und ihre Tochter, die Gallagher totgefahren hat. Sie sind meine Götter der Schuld.«
Ich schloss die Tür hinter mir und ließ das NICHT-STÖREN-Schild am Türgriff hängen. Vielleicht schaffte er es, das Sandwich aufzuessen, bevor die Schwestern nach ihm schauten und unser Delikt entdeckten.
3
Zurück im Lincoln, rief ich Lorna Taylor an, und statteiner Begrüßung sagte sie die Worte, die mir immer ein zweischneidiges Schwert in den Bauch rammten. Worte, die mich gleichzeitig erregten und abstießen.
»Mickey, du kannst einen Mordfall haben, wenn du willst.«
Der Gedanke an einen Mordfall kann einen aus vielen Gründen unter Hochspannung setzen. Zuerst und vor allen Dingen ist ein Mord das schlimmste Verbrechen, das es gibt, und mit entsprechend hohen Risiken geht ein solcher Fall für einen Anwalt einher. Um einen Mordverdächtigen zu verteidigen, muss man zu den Besten seines Fachs zählen. Um einen Mordfall zu bekommen, muss einem ein gewisser Ruf vorauseilen, der einen als einen der Besten seines Fachs ausweist. Und zu alldem kommt natürlich noch das Geld. Ein Mordfall – egal, ob er vor Gericht kommt oder nicht – ist eine kostspielige Angelegenheit, weil er so zeitaufwendig ist. Bekommt man einen Mordfall mit einem zahlungsfähigen Mandanten, hat man wahrscheinlich für das laufende Jahr ausgesorgt.
Die Kehrseite ist der Mandant. Obwohl ich keinerlei Zweifel habe, dass manchmal auch Unschuldige eines Mordes angeklagt werden, liegen Polizei und Staatsanwaltschaft in den meisten Fällen richtig, und man darf sich als Verteidiger lediglich damit herumschlagen, über Länge und Bedingungen der Haft zu verhandeln. Dabei sitzt man die ganze Zeit neben einem Menschen, der einen anderen um sein Leben gebracht hat. Das ist nie eine angenehme Erfahrung.
»Und die näheren Einzelheiten?«, fragte ich.
Ich saß auf dem Rücksitz des Town Car und hatte einen Notizblock auf dem Klapptischchen bereitliegen. Earl nahm die Third Street, die vom Fairfax District schnurgerade nach Downtown führte.
»Es war ein R-Gespräch aus dem Men’s Central, von einem Andre La Cosse. Ich habe es entgegengenommen. Er hat gesagt, er sei gestern Abend wegen Mordes verhaftet worden, und möchte dich als Verteidiger. Und jetzt halt dich fest: Als ich wissen wollte, wie er auf dich gekommen ist, hat er gesagt, du seist ihm von der Frau empfohlen worden, die umgebracht zu haben er beschuldigt wird. Er meinte, sie habe ihm gesagt, du seist der Beste.«
»Und wer ist diese Frau?«
»Das ist ja das Verrückte. Er hat gesagt, sie heiße Giselle Dallinger. Ich habe sie in unser Konflikt-Programm eingegeben, aber ihr Name ist nicht aufgetaucht. Du hast sie nie vertreten, deshalb kann ich mir nicht erklären, wie sie an deinen Namen gekommen ist und dich diesem Typen empfohlen haben soll, bevor sie angeblich von ihm umgebracht worden ist.«
Das Konflikt-Programm war eine Software, in der alle unsere Fallunterlagen gespeichert waren. Es ermöglichte uns, binnen weniger Sekunden festzustellen, ob ein angehender Mandant jemals als Zeuge, Opfer oder sogar Mandant an einem früheren Verfahren beteiligt war. Denn nach über zwanzig Jahren in diesem Geschäft konnte ich mich nicht mehr an jeden Mandanten erinnern, von den Nebenfiguren in diesen Strafsachen erst gar nicht zu reden. Das Konflikt-Programm ersparte uns sehr viel Zeit. Früher war es immer wieder vorgekommen, dass ich mich in einen Fall eingearbeitet hatte, um irgendwann festzustellen, dass wegen eines alten Mandanten, Zeugen oder Opfers ein Interessenkonflikt entstand, wenn ich den neuen Mandanten vor Gericht vertrat.
Ich schaute auf meinen Notizblock. Bisher hatte ich mir nur die Namen aufgeschrieben, sonst nichts.
»Na schön, wer ist für den Fall zuständig?«
»Das Morddezernat des LAPD West Bureau.«
»Wissen wir sonst noch was über die Sache? Was hat dieser Typ sonst noch gesagt?«
»Dass er morgen früh seinen ersten Gerichtstermin hat und möchte, dass du dabei bist. Er behauptet, der Mord sei ihm angehängt worden, und er habe sie nicht umgebracht.«
»War sie seine Frau, Freundin oder Geschäftspartnerin oder was?«
»Er sagt, sie habe für ihn gearbeitet, aber das ist alles. Ich weiß, du magst es nicht, wenn deine Mandanten am Gefängnistelefon zu viel reden. Deshalb habe ich ihm keine weiteren Fragen gestellt.«
»Vollkommen richtig, Lorna.«
»Wo bist du übrigens gerade?«
»Ich war Legal besuchen, und jetzt fahre ich in die Stadt zurück. Mal sehen, ob sie mich zu dem Typen vorlassen, dann kann ich mir schon mal einen ersten Eindruck von ihm verschaffen. Versuchst du bitte, Cisco zu erreichen, damit er mit den ersten Recherchen beginnt?«
»Tut er bereits. Ich höre ihn gerade mit jemandem telefonieren.«
Cisco Wojciechowski war mein Ermittler. Außerdem war er Lornas Ehemann, und sie operierten von ihrer Eigentumswohnung in West Hollywood aus. Außerdem war ich mal mit Lorna verheiratet. Sie war meine zweite Ehefrau gewesen, nach der Mutter meines einzigen Kinds – einer Tochter, die inzwischen sechzehn Jahre alt war und nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Manchmal glaubte ich, ein Whiteboard mit einem Flussdiagramm zu brauchen, um alle Menschen in meinem Umfeld und ihre Beziehungen untereinander auf die Reihe zu kriegen. Aber wenigstens gab es zwischen mir, Lorna und Cisco keine Eifersüchteleien, nur ein stabiles Arbeitsverhältnis.
»Okay, dann sag ihm, er soll mich anrufen. Oder ich rufe ihn an, sobald ich im Gefängnis war.«
»Alles klar. Viel Erfolg.«
»Noch ein Letztes. Ist La Cosse ein zahlungsfähiger Mandant?«
»Auf jeden Fall. Er sagt, er habe zwar kein Geld, aber Gold und andere ›Wirtschaftsgüter‹, die er verkaufen kann.«
»Hast du ihm schon irgendwelche Zahlen genannt?«
»Ja, dass du erst mal fünfundzwanzigtausend Vorschuss möchtest, damit ihr ins Geschäft kommt, und später mehr. Es hat ihm nicht groß die Sprache verschlagen oder was.«
Die Angeklagten, die sich einen Fünfundzwanzigtausend-Dollar-Vorschuss nicht nur leisten konnten, sondern auch bereit waren, ihn zu zahlen, waren äußerst dünn gesät. Ich wusste zwar nichts über diesen Fall, aber die Sache hörte sich immer besser an.
»Okay, ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.«
»Ciao.«
Die Vorfreude bekam bereits erste Dellen, bevor ich meinen neuen Mandanten überhaupt zu Gesicht bekam. Ich hatte in der Gefängnisverwaltung ein Mandatierungsschreiben ausgefüllt und wartete gerade darauf, dass die Deputys La Cosse ausfindig machten und in ein Besprechungszimmer brachten, als Cisco anrief und mir erzählte, was er in der Stunde, seit wir den Fall bekommen hatten, aus menschlichen und digitalen Quellen in Erfahrung hatte bringen können.
»Zunächst zwei Dinge. Das LAPD hat gestern zwar eine Presseerklärung zu dem Mord herausgegeben, aber über die Festnahme gibt es bisher noch nichts. Giselle Dallinger, sechsunddreißig Jahre alt, wurde am frühen Montagmorgen in ihrer Wohnung in der Franklin, westlich der La Brea, gefunden. Entdeckt wurde sie von Feuerwehrmännern, die verständigt wurden, weil in ihrer Wohnung ein Brand ausgebrochen war. Die Leiche war verbrannt, und das Feuer wurde vermutlich gelegt, um den Mord zu vertuschen und einen Unfall vorzutäuschen. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus, aber in der Presseerklärung ist die Rede von Hinweisen, dass sie stranguliert wurde. Laut Presseerklärung war sie Geschäftsfrau, aber in einer kurzen Meldung auf der Times-Website werden Polizeiquellen zitiert, denen zufolge sie eine Nutte war.«
»Na super. Und wer ist dann mein Typ, ein Freier?«
»In der Times-Meldung heißt es, die Polizei habe einen Geschäftspartner vernommen. Ob das La Cosse war, geht daraus nicht hervor, aber wenn du zwei und zwei zusammenzählst …«
»Kommt ein Zuhälter heraus.«
»Ganz so hört es sich jedenfalls an.«
»Super. Ein richtig sympathischer Typ also.«
»Sieh’s doch von der positiven Seite. Lorna meint, er kann zahlen.«
»Das glaube ich erst, wenn ich das Geld in der Tasche habe.«
Plötzlich musste ich an meine Tochter Hayley und eins der letzten Dinge denken, die sie zu mir gesagt hatte, bevor sie den Kontakt zu mir abgebrochen hatte. Sie bezeichnete meine Mandanten als Abschaum, lauter Leute, die nur an sich dachten und andere ausnutzten und sogar umbrachten. Im Moment hätte ich dem nichts entgegenzusetzen gehabt. Auf meiner Mandantenliste waren der Carjacker, der es auf alte Frauen abgesehen hatte, ein Mann, der mit einer Frau ausgegangen war und sie anschließend vergewaltigt hatte, ein Betrüger, der Geld von einem studentischen Reisefonds unterschlagen hatte, und eine Reihe anderer Schmarotzer. Jetzt würde ich dieser Liste wahrscheinlich noch einen mutmaßlichen Mörder hinzufügen – oder noch besser: einen mutmaßlichen Mörder aus dem Rotlichtmilieu.
Ich gewann den Eindruck, dass ich diese Leute genauso sehr verdiente wie sie mich. Wir waren alle Problemfälle und Verlierer, die Sorte Menschen, denen die Götter der Schuld kein Lächeln schenkten.
Meine Tochter hatte die zwei Menschen gekannt, die mein Mandant Sean Gallagher auf dem Gewissen hatte. Katie Patterson war eine Klassenkameradin gewesen, ihre Mutter Elternsprecherin. Hayley hatte die Schule wechseln müssen, um dem gegen sie gerichteten Zorn zu entgehen, als von den Medien – und damit meine ich: von allen Medien – enthüllt wurde, dass J. Michael Haller jr., Bewerber um das Amt des District Attorney von Los Angeles County, infolge eines Formfehlers Gallaghers Freispruch von einer Anklage wegen Alkohols am Steuer erwirkt hatte.
Im Endeffekt hieß das, dass sich Gallagher dank meiner sogenannten Fähigkeiten als Strafverteidiger betrinken und in ein Auto hatte setzen können, und sosehr Legal Siegel auch mit seiner »Du hast nur deinen Job gemacht«-Leier mein Gewissen zu beruhigen versuchte, wusste ich in den dunklen Abgründen meiner Seele, dass das Urteil »schuldig« lautete. Schuldig in den Augen meiner Tochter, schuldig auch in meinen eigenen.
»Bist du noch dran, Mick?«
Ich riss mich von meinen düsteren Gedanken los und merkte, dass ich immer noch Cisco am Telefon hatte.
»Ja. Weißt du, wer für den Fall zuständig ist?«
»Laut Presseerklärung ist der leitende Ermittler Detective Mark Whitten vom West Bureau. Von seinem Partner steht dort nichts.«
Ich kannte Whitten nicht, und soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich vor Gericht nie mit ihm zu tun gehabt.
»Okay. Sonst noch was?«
»Im Moment ist das alles, was ich habe, aber ich bleibe am Ball.«
Ciscos Auskünfte hatten meine Begeisterung gedämpft. Aber noch wollte ich den Fall nicht abschreiben. Schlechtes Gewissen hin oder her, Honorar war Honorar. Ich brauchte die Kohle, um Michael Haller & Associates finanziell über Wasser zu halten.
»Ich rufe dich wieder an, sobald ich mit dem Kerl gesprochen habe, was gleich der Fall sein wird.«
Ein Deputy deutete auf eins der Besprechungsabteile für Anwälte. Ich stand auf und ging hinein.
Andre La Cosse saß bereits auf einem Stuhl auf der anderen Seite des Tischs mit einer einen Meter hohen Plexiglasscheibe in der Mitte. Die meisten Mandanten, die ich in Men’s Central aufsuche, nehmen ihren Gefängnisaufenthalt eher auf die wurstig-lockere Art. Das ist eine Schutzmaßnahme. Zeigt man sich unbeeindruckt, mit tausendzweihundert anderen Gewaltverbrechern in einen Stahlbau eingesperrt zu sein, wird man vielleicht in Ruhe gelassen. Zeigt man dagegen Angst, sehen es die Brutalos und machen es sich zunutze. Dann machen sie einem das Leben schwer.
Aber La Cosse war anders. Zuallererst war er kleiner, als ich erwartet hatte. Er war schmächtig und sah aus, als hätte er nie eine Hantel in der Hand gehabt. Er trug den üblichen weiten orangefarbenen Gefängnisoverall, legte aber ein Selbstbewusstsein an den Tag, das seine Lage Lügen strafte. Er zeigte keine Angst, aber auch nicht die übertriebene Lässigkeit, der ich an Orten wie diesem so oft begegnet bin. Er saß kerzengerade auf der Kante seines Stuhls, und seine Augen folgten mir wie Laser, als ich das kleine Abteil betrat. Seine Art, sich zu halten, hatte etwas Förmliches. Sein Haar war an den Seiten sorgfältig gestuft, und es sah so aus, als hätte er Eyeliner aufgetragen.
»Andre?«, sagte ich, als ich mich setzte. »Ich bin Michael Haller. Sie haben in meiner Kanzlei angerufen, dass ich Sie vertreten soll.«
»Ja, habe ich. Ich bin zu Unrecht hier. Jemand hat sie umgebracht, nachdem ich bei ihr gewesen bin, aber niemand glaubt mir.«
»Augenblick bitte. Ich bin gleich so weit.«
Ich nahm einen Notizblock aus meinem Aktenkoffer und einen Stift aus meiner Hemdtasche.
»Dürfte ich Ihnen zuerst ein paar Fragen stellen, bevor wir über Ihren Fall sprechen?«
»Selbstverständlich.«
»Damit gleich von Anfang an eines klar ist, Andre. Sie dürfen mich nie belügen. Haben Sie verstanden? Wenn Sie lügen, bin ich sofort weg – das ist Regel Nummer eins. Ich kann nicht für Sie arbeiten, wenn wir kein Verhältnis haben, in dem ich davon ausgehen kann, dass Sie mir nichts als die reine Wahrheit erzählen.«
»Klar, kein Problem. Die Wahrheit ist das Einzige, was ich im Moment auf meiner Seite habe.«
Ich hakte eine Liste grundlegender Fragen ab und erstellte für die Akten eine kurze Biographie. La Cosse war zweiunddreißig Jahre alt und ledig und wohnte in einer Eigentumswohnung in West Hollywood. Er hatte keine Verwandten in Los Angeles und Umgebung, und seine Eltern lebten in Lincoln, Nebraska. Er sagte, er sei weder in Kalifornien noch in Nebraska noch sonst irgendwo vorbestraft und habe sich nicht einmal eine Geschwindigkeitsüberschreitung zuschulden kommen lassen. Er gab mir die Telefonnummer seiner Eltern, die Nummer seines Handys und die seines Festnetzanschlusses – sie sollten mir ermöglichen, ihn aufzuspüren, falls er aus dem Gefängnis entlassen wurde und unseren Honorarvereinbarungen nicht nachkam. Sobald ich mir das alles notiert hatte, blickte ich von meinem Block auf.
»Was machen Sie beruflich, Andre?«
»Ich arbeite zu Hause. Ich bin Programmierer. Ich entwerfe und verwalte Websites.«
»Woher kannten Sie das Opfer in diesem Verfahren, Giselle Dallinger?«
»Ich habe die ganzen Social-Media-Sachen für sie betreut. Ihre Websites, Facebook, E-Mail und so weiter.«
»Sie sind also eine Art digitaler Zuhälter?«
La Cosses Hals verfärbte sich sofort puterrot.
»Auf gar keinen Fall! Ich bin Geschäftsmann, und sie ist – war – Geschäftsfrau. Und ich habe sie nicht umgebracht. Aber das will mir hier niemand glauben.«
Ich machte mit meiner freien Hand eine beruhigende Geste.
»Nur keine Aufregung. Denken Sie immer dran, ich stehe auf Ihrer Seite.«
»So hört sich das aber nicht an, wenn Sie so eine Frage stellen.«
»Sind Sie schwul, Andre?«
»Was soll das damit zu tun haben?«
»Vielleicht nichts, vielleicht aber auch sehr viel, wenn der Ankläger auf ein Motiv zu sprechen kommt. Sind Sie es?«
»Ja, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Ich verheimliche es nicht.«
»Na ja, hier drinnen sollten Sie das aber lieber, um Ihrer Sicherheit willen. Ich kann Sie morgen nach der Anklageerhebung auch in einen Homosexuellenblock verlegen lassen.«
»Mischen Sie sich da bitte nicht ein. Ich möchte nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden.«
»Ganz wie Sie meinen. Wie hieß Giselles Website?«
»Giselle-for-you-dot-com. Das war die Hauptseite.«
Ich notierte es mir.
»Hatte sie auch andere?«
»Sie hatte Seiten, die auf spezielle Bedürfnisse zugeschnitten waren. Auf sie wurde man weitergeleitet, wenn man bestimmte Wörter oder Suchbegriffe eingab. Das ist, was ich anbiete – eine plattformübergreifende Präsenz. Aus diesem Grund ist sie zu mir gekommen.«
Ich nickte, als bewunderte ich seine Kreativität und Geschäftstüchtigkeit.
»Und seit wann bestand Ihr Geschäftsverhältnis?«
»Sie kam vor etwa zwei Jahren zu mir. Sie wollte eine mehrdimensionale Onlinepräsenz.«
»Sie ist zu Ihnen gekommen? Was heißt das? Wie ist sie zu Ihnen gekommen? Annoncieren Sie online, oder wie muss man sich das vorstellen?«
Er schüttelte den Kopf, als hätte er es mit einem Kind zu tun.
»Doch keine Annoncen. Ich arbeite nur mit Leuten, die von jemandem, den ich bereits kenne und dem ich vertraue, an mich verwiesen werden. Sie wurde von einer anderen Kundin an mich weiterempfohlen.«
»Wer war diese Kundin?«
»Das muss ich vertraulich behandeln. Ich möchte nicht, dass sie in diese Sache hineingezogen wird. Sie weiß nichts darüber und hat nichts damit zu tun.«
Jetzt schüttelte ich den Kopf, als hätte ich es mit einem Kind zu tun.
»Vorerst will ich das mal auf sich beruhen lassen, Andre. Aber wenn ich diesen Fall übernehme, wird irgendwann der Punkt kommen, an dem ich wissen muss, wer sie Ihnen empfohlen hat. Und dann werden nicht Sie derjenige sein, der entscheidet, ob jemand oder etwas für den Fall wichtig ist. Das entscheide ich. Ist das klar?«
Er nickte.
»Ich werde mich mit ihr in Verbindung setzen«, sagte er. »Sobald ich ihr Okay habe, werde ich den Kontakt zwischen Ihnen herstellen. Aber ich lüge nicht und ich missbrauche das in mich gesetzte Vertrauen nicht. Meine Firma und mein Leben basieren auf Vertrauen.«
»Gut.«
»Was meinen Sie übrigens mit ›Wenn ich den Fall übernehme‹. Haben Sie ihn denn nicht schon übernommen? Sie sind doch hier, oder nicht?«
»Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden.«
Ich sah auf die Uhr. Der Sergeant, bei dem ich mich gemeldet hatte, hatte gesagt, ich bekäme nur eine halbe Stunde mit La Cosse. Es gab noch drei Punkte zu klären – das Opfer, die Tat und mein Honorar.
»Wir haben nicht viel Zeit. Deshalb lassen Sie uns zum nächsten Punkt kommen. Wann haben Sie Giselle Dallinger zum letzten Mal persönlich gesehen?«
»Sonntagnacht – und als ich gegangen bin, war sie noch am Leben.«
»Wo?«
»In ihrer Wohnung.«
»Weshalb waren Sie dort?«
»Ich wollte Geld von ihr holen, habe aber keins bekommen.«
»Was war das für Geld, und warum haben Sie es nicht bekommen?«
»Sie war zu einem Job gefahren, und wir hatten vereinbart, dass ich einen prozentuellen Anteil von ihren Einkünften bekomme. Ich hatte ein Pretty Woman Special für sie arrangiert und wollte meinen Anteil – diese Mädchen, wenn man sich sein Geld nicht sofort holt, verschwindet es bei ihnen schnell durch ihre Nasen oder anderswo.«
Ich schrieb eine kurze Zusammenfassung dessen, was er gerade gesagt hatte, auch wenn mir bei vielem davon nicht klar war, was es bedeutete.
»Heißt das, Giselle hat Drogen genommen?«
»Das könnte man so sagen, ja. Nicht viel, aber das gehört zu diesem Job und diesem Leben.«
»Das müssen Sie mir genauer erklären. Ein Pretty Woman Special, was ist das?«
»Der Kunde nimmt sich wie in dem Film Pretty Woman eine Suite im Beverly Wilshire. Giz hat auf Julia Roberts gemacht, verstehen Sie? Vor allem nachdem ich ihre Fotos mit Photoshop bearbeitet hatte. Mehr brauche ich Ihnen dazu wahrscheinlich nicht mehr zu erklären.«
Ich hatte den Film nie gesehen, aber ich wusste, er handelte von einer Prostituierten, die das Herz am rechten Fleck hatte und bei einem bezahlten Treffen im Beverly Wilshire den Mann ihrer Träume kennenlernte.
»Wie viel hat sie dafür genommen?«
»Üblich waren zweitausendfünfhundert.«
»Und Ihr Anteil?«
»Tausend. Aber ich bekam nichts. Sie sagte, es sei ein toter Stich gewesen.«
»Was ist das?«
»Sie fährt ins Hotel, aber es ist niemand da, oder der Betreffende behauptet, er wisse von nichts. Ich versuche, das zu überprüfen und herauszubekommen, ob das stimmt.«
»Sie haben ihr also nicht geglaubt.«
»Sagen wir so, ich war misstrauisch. Ich habe mit dem Mann in diesem Zimmer gesprochen. Ich habe ihn über die Telefonzentrale des Hotels angerufen. Aber sie hat behauptet, es sei niemand da gewesen und das Zimmer sei gar nicht belegt gewesen.«
»Es kam deswegen also zum Streit zwischen Ihnen?«
»Na ja, ein bisschen.«
»Und Sie haben sie geschlagen.«
»Was? Nein! Ich habe noch nie eine Frau geschlagen. Auch einen Mann habe ich noch nie geschlagen! Das habe ich nicht getan. Können Sie nicht …«
»Schauen Sie, Andre, ich sammle hier nur Informationen. Sie haben sie also nicht geschlagen oder verletzt. Haben Sie sie irgendwo körperlich berührt?«
La Cosse zögerte, und das verriet mir, dass es ein Problem gab.
»Rücken Sie schon raus damit, Andre.«
»Na ja, ich habe sie gepackt. Sie hat mich nicht angesehen, und deshalb glaubte ich, sie log. Deshalb habe ich sie am Hals gepackt – nur mit einer Hand. Sie wurde sauer, und ich wurde sauer, und damit hatte es sich. Danach bin ich gegangen.«
»Sonst nichts?«
»Ja, das war alles. Das heißt, auf der Straße, als ich zu meinem Auto gegangen bin, da hat sie mir vom Balkon einen Aschenbecher hinterhergeworfen – aber nicht getroffen.«
»Und wie sind Sie miteinander verblieben, als Sie ihre Wohnung verlassen haben?«
»Ich habe ihr gesagt, ich würde ins Hotel fahren und selbst mit diesem Kerl reden und mir das Geld holen. Und damit bin ich gegangen.«
»In welchem Zimmer war dieser Mann, und wie hieß er?«
»Er hatte Suite acht-siebenunddreißig und hieß Daniel Price.«
»Sind Sie ins Hotel gefahren?«
»Nein, ich bin nach Hause gefahren. Ich fand, es wäre die Mühe nicht wert.«
»Als Sie sie am Hals gepackt haben, fanden Sie es aber schon der Mühe wert.«
La Cosse nickte angesichts der Widersprüchlichkeit, gab mir aber keine weitere Erklärung. Ich hakte diesen Punkt ab – vorerst.
»Okay, was ist dann passiert? Wann ist die Polizei zu Ihnen gekommen?«
»Gestern gegen fünf.«
»Morgens oder abends?«
»Abends.«
»Haben sie gesagt, wie sie auf Sie gekommen sind?«
»Sie wussten von Giz’ Website. Und die hat sie zu mir geführt. Sie sagten, sie hätten ein paar Fragen, und ich habe mich bereit erklärt, mit ihnen zu sprechen.«
Es war immer ein Fehler, freiwillig mit der Polizei zu reden.
»Erinnern Sie sich, wie die Polizisten hießen?«
»Da war ein Detective Whitten, das Reden hat hauptsächlich er übernommen. Sein Partner hieß Weeder oder so ähnlich.«
»Warum haben Sie sich bereit erklärt, mit ihnen zu reden?«
»Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich nichts Unrechtes getan hatte und helfen wollte? Dummerweise dachte ich, sie versuchten herauszufinden, was mit der armen Giselle passiert war, und nicht, dass sie bereits eine feste Vorstellung hatten, was passiert war, und mich lediglich in ihr Schema pressen wollten.«
Willkommen in meiner Welt, dachte ich.
»Wussten Sie schon, bevor die Polizei zu Ihnen gekommen ist, dass sie tot war?«
»Nein, ich hatte sie den ganzen Tag anzurufen versucht und ihr SMS und Mails geschickt. Mir tat mein Wutausbruch vom Abend zuvor leid. Aber sie rief nicht zurück, und ich dachte, sie sei noch wegen unseres Streits wütend. Dann kamen die zwei Polizisten und sagten, sie sei tot.«
Wird eine Prostituierte tot aufgefunden, ist eine der ersten Anlaufstellen bei den Ermittlungen verständlicherweise ihr Zuhälter, selbst wenn es ein digitaler Zuhälter ist, der nicht den typischen Vorstellungen von einem brutalen Schläger entspricht und die Frauen in seinem Stall nicht mit Drohungen und körperlicher Gewalt zum Spuren bringt.
»Haben sie das Gespräch mit Ihnen aufgezeichnet?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Haben sie Sie auf Ihr verfassungsmäßiges Recht aufmerksam gemacht, einen Anwalt dabeizuhaben?«
»Ja, aber erst später, auf dem Revier. Ich dachte nicht, dass ich einen Anwalt brauchen würde. Ich hatte nichts Unrechtes getan. Deshalb sagte ich: Schön, reden wir.«
»Haben Sie eine Verzichtserklärung unterschrieben?«
»Ja, ich habe etwas unterschrieben – aber ohne es wirklich zu lesen.«
Ich schluckte mein Missfallen hinunter. Die meisten Leute, die in die Mühlen der Strafjustiz geraten, werden irgendwann zu ihren schlimmsten eigenen Feinden. Sie reden sich buchstäblich selbst in ihre Handschellen.
»Schildern Sie mir noch mal den ganzen Ablauf. Zuerst haben Sie zu Hause mit ihnen gesprochen, und dann wurden Sie ins West Bureau gebracht?«
»Ja. Zuerst waren wir etwa eine Viertelstunde bei mir zu Hause, und dann haben sie mich auf die Wache mitgenommen. Sie haben gesagt, sie hätten gern, dass ich mir dort ein paar Fotos von Verdächtigen ansehe, aber das war nur ein Vorwand. Sie haben mir nie irgendwelche Fotos gezeigt. Sie haben mich in ein kleines Vernehmungszimmer gesteckt und mir ständig weiter Fragen gestellt. Dann haben sie mir erklärt, ich sei verhaftet.«
Ich wusste, für eine Festnahme musste die Polizei konkrete Beweise oder belastende Aussagen von Augenzeugen haben, die La Cosse irgendwie mit dem Mord in Verbindung brachten. Außerdem war dafür erforderlich, dass irgendetwas, was er ihnen erzählt hatte, nicht mit der Faktenlage übereinstimmte. Sobald er die Unwahrheit sagte oder sie Grund zu der Annahme hatten, dass er die Unwahrheit sagte, konnte er verhaftet werden.
»Okay, und Sie haben ihnen erzählt, dass Sie Sonntagnacht in der Wohnung des Opfers waren?«
»Ja, und ich habe ihnen gesagt, dass sie noch am Leben war, als ich gegangen bin.«
»Haben Sie ihnen auch erzählt, dass Sie sie am Hals gepackt haben?«
»Ja.«
»War das, bevor oder nachdem sie Sie auf Ihre Rechte aufmerksam gemacht haben und Sie die Verzichtserklärung haben unterschreiben lassen?«
»Hm. Das weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen, davor.«
»Das macht nichts. Ich werde es herausfinden. Haben sie über irgendwelche andere Beweise gesprochen oder Sie mit sonst etwas konfrontiert, was sie gegen Sie vorliegen hatten?«
»Nein.«
Ich sah erneut auf die Uhr. Mir lief die Zeit davon. Ich beschloss, die Befragung zu der Strafsache zu beenden. Den größten Teil der Informationen würde ich bei der Akteneinsicht erhalten, wenn ich den Fall übernahm. Außerdem ist man immer gut beraten, den Umfang der Auskünfte, die man direkt von seinem Mandanten erhält, zu begrenzen. Erfuhr ich nämlich zu viel von La Cosse, konnte sich das ungünstig auf mein weiteres Vorgehen in diesem Strafverfahren auswirken. Erzählte er mir zum Beispiel, dass er Giselle tatsächlich umgebracht hatte, war es mir nicht mehr möglich, ihn in den Zeugenstand zu rufen und dies leugnen zu lassen, weil ich mich damit der Anstiftung zum Meineid schuldig machte.
»Okay, das genügt fürs Erste. Wie werden Sie mich bezahlen, wenn ich den Fall übernehme?«
»In Gold.«
»Das weiß ich bereits, aber ich meine, wie? Woher kommt dieses Gold?«