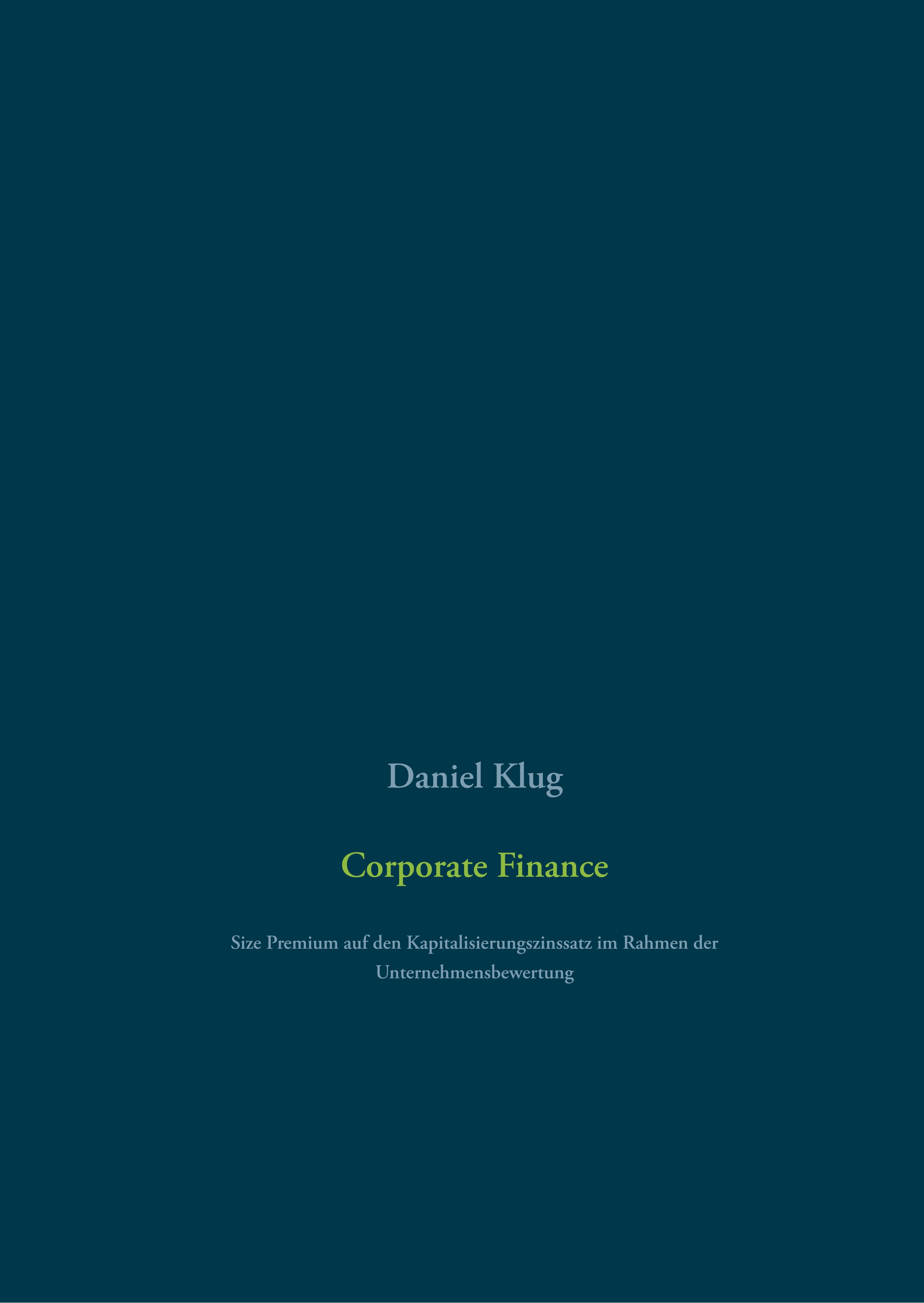14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Deutschland wurde in den 1960er häufig über das Erreichen der Vollbeschäftigung und die Sicherstellung von kontinuierlichem Wirtschaftswachstum durch eine antizyklische Fiskalpolitik mittels Ausgleiches konjunktureller Schwankungen ohne eine Inflationsherbeiführung diskutiert. Voraussetzung dafür ist, dass diese Fiskalpolitik in enger Verbindung mit einer optimalen Geldpolitik steht. Die Ergebnisse herzu sind im Stabilitätsgesetz verankert . Da es im Laufe der Zeit zu zahlreichen Versäumnissen kam, hat sich die staatliche Konjunkturpolitik von einem eigenständigen Handeln distanziert, was dazu führte, dass die Geldpolitik stetig an Bedeutung zunimmt. Entsprechend findet heute innerhalb der der fiskalpolitischen Steuerungsmaßnahmen das Geldmengenkonzept Anwendung. Ziel der Arbeit ist es, die Chancen und Risiken der Fiskalpolitik darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Danksagung
Ich bedanke mich bei Herrn Dr. rer. pol. Volker
Schlepütz,
für die stets gute Betreuung.
Sowie bei meiner Frau, welche meine Launen aushalten
musste.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1.1 Motivation und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
Theoretische Grundlagen
2.1 Definition Fiskalpolitik
2.2 Geldsystem
Chancen und Risiken von Fiskalpolitik
3.1 Kredite Zentralbank
3.3. Steuerfinanzierung
3.4 Transfere/Working Capital
Fazit und Prognose
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.
Tabellenverzeichnis:
Es konnten keine Einträge für ein Tabellenverzeichnis gefunden werden.
Abkürzungsverzeichnis
AT
Arbeitstage
Auto-ID
Automatische
Identifikationssysteme
AVE
Aris
Value
Engineering
Die Übrigen verwendeten Abkürzungen sind an dieser Stelle nicht aufgeführt, da sie im Alltag gebräuchlich sind sowie im Wörterbuch nachschlagbar sind (wie etwa z.B., zzgl., d.h., bzw., …).
In der vorliegenden Arbeit ist lediglich von Mitarbeitern, Kunden, Kollegen, etc. die Rede in der männlichen Form. Dies dient ausschließlich zu Zwecken der einfacheren Lesbarkeit. Stets sind beide Geschlechter gemeint.
1. Einleitung
1.1 Motivation und Zielsetzung
In Deutschland wurde in den 1960er häufig über das Erreichen der Vollbeschäftigung und die Sicherstellung von kontinuierlichem Wirtschaftswachstum durch eine antizyklische Fiskalpolitik mittels Ausgleiches konjunktureller Schwankungen ohne eine Inflationsherbeiführung diskutiert. Voraussetzung dafür ist, dass diese Fiskalpolitik in enger Verbindung mit einer optimalen Geldpolitik steht. Die Ergebnisse herzu sind im Stabilitätsgesetz verankert1.
Da es im Laufe der Zeit zu zahlreichen Versäumnissen kam, hat sich die staatliche Konjunkturpolitik von einem eigenständigen Handeln distanziert, was dazu führte, dass die Geldpolitik stetig an Bedeutung zunimmt. Entsprechend findet heute innerhalb der der fiskalpolitischen Steuerungsmaßnahmen das Geldmengenkonzept Anwendung.
Ziel der Arbeit ist es, die Chancen und Risiken der Fiskalpolitik darzustellen.
1.2 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit sollen der Begriff der Fiskalpolitik geklärt und auf die Bedeutung des Geldmengenkonzepts eingegangen werden.
Im Anschluss daran werden die Chancen und Risiken der Fiskalpolitik bezüglich der Kreditregulierung über die Zentralbanken und die Zinspolitik dargestellt. Des Weiteren soll in diesem Zusammenhang auf die Transfere, entsprechend dem Working Capital, eingegangen werden.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und eine Prognose.
1 Vgl. Menger, 1892, S. 246 f.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Definition Fiskalpolitik
Fiskalpolitik (engl.: fiscal policy) lässt sich als die Summe sämtlicher konjunktur- und stabilitätspolitischen Maßnahmen definieren, mit dem Ziel, die Vorgaben des Stabilitätsgesetzes zu erfüllen2. Diese stabilitätspolitischen Ziele beinhalten3:
Stabilität des Preisniveaus, d. h. keine signifikante De- oder Inflation
Vollbeschäftigung, d. h. eine Arbeitslosenquote je nach Region um die 3%
4
Keine signifikante Handelsüberschüsse oder Handelsdefizite (Gleichgewicht der Binnen- und Außenwirtschaft)
angemessenes Wirtschaftswachstum
Diese Ziele werden einer wirtschaftspolitischen Institution wie der Bundesbank oder Europäischen Zentralbank zugeordnet. Die Stabilität des Preisniveaus und die Versorgung mit öffentlichen Gütern wird der Fiskalpolitik zugewiesen. Die Europäische Zentralbank versteht seit der Eurokrise 2012 ein Inflationsziel von 2% als Preisniveaustabilität.5 Ein hoher Beschäftigungsgrad bedeutet, dass nur maximal ein bestimmter Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeitslos sind. Die Arbeitslosigkeit wird sowohl für die Gesellschaft als auch für Staat und Wirtschaft als eine höchst relevante ökonomische Größe verwendet. John Meynard Keynes warnte, dass an einer hohen Arbeitslosigkeit Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zerbrechen.6 Viele sozialpolitische Probleme entstehen durch eine hohe Arbeitslosigkeit, da diese beispielsweise die Sozialsysteme belasten und keine steuerlichen Einnahmequellen für die Staatskasse einbringen. Dadurch steigen die Lohnnebenkosten und es werden noch mehr Menschen entlassen. Der Prozess ist ein Teufelskreis. Die Vollbeschäftigung wird im Stabilitätsgesetz formuliert und es gibt regionale Unterschiede bezüglich der genauen prozentualen Festsetzung.
Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht zielt darauf ab, dass die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Ausland nicht durch einen zu hohen Überschuss oder Defizit belastet werden. Exportüberschüsse werden erzeugt, wenn wertmäßig mehr Güter exportiert als importiert werden (auch Handelsüberschuss genannt). Das Gegenteil ist das Handelsdefizit, wenn mehr im- als exportiert wird.7
Je nach Wirtschaftsphase werden die definierten Ziele verschieden quantitativ spezifiziert. Die Messung der Ziele und die Bestimmung der Wechselwirkungen der Einflussfaktoren stellen große Herausforderungen dar, die oft fehlerhaft modelliert und bewertet werden. Die Fehlbewertung kann unvorhergesehene Risiken beinhalten.8
Die Fiskalpolitik lässt sich in 3 Hauptaufgabenbereiche untergliedern9:
Allokative Funktion: Durch das Sicherstellen der privaten und kollektiven Befriedigung der Bedürfnisse sowie deren Gleichgewicht beinhaltet die Fiskalpolitik eine allokative Funktion um das soziale Gleichgewicht zu gewährleisten.
Stabilisatorische Funktion: Die Fiskalpolitik ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum
Distributive Funktion: Besteht in dem Ausgleichen des Markteinkommen, für den Fall, dass die Marktverteilung nicht mit dem politischen Willen übereinstimmt.
Hierbei muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die aufgeführten Funktionen und Instrumente in Wechselwirkung zueinanderstehen und aus diesem Grund ganzheitlich betrachtet werden müssen10. Infolgedessen kann die Fiskalpolitik die Nachfrage durch Veränderung der öffentlichen Ausgaben direkt beeinflussen. Beispielsweise können Infrastrukturmaßnahme wie der Bau von Brücken oder Flughäfen den Bausektor stimulieren und für eine erhöhte Nachfrage nach Baumaterial und Arbeitskräften schaffen.
2.2 Geldsystem
Im Laufe der Geschichte von Zahlungsmöglichkeiten haben sich unterschiedliche Systeme durch praktische Nachfrage und monetäre Politik entwickelt. Der initiale Bedarf für Geld, ein Medium für den Tausch, ist über den klassischen Tauschhandel entstanden.
Das Bedürfnis nach Geld entsteht durch das Problem, dass viele Güter nicht teilbar sind und das Auftreffen von Nachfrage und Angebot problematisch ist.11 Außerdem musste der Zahlungsverkehr von jemanden kontrolliert werden. Es entstand ein Wettbewerb zwischen Individuen und Gruppen, die individuelle Münzprägungen durchführten.12 Um den Wert einer Münze zu validieren, mussten Markennamen von Münzprägungen aufgebaut werden, denen Händler vertrauten. Um die Anforderungen des Vertrauens und der Vereinheitlichung zu erfüllen, wurde die Münzprägung schließlich verstaatlicht. Der Staat, der König, die Regierung standen nun für den Wert der Währung ein. Sie garantierten den Wert mit Gold und Silber, Autorität, Waffen und mit Blut.13 In der Antike bildeten sich unterschiedliche Zentralbanksysteme, die alle auf wesentliche Bestandteile wie die Emission des Geldes (Münzprägung), Qualitätskontrolle, Buchhaltung und Bürokratie zurückgriffen. In allen Teilen der Gesellschaft konnten Prozesse mittels des Geldes beziffert werden. Die ersten Münzen, die im Orient (Sumer und Elam) gefunden wurden, gehen bis in die antike Zeit 3000 Jahre v.Chr. und noch früher zurück.14 Die antiken Zivilisationen existieren auch tausende Jahre früher, sodass wahrscheinlich die Anfangszeit des Geldes noch weiter in die Vergangenheit reicht. Auf Metall basierte Münzen waren in Persien, Mesopotamien und China und später in Griechenland und Rom zu finden.15 Im späten Mittelalter entwickelten sich die ersten Banknoten (auf Papier basiertes Geld), die während der Renaissance verbreiteter wurden.16 Das moderne Banksystem fand die ersten Grundzüge während des Britischen Imperiums ab 1640, da wesentliche Regeln für die Kontrolle, des Gelddruckens, der Münzprägung, Institutionen aufgestellt wurden.17 Die technologischen Entwicklungen aus Italien, Frankreich und Großbritannien ermöglichten die Automatisierung von Prozessen und Erfindung neuer Maschinen und Geräte für die Geldherstellung.18 Auf der regulatorischen Seite entstanden neue Gesetze für den Werterhalt sowie die Stabilität des Währungssystems wie beispielsweise „The Banking Acts“ von 1826 und „The Bank Charter Act“ von 1833 und 1844, die von der Bank of England erstellt wurde, die eines der größten Wegbereiter des moderneren Bankensystems ist.19 Zahlreiche Finanzkrisen in den folgenden Jahrhunderten führten zu Änderungen und neuen Regeln, um die Stabilität von Gesellschaften zu gewährleisten. Im 20. Jahrhundert haben die Weltkriege und Wirtschaftskrisen zu neuen Goldstandards als Absicherung des Geldes geführt.20 1971 wurde die Bindung des US-amerikanischen Dollars an Gold aufgehoben und Geld ist seitdem ein nicht-dinglich, abgesicherter Schuldschein des Herausgebers (staatliche Zentralbank). Im Zuge der Computerisierung wurde das Geld digital und ist nicht mehr nur physisch, sondern auch virtuell existent.21
Die Erfüllung der Geldfunktionen in ausreichendem Grad stellt eine der Grundvoraussetzung dar, ein betreffendes Gut als Geld bezeichnen zu dürfen.
Die geläufigste Funktion stellt hierbei die Zahlungsmittelfunktion dar, welche es ermöglicht, Geld gegen jegliches andere Gut tauschen zu können22. Zudem müssen auch die Aspekte der Wertaufbewahrungsfunktion und der Recheneinheitsfunktion als erfüllt gelten.