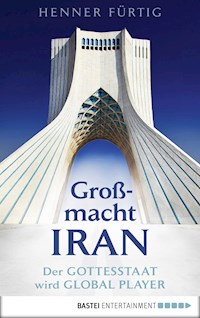
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Schlüssel für den Frieden in Europa liegt in Teheran: Ohne Iran ist weder der IS zu stoppen, die Flüchtlingswelle aufzuhalten noch der endlose Nahostkonflikt zu lösen. Schon heute ist das Land der wichtigste Gegner des IS, und Millionen afghanischer Flüchtlinge leben in Ostiran. Nach dem Atomabkommen von 2015 und dem Ende der Sanktionspolitik wird Iran politisch und wirtschaftlich noch mal dramatisch an Gewicht gewinnen, das Land kann wieder zur wichtigsten Regionalmacht im Vorderen Orient werden, wie es das schon vor der Revolution von 1979 war. Wie dieser Staat und seine Gesellschaft funktionieren, warum wir den Iran bei der Stabilisierung des Nahen Osten dringend brauchen und welche Chancen in den neu erwachenden Wirtschaftsbeziehungen stecken, das beschreibt der Direktor des GIGA Instituts für Nahost-Studien Henner Fürtig fundiert und erhellend in diesem wichtigen Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Schlüssel für den Frieden in Europa liegt in Teheran: Ohne Iran ist weder der IS zu stoppen, die Flüchtlingswelle aufzuhalten noch der endlose Nahostkonflikt zu lösen. Schon heute ist das Land der wichtigste Gegner des IS, und Millionen afghanischer Flüchtlinge leben in Ostiran. Nach dem Atomabkommen von 2015 und dem Ende der Sanktionspolitik wird Iran politisch und wirtschaftlich noch mal dramatisch an Gewicht gewinnen, das Land kann wieder zur wichtigsten Regionalmacht im Vorderen Orient werden, wie es das schon vor der Revolution von 1979 war. Wie dieser Staat und seine Gesellschaft funktionieren, warum wir den Iran bei der Stabilisierung des Nahen Osten dringend brauchen und welche Chancen in den neu erwachenden Wirtschaftsbeziehungen stecken, das beschreibt der Direktor des GIGA Instituts für Nahost-Studien Henner Fürtig fundiert und erhellend in diesem wichtigen Buch.
Über den Autor
Prof. Dr. Henner Fürtig ist Professor für Nahost-Studien an der Universität Hamburg und seit 2009 Direktor des renommierten GIGA-Instituts für Nahost-Studien. Fürtig studierte Arabistik und Geschichte. Anschließend promovierte er über die Islamische Revolution in Iran und habilitierte sich zum irakisch-iranischen Krieg. Er forscht und lehrt zur Zeitgeschichte und Politik des Vorderen Orients, insbesondere der Golfregion und arbeitete mehrere Jahre in Iran und Ägypten.
HENNER FÜRTIG
Großmacht IRAN
Der GOTTESSTAAT wird GLOBAL PLAYER
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2016 by Quadriga in der Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Jan W. Haas, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock: rickyd
© Bilder im Innenteil: Getty Images (S.10/11, 56/57, 98/99, 172/173, 230/231), ullstein bild – NMSI/Science Museum/Manchester Daily Express (S.22/23)
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-2935-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
INHALT
Iran und der Westen: An der Schwelle zu einer neuen Epoche?
1.
Eine Großmacht entsteht
Der Ursprung des iranischen Selbstbewusstseins
Vom Zoroastrismus zum Zwölfer-Schiismus – das religiöse Erbe
2.
Der Kampf um die Selbstbehauptung
Ein Spielball britischer und russischer Interessen
Die Pahlavi-Herrschaft
3.
Die islamische Revolution
– eine Zeitenwende
Von der Monarchie zur Republik
Die »Herrschaft des Rechtsgelehrten« – ein theokratisches Gesellschaftsmodell
Eine Mission für die Welt
Behauptung im Ost-West-Konflikt
4.
Ein islamischer Staat im 21.
Jahrhundert
Stabwechsel an der Führungsspitze
Islamisch oder republikanisch? – Der Richtungskampf in Regime und Gesellschaft
Iran und seine Minderheiten
Wirtschaft – Herausforderungen und Chancen
5.
Iran im internationalen System
Iran und der Westen
Regionale Hauptgegner Irans
Regionale und internationale Verbündete
6.
Iran nach dem Atomabkommen
Die Aufhebung der Sanktionen und ihre Folgen
Der Kampf gegen den »Islamischen Staat«
Regime und Bevölkerung: Gleiche Ziele oder getrennte Wege?
Ausblick
Anhang
Anmerkungen
Schlüsseldaten der frühen und mittelalterlichen iranischen Geschichte
Geschichte Irans seit dem westlichen Interventionismus
Register
IRAN UND DER WESTEN: An der Schwelle zu einer neuen Epoche?
Es dürfte kaum jemanden in Deutschland geben, der sich keinerlei Bild von Iran macht. Selbst politisch Desinteressierte konnten sich ab den 1950er-Jahren kaum der Flut von Bildern und Artikeln entziehen, die in der Regenbogenpresse Schah Mohammed Reza Pahlavi, sein verschwenderisches Hofleben und vor allem Habitus und Kleidung seiner Gemahlinnen Soraya und Farah Diba illustrierten und kommentierten. Für die Generation der »Achtundsechziger« ist Iran zumindest mit dem Jahr 1967 verbunden, als im Verlauf von Protesten gegen den Besuch des Schahs in Berlin der Student Benno Ohnesorg von der Polizei erschossen wurde. Für viele war dieses Ereignis in der Rückschau die Initialzündung für die tiefgreifenden Veränderungen in der deutschen Gesellschaft und Politik, die mit dem »magischen« Jahr 1968 in Verbindung gebracht werden. Viele junge Menschen jener Zeit lernten Land und Leute auch aus eigener Anschauung kennen, als sie auf dem sogenannten Hippie Trail über die Türkei, Iran und Afghanistan nach Nepal reisten. Spätere Generationen erfuhren immerhin aus den Medien von der »islamischen Revolution« von 1979 und der sich daran anschließenden »Herrschaft der Mullahs«. Viele sympathisierten mit ihren Altersgenossen in den Protestbewegungen von 1999, 2002 und 2009 gegen ebenjene Herrschaft oder erfreuten sich immerhin an den hochgelobten Produkten iranischer Kultur und Kunst, nicht zuletzt der weltweit geachteten Kinematografie.
Auf Menschen jedoch, die an Iran und seiner Nachbarschaft politisch und wirtschaftlich unmittelbar interessiert waren, übte das Land eine noch deutlich größere Faszination aus. Iran gehört zu den größten Erdöl- und Erdgasproduzenten der Welt und war das erste Land des Nahen Ostens und Nordafrikas, in dem seit Beginn des 20.Jahrhunderts Erdöl, der wichtigste Einzelrohstoff der vergangenen 100 Jahre, kommerziell gefördert wurde. Fast folgerichtig war es auch der iranische Ministerpräsident Mohammed Mossadegh, der 1951 als erster Politiker eines nahöstlichen Förderlandes den Versuch unternahm, die Erdölproduktion und -vermarktung zu nationalisieren. Der 1953 vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6 und vor allem der CIA organisierte Putsch gegen Mossadegh wurde zu einer Blaupause des »imperialistischen« Instrumentariums, mit dem die Großmächte versuchten, ihren Einfluss in der damaligen »Dritten Welt« aufrechtzuerhalten. Erst 2013 gab die CIA ihre Verwicklung offiziell zu.
Die späteren Pläne des durch den Putsch wieder an die Macht gebrachten Schahs Mohammed Reza Pahlavi, in Iran eine »große Zivilisation« zu errichten, wurden zunächst noch belächelt. Spätestens ab den 1970er-Jahren, nachdem Iran – wie viele andere Förderländer auch – den Erdölsektor verstaatlicht hatte und aufgrund einer Preisexplosion auf den Erdölmärkten plötzlich Deviseneinnahmen in Rekordhöhe verzeichnete, schlug diese Skepsis jedoch in Zuversicht um, und den Plänen wurde mehr Anerkennung gezollt, als sie letztlich verdienten. Der Schah machte sich als Schutzpatron der US-Interessen in der ölreichen Golfregion unentbehrlich (»Golfgendarm«) und erwarb in Westeuropa und den USA umfangreiche Beteiligungen an renommierten Unternehmen sowie ganze Straßenzüge in den Metropolen. In der westlichen Öffentlichkeit galt er in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre als nahezu allmächtig, ein Bild, das von den Medien eifrig ausgemalt wurde.1
Gerade deshalb kam sein Sturz 1979 für viele Beobachter so plötzlich und unerwartet. Jetzt mussten neue Superlative bemüht werden. Nach der russischen Oktoberrevolution von 1917 war die iranische Revolution von 1979 erst die zweite originär soziale Massenrevolution des 20.Jahrhunderts und zudem die erste, die eine Theokratie etablierte, die fest entschlossen war, einen funktionierenden islamischen Staat in der Gegenwart zu gründen. Gegner und Befürworter begleiten dieses Experiment nunmehr seit fast 40 Jahren; es wurde ebenso oft totgesagt, wie es überlebte. Es überstand Dutzende Versuche in- und ausländischer Gegner, es zu beenden, aber auch einen achtjährigen verheerenden Krieg mit dem Nachbarland Irak sowie ein mehrjähriges striktes internationales Sanktionsregime. Die iranische Theokratie steht andererseits aber auch für fortgesetzte massive Verletzungen der Menschenrechte, kontinuierliche Diskriminierung von Frauen und Minderheiten sowie die Unterstützung von radikalen und bisweilen auch terroristischen Organisationen.
Durch die Unterzeichnung des Nuklearvertrags mit den Vertretern der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschlands (P5+1) und die Mitwirkung am internationalen Kampf gegen den Terror des sogenannten »Islamischen Staates« (IS) geriet Iran erst unlängst wieder verstärkt in die Schlagzeilen der Weltmedien. Viele Beobachter fragen sich, ob die jahrelangen Misstöne im Verhältnis zu den westlichen Staaten nun der Vergangenheit angehören und das Land bereit ist, sein Potenzial als konstruktive regionale Führungsmacht voll auszuspielen.
Die Zeit scheint also reif für einen frischen Blick auf dieses so vielfältige und oft missverstandene Land. Wird die Aufhebung der Sanktionen das Land tiefgreifend verändern? Wird sich das Verhältnis Irans zum Westen, namentlich zu den USA und Europa, verbessern? Ist Iran der Schlüssel oder das größte Hindernis für eine Beilegung des Krieges in Syrien und des tiefen Konflikts zwischen Schiiten und Sunniten? Wie sieht das »normale« Leben der Iranerinnen und Iraner aus; arrangieren sie sich mit den gegebenen Umständen oder könnten Rebellionen womöglich sogar die Theokratie gefährden? Auf diese und viele weitere Fragen versuchen die folgenden Seiten eine Antwort zu geben.
KAPITEL 1 Eine Großmacht entsteht
Die Ruinen von Persepolis zeugen von jahrtausendealteriranischer Geschichte als Großmacht im Nahen und Mittleren Osten.
DER URSPRUNG DES IRANISCHEN SELBSTBEWUSSTSEINS
Wenn die Entwicklung Irans in Deutschland und den anderen westlichen Ländern seit Jahrzehnten kontinuierlich beobachtet wird, dann gilt dies für seine Nachbarschaft seit Jahrhunderten. Bereits seit dem 16.Jahrhundert trennte eine scharfe Grenze das vornehmlich von semitischen und Turkvölkern bewohnte sunnitische Osmanische Reich vom zumeist von Indoeuropäern besiedelten schiitischen Iran. Politik und Interessen des Iran konnten die Bewohner der Region also zu keinem Zeitpunkt missachten. Für viele reicht das Gewicht dieser regionalen Großmacht sogar noch viel weiter zurück. Für sie war Iran quasi »schon immer da«, er gehört zu den ältesten Staaten der Welt. Georg Friedrich Hegel bezeichnete die indoeuropäischen Siedler, die Ende des 4.Jahrtausends v.Chr. auf dem Gebiet des heutigen Iran eine bronzezeitliche städtische Zivilisation entwickelten, voller Hochachtung als »erstes historisches Volk«.2 Die Siedler bezeichneten sich als »Arier« (ariyānām) und ihr Siedlungsgebiet als ariyānām shahr (Land der Arier), aus dem später das bedeutungsgleiche Ērān Shahr wurde. Von da ab war es nicht mehr weit zu Iran. In späterer Zeit und unter unterschiedlichen Herrschern gehörten weite Teile der heutigen Türkei bis zum Bosporus, aber auch Ägypten, Nordindien, der Kaukasus, große Teile der eurasischen Steppe und der Persische Golf bis in den Süden nach Oman zu Iran respektive Persien. Bei den Nachfahren der Bewohner jener Gebiete blieb also ein Echo einstiger persisch/iranischer Dominanz und Glorie erhalten.
1250 v.Chr. setzte eine zweite große Wanderungsbewegung indoeuropäischer Völker aus den eurasischen Steppen in das iranische Hochland ein, zu denen auch die Perser gehörten. 550 v.Chr. errichteten sie unter Kyros II. das erste gleichnamige Reich auf iranischem Boden. Es war Namensgeber für Persien, wie Iran bis 1935 hieß. Das Abendland hingegen verdankt diesen Namen den Griechen, die das zentrale Siedlungsgebiet der Perser in der heutigen iranischen Provinz Fars mit der Hauptstadt Schiras Persis nannten.
Das von Kyros II. gegründete Perserreich der Achämeniden entwickelte sich zum ersten zentral geführten Großreich auf iranischem Boden. Das Reich dehnte sich rasch aus. Obwohl (oder vielleicht sogar gerade weil) er als Eroberer außerordentlich erfolgreich war, ging die Geschichtsschreibung sehr wohlwollend mit Kyros um. Mit seiner Erhebung zu »Kyros dem Großen« wird nicht nur seine Leistung als Staatsgründer gewürdigt, sondern vor allem auch sein sehr maßvoller Umgang mit den Kulturen, Religionen und Sitten der eroberten Völker. Die »Befreiung der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft« ging sogar in die biblische Geschichte ein. Als Vergeltung für Aufstände gegen ihre Herrschaft hatten die assyrischen Könige Tiglatpileser III. und Sargon II. zwischen 730 und 720 v.Chr. Tausende Juden nach Ekbatana und Susa in Südwestiran deportiert; sie gelten in der biblischen Überlieferung als die »Zehn verlorenen Stämme Israels«. 587/86 v.Chr. zerstörten die Assyrer Salomos »ersten Tempel« in Jerusalem und führten Zehntausende Juden in die »babylonische Gefangenschaft«. Aus ebendieser wurden sie 539 v.Chr. von Kyros befreit. Er stellte den Befreiten frei, nach Jerusalem zurückzukehren und ihren Tempel wiederaufzubauen oder sich in seinem Reich auf Dauer anzusiedeln. Viele nahmen die Offerte an und kehrten damit dem Berg Zion den Rücken.
Zumindest unter den Achämeniden sollten sie ihre Wahl nicht bereuen, denn Kultgegenstände und Artefakte aus Persepolis, Susa und Hamadan belegen, dass die Juden die gleichen Rechte wie andere Untertanen der persischen Herrscher genossen, einschließlich Religionsfreiheit. Obwohl vor allem seit der Revolution von 1979 stark geschrumpft, lebt in Iran bis heute eine etwa 25.000 Menschen umfassende jüdische Gemeinde – die größte des Nahen Ostens und Nordafrikas außerhalb Israels. Stolz auf ihre jahrtausendealte Existenz in ihrer angestammten Heimat, sehen sie sich nicht in erster Linie Israel und dem Berg Zion (Zionisten) verpflichtet, sondern Iran.
Die so erfolgreichen Achämeniden und namentlich Kyros der Große dienten auch späteren Dynastien und Herrschern immer wieder als Referenz, um eigene Bedeutung zu reklamieren. Das gilt faktisch bis zum letzten Schah Irans, Mohammed Reza Pahlavi. Mit großem Pomp beging er im Oktober 1971 den 2.500ten Geburtstag des persischen Reiches und feierte sich bei dieser Gelegenheit als Erbe der Achämeniden. In offener Provokation der Geistlichkeit schaffte er dabei – quasi nebenbei – den islamischen Kalender ab und ersetzte ihn durch einen »kaiserlichen« Kalender, der mit der Krönung von Kyros dem Großen begann.
Europa verbindet mit den Achämeniden dagegen weniger Kyros als vielmehr seine Nachfolger Dareios und Xerxes. Auch Dareios wurde von späteren Geschichtsschreibern als »der Große« tituliert. Diese Wertschätzung fußt in erster Linie auf seinen überragenden staatsmännischen Leistungen. Er ließ mit Persepolis die glanzvolle neue Hauptstadt des Reiches errichten, legte ein Netz von Fernstraßen mit Poststationen an, baute einen Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Meer, standardisierte das Münzwesen und modernisierte die Verwaltung.
Mit diesen Errungenschaften im Rücken richtete Dareios seinen Blick auf neue Eroberungen, dieses Mal in Richtung Westen, nach Europa. Er setzte über den Bosporus und unterwarf bis 512/511 v.Chr. Mazedonien auf griechischem Territorium. Damit herrschte Dareios über das größte bis dahin bekannte Reich, das sich über die Kontinente Asien, Afrika und Europa erstreckte. Dareios ließ sich »Schah-in-Schah« (König der Könige) nennen – ein Titel, den spätere Herrscher, einschließlich Mohammad Reza Pahlavi, gern übernahmen – und regierte faktisch die erste »Supermacht« der Geschichte, eine Supermacht, in der aber nach wie vor ein hohes Maß an Toleranz für andere Sitten, Gebräuche und Religionen galt.
Das ist umso erstaunlicher, als das Perserreich mit dem Zoroastrismus durchaus über eine eigene entwickelte Religion verfügte. Diese geht auf den Propheten Zarathustra, der wohl zwischen 1700 und 1300 v.Chr. in Bakhtrien im heutigen Afghanistan lebte, zurück und gilt als eine der ältesten ausformulierten »Buch«-Religionen (Avesta) der Erde. Sie ist monotheistisch und führte nicht zuletzt den Messianismus und das dualistische Prinzip von Himmel und Hölle in das religiöse Verständnis ein. Geradezu revolutionär war das darin enthaltene Zugeständnis an den freien Willen des Menschen, sich durch sein Verhalten zwischen beiden entscheiden zu können. Der Zoroastrismus beeinflusste so nachdrücklich alle nachfolgenden monotheistischen Religionen wie das Juden- und das Christentum, aber auch den Islam. Von den Achämeniden bis zur islamischen Eroberung Persiens im 7.Jahrhundert war der Zoroastrismus die vorherrschende Religion in Persien.3
Der Versuch, das griechische Festland zu erobern, führte das Perserreich aber schließlich an seine Grenzen. 499 v.Chr. begann der griechisch-persische Krieg, der fast 50 Jahre andauern sollte und der zum festen Bestandteil der europäischen Geschichte und Kultur wurde. Die Schlachten von Marathon (Marathonlauf) 490 v.Chr. und die Seeschlacht von Salamis 480 v.Chr. sind seit vielen Generationen Unterrichtsstoff. Nach dem Ende des Krieges mit Griechenland waren die Achämenidenherrscher mehr mit dem Erhalt als mit der Ausdehnung ihres Reiches beschäftigt. Mit dem Tod von Dareios III. 330 v.Chr. erlosch ihre Dynastie.
Es war Alexander der Große, der Dareios III. in den Schlachten von Granicos, Issos und Gaugamela entscheidend schlug und sich das Perserreich am Ende einverleibte. Alexanders Reich, das sich schließlich vom Indus bis zur Adria erstreckte, war damit sogar um einiges größer als der Staat, den Dareios I. regiert hatte. Als Einheitsstaat überlebte das Gebilde aber Alexanders Tod im Jahre 323 v.Chr. nicht. Vielmehr wurde es unter seinen fähigsten Feldherren aufgeteilt. Persien fiel an Seleukos Nicator, der die Dynastie der Seleukiden begründete und für eine – noch in vielen Artefakten sichtbare – Hellenisierung des Reiches sorgte.
Die den Seleukiden folgenden Dynastien der Parther (ab 248 v.Chr.) und Sassaniden (ab 224) führten den persischen Reichsgedanken der Achämeniden fort. In die Alte Geschichte Europas gingen sie vor allem wegen der nahezu sechs Jahrhunderte umfassenden Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich ein. Römische Legionäre und persische Reiterei hielten sich militärisch gleichsam die Waage und verhinderten eine dauerhafte Überlegenheit einer der beiden Seiten. 53 v.Chr. brachten die Parther den Römern unter Senator Marcus Licinius Crassus im mesopotamischen Carrhae eine der empfindlichsten Niederlagen ihrer gesamten Geschichte bei; den Sassaniden gelang es 260 in der Schlacht von Edessa sogar, den römischen Kaiser Valerian gefangen zu nehmen. Der römische Imperator verstarb in Gefangenschaft. Im Verlauf des letzten persisch-römischen Krieges von 602 bis 628 belagerten die Sassaniden – wenn auch vergeblich – Byzanz. Der Krieg laugte das Reich aber so nachhaltig aus, dass es den angreifenden islamisierten Arabern keinen nennenswerten Widerstand mehr zu leisten vermochte. 636 unterlagen die Sassaniden den Arabern unter dem Kalifen Omar bei Qadisiyya im heutigen Irak.
VOM ZOROASTRISMUS ZUM ZWÖLFER-SCHIISMUS – das religiöse Erbe
Im Bewusstsein der heutigen Bewohner der Region sind diese Ereignisse noch außerordentlich lebendig. Die Iraner verdanken den Arabern zwar die Übernahme des Islam, sie sehen diese selbst jedoch als unwillkommene Eroberer an. Viele Araber denken hingegen gern an diese »glorreiche« Phase ihrer Geschichte zurück. Nicht von ungefähr nutzte der irakische Diktator Saddam Hussein das Symbol von Qadisiyya in seiner Propaganda, um den iranischen Gegnern im Ersten Golfkrieg von 1980 bis 1988 ein »Qadisiyya Saddam« anzudrohen.
Diese Langlebigkeit gilt aber auch für das philosophische bzw. religiöse Erbe. Auf den bedeutenden Einfluss der Lehre Zarathustras wurde schon verwiesen, aus der Sassanidenzeit wirkt aber noch ein anderer Religionsstifter bis in die Gegenwart. Die Sassanidenherrscher hatten den Staat wesentlich stärker zentralisiert als die Achämeniden. Der sassanidische Schah-in-Schah herrschte absolut und durch »göttliches Recht«. Dazu wurde der Zoroastrismus quasi zur Staatsreligion erhoben und die zoroastrische Geistlichkeit neben dem Adel zu einem der wichtigsten Träger der Herrschaft.
Die dadurch erlangte politische Macht nutzte die Geistlichkeit nicht zuletzt, um kritische Geister mundtot zu machen. Das betraf beispielsweise den Propheten Mani (216–276/277), der in seine Lehre Bestandteile älterer Religionen wie des Buddhismus und des Christentums aufnahm und damit den Zoroastrismus aus der Sicht der Hohepriester verfälschte. Auf der anderen Seite spitzte er den Dualismus der zoroastrischen Lehre kompromisslos zu. Der nach Mani benannte Manichäismus unterschied zwei grundsätzlich verschiedene Naturen bzw. Prinzipien des Lebens: die des Lichts und die der Dunkelheit. Der »natürliche« Zustand der Welt manifestiere sich in der Trennung der Prinzipien. Mani wähnte sich und sein Zeitalter im Bereich der Dunkelheit, das lediglich einige »Lichtpunkte« aufweise. Der Mensch habe durch eigenes Zutun dafür zu sorgen, dass sich diese »Lichtpunkte« so weit vermehrten, dass am Ende wieder zwei vollständig und endgültig getrennte Welten entstünden.
Der Manichäismus dehnte sich nicht nur im Sassanidenreich rasch aus, sondern erreichte innerhalb weniger Jahrzehnte auch eine Anhängerschaft vom Römischen Reich bis nach China. Auf Betreiben des zoroastrischen Hohepriesters Kartir ließ König Bahram I. Mani schließlich verhaften. Der Prophet starb im Gefängnis. Die manichäische Weltsicht prägte die iranische Philosophie trotzdem nachhaltig und beeinflusste selbst schiitische Religionsgelehrte wie den späteren Führer der islamischen Revolution, Ayatollah Khomeini. Obwohl sein Weltbild immer im schiitischen Kontext verblieb, war es doch durchweg dualistisch geprägt. Khomeini erkannte nur »gut« oder »schlecht«, »hell« oder »dunkel«, »schwarz« oder »weiß« und ließ nur wenige Grautöne gelten.
Die Araber, die 636 über die Sassaniden gesiegt hatten, verfügten weder über die Zeit noch über das Personal, um die eroberten Gebiete umgehend selbst zu verwalten. Sie stützten ihre Herrschaft deshalb weitgehend auf die Übernahme der lokalen Oberschicht und der Beamtenschaft. Zwischen 934 und 1062 gelang es auf dieser Grundlage der persischen Buyidendynastie sogar, eine mehr als 100 Jahre dauernde Herrschaft in Iran zu errichten.
Die Geschichtsschreibung ist sich in der Bewertung dieser Periode uneins. Manche Historiker beschreiben sie als »persisches Intermezzo«, andere sprechen eher von einer »persianisierten« Phase, denn schließlich waren die Buyiden den arabischen Abbasiden formal untertan. Immerhin waren am Ende der Buyidenzeit nahezu alle Iraner Muslime, wenn auch zum Teil Schiiten wie ihre buyidischen Herrscher. Auf der anderen Seite wurde das iranische Selbstbewusstsein durch die Buyidenherrschaft enorm gestärkt. In dieser Periode wirkten die iranischen Nationaldichter Rudaki und Ferdowsi; Ersterer gilt als Begründer der modernen persischen Sprache, Letzterer erreichte als Schöpfer des 60.000 Verse umfassenden Nationalepos des Schahnameh (Buch der Könige), das zwischen 977 und 1010 entstand, unvergänglichen Ruhm in seinem Land.
Wenn schon die Buyiden nicht als Herrscher eines unabhängigen persischen Reiches gelten können, dann versank dieses Reich nach ihnen für einige Jahrhunderte sogar in der Bedeutungslosigkeit. Fremde Herrscher, nicht zuletzt mongolische, lösten sich ab, ehe Ismail Safawi, der Führer eines schiitischen Ordens, 1501 die aserbaidschanische Hauptstadt Täbris eroberte und sich zum »Schah von Aserbaidschan« ernannte. Schon wenig später zeigte er größeren »Appetit« und titulierte sich »Schah von Iran«. Das ging einher mit einem konsequenten Eroberungsfeldzug, der ihm binnen zehn Jahren die Herrschaft über das iranische Kernland und Gebiete im Osten bis nach Herat und im Westen bis nach Bagdad einbrachte. Obwohl selbst aserbaidschanisch-kurdischer Herkunft, errichtete Ismail I. zum ersten Mal seit den Sassaniden wieder ein als »persisch« verstandenes Reich. Mit dem Ziel, eine einigende Klammer zwischen den ethnisch unterschiedlichen Völkern seines Reiches zu schaffen und sich gleichzeitig gegen den großen Rivalen im Westen, das sunnitische Kalifat in Gestalt des Osmanischen Reiches, abzugrenzen, erklärte er den Zwölfer-Schiismus zur offiziellen Religion seines Reiches.
Der Zwölfer-Schiismus lehrt, dass es zwölf Imame aus der Familie des vierten Kalifen Ali gab. Der zwölfte Imam, Mohammed Ibn Hassan al-Mahdi, lebt demnach seit 874 »in der Verborgenheit«. Er gilt als Messias, der die Welt nach seiner Rückkehr zum wahren Glauben führen wird. Zu Beginn von Ismails Herrschaft folgte die übergroße Mehrheit seiner Untertanen jedoch noch der sunnitischen Glaubensrichtung. Am Ende seiner Regierungszeit, 1524, waren die meisten von ihnen, teilweise auch durch brutale Gewalt, zum Schiismus »bekehrt« worden. Mit der Erhebung des Zwölfer-Schiismus zur Staatsreligion hatte Ismail I. eine wesentliche Zäsur für die islamische Welt gesetzt, auch wenn Iran bis in die Gegenwart das einzige Land dieser Art bleiben sollte.
Die größte Blüte erreichte das Safawidenreich unter Schah Abbas I. (1587–1629), der Isfahan zur prunkvollen Hauptstadt eines Reiches machte, das von Afghanistan, Pakistan und Turkmenistan im Osten bis nach Anatolien, Syrien und Irak im Westen reichte. Abbas I. trieb mit der holländischen Ostindienkompanie erfolgreich Handel und knüpfte diplomatische Kontakte zu wichtigen europäischen Höfen. Kunst und Kultur entwickelten sich sprunghaft; am nachhaltigsten verbinden sich die einzigartigen Baudenkmäler – nicht zuletzt in Isfahan – mit der Herrschaft von Abbas. Kein persischer Herrscher hat nach ihm jemals wieder über so viel Macht und Wohlstand verfügt. In der Wertschätzung des Volkes steht er deshalb in einer Reihe mit den großen Achämeniden Kyros und Dareios. Seine Nachfolger verspielten das große Erbe aber rasch. Zu Beginn des 18.Jahrhunderts verloren die Safawiden nahezu alle Kriege gegen die Osmanen im Westen, Truppen Peters des Großen aus dem Norden und afghanische Stämme aus dem Osten. Im Vertrag von Konstantinopel (1724) wurde das Safawidenreich faktisch unter diesen Kriegsparteien aufgeteilt.
In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder Versuche, erneut ein einheitliches Persien zu errichten. Am erfolgreichsten war dabei noch Nader Khan, ein Stammesführer aus der iranischen Provinz Khorasan, dem überragendes militärisches Talent zugeschrieben wird. 1736 ernannte er sich selbst zum Schah. Nader Schah dehnte sein Reich noch einmal gewaltig aus. Sein erfolgreicher Feldzug gegen das indische Moghulreich blieb vor allem deshalb in Erinnerung, weil er nach der Eroberung von Delhi (1739) den »Pfauenthron« entführte, der seitdem zu einer Insignie kaiserlicher Macht in Iran wurde. Nader Schah fiel 1747 einem Attentat durch seine Leibgarde zum Opfer, auch sein Reich überlebte ihn nur kurz. Von 1751 bis 1793 konnte die Zand-Dynastie von Schiras aus wieder ein einheitliches Persien schaffen, gegen Ende des Jahrhunderts unterlag sie allerdings den rivalisierenden Kadjaren. Mit ihnen begann Irans folgenreiche Auseinandersetzung mit europäischen Hegemonialambitionen.
KAPITEL 2 Der Kampf um die Selbstbehauptung
Mit großem Pomp inszenierte Mohammed Reza Schah seine Macht. Hier die Krönungsfeierlichkeiten 1967, skeptisch beobachtet vom siebenjährigen Kronprinzen Reza.
EIN SPIELBALL BRITISCHER UND RUSSISCHER INTERESSEN
Durch die britische Eroberung Indiens bis zum Ende des 18.Jahrhunderts war Persien als Landbrücke plötzlich in das Blickfeld europäischer Mächte gerückt. Großbritannien wollte das Land als Bollwerk gegen Konkurrenten erhalten, während gleichzeitig Russland nach den warmen Wassern des Indischen Ozeans strebte und Persien dabei als Hindernis ansah. Persien wurde damit nicht nur zum Zankapfel, sondern auch zum Austragungsort dieser Rivalität. Die Kadjarenherrscher gerieten quasi zum Korn zwischen diesen Mühlsteinen.
Die Kadjaren und der westliche Interventionismus
Die Kadjarendynastie herrschte in Iran bis 1925 und überflügelte damit ihre unmittelbaren Vorgänger um mehr als ein Jahrhundert. Dennoch findet sie in der Geschichtsschreibung kaum rühmliche Erwähnung. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass sie sich während ihrer gesamten Herrschaftszeit ebenjener massiven Versuche externer Mächte ausgesetzt sah, Iran unter ihre Kontrolle zu bringen, und dass sie diesen Versuchen verhältnismäßig wenig Widerstand entgegensetzte.
Die Zaren hatten die turbulente Zeit nach Nader Schahs Tod für massive Vorstöße in den Südkaukasus genutzt und sich Georgien de facto einverleibt. Fath Ali Schah Kadjar (1797–1834) eroberte im Nordosten zwar Khorasan zurück, verspekulierte sich aber letztlich bei seinem Versuch, europäische Verbündete wie Frankreich und Großbritannien gegen Russland zu gewinnen. Vielmehr wurde der russische Einfluss im Südkaukasus 1813 im Vertrag von Golestan zementiert.
Die weiterhin unklaren Grenzziehungen ermunterten den Zaren 1825 zu neuen militärischen Vorstößen in Richtung Süden. Erstmals in der iranischen Geschichte riefen die schiitischen Geistlichen zum »Heiligen Krieg« (Jihad) gegen die Eindringlinge auf, ein Privileg, das nach ihrer eigenen Lesart eigentlich nur dem »Verborgenen Imam« (Mahdi) zustand. Trotzdem musste der militärisch unterlegene Fath Ali Schah weitere Gebiete abtreten und 1828 den Vertrag von Turkmentschai unterzeichnen, der ein dauerhaftes Grenzregime einrichtete: Georgien kam zu Russland, Armenien wurde zwischen dem Osmanischen Reich und Russland aufgeteilt, Aserbaidschan bzw. das von Azeri-Türken besiedelte Gebiet am Westrand des Kaspischen Meeres zerfiel in einen russischen Teil um Baku und einen persischen um Täbris. Erst knapp 170 Jahre später wurde diese Machtkonstellation durch den Zerfall der Sowjetunion (1991) wieder infrage gestellt.
Im gesamten Verlauf des verbleibenden 19.Jahrhunderts war es vor allem die erbitterte Rivalität zwischen Russland und Großbritannien, die die Geschicke Persiens bestimmte. Beide Großmächte ertrotzten wesentliche Handelsprivilegien, erwarben Lizenzen für Staatsaufgaben und Konzessionen für die Erkundung von Bodenschätzen und sicherten ihren eigenen Vertretern in Iran rechtliche Sonderstellungen (Kapitulationen). So erhielt der britische Baron de Reuther am 25.7.1872 eine Konzession zur Ausbeutung jeglicher von ihm gefundener iranischer Bodenschätze, außer Gold, Silber und Edelsteinen. Darüber hinaus sollte er ein Eisenbahn- und Fernmeldemonopol für 70 Jahre erhalten. Die Zusagen mussten zwar 1874 aufgrund von Massenprotesten wieder zurückgenommen werden, aber der Hof entschädigte ihn dafür 1889 mit dem Recht der Notenemission durch die von ihm gegründete Imperial Bank of Persia. Die Bank erwies sich bis zur Etablierung der Anglo-Persian Oil Company (APOC) im Jahre 1909 als wichtigstes britisches Einflussinstrument in Iran.
Aber auch Russland konnte sich bedeutende Rechte sichern. 1879 wurde eine Kosakenbrigade unter russischem Kommando aufgestellt, die als einzige kampffähige Truppe Irans galt. 1890 gründete Poljakow eine Diskontbank für die Nordprovinzen, 1900 erkaufte sich Russland die iranischen Zollrechte und 1902 für 10 Mill. Rubel das Zucker-, Streichholz- und Bedarfsgütermonopol. Im gleichen Jahr wurde das Zollabkommen sogar erweitert: Die russische Regierung konnte die Zollgesetze Irans nun so revidieren, dass iranische Waren fast vollständig vom Export ausgeschlossen blieben. Trotz des Ausverkaufs von nationalen Besitztümern und Rechten lebte der Kadjarenhof weiterhin »auf Pump«. Sobald die Einnahmen aus einer Konzession aufgebraucht waren, wurde fieberhaft nach weiteren Erwerbsquellen gesucht. So verkauften die Kadjaren 1890 das Tabakmonopol an einen britischen Major.
Damit war das Fass allerdings zum Überlaufen gebracht worden. Einheimische Händler und Gewerbetreibende waren schon seit geraumer Zeit über die eindeutige Bevorteilung ausländischer Konkurrenten aufgebracht, die immer ärmer werdende Bevölkerung machte ebenfalls die ausländischen Konzessionäre und den ignoranten und prunksüchtigen Hof für ihre elende Lage verantwortlich. Tabakgenuss gehörte zu den wenigen Vergnügungen, die sich auch ärmere Bevölkerungsschichten noch leisten konnten; deshalb eignete sich die Vergabe des Tabakmonopols auf besondere Weise als Auslöser der Unruhen, die noch 1890 ausbrachen. Der Kampf gegen das Tabakmonopol einte so breite Bevölkerungsschichten: Arbeiter, Bauern, Handwerker, Kaufleute und Intellektuelle. Ihr gemeinsames Sprachrohr fanden sie in dem damals namhaftesten Geistlichen, Ayatollah Mirza al-Schirazi.
Die Geistlichkeit und ihre höchsten Vertreter verfolgten den massenhaften Einbruch und die Privilegierung von ausländischen Vertretern und Ideen ebenfalls mit großem Argwohn. Mittelfristig sahen sie ihre eigene Stellung in der Gesellschaft in Gefahr. Gewissermaßen im Vorgriff auf Ereignisse in Iran knapp ein Jahrhundert später zeigte sich schon hier die mobilisierende Rolle der Geistlichkeit, der – vor allem mangels einer organisierten gesellschaftlichen Alternative – eine Führungsrolle zufiel. 1892 musste der Schah die Konzession jedenfalls zurücknehmen, das Volk hatte erstmals erfolgreich Widerstandskraft demonstriert.
Das brachte die Kadjaren jedoch nicht zum Umdenken. Im Gegenteil, die verlorenen Einnahmen aus der Tabakkonzession verschärften die Geldnot. Am 28.Mai 1901 vergab der Hof eine Konzession mit 60-jähriger Laufzeit zur Erkundung von Erdöllagerstätten in Iran für 20.000 Pfund in bar und 20.000 Pfund in Aktien einer zu gründenden Aktiengesellschaft an den britischen Abenteurer William Knox d’Arcy. Lediglich der Norden Irans, der fest unter russischer Kontrolle stand, war von der Konzession ausgenommen. D’Arcy verspekulierte sich allerdings mit den Explorationskosten und musste die Konzession daher schon 1908 an die von der britischen Regierung unterhaltene Burmah-Oil verkaufen, aus der 1909 die Anglo Persian Oil Company (APOC) entstand, die Iran danach für mehrere Jahrzehnte im ökonomischen Würgegriff halten sollte.
Aber auch diese Konzessionseinnahmen hielten nicht lange: 1906 stand Iran mit Schulden von 7,5 Mill. Pfund bei der britischen Regierung »in der Kreide«. Die Lage wurde unhaltbar. Immer weniger Iraner wollten die Willkür seitens der Obrigkeit, die Ausplünderung und Knebelung durch das Ausland sowie die korrupte und parasitäre Lebensweise der Kadjaren länger dulden. Letztere zeigten sich zunehmend unfähig, die bestehende Lage aufrechtzuerhalten. Es bedurfte nur noch geringfügiger Anlässe, um die brisante Situation zur Explosion zu bringen.
Ein entscheidender Wegbereiter war die russische Niederlage im Krieg gegen Japan in Fernost 1905 und die sich daran anschließende Revolution in Russland. Der Koloss im Norden erschien nun verwundbar, und die Auswirkungen der Revolution wurden in Iran zudem spürbar, weil zahlreiche iranische Saison- und Wanderarbeiter auf den Erdölfeldern Bakus, beim Straßenbau in Mittelasien und in den Häfen am Kaspischen Meer arbeiteten – allein in Baku etwa 7.000. Sie trugen nicht unwesentlich zur schnellen Popularisierung und Verbreitung der Ideen der russischen Revolution bei.
Die konstitutionelle Revolution 1905–1911
Die konstitutionelle Revolution in Iran begann am 12.Dezember 1905 mit Massenkundgebungen in Teheran als Protest gegen die öffentliche Auspeitschung von 17 Kaufleuten wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Der Basar wurde geschlossen und in der Hauptstadt in den folgenden 25 Tagen gestreikt. Der Schah nahm einige personelle Umbesetzungen in der Regierung vor und versuchte im Übrigen, die Proteste »auszusitzen«. Daraufhin begannen die Unruhen von Neuem; im Juni 1906 suchten rund 10.000 Protestierende Zuflucht in der britischen Gesandtschaft in Teheran.
Am 5.August 1906 sah sich der Schah gezwungen, erstmals die Einführung einer Verfassung in Aussicht zu stellen. Danach beruhigte sich die Lage vorübergehend, und der Hof setzte alles daran, diesen Zustand zu verewigen. Die Bevölkerung antwortete jedoch mit einer neuen Empörungswelle, die insbesondere die Nordprovinzen erfasste, wo die Kontakte zum revolutionären Russland besonders eng waren. Im September 1906 wurde in Täbris ein Generalstreik ausgerufen; Kaufleute, Handwerker und Arbeiter, aber auch Geistliche bildeten erste »Revolutionskomitees«. Bis auf den Hof und die mit ihm verbündete kleine Schicht von Großgrundbesitzern stand zu diesem Zeitpunkt das gesamte Volk hinter der Revolution. Bald folgte eine Vielzahl anderer iranischer Städte dem Beispiel aus Täbris; überall entstanden Revolutionskomitees, die die örtlichen Schah-Behörden kontrollierten.
Getrieben von den revolutionären Aktivitäten musste der Schah am 9.September 1906 die Parlamentsverordnung bestätigen; am 7.Oktober 1906 wurde das erste iranische Parlament eröffnet und mit der Ausarbeitung einer Verfassung begonnen. Diese sollte die Macht des Schahs beschränken, die Partizipation des Volkes sichern und alle gewählten Institutionen rechenschaftspflichtig machen. Keine Regierung wäre zukünftig ohne Bestätigung durch das Parlament rechtmäßig im Amt. Am 30.Dezember 1906 unterzeichnete Mozaffar ad-Din Schah Kadjar die Verfassung. Mit ihrer Annahme war ein erster großer Sieg der Revolution errungen worden.
Mozaffar ad-Din Schah überlebte die Unterzeichnung der Verfassung jedoch nur um fünf Tage. Sein Nachfolger, Mohammed Ali Schah, der am 8.Januar 1907 den Pfauenthron bestieg, setzte alles daran, die Revolution und ihre Errungenschaften zu zerschlagen. Er mobilisierte die Kosakenbrigade und setzte sie gegen die Revolutionskomitees ein. In Täbris brach daraufhin erneut ein bewaffneter Aufstand aus, Mohammed Ali Schah musste die Verfassung explizit bestätigen.
Im gesamten Verlauf des Jahres 1907 traten die Revolutionskomitees zunehmend mit eigenen Forderungen an die Öffentlichkeit und riefen zu Streiks und zum Boykott ausländischer, speziell britischer Waren auf. Die Komitees bestimmten das Bild der iranischen Städte, sie kontrollierten das öffentliche Leben, übten eine eigene Gerichtsbarkeit aus, unterhielten Schulen und veröffentlichten eine Vielzahl patriotischer Publikationen. Das Parlament und die Revolutionskomitees agierten 1907 faktisch parallel, mit einem klaren politischen Übergewicht für Letztere. Im Oktober 1907 musste der Schah sogar den Ergänzungen zur Verfassung zustimmen, die ihren eigentlichen Hauptteil darstellten. Die mittelalterliche Lehnsordnung wurde abgeschafft, das Privateigentum gesetzlich geschützt und bürgerliche Freiheiten wie Rede- und Pressefreiheit sowie das Versammlungsrecht wurden gesichert.
Mit dem Erreichen dieser Ziele war aber für einen maßgeblichen Teil der Protestierenden die Revolution beendet. Vor allem die im Parlament vertretenen Kräfte – Kaufleute, Grundbesitzer, städtische Notabeln und Geistliche – sahen die Macht des Schahs und seiner ausländischen Helfershelfer genügend beschnitten; damit waren die wesentlichen Gründe für ihren Unmut beseitigt. Gerade in der Geistlichkeit war schon seit Längerem Angst vor der eigenen Courage aufgekommen. Ganz in der Tradition der Tabakunruhen von 1890–92 hatten sich viele Geistliche an die Spitze der Proteste gesetzt, da es galt, ausländischen Einfluss und die Willkür der Schahs zu beschneiden.
Zunehmender Widerstand und der ausländische Einfluss
Spätestens bei der Einführung bürgerlicher Rechte endete für viele Geistliche aber der Zuspruch für die Revolution. Ayatollah Fazlollah Nuri wurde zur Gallionsfigur dieser klerikalen Fraktion. Er betonte, dass nicht das Volk, sondern Allah der Souverän sei. Alle Gewalt gehe von Allah aus. Deshalb sei das islamische Recht, die Scharia, für die Muslime auch keine Ermessensfrage. Schon die von der Verfassung geforderte Gleichheit vor dem Gesetz verstoße gegen die Scharia, da diese zwischen Muslimen und Nichtmuslimen unterscheide und beiden einen unterschiedlichen Rechtsstatus zuweise. Zudem basiere der konstitutionelle Gedanke auf den Ideen des europäischen Materialismus und stehe damit in vollständigem Widerspruch zum Islam.
Bezeichnenderweise berief sich der spätere Führer der islamischen Revolution in Iran, Ayatollah Khomeini, ausdrücklich auf Nuri und versprach, dessen Vermächtnis in der Islamischen Republik Iran umzusetzen. Das Parlament, das unter dem Druck der Revolutionskomitees stand, wollte sich die Unterstützung durch die Geistlichkeit keinesfalls verscherzen und stimmte deshalb der Forderung Fazlollah Nuris zu, ein aus fünf Rechtsgelehrten bestehendes Gremium zu benennen. Dieses Organ musste vor Inkrafttreten neuer Gesetze bestätigen, dass diese nicht im Widerspruch zum islamischen Recht standen. Formal galt diese Bestimmung, wie die gesamte Verfassung von 1907, bis zur Revolution von 1979. Fazlollah Nuri genügten diese Zugeständnisse jedoch nicht. Er setzte seinen Kampf gegen die Verfassungsbewegung unvermindert fort. Unter dem Vorwurf, an der Ermordung mehrerer Revolutionäre beteiligt gewesen zu sein, wurde er 1909 verhaftet, zum Tode verurteilt und am 31.Juli 1909 öffentlich in Teheran gehenkt.
Noch 1907 hatten allerdings die beiden großen ausländischen Einflussmächte in Iran, Russland und Großbritannien, die unsichere Lage im Land und vor allem die Schwäche des Schahs genutzt, um Iran vertraglich unter sich aufzuteilen. Der Norden des Landes sollte fortan auch offiziell unter russischer und der Süden unter britischer Kontrolle stehen. Für den Schah und seine Regierung war nur ein schmaler Streifen nördlich und südlich der Hauptstadt Teheran vorgesehen.
Dagegen erhob sich 1907 nur verhaltener Protest; Mohammed Ali Schah und Teile der Oberschicht versuchten vielmehr sogar, sich mit den Einflussmächten zum eigenen Vorteil zu arrangieren. Im Juni 1908 setzte er die Kosakenbrigade gegen das Parlament in Marsch. Viele Abgeordnete wurden festgenommen und das Parlament schließlich aufgelöst. Jetzt zeigten einmal mehr die Revolutionskomitees ihre Stärke. Von Täbris und Rasht im Norden aus wurde der Widerstand organisiert, aber auch von Isfahan im Süden aus setzte sich ein Protestzug in Bewegung.
Im Juli 1909 erreichten die Protestierenden Teheran. Mohammed Ali Schah floh am 16.Juli 1909 in die russische Botschaft. Noch am gleichen Tag trat das Parlament wieder zusammen, erklärte die Wiedereinsetzung der Verfassung und die Abdankung Mohammed Ali Schahs zugunsten seines minderjährigen Sohnes Ahmad. Nach längeren Verhandlungen verließ der abgesetzte Schah im September 1909 das Land und ging ins Exil nach Odessa. Mithilfe russischer Truppen versuchte er im Sommer 1911 noch einmal vergeblich, seinen Thron zurückzuerlangen. In der Zwischenzeit war die Entwicklung in Iran aber längst über ihn hinweggegangen.
Obwohl die Konstitutionalisten im Juli 1909 ein weiteres Mal gesiegt hatten, standen sie vor erheblichen Schwierigkeiten. Aus Sicht vieler Parlamentarier war ihre Wiedereinsetzung des Schahs zwar richtig, die Revolution aber ansonsten beendet. Das Wirken der Revolutionskomitees verbanden sie mit anhaltender Unruhe und Instabilität – Dinge, die einem gedeihlichen Handel und Wandel im Wege standen. Die Revolution zerfaserte, die auf sich selbst zurückgeworfenen Revolutionskomitees stellten ihre Tätigkeit allmählich ein.
Die letzte Etappe der Revolution wurde daher durch ein eher untypisches Ereignis eingeläutet: Im Mai 1911 hatte die iranische Regierung den US-amerikanischen Finanzfachmann Morgan Shuster mit der klaren Vorgabe, das Finanzwesen zu reformieren, als Schatzmeister eingestellt. Shuster nahm sich rasch der zahlreichen Privilegien der Höflinge, der hohen Beamten, der ausländischen Offiziere und Günstlinge an. Russland forderte die iranische Regierung daraufhin ultimativ auf, Shuster zu entlassen. Als diese sich weigerte, besetzten am 20.Dezember 1911 Kosaken und in britischem Sold stehende Stammeskämpfer der Bakhtiaren das Parlament und suspendierten die Verfassung erneut. Die konstitutionelle Revolution war beendet.
DIE PAHLAVI-HERRSCHAFT
Im Ersten Weltkrieg operierten russische, britische und osmanische Truppen auf iranischem Boden, obwohl das Land offiziell seine Neutralität erklärt hatte. Die Kriegshandlungen ließen ganze Landstriche veröden, Hungersnöte brachen aus, das Volk revoltierte, vielerorts kam es zu Aufständen. In diese Situation platzte 1917 die Nachricht von der Oktoberrevolution in Russland. Aufgrund der besonderen Position Russlands in Iran hatte diese fundamentale politische und soziale Wende im nördlichen Nachbarland erhebliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung in Iran. Zum einen entschied die neue russische Führung, auf alle Privilegien und Besitzrechte der zaristischen Vorgängerregierungen in Iran zu verzichten und die Beziehungen zum südlichen Nachbarn auf eine neue, gleichberechtigte Grundlage zu stellen. Damit war Russland faktisch aus dem Teilungsvertrag von 1907 ausgeschieden. Zum anderen sah London so 1919 die einmalige Chance, die Positionen des einstmaligen Rivalen zu übernehmen und Iran unter ein vollständig britisches Mandat zu stellen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am erbitterten Widerstand der iranischen Bevölkerung.
Dieser Widerstand bildete im Übrigen nur ein Element der grundsätzlichen revolutionären Situation im Nachkriegsiran. Viele Aufständische aus den letzten Weltkriegsjahren hatten sich unterdessen organisiert, sie gründeten nach dem Ende des Krieges mit massiver sowjetischer Unterstützung »Sowjetrepubliken« auf iranischem Boden. Deren Milizen lieferten den britischen antisowjetischen Interventionstruppen unter General Dunsterville (Dunsterforces) erbitterte Kämpfe, die Regierung in Teheran musste ohnmächtig zuschauen. Dieses Machtvakuum nutzte am 21.Februar 1921 Reza Khan, ein Offizier der berüchtigten Kosakenbrigade, für einen Putsch.
Reza Khan wird Schah
Formal beendete Reza Khan die Kadjarenherrschaft noch nicht, er etablierte sich allerdings in den Folgejahren als der »starke Mann« Irans. Als Kriegs- und Finanzminister zog er im Hintergrund die Fäden. Er machte keinen Hehl aus seiner Absicht, Iran in einen starken, zentral regierten und modernen Nationalstaat zu verwandeln. Sein erklärtes Vorbild war dabei Mustafa Kemal, der spätere türkische Präsident Kemal Atatürk, der ebenfalls angetreten war, seinem Land durch tiefgreifende politische und soziale Reformen den Weg zu einer Entwicklung nach europäischem Vorbild zu ebnen.
In scheinbar völliger Umkehrung ihrer Protektoratsabsichten von 1919 ließen die Briten Reza Khan gewähren, weil sie erkannt hatten, dass nur ein starker und straff geführter Zentralstaat Iran in der Lage war, einer Weiterverbreitung des sowjetischen »Revolutionsvirus« Widerstand zu leisten. Zu den ersten politischen Maßnahmen Reza Khans als Kriegsminister gehörte deshalb folgerichtig die Schaffung einer nationalen Streitmacht, die seine Position stärken und die territorialen Auflösungserscheinungen in Iran bekämpfen sollte. Kern der Streitmacht war seine Kosakenbrigade, der er Teile der bis dato schwedisch geführten Gendarmerie und Reste der 1916 unter britischem Kommando aufgestellten South Persian Rifles anschloss. Britische Berater sorgten für eine modernere Bewaffnung und Ausbildung, die die Zentralarmee allen anderen bewaffneten Kräften in Iran bald überlegen machte.
Noch im ersten Amtsjahr als Kriegsminister zerschlug Reza Khan die revolutionären Erhebungen in Nord-Iran und die aus ihr hervorgegangenen »Sowjetrepubliken«. Danach richtete er sein Bestreben darauf, die militärische Autonomie der Stämme zu beenden. Ab 1922 vernichtete er die militärische Macht einer Reihe iranischer Stämme, nicht zuletzt die der Bakhtiaren. Gerade an dieser Kampagne ließ sich die neue britische Strategie besonders gut ablesen, denn die Bakhtiaren waren praktisch seit 1909 die Kontraktpartner der APOC für den Schutz der Ölfelder in Khuzestan gewesen. Jetzt wurden sie von den Briten zugunsten Reza Khans im Stich gelassen und mussten eine Niederlage hinnehmen.
Um seine wirklichen Absichten zu verschleiern und die revolutionäre Grundstimmung einzudämmen und zu kanalisieren, zeigte sich Reza in den ersten Jahren seiner verdeckten Machtausübung als »liberaler« Politiker, vor allem nach der Niederwerfung der Aufstände in Nord-Iran und der militärischen Macht der Stämme. Das Parlament erwachte zu neuem Leben, die Abgeordneten debattierten nicht zuletzt über die zukünftige Staatsform Irans. Die parasitäre Lebensweise der Kadjarenherrscher bestärkte eine machtvolle republikanische Strömung, sowohl im Volk als auch im Parlament und in der Beamtenschaft. Die hohe Geistlichkeit und die Großgrundbesitzer schlossen sich dagegen im royalistischen Lager zusammen. Vor allem die Geistlichen fürchteten ähnliche säkularistische Reformen wie in der Türkei, wenn sich der republikanische Gedanke durchsetzen sollte. Reza Khan, dessen Sympathien für Atatürk bekannt waren, wurde eindeutig zum republikanischen Lager gezählt.
Nicht nur mit dieser republikanischen Attitüde bewies Reza politischen Instinkt. So hatte er sich schon am 26.Februar 1921, also wenige Tage nach dem Putsch, der sowjetischen Nichteinmischung versichert, indem er einen weitreichenden Vertrag mit der Sowjetregierung unterschrieb. Die sowjetische Seite bekräftigte darin noch einmal den Verzicht auf alle Privilegien der Zarenzeit, Reza versprach seinerseits Nichteinmischung in sowjetische Angelegenheiten. Gleichzeitig bekräftigte er insbesondere in den Artikeln 5 und 6 des Vertrags das Recht der Sowjetunion, in Iran militärisch zu intervenieren, wenn sich auf iranischem Territorium eine Gefahr für die staatliche Integrität der Sowjetunion entwickeln sollte. Auf der Grundlage dieses Vertrags nahm die Sowjetregierung die Zerschlagung der iranischen Sowjetrepubliken letztlich hin.
Machtübernahme und Reformen
1923 hielt Reza seine zweijährigen Vorbereitungen der direkten Machtübernahme für abgeschlossen und seine Stellung für so gesichert, dass es ihm ungefährlich erschien, erstmals das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Ahmad Schah floh ins Exil nach London. Das Parlament übertrug dem neuen Ministerpräsidenten weitreichende Vollmachten. Dieser begann nun rasch, die republikanische Verkleidung abzustreifen. Um mit »eiserner Hand« regieren zu können und die Geistlichkeit auf seine Seite zu ziehen, bedurfte es des klaren Bekenntnisses zur Monarchie.





























