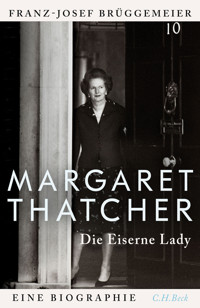22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Dein Grubengold hat uns wieder hoch geholt“ – mit dieser Songzeile drückte Herbert Grönemeyer 1984 aus, wem das Ruhrgebiet seine Bedeutung als Industrierevier zu verdanken hatte: der Kohle. 2018 schließen die letzten Steinkohlenzechen in Deutschland. Aus diesem Anlass erzählt Franz-Josef Brüggemeier die Geschichte des Rohstoffs, der ein ganzes Zeitalter prägte. Lange stand die Kohle für Fortschritt und Wohlstand. Sie ermöglichte einen ungeahnten Produktivitätsschub und lieferte die Energie, um aus den vormodernen Produktionsweisen auszubrechen. Ohne die Kohle wäre die Industrielle Revolution nicht möglich gewesen. Mit ihrer Hilfe erreichten die europäischen Gesellschaften bis ins 20. Jahrhundert hinein ein zuvor ungeahntes Entwicklungsniveau. Doch hatte dieser kohlegetriebene Sprung in die Moderne auch seine dunklen Seiten: Die Kohle lieferte die Energie für zwei desaströse Weltkriege, und die Bedingungen ihres Abbaus unter Tage waren für die Gesundheit der Arbeiter verheerend. Schließlich läuteten die Umweltbelastungen durch die Steinkohleförderung den Anfang vom Ende des wichtigsten fossilen Energieträgers in der Geschichte der Menschheit ein. Anschaulich und prägnant verfolgt Franz-Josef Brüggemeier diese Entwicklungen und zeigt, wie das Grubengold den Weg Europas in die Moderne prägte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Franz-Josef Brüggemeier
Grubengold
Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute
C.H.Beck
Zum Buch
Dampfmaschinen, stählerne Schiffe, Eisenbahnen, rauchende Fabrikschlote: die Industrielle Revolution verwandelte die Welt und katapultierte die Menschheit in die Moderne. Ihr Treibstoff war die Kohle. Lange stand sie für Fortschritt und Wohlstand. Sie ermöglichte einen ungeahnten Produktivitätsschub und lieferte die Energie, um aus den vormodernen Produktionsweisen auszubrechen. Doch hatte dieser kohlegetriebene Sprung in die Moderne auch seine dunklen Seiten: Die Kohle lieferte die Energie für zwei desaströse Weltkriege, und die Bedingungen ihres Abbaus unter Tage waren für die Gesundheit der Arbeiter verheerend. Schließlich läuteten die Umweltbelastungen durch die Steinkohleförderung den Anfang vom Ende des wichtigsten fossilen Energieträgers in der Geschichte der Menschheit ein. Anschaulich und auf dem neuesten Forschungsstand erzählt Franz-Josef Brüggemeier, wie dieser Rohstoff und sein Abbau ein ganzes Zeitalter prägten – bis ihm das Erdöl in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Rang ablief. Ein beeindruckendes europäisches Panorama und ein Nachruf auf den Wegbereiter der Industriegesellschaft.
Über den Autor
Franz-Josef Brüggemeier ist Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Freiburg. Bei C.H.Beck ist von ihm lieferbar: «Geschichte Großbritanniens im 20. Jahrhundert» (2010).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Eine Welt (fast) ohne Kohle
Anfänge und Mythen
Ungeliebte Kohle
Transport
Unter Tage
Muskelkraft und Erfahrungen
Bergleute und Unternehmer
Staat und Recht
Dampfmaschinen
Organische Gesellschaften
Eine Energiekrise um 1800?
2. Anfänge der Industrialisierung (ca. 1750–1830)
Kohle, Stahl und Eisenbahn
Politik, Staat und Unternehmer
Bergleute
Konflikte
Kohle und Gesundheit: Das Beispiel Bamberg
Eine ekelhafte Feuerung
Betriebe, Staat und Bürger
3. Kohle, Kohle, Kohle. Der Siegeszug der Steinkohle (ca. 1830–1914)
Nachfrage und Förderung
Technische Entwicklungen
Arbeit und Bergleute
Auswirkungen auf Umwelt und Natur
Rauch, Ruß und Abwässer
Debatten und Lösungen
Unglücke, Unfälle, Krankheiten und Verschleiß
Das Beispiel Courrières
Krankheiten und Verschleiß
Unfälle
4. Menschen, Menschen, Menschen
Der 16. Mai 1889
Unternehmer
Risiken, Kartelle und Gewinne
Bergleute, Familien, Fremde
Herkunft und Zuwanderung
Ankommen
Selbsthilfe
Religion und Kirchen
5. Streiks, Gewerkschaften und Demokratie
Arbeitserfahrungen
Konflikte
Anzin 1833
Ruhr, Saar und Oberschlesien 1889
Großbritannien, 1912
Belgien und Frankreich, 1890–1914
Deutschland vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs
Nach der Jahrhundertwende
Streiks 1912/13
Donez-Becken
Carbon Democracy?
6. Raum, Zeit, Natur (und China)
Gas und Licht
Wunderwelten
Raupenplage
Raum und Zeit
Warum Europa?
7. Kampf um Kohle (1914–1938)
Förderung und Nachfrage
Rationalisierung und Modernisierung
Umwelt
Konflikte, Streiks, Kämpfe
Erster Weltkrieg
Nach dem Krieg, 1918–1924
Stabilität und Krise, 1924–1938
8. Kohle im Zweiten Weltkrieg
Vorbereitungen auf den Krieg
Internationale Gespräche
Ersatzstoffe
Exkurs: Arthur Imhausen, ein Leben in Deutschland
Kohlemangel und Arbeitsbedingungen
Krieg
Herren über Europas Kohle
Auf dem Weg zur Zwangsarbeit
Ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen und Zwangsarbeit
Sowjetische Kriegsgefangene
Resistenz, Streiks, Widerstand
Großbritannien
Fürstengrube
Kriegsende
9. König Kohle
Kohlemangel und Arbeitskräfte
Sozialisierung und Verstaatlichung
Frankreich
Großbritannien
Bundesrepublik
Montanunion
Der 1. Januar 1958
10. Hoffnungsschimmer und Schrumpfung
Konkurrenten
Förderung und Verbrauch
Technik
Belegschaften
Umwelt
Subventionen
11. Abschied und Erbe
Schließungen und Proteste
Klassenkämpfe?
Thatcher und Scargill
Polen und Ukraine
Letzte Schritte
Energiewende 1
Energiewende 2
Herausforderungen
Finanzierung
Was bleibt – und was geht?
Anhang
Glossar
Anmerkungen
Einleitung
1. Eine Welt (fast) ohne Kohle
2. Anfänge der Industrialisierung (ca. 1750–1830)
3. Kohle, Kohle, Kohle. Der Siegeszug der Steinkohle (ca. 1830–1914)
4. Menschen, Menschen, Menschen
5. Streiks, Gewerkschaften und Demokratie
6. Raum, Zeit, Natur (und China)
7. Kampf um Kohle (1914–1938)
8. Kohle im Zweiten Weltkrieg
9. König Kohle
10. Hoffnungsschimmer und Schrumpfung
11. Abschied und Erbe
Literaturverzeichnis
Tabellen
Abkürzungsverzeichnis
Bildnachweis
Vorwort
Es mag etwas merkwürdig erscheinen, dass ich am Ende meines Berufslebens zu dem Thema zurückkehre, mit dem alles begann: dem Bergbau. Doch dieses Buch ist keine melancholische Rückkehr, sondern soll weit über mein erstes Thema und den Bergbau hinaus die vielfältigen Aspekte der Kohle und ihren Einfluss auf die europäische Geschichte seit etwa 1750 nachzeichnen. Meine Dissertation behandelte Ruhrbergleute von 1889 bis 1919, und ihr Schwerpunkt lag auf der Alltags- und Sozialgeschichte. In späteren Veröffentlichungen kamen weitere Themen, Aspekte und methodische Ansätze hinzu, von denen die meisten sich in der vorliegenden Untersuchung wiederfinden. Das erscheint wie ein Zufall und war sicherlich nicht geplant, folgt aber einer Logik, die sich aus der Kohle selbst ergibt. Denn dieser Stoff besitzt so viele Facetten und ermöglichte so unterschiedliche Entwicklungen, dass seine Darstellung zwangsläufig zentrale Merkmale der jüngeren europäischen Geschichte behandelt und einen breiten Zugang erfordert. Davon ist das vorliegende Buch geprägt, das viele Bereiche und Entwicklungen behandelt, die mich schon länger interessieren, dabei zugleich aber nur einen ersten Überblick über das Zeitalter der Kohle in Europa bieten kann.
Die Arbeit am Buch erforderte viel Zeit für Lektüre und Recherchen zu den verschiedenen Themen und Ländern – und sie erforderte noch mehr Unterstützung, um zu einem guten Ende zu kommen. Daran hat es nicht gefehlt. Im Gegenteil: Dieses Buch hat mehr Unterstützung von Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen erfahren, als ich je erhoffte. An erster Stelle nennen möchte ich meine Frau, die sich fertige wie unfertige Überlegungen anhörte, Entwürfe und Kapitel in den unterschiedlichsten Stufen las und dabei nicht nur die Geduld behielt, sondern auch viele wichtige Ratschläge gab. Ebenfalls viel Zeit und Rat investierten Hans Woller, Georg Cremer und Ludger Claßen, die zahlreiche Verbesserungen vorschlugen, Fehler ausmerzten und mich bestärkten, dieses Buch zu beginnen und es schließlich zu Ende zu schreiben. In wichtigen Einzelfragen berieten mich Jörg Arnold, Michael Farrenkopf, Michael Ganzelewski, Peter Itzen, Peter Kramper, Jon Mathieu, Nils Metzler-Nolte, Willi Oberkrome, Stefan Przigoda und Roman Köster. Bei der Recherche und den Korrekturen halfen Andreas Bolte, Judith Brukowski, Colin Brüggemeier, Jonas Goehl, Marie-Christin Krüger, Kerstin Laute, Nora Hendriscke, Lea Pfeffermann und Dagmara Kuriata, bei der Suche nach Abbildungen Carola Samlowsky. Das intensive Lektorat durch Matthias Hansl hat dem Buch sehr gut getan, ebenso die Zusprache von Sebastian Ullrich und dessen Bereitschaft, es bei C.H.Beck zu veröffentlichen. Ebenso wichtig war die freundliche Unterstützung durch die DFG und durch FRIAS (und deren Gutachter), die mir die dringend benötigte Zeit zur Verfügung stellten und viele interessante Diskussionen ermöglichten. Für die unvermeidlichen Fehler, die hoffentlich nur Kleinigkeiten betreffen, zeichnet allerdings allein der Autor verantwortlich.
Nun liegt das Buch vor. Mir hat seine Erstellung große Freude bereitet, und ich war oft überrascht, wie abwechslungsreich das Thema Kohle ist. Beides, Spaß und Überraschungen, wünsche ich auch den Leserinnen und Lesern.
Einleitung
Kohle schuf die Welt, in der wir leben. Sie war die Grundlage der europäischen Industrialisierung, ermöglichte den Aufstieg Deutschlands zur Großmacht und festigte die Herrschaft der europäischen Mächte über weite Teile der Welt; dieser Brennstoff verwandelte die beiden Weltkriege in blutige Materialschlachten, die fast achtzig Millionen Tote forderten, und stellte parallel dazu die Stoffe zur Verfügung, aus denen die chemische Industrie betörende Farben, neue Medikamente und die ersten Plastikprodukte schuf; Kohle ließ einen Bergbau entstehen, der beeindruckende technische Leistungen hervorbrachte, auf seinem Höhepunkt mehr als zwei Millionen Beschäftigte zählte, Zuwanderern aus ganz Europa eine neue Perspektive bot und zugleich ganze Landschaften umpflügte; sie etablierte unsere Abhängigkeit von der Energie, ohne die moderne Industriegesellschaften nicht überleben können; sie verursachte gravierende Umweltbelastungen, von denen CO2 aktuell eine globale Bedrohung bedeutet; und Kohle war Anlass erbitterter Klassenkämpfe, aber auch Motor demokratischer Entwicklungen und leitete nach dem Zweiten Weltkrieg die europäische Einigung ein. Anders ausgedrückt: Kohle hat unsere Welt verändert, im Positiven wie im Negativen.
Davon handelt dieses Buch. Es geht nicht davon aus, dass die genannten Entwicklungen ohne Kohle gar nicht stattgefunden hätten. Allerdings bestand zu ihr lange Zeit keine Alternative, denn Kohle konnte nur sehr begrenzt – und oft gar nicht – durch andere Stoffe ersetzt werden. Ohne sie wäre der Weg in die Moderne deutlich langsamer verlaufen und vielfach ganz anders beschritten worden. Es ist folglich gerechtfertigt, von einem Zeitalter der Kohle zu sprechen.
Dieses Zeitalter reicht nicht lange zurück. In Großbritannien begann es Ende des 18. Jahrhunderts, in Belgien, Frankreich und Deutschland erst um 1840, in anderen europäischen Ländern sogar noch später. Und sein Ende ist abzusehen. Am 31. Dezember 2018 stellen in Deutschland die letzten zwei Zechen ihre Förderung ein: Prosper-Haniel in Bottrop und das Bergwerk Ibbenbüren im Tecklenburger Land. Damit endet der Steinkohlebergbau in der Bundesrepublik. In den meisten anderen europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Griechenland, Tschechien, Italien) wurde dieser bereits vor längerem eingestellt oder auf den Abbau kleinster Mengen reduziert. Eine nennenswerte Förderung findet nur noch in Polen, Russland und der Ukraine statt – und bis Ende 2018 noch in den beiden genannten deutschen Zechen. Bei deren Schließung finden Veranstaltungen statt; Funk, Fernsehen und Zeitungen werden einige Tage darüber berichten. Doch insgesamt findet das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland nur wenig Beachtung.
Dieses geringe Interesse ist verständlich. Ende 2017 beschäftigte der früher so wichtige Bergbau nur noch etwa 3000 Personen und besaß selbst im Ruhrgebiet, seinem früheren Kernland, keine besondere wirtschaftliche Bedeutung mehr. Außerhalb des Ruhrgebiets dürften viele Deutsche nicht einmal wissen, dass in ihrem Land Steinkohle gefördert wird. Die wenigsten von ihnen werden Kohlestücke jemals gesehen, geschweige denn in der Hand gehalten haben. Als Brennmaterial in Haushalten hat dieser Rohstoff seit langem ausgedient und spielt auch sonst im Alltag keine Rolle mehr. Kohle hat mittlerweile einen äußerst schlechten Ruf, keiner will sie mehr haben.
Vor etwa 200 Jahren sah es ähnlich aus. Um 1800 zählte der Bergbau an der Ruhr gerade einmal 1200 Beschäftigte. Er besaß in Deutschland und auf dem europäischen Kontinent eine lange Tradition, spielte aber ökonomisch, politisch oder gesellschaftlich nahezu keine Rolle. Wer immer konnte, hielt sich von Kohle fern. Sie verursachte Ruß und Schmutz und war nur für wenige Zwecke geeignet. Das änderte sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts. Innerhalb weniger Jahre stieg die Förderung in Europa geradezu dramatisch an. Kohle gab der Industrialisierung den entscheidenden Schub, sie erwies sich als unentbehrlich. Wer an Kohle gelangte, konnte am wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben, und wer viel davon förderte, wurde Großmacht – wie Großbritannien und Deutschland. Zwar stießen diese beiden Nationen nicht wegen des viel beschworenen Grubengolds in zwei Weltkriegen aufeinander, doch wären ihre Auseinandersetzungen ohne Kohle wohl ganz anders verlaufen. «Es ist zu betonen, dass die Kohle der Ausgangspunkt für alles ist, was für den Krieg notwendig ist», stellte Albert Speer, Hitlers Rüstungsminister, 1944 fest.[1]
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das Leid und die Zerstörungen besonders groß und ließen unterschiedliche Vorstellungen darüber entstehen, wie es in Europa weitergehen sollte. In einem Punkt allerdings stimmten alle überein: Ohne Kohle konnte dieser Kontinent nicht wiederaufgebaut werden. Allerdings zeigte spätestens der kalte Winter 1946/7 unerbittlich auf, dass an diesem Brennstoff Mangel herrschte. Im Herbst 1946 fiel die Ernte spärlich aus, und als im Winter die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad sanken, starben mehrere Hunderttausend Deutsche an Hunger oder Kälte. Zwei Jahre später blockierten sowjetische Truppen die Zufahrt nach Berlin, das für 16 Monate aus der Luft versorgt werden musste. Flugzeuge brachten die dringend erforderlichen Güter in die abgeschnittene Stadt und wurden wegen ihrer Ladung als Rosinenbomber bekannt. Doch tatsächlich bestand die Fracht zu etwa 70 Prozent aus Kohle, die als Heizmaterial und zur Stromproduktion das Überleben sicherte.
Auch ein Blick nach China verdeutlicht die große Bedeutung dieses Rohstoffs. In einer der derzeit interessantesten Debatten verweisen Chinahistoriker darauf, dass das Reich der Mitte bis etwa 1750/1800 in vielen Bereichen ein vergleichbares Entwicklungsniveau wie Europa besessen habe. Danach hätten die Unterschiede jedoch rapide zugenommen. Es kam zum Aufstieg Europas, zur «Great Divergence», die einige Historiker vor allem darauf zurückführen, dass in Europa genügend Kohle zur Verfügung stand. Diese lieferte ungeahnte Mengen an Energie, die zudem in gespeicherter und leicht transportierbarer Form verfügbar war und an nahezu jedem Ort genutzt werden konnte – vor allem in einer Zeit, in der Eisenbahn und Dampfschiffe einen preiswerten und raschen Transport ermöglichten. Dass diese Faktoren der europäischen Industrialisierung einen wichtigen Schub gaben, ist unbestritten. Es wird jedoch kontrovers diskutiert, wie hoch der Anteil der Kohle daran zu veranschlagen ist – ob sie die Industrialisierung überhaupt erst ermöglichte oder ob sie nur ein Faktor unter vielen war und erst in einer späteren Phase wirkmächtig hinzutrat.
Ein anderes Merkmal des Bergbaus waren die überaus heftigen Konflikte zwischen Zechenbesitzern und Bergleuten. Dabei ging es um Löhne und Arbeitsbedingungen, aber auch um die grundsätzliche Stellung von Arbeitern und Unternehmern, um Demokratie und Herrschaft, die Rolle von Parlamenten und ganz grundsätzlich um politische Macht. Vor allem im Bergbau standen sich in ganz Europa Arbeiter und Unternehmer bis vor kurzem erbittert gegenüber. Der Nahosthistoriker Timothy Mitchell hat jüngst die These der «Carbon Democracy» formuliert und einen engen Zusammenhang von Kohle und Demokratie beschrieben. In einem Vergleich von Bergbau- und Erdölländern kommt er zu dem Ergebnis, dass Erstere deutlich bessere Voraussetzungen dafür besaßen, demokratische Strukturen hervorzubringen und sie zu etablieren.
Wer die lange Konfliktgeschichte des europäischen Bergbaus kennt, wird auf diese These mit Überraschung reagieren. Doch sie erlaubt es, den Zusammenhang von Bergbau, Kohle und Politik neu zu sehen. Zusätzlich ist sie auch deshalb interessant, weil sie unqualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter in den Mittelpunkt stellt, die sich in modernen Industriegesellschaften ausgegrenzt fühlen und ihren Unmut vielfach in populistischen Bewegungen äußern. Zu dieser Gruppe zählten auch Bergleute, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg nur eine geringe Ausbildung genossen und zudem oftmals nur den Status von Zuwanderern innehatten. Das waren schlechte Bedingungen, um Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit zu entwickeln und eigenständig Interessen zu vertreten. Dennoch gelang es ihnen. Zu fragen ist deshalb, worauf diese Handlungsmöglichkeiten beruhten, ob sie heute noch Zuwanderern und gering Qualifizierten zur Verfügung stehen oder ob mit dem Ende des Steinkohlebergbaus eine Phase innerhalb des Kapitalismus endet, die selbst den vermeintlich Zukurzgekommenen Möglichkeiten bot.
Ist das Zeitalter der Kohle tatsächlich vorbei? Wenn es lediglich um die Förderung geht, ist die Antwort einfach: Sie endet in Deutschland am 31. Dezember 2018. In den meisten anderen europäischen Ländern findet seit längerem keine Förderung mehr statt, und auch in Osteuropa dürfte sie demnächst ausklingen. Ein Ende der Förderung ist in Europa also abzusehen. Deutlich anders sieht es beim Gebrauch von Kohle aus. In Deutschland ist sie trotz der Energiewende für Kraftwerke weiterhin unverzichtbar und wird seit einigen Jahren in großen Mengen importiert. Genauso verhält es sich in anderen europäischen Ländern, wo dieser Brennstoff zumindest in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten ebenfalls eine wichtige Energiequelle bleiben wird. Und bei globaler Betrachtung kann erst recht nicht von einem Ende des Kohlezeitalters gesprochen werden. Weltweit wird mehr Kohle gefördert und verbraucht als je zuvor. Eine weitere Steigerung mag ökologisch unerwünscht sein, könnte aber eintreten.
Auch bei anderen Aspekten fällt es schwer, von einem Ende des Zeitalters der Kohle zu sprechen – vor allem bei der Abhängigkeit der Industriestaaten von Energie. Diese erlangte ihre heutige Bedeutung erst mit dem Aufstieg der Kohle, und inzwischen sind wir darauf so fixiert, dass bisher alle Bemühungen, den Verbrauch an Energie zu mindern und von ihr unabhängiger zu werden, erfolglos blieben. Ebenfalls anhalten wird der Beitrag der synthetischen Chemie zur fortwährenden (Neu-)Erschaffung unserer Welt; dazu wird inzwischen kaum noch Kohle genutzt, doch die grundlegenden Kenntnisse, die um 1850 bei deren Verarbeitung gewonnen wurden, gelten bis heute. Noch in Jahren schließlich werden die erheblichen Veränderungen der Landschaften zu sehen sein, in denen Kohlebergbau stattfand.
Anders ausgedrückt: Die folgenden Kapitel behandeln die erstaunliche Geschichte eines Rohstoffs, der seit Jahrhunderten genutzt wird, seine enorme Bedeutung aber erst im Laufe des 19. Jahrhunderts erlangte und seitdem wesentliche Bereiche von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in Europa entscheidend prägte. Hierzu liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die oft allerdings einzelne Reviere, wenn nicht Zechen, behandeln und ihren Schwerpunkt auf die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg legen. Zusätzlich stellen umfassende Darstellungen und internationale Vergleiche wichtige Kenntnisse zur Verfügung. Aber eine Darstellung, die Kohle als europäisches Thema aufgreift, fehlt. Schon Untersuchungen, die über einzelne Reviere hinausreichen und ganze Länder behandeln, sind Mangelware. Noch größer sind die Defizite für die Themen, die über den Bergbau hinausreichen.
Das vorliegende Buch kann deshalb die verschiedenen Länder nicht gleichgewichtig behandeln oder gar eine umfassende Gesamtdarstellung bieten. Dafür fehlt es an den erforderlichen Vorarbeiten. Das ist eine erstaunliche Feststellung, da inzwischen zu anderen Rohstoffen beeindruckende Untersuchungen vorliegen, so zu Baumwolle, Zucker, Reis oder Gummi. Die Kohle hingegen, fraglos die wichtigste Ressource der letzten 250 Jahre, hat noch kein vergleichbares Interesse gefunden.
Diejenigen Länder und Aspekte, die besser untersucht sind, werden in den folgenden Kapiteln unvermeidlich eine größere Rolle einnehmen. Ziel ist jedoch ein möglichst umfassender Überblick, der sich in drei Blöcke unterteilen lässt. Der erste behandelt die langen Zeiträume, in denen Kohle zwar gefördert und genutzt wurde, aber nur in kleinen Mengen, und fragt nach den Gründen für diese geringe Bedeutung. Der zweite Block steht im Zentrum der Darstellung. Er behandelt den Aufstieg der Kohle und deren vielfältige Folgen für die europäische Geschichte. Dazu untersucht er den Zeitraum von etwa 1750, als der Aufstieg begann, bis 1958, als ihr Niedergang einsetzte. Dieser ist das Thema des dritten Blocks, der einen knappen Überblick über den Abstieg gibt und erörtert, ob und wie das Zeitalter der Kohle zu Ende geht und wo es auf absehbare Zeit noch fortwirkt.
Zum Abschluss seien drei Hinweise gestattet. Wenn in dieser Darstellung von Kohle gesprochen wird, ist Steinkohle gemeint, nicht Braunkohle. Eigentlich müsste der genauere Begriff verwendet werden, was jedoch sprachlich umständlich und inhaltlich nicht erforderlich ist. Umgangssprachlich ist mit «Kohle» in der Regel «Steinkohle» gemeint, die für die Themen der folgenden Kapitel bei weitem wichtiger war als Braunkohle, mit einer Ausnahme: der aktuellen Debatte über die Freisetzung von CO2 und Feinstäuben. Hier spielt Braunkohle eine wichtige Rolle und wird entsprechend berücksichtigt. Ansonsten geht es um Steinkohle, auch dann, wenn die Kurzformel «Kohle» benutzt wird.
Hinzu kommt, dass die vorliegende Darstellung nur entstehen konnte, weil zur Geschichte der Kohle, insbesondere des Bergbaus, die erwähnten Veröffentlichungen vorliegen. Diese wurden möglichst weitgehend ausgewertet, sind in den folgenden Ausführungen jedoch nur teilweise genannt. Angeführt sind lediglich die Titel, aus denen Zitate stammen, und diejenigen, die für einzelne Aspekte und Länder besonders wichtig sind.
Schließlich kennt der Bergbau viele, oft faszinierende Fachbegriffe. Diese sind allgemein nicht bekannt und haben oft verwirrende Bedeutungen. Sie werden deshalb möglichst selten benutzt – was Fachleute irritieren mag. Allen anderen wird die Lektüre erleichtert. Zusätzlich befindet sich am Ende des Buchs eine Auflistung und Erklärung der wichtigen Begriffe.
1.Eine Welt (fast) ohne Kohle
Anfänge und Mythen
Eines Morgens, so die Erzählung, wachte südlich der Ruhr ein Hirtenjunge neben einer Feuerstelle auf, die ihn am Abend zuvor erwärmt hatte. Die Holzscheite waren niedergebrannt, und auf dem Boden fand sich nur etwas Asche. Doch darunter bemerkte der Hirtenjunge Klumpen mit roter Glut. Mit seinem Stock stocherte er darin herum und fand kleine schwarze Steine, von denen einige glühten. Voller Aufregung rannte er nach Hause, berichtete seinem Vater davon, der die Stelle genauer untersuchte. Die schwarzen Steine hatte er schon gesehen, wusste aber nicht, dass sie glühen und sogar brennen konnten. Beim Graben fand er mehr davon und nahm sie mit nach Hause. Dort nutzte er sie fortan zum Heizen, zum Backen und zum Schmieden und berichtete den Nachbarn davon. Diese waren ganz begeistert, wollten ebenfalls diese schwarzen Steine haben und gruben danach. So begann der Kohlebergbau.
Diese und ähnliche Erzählungen finden sich in großer Zahl. Sie verweisen darauf, dass Kohle seit Jahrtausenden genutzt wird, in China wohl seit 1000 v. Chr., und später bei den Römern, die damit ihre Bäder erhitzten. Mit dem Ende des Römischen Reiches ging in Europa die Nutzung von Kohle zurück, nahm ab dem 8. Jahrhundert jedoch wieder zu, wobei die Quellen etwas ungenau sind. Umso zahlreicher sind mythische Schilderungen. In Belgien soll in grauer Vorzeit ein geheimnisvoller Greis ein Kohlestück auf einen Schmied geworfen habe, der sich über hohe Holzpreise beklagte und danach die billigere Kohle nutzte.[1] Die Soldaten Cäsars seien entsetzt vor Galliern geflohen, die durch Kohlestaub ganz schwarz aussahen. Und an der Ruhr kursierte die Geschichte vom Hirtenjungen.
Diese Erzählungen sind plausibel, denn an vielen Stellen in Europa reichten Kohleflöze bis an die Oberfläche und konnten durch Zufall gefunden und leicht abgebaut werden. Aus diesen Anfängen entstand der Kohlebergbau und wuchs allmählich an. Es gab aber Schwierigkeiten mit dem Grundwasser, das in größeren Tiefen in die Gruben strömte und den Abbau verhinderte, bis schließlich im 19. Jahrhundert neue Maschinen und Verfahren es erlaubten, größere Wassermengen abzupumpen, immer tiefere Zechen zu errichten und den Aufstieg der Industrie zu ermöglichen. Voller Stolz blickten Zeitgenossen auf diese lange Vorgeschichte zurück, deren Wurzeln sie auch in ihren Revieren fanden. So war 1898 für Franz Büttgenbach das Wurmrevier bei Aachen «was Alter und Ausdauer in der Geschichte der Steinkohlenindustrie anbetrifft, das Interessanteste des ganzen Kontinents, mithin wohl auch der ganzen Welt».[2]
Diese Aussage war fraglos übertrieben, wie überhaupt die Entwicklung zum modernen Bergbau nicht gradlinig verlief, sondern viele Brüche und Rückschritte erlebte und überaus lange dauerte. Vielerorts lagen die Anfänge im Frühen Mittelalter, doch es dauerte Jahrhunderte, bis größere Mengen gefördert wurden. Als Büttgenbach sein Wurmrevier anpries, arbeiteten im benachbarten Ruhrgebiet fast 230.000 Bergleute und bildeten das größte Revier Europas. Hundert Jahre zuvor betrug deren Zahl lediglich 1500. Diese verteilten sich auf 150 Gruben, die im Durchschnitt gerade einmal zehn, oft aber nur vier bis sechs Arbeiter zählten. Noch einmal einhundert Jahre zuvor war in der Grafschaft Tecklenburg, die eine lange Tradition der Kohleförderung besaß, das Interesse daran so gering, dass die Behörden um 1710 von den Kanzeln ihre Untertanen dazu aufforderten, Kohlegruben zu pachten. Diese blieben skeptisch. Denn sie wussten, dass Lagerstätten existierten, aber Enttäuschungen bereithielten – wie später ein Apotheker erfahren musste, der 1783 bei Vlotho ein mächtiges Flöz entdeckte und dieses abbauen wollte. Doch hinzugezogene Fachleute erklärten, der Fund sei zu klein, und ein Schmied, der die Kohle in seiner Werkstatt ausprobierte, lehnte sie wegen zu schlechter Qualität ab.[3] In Lüttich hingegen bestanden zur gleichen Zeit Zechen, die mehrere Hundert Bergleute beschäftigten, und in Großbritannien war im 18. Jahrhundert die Förderung von Steinkohle so wichtig geworden, dass ohne sie weder private Haushalte noch die aufkommende Industrie bestehen konnten. Sie war, so 1739 ein französischer Beobachter, «eine der wichtigsten Quellen des englischen Reichtums und Wohlstands. Ich betrachte sie als die Seele der englischen Erzeugnisse (manufactures).»[4]
Derart widersprüchliche Aussagen liegen für das ausgehende 18. Jahrhundert aus zahlreichen Regionen Europas vor. Sie bestätigen, dass Kohle an vielen Orten seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten genutzt wurde, zugleich aber in den einzelnen Regionen sehr unterschiedliche Bedeutung besaß und eine große Vielfalt an Bergbauindustrien hervorgebracht hatte. Dabei kann von Industrien eigentlich nur für Großbritannien und das Gebiet um Lüttich gesprochen werden. Nur hier gab es Zechen, die mehr als 600 Bergleute beschäftigten, fast 400 Meter in die Tiefe reichten, mehrere Zehntausend Tonnen Kohle abbauten und hohe Investitionen erforderten.[5] Um 1800 förderten die britischen Zechen mehr Kohle als alle anderen europäischen Reviere zusammen. Vereinzelt fanden sich auf dem Kontinent auch außerhalb von Lüttich größere Bergwerke. Doch vorherrschend waren kleine Gruben mit sechs bis zehn Personen, die nur wenige Meter in die Tiefe gruben, geringe Mengen abbauten und keinen großen Kapitalbedarf besaßen.
Für diese unterschiedlichen Entwicklungen gab es zahlreiche Gründe, darunter die Schwierigkeit, Kohle unter der Erde, bei Dunkelheit und unter großen Gefahren abzubauen. Diese Herausforderungen werden zu Recht betont, und es erforderte zahlreiche Bemühungen, sie nach und nach zu überwinden. Doch zugleich lagen viele Flöze nah an der Oberfläche und wurden dennoch nur zurückhaltend abgebaut. Außerdem fragt sich, warum in Großbritannien und um Lüttich große Bergwerke bestanden, in den anderen Regionen aber nicht mehr unternommen wurde, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Dafür gab es vor allem zwei Gründe, die den langsamen Anstieg des Steinkohlebergbaus erklären: das geringe Interesse an, ja sogar eine verbreitete Ablehnung von Kohle und die hohen Kosten, die bei deren Transport entstanden.
Ungeliebte Kohle
Der eingangs geschilderte Hirtenjunge mag glühende schwarze Steine entdeckt haben. Doch im Gegensatz zu den Mythen reagierten Zeitgenossen darauf nicht mit Begeisterung. Sie mussten vielmehr davon überzeugt werden, Kohle trotz ihrer unangenehmen Nebenwirkungen zu nutzen. Denn aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung ist sie ein unangenehmer Brennstoff. Sie existiert in unterschiedlichen Sorten, die zwischen 75 und 90 Prozent Kohlenstoff und außerdem Wasser, Stickstoff, Schwefel sowie weitere flüchtige Bestandteile enthalten. Bei der Verbrennung entstehen Rauch und Ruß, die lästig sind, die Umgebung einschwärzen und Schadstoffe freisetzen – zumal bei den damals üblichen Öfen und Herden, die für die Verfeuerung von Holz gebaut und für Kohle nicht geeignet waren.
Als Brennmaterial diente traditionell Holz, das kaum Schadstoffe enthält, auch bei geringem Zug gut verbrennt und wenig Rückstände hinterlässt. Wenn Holz trocken ist und locker geschichtet wird, genügen dafür offene Feuerstellen, die nur kleine Schornsteine besitzen und notfalls auch ohne diese auskommen. Kohle hingegen erfordert eine deutlich stärkere Zufuhr von Luft bzw. Sauerstoff, geeignete Roste und entsprechende Kamine, um den erforderlichen Zug und die angestrebten hohen Verbrennungstemperaturen zu erreichen. Wenn sie auf traditionellen Feuerstellen genutzt wurde, fehlten diese Voraussetzungen, und es entstanden große Mengen an Rauch und Ruß, die selbst arme Leute vor der Kohlenutzung zurückschrecken ließen. Nur wenn Holz zu teuer wurde, sahen sie sich dazu gezwungen, so um Lüttich und zunehmend in englischen Städten, darunter vor allem London, wo Ende des 17. Jahrhunderts die Verwendung von Kohle üblich war. London war die größte Stadt Europas und zählte fast 600.000 Bewohner, deren Nachfrage den Preis für Holz emportrieb; auch die Beschaffung ausreichender Mengen bereitete Probleme. In der Folge breitete sich die Kohle sukzessive aus. Nicht so beim Monarchen und wohlhabenden Adligen, die in ihren Salons und Privatgemächern weiterhin das angenehmere Holz verwendeten, während in den Räumen des Dienstpersonals und beim Kochen die preiswerte Kohle zum Einsatz kam.[6]
Zu deren Verbreitung trug auch bei, dass es unterschiedliche Sorten dieses Brennstoffes gab, von denen einige geringere Belastungen verursachten. Zudem wurden nach und nach geeignete Öfen errichtet, und Häuser erhielten höhere Kamine, die den Zug verbesserten. Doch diese Entwicklungen zogen sich über Jahrzehnte hin, da die Ursachen für die Entstehung von Ruß und Qualm zuerst verstanden und passende Lösungen gefunden werden mussten. Zusätzlich verursachte deren Umsetzung erhebliche Kosten, vor allem wenn bestehende Gebäude nachträglich neue Kamine erhalten sollten. Außerdem standen nicht überall die vergleichsweise sauberen Kohlesorten zur Verfügung, während der Holzpreis auf dem Kontinent – anders als in England – nur selten in solche Höhen schnellte, dass sich die Kohle als Brennstoff verbreitete. Besucher vom Kontinent bemerkten um 1700 in London zu ihrem Erstaunen, dass sie sich hier in privaten Haushalten durchgesetzt hatte. Eine vergleichbare Bedeutung besaß dieser Brennstoff nur in einigen belgischen Städten, während in Paris selbst Versuche damit erst etwa 20 Jahre später stattfanden.[7] In Bochum und Hattingen, wo die Förderung von Steinkohle eine lange Tradition besaß, wurde sie noch um 1750 nur zum Heizen, nicht hingegen zum Kochen und erst recht nicht für weitere Zwecke verwendet. In München, das damals immerhin 32.000 Bewohner zählte, und dem sonstigen Bayern stieß sie auch 1796 noch auf heftige Ablehnung.[8]
Handwerker betrachteten den Einsatz von Kohle ebenfalls mit Skepsis, wenn nicht mit Ablehnung. Vorteile bot sie Schmieden, da ihre Glut eine hohe Hitze erreichte und lange anhielt. Allerdings eigneten sich dafür nur bestimmte Sorten, von denen zudem große Stücke die beste Glut erzeugten – was beim erwähnten Fund in Vlotho nicht der Fall war, so dass der hinzugezogene Schmied die dortige Kohle als ungeeignet bezeichnete. Insgesamt erlangte der Brennstoff in diesem Handwerk jedoch eine gewisse Verbreitung, zumal Schmiede bereit waren, wegen der genannten Vorteile hohe Preise für Kohle zu zahlen und sie über große Entfernungen liefern zu lassen. Ebenfalls gut geeignet war sie für das Brennen von Kalk und nach und nach für die Herstellung von Ziegeln, die sich allerdings erst im 18. Jahrhundert durchsetzte. Als 1770 Fachleute aus Lüttich in Wien demonstrierten, wie Kohle beim Ziegelbrennen eingesetzt werden konnte, lockten sie zahlreiche Bewohner der Stadt an, die diese Neuigkeit hellhörig machte.[9]
Einen großen Bedarf an Brennmaterial besaßen auch Salzsiedereien, die Meerwasser oder Sole erhitzten, um Salz zu gewinnen. Traditionell nutzten sie Holz oder Holzkohle, da der Kohlerauch zu Verunreinigungen führen konnte. Hinzu kam, dass die Hitze beim Verbrennen von Kohle schwer zu regulieren war und dafür spezielle Roste vorhanden sein mussten. In Großbritannien setzte Kohle sich bei der Salzgewinnung dennoch bereits im 16. Jahrhundert durch; auch auf dem Kontinent wurden erste Versuche unternommen. Doch noch ein Jahrhundert später galt in Deutschland der Einsatz von Kohle in Salzsiedereien als eine besondere Kunst. 1624 reisten von Halle Beschäftigte der Salinen eigens nach Allendorf, «um die dortige Art des Salzsiedens mit Mineralkohle zu erforschen und einige Salzsieder mit nach Halle zu bringen».[10]
Noch länger herrschte Holz in Bäckereien, Brauereien, beim Färben von Textilien, der Herstellung von Glas und in zahlreichen anderen Gewerben vor. Denn deren Produkte litten, wenn brennende Kohle Rauch, Ruß oder Gase freisetzte. Solche Schadstoffe belasteten auch die Herstellung von Eisen und minderten dessen Qualität. Bei der Verarbeitung des Eisens bot Kohle die Vorteile großer Hitze, nicht hingegen bei den Schmelzprozessen. Diese sollten Eisen erzeugen, das möglichst keine Verunreinigung aufwies, wozu sich Holzkohle besser eignete. Die schwefligen Kohlegase hingegen ließen Eisen von geringer Qualität entstehen, das leicht zerbrach. Die zahllosen Versuche, Kohle dennoch bei der Verhüttung einzusetzen, brachten nicht das gewünschte Ergebnis. Eine Lösung fand sich erst, als es im Laufe des 17. Jahrhunderts gelang, Koks herzustellen. Dazu wurde (und wird bis heute in Kokereien) Kohle erhitzt, allerdings abgedeckt, damit möglichst wenig Kontakt zu Sauerstoff entsteht und die Kohle zwar glüht, aber nicht verbrennt. Bei hohen Temperaturen entweichen die unerwünschten Bestandteile, und nach Abkühlung verbleibt Koks, der kaum noch Schadstoffe enthält. Er konnte Holzkohle ersetzen und bei der Herstellung von Eisen eingesetzt werden, doch dazu mussten noch spezielle Hochöfen entstehen.
1709 stellte Abraham Darby den ersten Hochofen vor, der mit Hilfe von Koks Eisen erzeugte. Doch die genauen Zusammenhänge waren nicht verstanden, und es dauerte noch mehrere Jahrzehnte und erforderte zahlreiche weitere Versuche, bis sich dieses Verfahren in Großbritannien und danach auf dem Kontinent durchsetzte. In Frankreich war es Ende des 18. Jahrhunderts zwar grundsätzlich bekannt, wurde aber wegen letztlich unzureichender Kenntnisse nicht genutzt; auch in Deutschland verdrängte Koks bei der Eisenerzeugung erst im Laufe des 19. Jahrhunderts die Holzkohle. Zuvor hatten in Großbritannien bereits Bierbrauer, Bäcker, Glasmacher und andere Handwerker den Vorteil von Koks erkannt und dieses Material genutzt, allerdings in überschaubaren Mengen.
Für die weitere Entwicklung des Bergbaus deutlich wichtiger war der Einsatz bei der Eisenerzeugung. Diese verbrauchte traditionell erhebliche Mengen an Holzkohle, so dass bereits ein großer Absatzmarkt bestand, den Koks nach und nach bediente. Immer größere Hochöfen kamen auf, um nicht nur wachsende Mengen an Eisen und Stahl herzustellen, sondern diese auch in besserer Qualität und zu fallenden Preisen anzubieten. In der Folge stieg die Nachfrage – auch nach Kohle bzw. Koks –, und die moderne Eisen- und Stahlindustrie entstand, allerdings erst im Laufe des 19. Jahrhunderts.
Transport
Der Absatz von Kohle litt auch unter hohen Transportkosten. Kohle besitzt einen hohen Brennwert, aber auch ein großes Gewicht, das den Transport über Land massiv erschwerte. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein waren Straßen kaum oder gar nicht befestigt und von Schlaglöchern durchzogen, verschlammten bei Regen und konnten im Winter kaum benutzt werden. Ende des 17. Jahrhunderts besaß England – neben den Niederlanden – das wohl am besten ausgebaute Straßennetz Europas. Doch auch hier waren bei Kohle die Transportkosten so hoch, dass sich deren Preis nach etwa zehn Kilometern verdoppelte. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts setzte sich Kohle entlang der Themse nur in den Orten durch, die weniger als 20 Kilometer vom Fluss entfernt lagen; in größerer Entfernung wurde sie so teuer, dass weiterhin Holz vorherrschte.[11]
Die in London gehandelte Kohle hatte bereits weite Wege zurückgelegt. Vorwiegend kam sie aus dem Revier um Newcastle, das mehr als 400 Kilometer entfernt lag, aber einen preiswerten Transport über Wasser erlaubte. Von den Zechen gelangte Kohle über Flüsse zum nächsten Hafen und von dort über das Meer bis nach London oder in andere Städte. Einer Schätzung aus dem Jahre 1675 zufolge hätte der Landtransport von Newcastle nach London 60-mal so viel gekostet wie der Seeweg.[12] Für andere Reviere liegen derartige Kalkulationen nicht vor, doch überall galt, dass eine Anbindung an Gewässer erforderlich war, um Kohle über die unmittelbare Umgebung hinaus abzusetzen. So gelangte sie etwa von Lüttich in die Niederlande. Diese erhielt Kohle auch von der Ruhr, deren Zechen ebenfalls Köln und Düsseldorf versorgten. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts war britische Kohle, die auf dem Wasserweg nach Berlin gelangte, preiswerter als die Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet. Der Landweg war zu teuer. Und bei Transport über Wasser musste sie erst über den Rhein zur Nordsee gelangen, dort umgeladen werden und dann die preußische Hauptstadt erreichen, was zu hohe Kosten verursachte.
Transportkosten entstanden auch bei anderen Gütern. Doch bei Kohle fielen sie besonders ins Gewicht, da dieser Brennstoff nur in wenigen Regionen vorhanden war, die oft entfernt von den wichtigen Handels- und Gewerbezentren lagen – im Gegensatz zum Konkurrenten Holz, das nahezu überall bereitstand, nur geringe Entfernungen zurücklegen musste und sich auch deshalb so lange behaupten konnte. Vereinzelt gab es wichtige Kunden für Kohle im Umfeld der Bergwerke, so Salinen, die in Westfalen und Ibbenbüren die wichtigsten Abnehmer waren. Allerdings benötigten Fuhrleute 1744 ganze zwei Tage, um Kohle von Bochum zur 40 Kilometer entfernten Saline in Unna zu bringen. Sie mussten in einer Herberge übernachten, was zusätzlich zu den Kosten für Personal, Wagen und Pferde die Ausgaben weiter in die Höhe trieb.[13] Später stieg die Nachfrage, wo Kohle- und Erzvorkommen beieinander lagen wie im Ruhrgebiet, in Lothringen oder in Belgien. Doch abgesehen von solchen glücklichen Zufällen kam es vor allem darauf an, die Transportkosten zu senken.
In Großbritannien half die Natur. London – der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt – und die nördlichen Kohlereviere waren über das Meer miteinander verbunden, so dass die Transportkosten hier von Beginn an gering ausfielen und zusätzlich durch ein umfassendes Kanalnetz weiter gesenkt wurden. Kanäle entstanden nicht nur für Kohle, sondern auch für andere Güter wie Leinen, Wolle, Textilien oder Nahrungsmittel, die auf diesem Wege ebenfalls deutlich preiswerter transportiert werden konnten. Derartige Kanäle fanden sich vereinzelt auch auf dem Kontinent. Doch in England entwickelte sich ein besonders dichtes Netz, das den preiswerten Transport von Kohle erlaubte und dem Bergbau großen Aufschwung gab. Dabei griffen mehrere Faktoren ineinander. Die steigende Nachfrage nach Kohle begünstigte den Ausbau von Kanälen, die wiederum die Transportkosten und damit den Kohlepreis senkten, die Nachfrage stimulierten und die Unternehmer veranlassten, größere Zechen zu errichten, die wiederum gewinnbringende Kanalbauten erlaubten usw.
Ein gutes Beispiel für diesen Zusammenhang ist der Bridgewater Canal, der 1761 eröffnet wurde und Zechen in Worsley mit Manchester verband. Bis dahin wurde deren Kohle über Flüsse mit schwankendem Wasserstand und auf dem Rücken von Pferden transportiert, die keine große Last tragen konnten. Der Kanal, der sich an französischen Vorläufern orientierte, stellte zahlreiche technische Herausforderungen und erforderte hohe Investitionen, spielte aber nach seiner Fertigstellung die Kosten bald ein. Er halbierte den Preis für Kohle in Manchester, erhöhte infolgedessen deren Absatz und ließ die Förderung in Worsley ansteigen – was der Erbauer des Kanals, der Herzog von Bridgewater, erwartet hatte, um die hohen Ausgaben zu finanzieren. Sein Modell fand zahlreiche Nachahmer. Bei solchen Kanalbauten handelte es sich um komplexe Vorhaben, während viele der anderen Neuerungen im Transportbereich unspektakulär ausfielen und jahrelange Entwicklungen durchliefen, in ihrer Wirkung aber nicht geringer einzuschätzen sind. Das gilt für die Befestigung von Wegen und Straßen, die Herstellung stabiler Räder und belastbarer Achsen oder die Entwicklung kleiner und kostengünstiger Schiffe, die Kohle auf Wasserstraßen und entlang der Küste beförderten. Dazu musste sie allerdings erst einmal gefördert werden.
Unter Tage
Die Förderung von Kohle ist bis heute wesentlich durch ihre Entstehungsbedingungen geprägt. Sie entstand aus Sumpfwäldern, die vor 250 bis 350 Millionen Jahren existierten und nach und nach durch Ton-, Sand- oder Gesteinsschichten abgedeckt wurden. Diese Abdeckung erzeugte wachsenden Druck und hohe Temperaturen, entwässerte die eingeschlossenen Pflanzen und führte zum Prozess der sogenannten Inkohlung, bei dem durch Hitze und Druck Steinkohle entstand. Dieser Prozess wiederholte sich, so dass mehrere Schichten von Kohle, Sandstein, Ton und anderem Gestein übereinander liegen können. Anfänglich verliefen diese Ebenen waagrecht, waren dann jedoch heftigen Bewegungen der Erdkruste ausgesetzt. Diese drückten die Schichten zusammen und erzeugten Brüche, Steigungen, Gefälle und Verwerfungen. Sie ließen zudem verschiedene Kohlesorten und unterschiedlich dicke Flöze entstehen, pressten diese tief nach unten, aber auch in die Höhe und brachten Regionen hervor, die nur kleine Lagerstätten kannten, und andere, die von mächtigen Flözen durchzogen waren. Einige davon reichten immer schon bis an die Oberfläche, andere wurden freigelegt, wenn Erosionen die Deckschichten abtrugen, und wieder andere befanden sich tausend und mehr Meter in der Tiefe.
Die Anfänge des Kohlebergbaus begannen deshalb an der Oberfläche und dehnten sich in geringe Tiefen aus, solange dieser Rohstoff mit wenig Aufwand gewonnen werden konnte. Ebenfalls gut zugänglich waren Flöze, die sich in hügligen Gegenden innerhalb der Berge befanden und waagrecht verliefen oder nur eine geringe Neigung aufwiesen. In beiden Fällen folgte der Abbau der Richtung der Flöze, bis die Gänge und Hohlräume so groß wurden, dass sie durch hölzerne Stempel und Balken abgesichert werden mussten. Damit waren höhere Kosten und wachsende Risiken verbunden, die dazu führen konnten, die Gruben aufzugeben oder sie bei ausreichenden Gewinnen auszubauen – sofern die Sicherheit gewährleistet war. Das einfachste Verfahren bestand darin, Flöze nicht komplett abzubauen, sondern Teile davon als Stützpfeiler stehen zu lassen, was aber die Erträge schmälerte. Diese litten auch darunter, dass Kohleflöze bei ihrer Entstehung den beschriebenen Kräften ausgesetzt waren. Vielfach verliefen sie deshalb sehr unregelmäßig, änderten plötzlich die Richtung oder hörten ganz auf. Wenn es gelang, sie an anderer Stelle wieder aufzuspüren, konnte der Abbau weitergehen. Doch angesichts der geringen geologischen Kenntnisse war dies – wie das Auffinden von Lagerstätten generell – bis in das 19. Jahrhundert hinein weitgehend dem Zufall überlassen.
Nicht nur Kohleflöze, auch das umgebende Gestein verlief oft unregelmäßig und konnte zudem brüchig sein und leicht einstürzen. Generell ist die Einsturzgefahr bei der Förderung von Steinkohle größer als im Erzbergbau. Dieser findet vorwiegend in felsigem Gebirge statt, und es erfordert großen Aufwand, um Wege in das harte Gestein zu schlagen, das im Gegenzug jedoch robuster ist, nicht so leicht einstürzt und folglich weniger Schutzmaßnahmen erfordert. Zusätzlich wies der Erzbergbau noch zwei andere Besonderheiten auf: Bei der Förderung von Eisen-, Blei-, Silber- oder Golderzen konkurrierten Reviere und Bergwerke zwar miteinander, doch die aus den Erzen erstellten Metalle konnten nicht oder nur sehr schwer durch Alternativen ersetzt werden – so wie Kohle durch Holz. Und sie ließen sich leichter transportieren, zumal schon geringe Mengen – wie bei Gold oder Silber – einen sehr hohen Wert besaßen. Nach ihnen bestand eine große Nachfrage, sie erzielten gute Erträge und führten zu entsprechend umfangreichen Investitionen. Der Erzbergbau fand deshalb in größeren Dimensionen statt, war technisch innovativer und entwickelte auch für schwierige Herausforderungen Lösungen. Diese ließen sich auf den Steinkohlebergbau übertragen, wie der Blick auf den weit entwickelten Bergbau in Großbritannien und dem Lütticher Revier zeigt. In beiden Fällen bestand allerdings schon vor Ort eine beachtliche Nachfrage, die durch leistungsfähige Transportmöglichkeiten noch anstieg. Hier fiel es deshalb leichter, Kohle abzusetzen, angemessene Preise zu erzielen und die erforderlichen Mittel für den Bau großer Zechen und für anspruchsvolle Techniken aufzubringen.
Mit einer Herausforderung mussten und müssen sich alle Formen des Bergbaus auseinandersetzen: mit einströmendem Wasser, dessen Menge davon abhängt, wie viel die umgebenden Gesteinsschichten führen, wie oft und wie stark es regnet, ob sich in der Nähe Flüsse, Bäche oder Seen befinden und nicht zuletzt davon, ob der Bergbau ober- oder unterhalb des Grundwassers stattfindet. Lagen die Flöze unterhalb des Grundwasserspiegels, strömte das Wasser kontinuierlich in mehr oder minder großen Mengen ein und erforderte leistungsfähige Pumpvorrichtungen, insbesondere in den großen Bergwerken, deren Zahl im 18. Jahrhundert zunahm.
In kleinen Gruben, die an oder nur wenige Meter unter der Oberfläche lagen, verursachten einströmende Wassermengen keine ernsthafte Gefahr. Sie konnten aber zu erheblichen Einschränkungen und selbst zum Ende der Förderung führen. Größere Betriebe besaßen die Möglichkeit, natürliche Abflüsse zu nutzen, wenn Flöze und Strecken ein Gefälle aufwiesen. Hier errichteten sie unterhalb davon Kanäle, die Wasser sammelten und es nach außen fortleiteten. Einige davon erreichten eine Länge von mehreren Kilometern, setzten sich außerhalb der Gruben fort und dienten zur Bewässerung, wie seit dem 13. Jahrhundert in Lüttich. Doch nicht alle Abwässer waren unbedenklich, sie enthielten auch Schlamm, Gestein oder Schadstoffe, die Äcker, Bäche oder Flüsse belasteten, in die sie schließlich gelangten. Entsprechend wandten sich am 23. Juli 1754 Landwirte und Anwohner in Ibbenbüren mit einer Eingabe an den preußischen König und beschwerten sich über die verschmutzten Wassermengen, die ein Stollen auf ihre Grundstücke leitete.[14]
Eine andere Möglichkeit bestand darin, das Wasser am tiefsten Punkte zu sammeln, diesen notfalls selbst anzulegen und es von dort zur Oberfläche zu befördern. In kleinen Gruben und bei geringen Mengen reichte es, das Wasser in Eimern, Ledersäcken oder anderen Behältern nach oben zu tragen. Dieses Verfahren lag auch deshalb nahe, weil Bergleute ohnehin Leitern benötigten, um an ihre Arbeitsstellen und von dort wieder zur Oberfläche zu gelangen. Doch als die Betriebe anwuchsen, erreichten sie immer größere Tiefen und mussten mit wachsenden Wassermengen umgehen. Im Lütticher Kohlerevier reichten Gruben bereits Mitte des 14. Jahrhunderts bis auf 116 Meter und zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf 240 Meter Tiefe. Hier entstanden die erwähnten Entwässerungsgräben, die ein komplexes System bildeten, aber nicht verhindern konnten, dass im Jahr 1515 von 100 eingefahrenen Bergleuten 88 bei einem Wassereinbruch starben.[15]
Verbreiteter als Kanäle waren Verfahren, mit Wasser gefüllte Behälter an Seilen nach oben zu ziehen und dazu die Hebelwirkung zu nutzen, Kurbeln einzusetzen oder horizontale Drehbewegungen in vertikale Förderung umzuwandeln – etwa durch Göpel, die nicht nur bei der Kohle, sondern im Bergbau insgesamt eine große Bedeutung erlangten (Abb. 1). Im 18. Jahrhundert erfolgte deren Antrieb zunehmend durch Pferde, die im Kreis liefen, ein großes Rad in Bewegung setzten und mit ihrer Kraft sowohl erhebliche Wassermengen wie die gewonnene Kohle nach oben beförderten. Große Bergwerke setzten dazu Dutzende dieser Tiere ein und entwickelten ein komplexes System von Wasserstollen, tief gelegenen Sammelbrunnen und Pumpsystemen, um die Förderung aufrechtzuerhalten. Doch damit waren erhebliche Kosten verbunden, die nur wenige Betriebe aufbringen konnten. Zahlreiche Göpel – wie auch andere Fördereinrichtungen – wurden deshalb bis in das 19. Jahrhundert hinein von Menschen betrieben.
Abb. 1 Pferdegöpel, Frankreich um 1860
Ebenso wichtig war, unter Tage genügend frische Luft zuzuführen und die Explosionsgefahr zu bannen, die ausströmende Gase verursachten. Beide Herausforderungen sind untrennbar mit dem Abbau von Kohle verbunden, da mit größerer Tiefe die Versorgung mit frischer Luft nachlässt, während gleichzeitig in den Flözen chemische Prozesse ablaufen, die selbst Sauerstoff verbrauchen und zusätzlich Gase, vor allem Methan, freisetzen. Auch hier gilt, dass beide Probleme nicht weiter ins Gewicht fielen, solange sich der Abbau nur über wenige Meter erstreckte. Wurden größere Tiefen erreicht, legten Bergleute zusätzliche Gänge an, um Luft zuzuführen, oder führten Bohrungen durch, so in Ibbenbüren, um elf kleine Stollenschächte durch 17 sogenannte Lichtlöcher zu versorgen. An anderen Orten nutzten sie längliche Zylinder mit einer Welle und Kurbel, um die Luftzufuhr zu verbessern. Wenn die Kurbel schnell gedreht wurde, drückte sie frische Luft in die Grube, konnte aber auch in Gegenrichtung betrieben werden, Grubenluft absaugen und einen Unterdruck erzeugen, der frische Luft zuführte. Einen ähnlichen Zweck erfüllten hölzerne Kanäle, die mit Blasebälgen verbunden waren, oder Feuerkörbe, die in Bewetterungsschächten hingen. Deren Hitze erzeugte einen Sog und führte unter Tage zu einem Unterdruck, der frische Luft anziehen sollte. Schließlich gab es einen natürlichen Austausch, wenn im Sommer die Außenluft wärmer und im Winter kälter war als in den Gruben.
Die Wirksamkeit dieser Verfahren dürfte begrenzt gewesen sein, zumal bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht bekannt war, was «frische» Luft ausmachte. Erst um 1780 wies Lavoisier die Existenz von Sauerstoff nach, und danach vergingen weitere Jahre, bis die Aufnahme durch die Lungen und der Mechanismus der Atmung verstanden waren. Parallel dazu mussten Geräte entwickelt werden, die den Sauerstoffgehalt überhaupt messen konnten. Bis dahin konnten Bergleute nur ihren Erfahrungen vertrauen und vermieden Orte, wo sie besonders schnell erschöpft waren. Oder sie achteten auf ihre Kerzen und sahen es als Warnzeichen, wenn deren Flammen schwächer wurden oder ganz erloschen.
Auch die austretenden Gase konnten sie bis ins 19. Jahrhundert mit ihren Sinnen nicht zuverlässig wahrnehmen bzw. erst in Konzentrationen, bei denen eine Explosion drohte. Einzelne Bergleute besaßen anscheinend eine besonders empfindliche Wahrnehmung. In England jedenfalls wurden sie beauftragt, vor Arbeitsbeginn nach Gasen zu suchen. Da Methanblasen leichter waren als Luft und sich an der Decke von Stollen oder Abbauorten fingen, sollten sie diese auffinden und sie mit Stöcken aufwirbeln, um die Konzentration der Gase zu reduzieren, oder sie vorsichtig abbrennen.
Abb. 2 Abflammen von Gasen, um größere Ansammlungen und Explosionen zu verhindern, Großbritannien um 1860
Dennoch nahmen in Großbritannien gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Gasexplosionen zu, da in den großen Zechen zahlreiche Flöze gleichzeitig abgebaut wurden, die erhebliche Gasmengen freisetzten. Zugleich herrschte hier tiefste Dunkelheit. Die Bergleute benötigten deshalb Kerzen, Öllampen oder andere offene Lichter, die wiederum Explosionen verursachen konnten. Alle Lösungsversuche standen deshalb vor einem Dilemma. Kerzen und Lampen waren erforderlich, um überhaupt etwas sehen zu können. Um brennen zu können, mussten sie Sauerstoff erhalten, durften zugleich aber nicht mit Gasen in Kontakt kommen, um Explosionen zu vermeiden. Eine Lösung boten erst nach 1820 die Lampen des Engländers Humphry Davy. Er umgab die Flammen mit einem dichten Gewebe aus Metall, das Sauerstoff für die Flammen durchließ, zugleich aber dafür sorgte, dass Methangas, das ebenfalls eindrang, zwar verbrannte, aber keine Explosionen auslöste. Dadurch waren die Lampen sicher, erhielten aber durch das dichte Gewebe nur wenig Sauerstoff, erzeugten deshalb lediglich spärliches Licht und setzten sich nur langsam durch. Viele Bergleute waren bereit, das Risiko offener Flammen einzugehen. Denn deren Licht benötigten sie nicht nur, um Kohle zu gewinnen, sondern auch um die Gefährdungen durch Steinschlag oder nachgebende Stempel zu erkennen, die ein zumindest genauso großes Risiko bedeuteten wie die Explosionsgefahr durch Gase.
Muskelkraft und Erfahrungen
Bereits vor der Industrialisierung fanden im Kohlebergbau bemerkenswerte technische Entwicklungen statt, um Wasser fernzuhalten, Explosionen zu vermeiden, für ausreichend Licht zu sorgen, Schächte und komplexe Stollensysteme zu errichten, diese mit hohem Aufwand abzusichern und Kohle nach oben zu fördern. Nach und nach entstand eine eigene Gruppe von Fachleuten, die teils aus anderen Regionen kamen oder auch vorübergehend als Berater herangezogen wurden. Wichtig waren auch Reisen in entwickelte Reviere, insbesondere nach Großbritannien, um die dortigen Erfahrungen, Techniken und Maschinen kennenzulernen
Eine formelle Ausbildung boten Bergakademien, die allerdings erst um 1760 entstanden.[16] Zuvor gab es Bergschulen, die nicht viel älter waren, und 1747 mit der École des Ponts et Chaussées die weltweit erste technische Bildungseinrichtung. In Großbritannien hingegen, dessen Steinkohlebergbau eine unbestrittene Führungsrolle einnahm, besteht die Royal School of Mines erst seit 1851. Die Bedeutung dieser Institutionen darf deshalb nicht überschätzt werden, zumal schon vorher unterschiedliche Formen der Ausbildung existierten und vor allem ein Wissensaustausch stattfand. Dieser beruhte auf den erwähnten Besuchen fortgeschrittener Reviere, auf Korrespondenzen und auf zahllosen Veröffentlichungen über geologische, physikalische, chemische und technische Fragen – und nicht zuletzt auf Mitteilungen über eigene Erfahrungen.
Diese kennzeichneten den damaligen Wissenschaftsbetrieb generell, der zwar seit langem systematische Experimente kannte, davon aber erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Umso wichtiger waren bis dahin Erfahrungen, zumal im Steinkohlebergbau, wo die geologischen Bedingungen, die Qualität der Flöze, die Festigkeit der Gebirge oder die Gefahr durch austretende Gase von Ort zu Ort unterschiedlich ausfielen und ohnehin bis weit in das 19. Jahrhundert hinein mit den damaligen Methoden nur begrenzt erfasst, analysiert oder gar verstanden werden konnten. Erfahrungen sammelten dabei nicht nur die aufkommenden Fachleute, sondern alle, die über oder unter Tage im Bergbau tätig waren. Deren Bedeutung versteht sich von selbst in den kleinen Gruben, die nur wenige Personen beschäftigten, so dass keine nennenswerte Spezialisierung stattfand. Gerade hier war ein Austausch darüber erforderlich, wo Gefahren drohten, wie Kohle am besten gewonnen werden konnte, wie viel davon stehen bleiben musste oder welche Maßnahmen der Sicherheit dienten. Dieses Wissen besaßen nicht nur Vorgesetzte, sondern vor allem die sogenannten Hauer, die vor Ort die anfallenden Arbeiten verrichteten, Strecken anlegten und Kohle abbauten. Sie erwarben besonders vielfältige Erfahrungen, bildeten eine eigene Gruppe und erzielten den höchsten Lohn.
Eine ebenfalls herausgehobene Bedeutung hatten diejenigen, die komplexe Förderanlagen bedienten oder die Sicherheit des Ausbaus überwachten, wobei die großen Bergwerke, die im 18. Jahrhundert in Großbritannien entstanden, eine zunehmend ausdifferenzierte Belegschaft herausbildeten. Auch diese Personen mussten Erfahrungen machen und daraus lernen, um ihre Arbeiten verrichten zu können, denn weder sie noch die Hauer durchliefen eine Ausbildung. Viele Arbeiten ließen sich schnell erlernen, andere erforderten längere Zeit der Beobachtung, des Abschauens und eigene Routinen, um die anspruchsvollen Tätigkeiten ausführen zu können.
Zusätzlich zur Erfahrung ist ein anderes Merkmal zu betonen: die Muskelkraft, die für die anstrengenden und gefährlichen Arbeiten erforderlich war, beginnend mit dem Bau von Gängen, Strecken und Schächten oder der Beförderung des nachlaufenden Wasser an die Oberfläche. Dafür standen zwar zunehmend technische Pumpwerke zur Verfügung, doch deren Bedienung erforderte ebenfalls Muskelkraft, teils von Tieren und vor allem von Menschen. Das gilt noch mehr für den Abbau der Kohle und deren Transport bis zum Schacht. Bis in das 20. Jahrhundert hinein erfolgte der Abbau mit Hacke und Schaufel und der Abtransport fast genauso lange durch schiere körperliche Kraft und Gewandtheit. Dazu wurde Kohle in Tücher, Körbe oder Kisten gefüllt und auf dem Rücken getragen, über den Boden gezogen oder auch geschoben (Abb. 10, S. 128).
Dabei handelte es sich um eine anstrengende Arbeit, da der Untergrund uneben war, schwere Lasten anfielen und oft nur schmale, niedrige Gänge existierten, deren Errichtung mit wachsender Größe zunehmende Kosten verursachte. Eigentlich besaßen Männer mehr Kraft für diese Arbeit, doch tatsächlich wurde sie oft von Jugendlichen, teils auch Kindern, und Frauen ausgeübt, die wegen ihrer geringen Körpergröße für die schmalen Gänge besser geeignet waren, zugleich einen niedrigeren Lohn erhielten und sich besonders anstrengen mussten. Diese Mitarbeit von Kindern, Jugendlichen und Frauen bedeutete keine Besonderheit des Bergbaus, sondern war allgemein verbreitet, wenn auch nicht allerorts so anstrengend wie unter Tage. In kleineren Gruben wurde die Arbeit oftmals im Familienverbund von Eltern und Kindern – unter Einschluss von Ehefrauen und Töchtern – gemeinsam verrichtet und hielt sich in überschaubaren Grenzen. Ganz andere Dimensionen erreichte Schlepperarbeit in den anwachsenden britischen Zechen, wo Kohle über sehr lange und enge Strecken transportiert werden musste. Hier war die Beschäftigung von Frauen und Kindern im 19. Jahrhundert verbreitet, stieß aber zunehmend auf Kritik (Abb. 7, S. 103).
Das Schleppen der schweren Last ließ sich durch mehrere Verfahren erleichtern. Da Flöze in der Regel nicht waagrecht verliefen, sondern Steigungen aufwiesen, konnte deren Gefälle genutzt werden. Im 18. Jahrhundert wurden auf diesen Strecken zunehmend Bretter verlegt, die eine glatte Oberfläche schufen; ihnen folgten hölzerne Schienen, die den Reibungswiderstand der Wagen noch effektiver verminderten. Sie litten aber unter der schweren Last, so dass sie erst durch eiserne Beläge verstärkt und schließlich im 19. Jahrhundert durch Eisenschienen abgelöst wurden, die es zugleich erleichterten, die Wagen mit Hilfe von Pferden zu ziehen. Diese erforderten allerdings entsprechend hohe und breite Strecken, so dass ihr Einsatz große Investitionen verlangte, die nur die nach 1850 entstandenen neuen Großzechen aufbringen konnten.
Traf die Kohle am Schacht ein, musste sie nach oben gelangen, was ebenfalls erhebliche Muskelkraft erforderte und lange Zeit vor allem bedeutete, schwer beladene Körbe über Leitern nach oben zu schleppen. Später kamen Seile, unterschiedliche Hebevorrichtungen oder die erwähnten Göpel hinzu, die Pferde, Wasser- und vereinzelt auch Windkraft, vor allem aber Menschen antrieben. Oben angekommen, musste die Kohle die Verbraucher erreichen. Diejenigen, die im näheren Umfeld wohnten, kamen selbst zu den Schächten und holten das Grubengold dort mit Lastpferden und Fuhrwerken ab. Damit konnten sie Kohle über einige Kilometer transportieren, wobei genaue Angaben schwierig sind. Dazu waren die Straßen zu unterschiedlich ausgebaut, weichten bei heftigem Regen auf und ließen bei Frost den Transport schwerer Güter wie Kohle kaum noch zu.
Diese Entwicklungen erfolgten nicht als gradliniger oder gar rascher Prozess. Sie erforderten viel Zeit und kannten ein Nebeneinander unterschiedlichster Stufen und Geschwindigkeiten. Für einzelne Zechen lässt sich angeben, wann bestimmte Entwicklungen begannen, wann diese sich durchsetzten oder ob sie wieder aufgegeben wurden. Für den gesamten Steinkohlebergbau in Europa hingegen sind derartige Aussagen nicht möglich, dazu waren die Unterschiede zu groß. Grundsätzlich besaßen der britische Bergbau und die Region um Lüttich eine Vorreiterrolle, und viele Entwicklungen begannen dort mehrere Jahrzehnte, wenn nicht mehr als ein Jahrhundert früher als in den anderen Revieren. Als hier bereits Großzechen bestanden, verharrte der Bergbau andernorts noch auf einem niedrigen Niveau, so Anfang des 19. Jahrhunderts in Briançon in den französischen Alpen.
In dieser Region besaß der Steinkohlebergbau ebenfalls eine lange Tradition und erfolgte in Gruben, in denen drei bis sechs Personen aus einer Familie oder dem Bekanntenkreis arbeiteten. Kohle förderten sie über Strecken, die bis zu 100 Meter in den Berg hineinreichten, und errichteten teilweise einen zweiten Gang, um frische Luft zuzuführen. Die geförderten Mengen blieben gering und dienten vorwiegend zum Eigenverbrauch, teils auch zum Verkauf. Die Erträge teilten die Gruppen unter sich auf, und einige beschäftigten auch Tagelöhner. Doch ihre Existenz hing von der Landwirtschaft ab, die allerdings nicht genug abwarf. Denn Briançon lag in einer Höhe von 1200 Metern und kannte nur kurze warme Jahreszeiten, so dass die Ernten mager ausfielen. Die Förderung von Kohle leistete deshalb einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Lebensunterhaltes – zumal in dieser Höhe der Baumwuchs nachließ und Mangel an Brennmaterial herrschte.
Bergleute und Unternehmer
Es mag überraschen, Bergleute und Unternehmer nebeneinander zu stellen, da diese beiden Gruppen sich seit der Industrialisierung so feindlich gegenüberstanden. Im frühen Bergbau hingegen waren die Grenzen fließend, wie im gerade erwähnten Briançon. Hier arbeiteten die erwähnten kleinen Gruppen in den Gruben, die ihnen gehörten und wo sie als Eigentümer selbst Kohle förderten. Vergleichbare Situationen herrschten in vielen europäischen Revieren, wo Familien, Bekannte oder auch dörfliche Gemeinschaften bis in das 19. Jahrhundert hinein auf ihrem Grund und Boden Bergbau betrieben.
Inwieweit hier von Bergleuten gesprochen werden kann, ist schwer zu entscheiden. Fraglos bauten sie Kohle ab. Doch ebenso fraglos waren sie in erster Linie Bauern, die den Brennstoff selbst verbrauchten oder sich damit ein Zubrot verdienten. Dieses Nebeneinander von Landwirtschaft und Bergbau blieb bestehen, solange die Verkehrswege nicht eine konstante Nachfrage ermöglichten. Mit deren Ausbau wuchsen auch die Zechen und beschäftigten immer mehr Bergleute, die hauptsächlich durch diese Tätigkeit ihren Lebensunterhalt sicherten. Doch sie arbeiteten mit Tagelöhnern zusammen, die nur bei besonderer Nachfrage benötigt wurden bzw. in den kalten Monaten eine Beschäftigung suchten, da sie in der Landwirtschaft nicht gebraucht wurden, während die Haushalte zum Heizen auf Kohle angewiesen waren.
Auch die hauptberuflichen Bergleute konnten nicht das ganze Jahr über mit einer festen Beschäftigung rechnen. Das galt nicht nur für das abgelegene Briançon, sondern bis weit in das 19. Jahrhundert hinein auch für die Gruben im Ruhrgebiet, in Oberschlesien und anderen Revieren auf dem Kontinent. In der Nähe von Salinen, die kontinuierlich Kohle benötigten, im gut erschlossenen Revier um Lüttich und vor allem in Großbritannien sah die Situation anders aus. Doch solange Kohle vor allem dazu diente, Haushalte zu beheizen, und Handwerker sie ablehnten, gab es selbst hier Schwankungen und zahlreiche Bergleute, die in den Zechen nur phasenweise benötigt wurden. Entsprechend beschäftigte eine Anlage in Westfalen von 1614–16 insgesamt zwar 39 Bergleute. Doch darunter befanden sich 26 Personen, die in diesen zwei Jahren weniger als 100 Tage dort ihr Geld verdienten, während lediglich sieben zur Stammbelegschaft gehörten und weitere sechs eine Art Reserve bildeten. Doch selbst bei der Stammbelegschaft arbeiteten sechs Personen jedes Jahr nur etwa 200 Tage als Bergleute, lediglich einer erreichte 280 Tage.[17]
Zu dieser Fluktuation trug auch bei, dass der Bergbau zwar gute Verdienstmöglichkeiten bot, allerdings auch anstrengend und gefährlich war. Er zog zahlreiche Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen an, die den hohen Lohn schätzten, jedoch nicht lange bleiben wollten und es etwa in der Erntezeit vorzogen, zur Landwirtschaft zurückzukehren. Darüber beschwerten sich Grubenbesitzer immer wieder und behaupteten, diese abrupten Wechsel führten dazu, dass ganze Bergwerke absoffen. Als sie diese Klage um 1780 in Nordfrankreich vorbrachten, wurde den Besitzern empfohlen, Vagabunden und Faulpelze einzustellen und für die gefährlichen Arbeiten auf «die enorme Zahl der Verbrecher, die zum Tode verurteilt sind», zurückzugreifen.[18]
Eine weniger drastische Maßnahme, die Fluktuation unter Bergleuten zu unterbinden, bestand darin, sie durch Verträge für ein Jahr oder länger zu binden. Diese Verträge existierten seit langem in der Landwirtschaft und anderen Gewerben und stellten keine Besonderheit des Bergbaus dar. In Schottland hingegen banden sie Bergleute für ihr ganzes Leben an eine Zeche und etablierten eine Leibeigenschaft, die an Sklaverei grenzte, auch Kinder miteinschloss und erst um 1780 abgeschafft wurde.[19] Allerdings hatten diese Verträge schon zuvor ambivalente Folgen. Auf der einen Seite raubten sie den Bergleuten die persönliche Freiheit. Auf der anderen sicherten sie ihnen einen vergleichsweise guten Verdienst, denn die lebenslange Bindung hielt andere Arbeiter ab. «Die Sklaverei des Sklaven», so die «Edinburgh Review» 1899 in einem Rückblick, «wurde zu dessen Stärke im Kampf um Löhne. Sie gab ihm den Vorteil eines Monopolisten und schreckte Konkurrenten ab.»[20]
Viel wichtiger war für die Bergleute ein anderer Faktor, um ihre Handlungsposition zu verbessern: die Erfahrungen, die sie durch jahrelange Tätigkeit ansammelten. Nur durch praktische Erfahrungen konnten sie den Verlauf von Flözen abschätzen, Kohle daraus lösen, nicht zu große Reste stehen lassen, Strecken und Gänge ausbauen, dazu möglichst wenig Holz verwenden oder Gefahren erkennen. Der Ratschlag, Vagabunden und zum Tode Verurteilte anzustellen, kam von Laien und war geradezu absurd, zumal bei gefährlichen Arbeiten. Der Bergbau war auf erfahrene Arbeiter angewiesen. Diese kannten, so ein Zeitgenosse um 1780, «ihren Wert sehr genau und sagten ihren Meistern, wo es lang ging».[21]
Zu den erfahrenen Arbeitern gehörten vor allem die Hauer, die beim Abbau der Kohle und dem Ausbau der Strecken die anspruchsvollen Tätigkeiten ausführten. Unterstützt wurden sie von Schleppern, die Kohle zum Schacht beförderten, und weiteren Personen, die sie nach oben zogen, Pumpen betrieben, die geförderte Kohle in Wagen verluden oder andere Tätigkeiten übernahmen, die meist keine besonderen Fertigkeiten verlangten. Wer diese Arbeiten lange genug verrichtete und genügend Erfahrungen sammelte, konnte zum Hauer aufsteigen, was vor allem junge Schlepper erhofften. Schon früh entstanden dabei offensichtlich Familientraditionen, in denen Söhne ihren Vätern folgten. Generell rekrutierten sich die benötigten Arbeitskräfte lange Zeit aus dem lokalen und regionalen Umfeld, bis die Entstehung größerer Betriebe Zuwanderung erforderte. Gerade hier sind genaue Zeitangaben schwierig. So fand noch in den 1860er Jahren im Ruhrgebiet kaum Zuwanderung statt, während sie in Großbritannien mehr als einhundert Jahre davor verbreitet war. Zudem war es seit langem üblich, aus anderen Regionen Fachleute anzuwerben, die spezielle Arbeiten selbst verrichteten oder Einheimische dazu anlernten. Dazu zählten Bergleute aus dem Lütticher Revier, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Ibbenbüren große Wasserstollen errichteten und vorführten, wie Arbeiten im harten Gestein durchzuführen waren.[22] Oder Fachleute, die 1615 in Hörde bei Dortmund Anlagen zur Wasserhaltung bauten.[23]
Zu den Gruppen, die im traditionellen Bergbau Kohle förderten, zählten auch Frauen, über deren Tätigkeit und Stellenwert kaum Unterlagen vorliegen. Vielfach handelte es sich um Ehefrauen und Töchter, die als Teil eines Familienverbundes in Gruben arbeiteten, dort aber auch selbst beschäftigt sein konnten. In Westfalen waren sie dabei im 17. Jahrhundert den Männern gleichgestellt, arbeiteten sowohl über wie unter Tage und erhielten den gleichen Lohn.[24] Auch in Schottland förderten zu dieser Zeit Frauen und Mädchen Kohle unter Tage.[25] Da in vielen europäischen Revieren die Gruben lange klein blieben und Familienverbünde verbreitet waren, dürften dort vergleichbare Verhältnisse geherrscht haben, über die wir jedoch nur wenig wissen (Abb. 3, S. 72). Nach und nach allerdings wurde die Beschäftigung von Frauen und Mädchen zurückgedrängt, zuerst unter Tage und zunehmend auch über Tage, in Großbritannien jedoch erst 1842 und in Belgien gegen Ende des 19. Jahrhunderts, während sie in Preußen schon zu dessen Beginn verboten wurde. Auch weisen die meisten Überlieferungen darauf hin, dass sie geringeren Lohn erhielten und nicht zur gutbezahlten Hauertätigkeit aufsteigen konnten.
Insgesamt ergibt sich somit ein sehr vielschichtiges Bild der Beschäftigten im Steinkohlebergbau. In Großbritannien und Lüttich gab es seit längerem Belegschaften, die im Bergbau ihre wichtigste Einnahmequelle sahen, dauerhaft beschäftigt waren und vergleichsweise gut verdienten. Das gilt vor allem für erfahrene Hauer und andere Fachleute, die bei der Wasserhaltung oder der Bedienung von Hebevorrichtungen besondere Fähigkeiten besaßen, weniger für Schlepper und andere Gruppen, die einfache Arbeiten verrichteten. Dabei gab es keine formalisierte Ausbildung. Die erforderlichen Fertigkeiten beruhten vielmehr auf Erfahrungen, dem Abschauen bei Älteren, Geschicklichkeit und nicht zuletzt körperlicher Kraft – Merkmale, die den Kohlebergbau bis weit in das 20. Jahrhundert kennzeichneten. Er bot deshalb auch denjenigen, die keine handwerkliche Ausbildung durchliefen und jung und kräftig waren, die Möglichkeit, eine anspruchsvolle Tätigkeit zu erlernen und einen guten Verdienst zu erzielen.