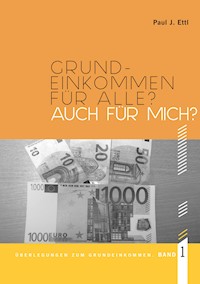
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Überlegungen zum Grundeinkommen
- Sprache: Deutsch
Die Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommen wird in der letzen Zeit heftig diskutiert. Trotzdem gibt es viel Unklarheit, was damit gemeint ist, wer wieviel bekommen soll und wie das finanziert werden kann. Die Reihe "Überlegungen zum Grundeinkommen" wird keine endgültige Lösung zeigen, sondern soll die Diskussion unterstützen und etwas Klarheit schaffen. Im ersten Band der Reihe hat Paul Ettl den Rechenstift in die Hand genommen und der Befürchtung nachgegangen, dass ein Grundeinkommen nicht finanzierbar sei, aber auch der Befürchtung, dass dann Reiche noch reicher würden. Beides kann in seinen Rechnungen klar widerlegt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit):
Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft
das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf,
(…) in den Genuss der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen,
die für die eigene Würde und die freie Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Artikel 25 (Recht auf Wohlfahrt):
Jeder Mensch hat das Recht auf einen
Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl für sich
selbst und die eigene Familie gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie
das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie
bei anderweitigem Verlust der eigenen
Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
INHALT
Vorwort zur 1. Auflage
Vorwort zur 5. Auflage
Grundprinzipien eines Bedingungslosen Grundeinkommens
Wer bekommt mehr Geld?
2.1. Die Rolle der Steuer
2.2. Konsumsteuer statt Einkommensteuer?
2.3. Einkommensteuer – der IST-Zustand
2.4. Flat-Tax-Besteuerung
2.5. BGE und Einkommensteuer
2.6. Das BGE getrennt von der Einkommensteuer
2.7. Das BGE als 8. Einkommensart
2.8. „Finanzierungsbedarf“
2.9. Anpassung der ESt-Tabelle
Mehr Einkommen für mich?
3.1 Grundeinkommen für Millionäre?
3.2 Mehr Einkommen für Pensionisten?
Wer soll das bezahlen?
Einnahmen
5.1. Einkommensteuer
5.2. Mehr Steuereinnahmen durch mehr Konsum
5.3. Einsparungen
5.3.1. Notstandshilfe (aber nicht Arbeitslosengeld)
5.3.2. Mindestsicherung (bzw. Sozialhilfe)
5.3.3. Ausgleichszulage (zu kleinen Pensionen)
5.3.4. Kindergeld (Familienbeihilfe)
5.3.5. Studienbeihilfen, Stipendien und BAföG
5.3.6. Weitere Einsparungen
5.4. Mehr Steuern?
5.4.1. Einkünfte aus Kapitalvermögen
5.4.2. Konsumsteuern
5.4.3. Luxussteuer
5.4.4. Finanzsteuern
5.4.5. Vermögens- und Erbschafts-/Schenkungssteuer
5.4.6. Freibeträge
5.5. Zusammenfassung
Arbeitslosen- und Pensionsversicherung
6.1. Arbeitslosenversicherung
6.2. Pensionsversicherung
6.3. „BGE-Versicherung“
Wer profitiert vom BGE?
Die Spielwiese (Excel-Datei)
8.1. Beispielrechnungen mit der Spielwiese
Anhang
Grundeinkommen in Kombination mit einem Wohngeld
Das BGE-Modell des Vereins „Das Grundeinkommen“
Fußnoten
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE
In den letzten Monaten gehen mir viele Gedanken zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) durch den Kopf. Ich hatte die Möglichkeit, viel darüber zu lesen, mit vielen Menschen darüber zu sprechen und auch einige Informationen aus dem Internet (z.B. YouTube) zu erhalten.
Besonders ein Beitrag in einem Internet-Forum, in dem gefragt wurde, ob dann jeder 1.000 Euro mehr zur Verfügung hätte, hat mich dazu veranlasst, einige meiner Gedanken einmal niederzuschreiben.
Gleich zu Beginn kann und muss ich sagen: JA, ich bin für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE). Gleichzeitig muss ich aber sagen: NEIN, ich weiß derzeit noch nicht, wann und wie es eingeführt werden könnte. Da sind meiner Meinung nach noch sehr viele Fragen offen. Aber genau deshalb müssen wir darüber nachdenken und darüber reden, damit wir zu einer Lösung kommen, die diese nächste Stufe einer sozialen Gesellschaft möglich macht.
In dieser Broschüre werden also keine „Lösungen“ präsentiert, sondern Ideen, die helfen sollen, Lösungen zu finden. So wird z.B. kein komplettes Finanzierungsmodell dargestellt, sondern Ansätze, die zu einer Finanzierung beitragen, werden vorgestellt.
Nach dem Erscheinen der ersten beiden Auflagen gab es viele Fragen zur Finanzierung, sodass ab der dritten Auflage doch mehr auch über Finanzierungsmöglichkeiten enthalten ist. Die vierte Auflage unterscheidet sich von den Vorgängerversionen vor allem darin, dass die Rechnungen mit den in Österreich inzwischen geänderten ESt-Sätzen gemacht wurden. Im September 2020 wurde vom Nationalrat beschlossen, den Einsteigssteuersatz von 25% auf 20% zu senken und zwar rückwirkend mit 1.1.2020. Daher sind in der vierten Auflage die Rechnungen und Beispiele unter Einbeziehung dieser Änderung.
Feedback zu dieser Broschüre (z.B. per E-Mail unter [email protected]) ist herzlich willkommen.
Linz, im Frühjahr 2020
Paul J. Ettl, MBA
„Wer etwas will, sucht Wege.
Wer etwas nicht will, sucht Gründe.“
(Albert Camus)
VORWORT ZUR 5. AUFLAGE
Seit der Erstveröffentlichung dieses Buches vor zwei Jahren ist viel geschehen: Das „Linzer Modell“, das auf diese Berechnungen aufbaut, ist vom Verein „Das Grundeinkommen“ beschlossen worden1 und ist inzwischen in der Gesellschaft und in der Wissenschaft angekommen, wie ein doppelseitiger Artikel in der Kronenzeitung2 vom 17. Juni 2022 zeigt bzw. mehrere Publikationen und Vorträge von Prof. Dr. Friedrich Schneider und Dr. Elisabeth Dreer (beide Johannes-Kepler-Universität Linz)3.
Als im Frühjahr 2020 die erste Auflage dieses Buches erschien, war der Eindruck der Pandemie noch sehr jung und niemand ahnte, wie lange das dauern und wieviel es kosten würde.
Nun, immer Sommer 2022 erscheint also diese 5. Auflage. Und die Welt hat sich in den letzten beiden Jahren stark verändert. Wir wissen, dass die Pandemie uns noch länger beschäftigen wird, wir haben gesehen, welche finanziellen Möglichkeiten es dadurch gab. Auch der Krieg in der Ukraine hat uns zu manchen neuen Sichtweisen gezwungen und durch die massive Teuerungswelle kam es zu – teilweise lang aufgeschobenen – Änderungen im Sozialsystem und im Steuersystem: Transferzahlungen, die seit Jahren nicht erhöht wurden, sollen nun an die Inflation angepasst werden und die sogenannte „kalte Progression“ soll ein Ende haben.
In diesen Tagen, in denen diese Neuauflage des Buches erscheint, sind diese Änderungen in der Regierung beschlossen, aber noch nicht im Nationalrat. Dadurch gibt es auch noch wenig Informationen, wie diese Änderungen konkret aussehen werden.
Deshalb habe ich die Zahlen in diesem Buch nicht geändert. Ich gehe in den Zahlen immer noch von der Einkommensteuertabelle 0%/20%/35%/42%/48%/50%/55% aus, obwohl die dritte Steuerstufe heuer per 1. Juli von 35% auf 30% gesenkt wird, was für dieses Jahr einen Mischsteuersatz von 32,5% ergeben wird. In den nächsten Jahren wir dann aber auch der Steuersatz von 42% auf 40% gesenkt werden.
Durch die Ankündigung, die kalte Progression zu beenden, sollen aber nicht nur die Steuersätze gesenkt, sondern auch die Steuerstufen erhöht werden. Dazu gibt es aber noch gar keine Zahlen.
Wie werden sich diese Änderungen auswirken?
Die Senkung des 2. Einkommensteuersatzes von 25% auf 20% (die in dieser Broschüre schon berücksichtigt ist) brachte Erwerbstätigen ab 18.000 € Jahreseinkommen (Steuerbemessungsgrundlage) eine Ersparnis von 350 €. Erwerbstätigen unter 18.000 € Jahreseinkommen entsprechend weniger, Erwerbstätigen unter 11.000 € Jahreseinkommen nichts.
Die Senkung der 3. Einkommensteuersatzes von 35% auf 30% wird allen Beziehern eines Jahreseinkommens von 31.000 € oder mehr weitere 650 € bringen, nämlich 5% von den 13.000 € (Differenz zwischen 3. und 4. Einkommensstufe). Und wenn dann 2024 noch der 4. Einkommensteuersatz von 42% auf 40% gesenkt wird, sind das noch einmal 580 € für alle Gutverdienenden.
Gutverdienende haben durch die Steuersenkung also bis zu 1.580 € Steuerersparnis, während Geringverdienende nur wenige hundert – oder gar keine Ersparnis haben.
Lohnsteuersenkung
ist also Umverteilung von unten nach oben -
Lohnsteuererhöhung mit Grundeinkommen
ist Umverteilung von oben nach unten!
Was ändert sich in unseren Berechnungen durch die ESt-Änderung?





























