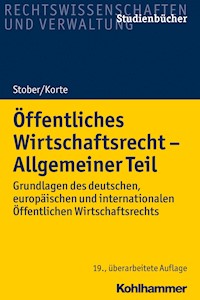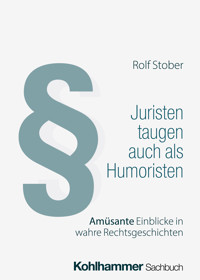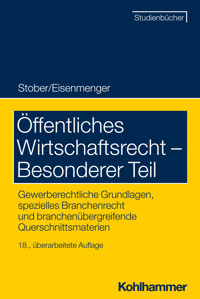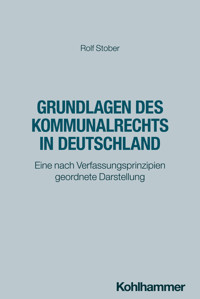
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Kommunalrecht wurzelt als zentrale Ausprägung der Selbstverwaltungsidee im Unions-, Bundes- und Landesverfassungsrecht. Zur stofflichen Bewältigung dieser mehrschichtigen und unterschiedliche Gemeindetypen erfassenden Materie bedarf es einer klaren inhaltlichen Strukturierung. Sie hat bei den als Rechtsgerüst für das konkrete Kommunalrecht fungierenden Verfassungsprinzipien anzusetzen. Dieser neue systemwissensbasierte Zugang erleichtert und optimiert die effiziente Erschließung des für die Arbeit in Wissenschaft, Lehre und Praxis erforderliche Detail- und Problemwissens, ohne vertiefende didaktische Elemente zu vernachlässigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundlagen des Kommunalrechts in Deutschland
Eine nach Verfassungsprinzipien geordnete Darstellung
Professor Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Stober
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045612-9
E-Book-Formate:
pdf: 978-3-17-045613-6
epub: 978-3-17-045614-3
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Das Kommunalrecht wurzelt als zentrale Ausprägung der Selbstverwaltungsidee im Unions-, Bundes- und Landesverfassungsrecht. Zur stofflichen Bewältigung dieser mehrschichtigen und unterschiedliche Gemeindetypen erfassenden Materie bedarf es einer klaren inhaltlichen Strukturierung. Sie hat bei den als Rechtsgerüst für das konkrete Kommunalrecht fungierenden Verfassungsprinzipien anzusetzen. Dieser neue systemwissensbasierte Zugang erleichtert und optimiert die effiziente Erschließung des für die Arbeit in Wissenschaft, Lehre und Praxis erforderliche Detail- und Problemwissens, ohne vertiefende didaktische Elemente zu vernachlässigen.
Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Rolf Stober, ehem. Geschäftsführender Direktor am Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg.
Inhaltsverzeichnis
VorwortAbbildungs- und TabellenverzeichnisPrüfungs- und AufbauschemataAbkürzungsverzeichnis§ 1 Methodische Erschließung und Abgrenzung des KommunalrechtsI. Begriff und Gebiete des KommunalrechtsII. Kommunalrecht als konkretisiertes Unions- und VerfassungsrechtIII. Zur Vernachlässigung der verfassungsrechtsprinzipiellen Seite und zu den Zielen dieses LehrbuchesIV. Welche Verfassungsprinzipien sind relevant?V. Abgrenzung von ähnlichen Erscheinungsformen1. Kommunalverfassungsrecht und Staatsverfassungsrecht2. Kommunalrecht und Verwaltungsrecht3. Kommunalrecht im weiteren Sinne4. Konsolidiertes und kodifiziertes Kommunalrecht5. Kommunalrecht und Kommunalwissenschaften6. Kommunalrecht und Kommunalpolitik7. Kommunalpolitik und KommunalrechtspolitikVI. Herausforderungen an das Kommunalrecht1. Kommunen im permanenten Transformationsprozess2. Aufgabenbezogene Herausforderungen3. Verwaltungsinterne und verwaltungsexterne VerantwortungVII. Gemeinden in der SandwichpositionVIII. Ausgewählte Hilfsmittel1. Kommunalrechtliche Literatur2. Kommunalrechtliche Rechtsprechung3. Kommunalrechtliche Online-Recherche§ 2 Kommunalrecht und UnionsprinzipI. Die EU als KommunalunionII. Die Rechtsgrundlagen der KommunalunionIII. Der Einfluss des Unionsrechts auf das KommunalrechtIV. Mitwirkung und Schutz der GemeindenV. Rechtsschutz§ 3 Kommunalrecht und BundesstaatsprinzipI. Kommunalrecht als gestaltbare LandesangelegenheitII. Der Einfluss des BundesgesetzgebersIII. Grundgesetzliche Bezüge zum KommunalrechtIV. Unterschiedliche bundesstaatliche Kommunalrechtssysteme und AufgabentypenV. Einzelne Kommunalrechtssysteme1. Rats-, Bürgermeister- und Magistratsverfassung2. Aufgabenmonismus und Aufgabendualismus3. Eigener Wirkungskreis4. Auftrags- und Weisungsverwaltung5. Organleihe6. Gemeinschaftsaufgaben und Mischverwaltung7. AufgabentypenVI. Kommunen als Glied der Verwaltungsorganisation1. Dezentralisierung und Dekonzentration als Grundprinzipien2. Treuepflicht und gemeindefreundliches Verhalten3. Einzelne kommunale ErscheinungsformenVII. Bundesstaat und kommunale Selbstverwaltung in StadtstaatenVIII. Kommunalverfassungen und Kommunalverwaltung1. Bundesstaatlich motivierte Abweichungen2. Der Rat3. Der Ratsvorsitzende4. Ausschüsse5. Der Gemeindevorsteher/Bürgermeister6. Die Beigeordneten7. Die Fraktionen8. Bezirksvertretung und Bezirksvorsteher9. Beiräte, Interessenvertretungen und BeauftragteIX. Kommunalverfassungsstreitverfahren1. Begriff und Abgrenzung des Kommunalverfassungsstreitverfahrens2. Prozessvoraussetzungen und Prüfungsumfang§ 4 Kommunalrecht und SelbstverwaltungsprinzipI. Verfassungsrechtliche und rechtstatsächliche Ausgangslage1. Rechtstatsächliche Bedeutung der Gemeinden und Gemeindeverbände2. Verfassungsrechtliche Verankerung der Gemeinden und GemeindeverbändeII. Das Kommunalrecht im Wandel der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte1. „Stadtluft macht frei“ und Selbstverwaltung als Grundrecht2. Kommunalrecht in der NachkriegszeitIII. Politische und juristische SelbstverwaltungIV. Verfassungsrechtliche Dimension der kommunalen SelbstverwaltungV. Eigenverantwortliche Erledigung aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft1. Institutionelle Garantie als Bestandsgarantie2. Subjektive Rechtsstellung3. Objektive AufgabengarantieVI. Objektiver Schutz der kommunalen Selbstverwaltung und kommunale HoheitsrechteVII. GebietshoheitVIII. OrganisationshoheitIX. Personalhoheit1. Kommunale Dienstherrnfähigkeit2. Gleichbehandlungsgebot und DiskriminierungsverbotX. Finanz-, Haushalts- und AbgabenhoheitXI. PlanungshoheitXII. Satzungshoheit1. Satzungshoheit und Satzungsrecht2. Zweck und Grenzen des Satzungsrechts3. Satzungsermessen und Rechtsansprüche4. Satzungsverfahren und Rechtmäßigkeit von Satzungen5. Rechtsschutz gegen SatzungenXIII. VerwaltungshoheitXIV. KooperationshoheitXV. Informations- und StatistikhoheitXVI. Selbstverwaltung und Teilnahme am Rechtsverkehr1. Name, Bezeichnung, Siegel und Wappen2. Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Dienstherrnfähigkeit3. Privatrechtsgeltung der Grundrechte4. Gesetzliche Vertretung5. RechtsschutzXVII. Kommunale Haftung1. Haftungsrechtliche Ausganglage2. Gefährdungshaftung3. Haftung für unerlaubte Handlungen4. Haftung aus kommunalen Benutzungsverhältnissen5. Amtshaftung6. Enteignungs- und EntschädigungsregelungenXVIII. Selbstverwaltung und andere Verwaltungsträger1. Staat und EU2. Kreise3. Nachbargemeinden und kommunale Zusammenarbeit4. Kommunale Spitzenverbände und Fachverbände5. Überregionale ZusammenarbeitXIX. Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze1. Die Schranke des Art. 28 Abs. 2 GG2. Gesetze im Sinne des Art. 28 Abs. 2 GG3. Selbstverwaltungsrechtlich motivierter GesetzesvorbehaltXX. Grundrechtsfähigkeit von Gemeinden und GemeindeunternehmenXXI. Rechtsschutz der kommunalen Selbstverwaltung1. „Jedermann“-Verfassungsbeschwerde für Gemeinden?2. Kommunale Verfassungsbeschwerde3. Verwaltungsgerichtliche Klage§ 5 Kommunalrecht und DemokratieprinzipI. Der demokratische Status einzelner Personengattungen1. Grundlagen des lokalen demokratischen Status2. Der demokratische Status der Einwohner3. Der demokratische Status der Bürger4. Der demokratische Status der Unionsbürger5. Der demokratische Status der AusländerII. Legitimation durch Kommunalwahlen1. Legitimation der Repräsentativorgane2. Legitimation der kommunalen Wahlbeamten3. Delegitimierung durch AbwahlIII. Kommunale Wahlrechtsgrundsätze1. Allgemeinheit2. Unmittelbarkeit3. Wahlfreiheit4. Wahlgleichheit5. GeheimheitIV. InkompatibilitätenV. Kontrolle und Rechtsschutz bei Wahlen1. Kommunalinterne Kontrolle2. Gerichtliche Wahlprüfung§ 6 Kommunalrecht und SozialstaatsprinzipI. Bedeutung des Sozialstaatsprinzips für die KommunenII. Kommunale Sozialaufgaben und Ansprüche der BewohnerIII. Einzelne kommunale Sozialaufgaben1. Zur Ausführung von Sozialrecht durch die Bundesländer2. Allgemeine kommunale Zuständigkeiten für Sozialleistungen3. Zur Kooperation bei der Erledigung von SozialaufgabenIV. Weitere sozialstaatliche Aufgaben der Gemeinden und Kreise1. Sport und Freizeit2. Kommunale Gefahrenabwehr und Risikovorsorge3. Sozialgerechte Bodennutzung und sozialer Wohnungsbau4. Integration5. Gleichberechtigung und Inklusion6. Intersozialer Austausch§ 7 Kommunalrecht und RechtsstaatsprinzipI. Zur Bedeutung des Rechtsstaates für die KommunenII. Kommunalrecht als Element der FunktionenteilungIII. Der rechtsstaatliche Status der Gemeindeangehörigen im Kommunalrecht1. Gesetzesbindung und Ermessensschranken2. Gemeinden als Serviceeinrichtung3. Recht auf gute Kommunalverwaltung4. Gemeinden als BeschwerdeinstanzIV. Der rechtsstaatliche Status der Gemeinden1. Gesetzesvorbehalt und Gesetzesvorrang nach Art. 28 Abs. 2 GG2. Gesetzesvorbehalt und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz3. Die rechtsstaatliche Rolle der Rechtsprechung4. Staatliche Rechtsaufsicht über die Gemeinden5. Staatliche Fachaufsicht und Rechtsschutz§ 8 Kommunalrecht und UmweltstaatsprinzipI. Kommunen als Adressaten des Umweltstaates1. Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als wertvollstes Gut2. Kommunale Sorge für das ökologische Wohl und Berücksichtigungsgebot – sustainable city3. Interne und externe UmweltaufgabenII. Kommunaler KlimaschutzIII. Ökologischer PersonennahverkehrIV. Ökologische BauplanungV. Ökologische EntsorgungVI. Ökologischer Status der Ortsbevölkerung§ 9 Kommunalrecht und KulturstaatsprinzipI. Kultur als Hausgut der BundesländerII. Umfassender kommunaler KulturauftragIII. Einzelne Erscheinungsformen kommunaler Kulturaktivitäten1. Schulträgerschaft2. Kommunale KulturförderungIV. SportförderungV. Denkmalschutz§ 10 Kommunalrecht und InfrastrukturprinzipI. Der Infrastrukturauftrag der Kommunen1. Gegenstand der kommunalen Infrastruktur2. Kommunale Verantwortung für kritische InfrastrukturenII. Rechtsgrundlagen und Dimensionen des kommunalen InfrastrukturauftragesIII. Kommunale Leistungs- versus GewährleistungsverwaltungIV. Kommunale öffentliche Einrichtungen1. Begriff der kommunalen öffentlichen Einrichtung2. Rechts- und Organisationsformen öffentlicher Einrichtungen3. Die Rechtsstellung der Benutzer öffentlicher Einrichtungen4. Rechtsschutz§ 11 Kommunalrecht und AbgabenstaatsprinzipI. FinanzierungsoptionenII. Rechtsgrundlagen des Abgabenstaatsprinzips1. Finanzrechtliche Bestimmungen2. Umfassender AbgabenbegriffIII. System und Rangfolge der Kommunalfinanzierung1. Aufgabentypen und Finanzquellen2. Subsidiarität und VertretbarkeitIV. Steuern1. Verfassungsrechtliche Ausgangslage2. Grundsteuer und Gewerbesteuer3. Örtliche Steuern und Steueranteile4. Finanzzuweisungen5. Sonderlastenausgleich und Finanzhilfen6. SteuererfindungsrechtV. Gebühren, Beiträge und Sonderabgaben1. Gebühren2. Beiträge3. Gebühren- und Beitragsbemessung4. SonderabgabenVI. Privatrechtliche Erträge und EntgelteVII. KreditaufnahmenVIII. Privatwirtschaftlich orientierte FinanzmodelleIX. Finanzierung der Auftrags- und WeisungsangelegenheitenX. Finanzierung der Landkreise1. Schwache Beteiligung an Steueraufkommen2. Kreisumlage als FinanzierungskonstanteXI. Zur tatsächlichen Finanzsituation der Kommunen§ 12 Kommunalrecht und WirtschaftlichkeitsprinzipI. Zum Verhältnis von Abgabenstaat und WirtschaftlichkeitsprinzipII. Wirtschaftlichkeitsprinzip als Verfassungsgrundsatz1. Verfassungsrechtliche Grundlagen des Wirtschaftlichkeitsprinzips2. Haushaltshoheit und konjunkturelle VerantwortungIII. Haushaltsplan und HaushaltsgrundsätzeIV. HaushaltssatzungV. RechnungsprüfungVI. Rechtsstellung der Einwohner und AbgabepflichtigenVII. Grundlagen und Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde1. Die Gemeinde als Verbraucherin2. Die Gemeinde als Unternehmerin3. Zur Zulässigkeit kommunaler Unternehmen4. Ausländische und überörtliche Aktivitäten5. Marktbezogene Verfahrensvorgaben6. Drittschützender Charakter der Vorschriften?VIII. Wettbewerbliche und verfassungsrechtliche Schranken wirtschaftlicher Betätigung1. Zur Reichweite der Schutzfunktion des Lauterkeitsrechts2. Unternehmerische Motivation ist den Kommunen fremdIX. Organisationsformern wirtschaftlicher Betätigung1. Eingeschränkte Wahlfreiheit zwischen Organisationsformen2. Öffentlich-rechtliche Organisationsformen3. Privatrechtliche Organisationsformen4. Materielle Privatisierung von KommunalaufgabenX. Aufsichtsrecht und Rechtsschutz gegen kommunale wirtschaftliche Tätigkeit§ 13 Kommunalrecht und WirtschaftsförderungsprinzipI. „think global and act local“II. Rechtsgrundlagen der kommunalen WirtschaftsförderungIII. Gegenstand kommunaler WirtschaftsförderungIV. Die beihilferechtliche und ordnungspolitische Perspektive kommunaler WirtschaftsförderungV. Mittelbare Wirtschaftsförderung als Schwerpunkt kommunaler UnterstützungVI. Kein Anspruch auf Wirtschaftsförderung§ 14 Kommunalrecht und SicherheitsstaatsprinzipI. Sicherheit als Kernbedürfnis der OrtsbevölkerungII. Sicherheit als Kernkompetenz der BundesländerIII. Kommunalrecht und Sicherheit und OrdnungIV. Ausgewählte kommunale Sicherheits- und OrdnungsaufgabenV. Kein ordnungsrechtlicher Anspruch auf Tätigwerden der Kommune§ 15 Kommunalrecht und GrundrechtsstaatsprinzipI. Dimensionen der Grundrechtsgeltung im KommunalrechtII. Funktionen der Grundrechte auf der KommunalebeneIII. Grundrecht auf gute Kommunalverwaltung?IV. Gleichheitsrechte für die Ortsbevölkerung und BewerberSachverzeichnisVorwort
Otto Mayer, ein maßgeblicher Wegbereiter des heutigen Verwaltungsrechts, hat im Vorwort zur ersten Auflage seines Lehrbuchs zum Verwaltungsrecht im Jahre 1895 ausgeführt:
„Vielleicht war es doch das Richtige, mutig das Ganze anzufassen, um es einheitlich nach gemeinsamen großen Gesichtspunkten aufzubauen.“
Diese Ordnungs- und Systematisierungsaufgabe betrifft in besonderem Maße auch das Kommunalrecht. Zum einen bedarf es für diese Rechtsmaterie schon wegen der Existenz unterschiedlicher Gemeindeverfassungstypen einer Suche nach gemeinsamen übergreifenden Strukturen. Zum anderen sind die Gemeinden und Gemeindeverbände Teil des zugrunde liegenden Verfassungs- und Verwaltungssystems, das ihre Rolle innerhalb dieses Funktionsrahmens prägt.
Folglich ist das Kommunalrecht anhand von Verfassungsprinzipien zu erklären und zu konkretisieren. Dieser systemwissensbasierte Ansatz ist ein solides Fundament zur leichten stofflichen Erschließung des erforderlichen Detailwissens. Die klare Strukturierung gestattet die komplexe und komplizierte Thematik „Kommunalrecht“ effizient zu erfassen, prozessuales Recht zu integrieren, ohne didaktische Elemente und die Kommunalpraxis zu vernachlässigen.
Rolf Stober, im Juli 2025
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Sandwichposition der Gemeinde Rn. 17
Abbildung 2: Süddeutsche Ratsverfassung Rn. 31
Abbildung 3: Aufgabentypen Rn. 37
Abbildung 4: Dezenatsverteilungsplan Rn. 95
Abbildung 5: Gemeindefinanzierung Rn. 257
Prüfungs- und Aufbauschemata
Gemeinderatssitzung Rn. 64
Rechmäßigkeit kommunaler Satzungen Rn. 109
Kommunale Verfassungsbeschwerde Rn. 155
Zulassung zu einer öffentlichen Einrichtung Rn. 247
Abkürzungsverzeichnis
Die verwendeten Abkürzungen entsprechen den Abkürzungen aus
Kirchner – Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 11. Auflage 2024
Nachdenkaufgabe
Zwischenfrage
§ 1Methodische Erschließung und Abgrenzung des Kommunalrechts
1Nachdenkaufgabe: Als Bürger und Einwohner einer Gemeinde kommen wir permanent mit dem Kommunalrecht in Kontakt. Man denke nur an die Benutzung des ÖPNV, den Besuch eines städtischen Schwimmbades oder an die Zahlung von Steuern.
Was verbirgt sich nach Ihrer Ansicht Alles hinter der Materie Kommunalrecht?
Welche Aufgaben fallen Ihnen ein, die von den Gemeinden zu erledigen sind?
Welche Ihnen aus den Medien bekannten aktuellen Herausforderungen müssen die Kommunen bewältigen?
Welche Verfassungsprinzipien beeinflussen nach Ihrer Auffassung die kommunale Aufgabenerledigung?
Wie würden Sie Kommunalrecht definieren?
I.Begriff und Gebiete des Kommunalrechts
2Das Kommunalrecht lässt sich auf unterschiedliche Weise thematisieren, systematisieren, problematisieren und argumentieren. Allerdings befasst sich das Schrifttum nur ansatzweise mit kommunalmethodischen Fragen. Es nähert sich dieser Rechtsmaterie vielmehr ohne nähere Erläuterungen insbesondere begrifflich1, organisatorisch2 oder historisch3. Sämtlichen Konzepten ist gemeinsam, dass sie zutreffend eine ziemlich einheitlich verstandene normativ geprägte Definition des Kommunalrechts zugrunde legen.
Danach ist Kommunalrecht die Summe der Rechtssätze, die sich auf die Rechtsstellung, Organisation, Aufgaben, Handlungsformen und Finanzen der Gemeinden, Gemeindeverbände (Kreise) und der kommunalen Zusammenschlüsse (z. B. Zweckverbände) beziehen4.
Das Kommunalrecht regelt den Aufbau, und die Tätigkeit dieser Einrichtungen, insbesondere den Status der Organe gegenüber dem Staat und anderen gemeindlichen Organen sowie die Rechtsstellung der Einwohner und Bürger.
Das Kommunalrecht ist im Wesentlichen in Gemeindeordnungen, Kreisordnungen und Bezirksordnungen normiert, die durch andere Gesetze ergänzt werden. Innerhalb des Kommunalrechts kommt dem Gemeinderecht in Rechtsetzung, Verwaltung, Rechtsprechung, Praxis, Lehre und Wissenschaft die größere Bedeutung zu. Die Gemeindeordnungen sind das Grundgesetz der Kommunalverwaltung. Diese Führungsrolle wirkt sich gesetzestechnisch insofern aus, dass die übrigen Kommunalgesetze häufig auf die Gemeindeordnungen verweisen. Deshalb beschränkt sich dieses Lehrbuch vornehmlich auf das Gemeinderecht.
Systematisch betrachtet ist zwischen dem Allgemeinen Kommunalrecht und dem Besonderen Kommunalrecht zu trennen. Während sich das Allgemeine Kommunalrecht mit allgemeinen Grundsätzen dieser Rechtsmaterie befasst, die für alle Kommunalverwaltungen gelten, betrifft das Besondere Kommunalrecht die spezielle Ausgestaltung divergierender Kommunalrechtsverfassungen.
Das materielleKommunalrecht bezieht sich auf die rechtlichen Grundlagen des Kommunalrechts, bei deren Umsetzung das geltende Kommunalverfahrensrecht zu beachten ist (z. B. Satzungsverfahren, Sitzungsverfahren). Demgegenüber regelt das Kommunalprozessrecht die gerichtliche Durchsetzung individueller und organschaftlicher Rechtspositionen (z. B. Kommunalverfassungsstreit – s. u. § 3 IX 10).
Aufgrund der Einbindung der Gemeinden in die Europäische Union sowie die Zusammenarbeit von Staat und Gemeinden im grenznachbarlichen Verwaltungsräumen ist es schließlich erforderlich, das Kommunalrecht in unionales und internationales sowie in- undausländisches Kommunalrecht einzuteilen.
II.Kommunalrecht als konkretisiertes Unions- und Verfassungsrecht
3Die begriffliche Annäherung und die sektorale Abschichtung eröffnen mehrere Wege zur Darstellung des Kommunalrechts. Im Mittelpunkt der anfangs zitierten Definition und der der Abschichtung nach Allgemeinem und Besonderen Kommunalrecht stehen hingegen die Schlüsselworte „Summe der Rechtssätze“ und „allgemeine Grundsätze dieser Rechtsmaterie“. Angesichts dieses umfassenden positivrechtlichen Bezugs drängt es sich auf, das Kommunalrecht unter Berücksichtigung hierarchisch vorgegebener Strukturen sowie allgemeiner Vorgaben in einem großen juristischen Kontext zu untersuchen. Nur diese übergeordnete Sichtweise berücksichtigt ausreichend, dass sich das Recht der Kommunalverwaltung aus unterschiedlichen Rechtsebenen zusammensetzt, die ihren Ursprung vornehmlich
– im Unionsrecht,
– im Grundgesetz und
– im Landesverfassungsrecht
haben5.
Die auf diesen Rechtsgrundlagen basierenden Verwaltungsrechtsnormen bilden den rechtlichen Rahmen für die differenziert stattfindende örtliche Aufgabenerledigung. So sind die Kommunen einerseits an die vorhandenen Regeln gebunden, die sie bei der Anwendung und Auslegung beachten müssen. Andererseits profitieren sie von gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsspielräumen. Und schließlich können sie gegenüber übergeordneten Stellen und ihren Einwohnern bestimmte Ansprüche geltend machen.
Zwischenfrage: Auf welchen verfassungsrechtlichen Grundlagentexten beruht das Kommunalrecht?
4Diese transformationsrechtlichen Wirkungen belegen, dass das gesamte Kommunalrecht durchgehend unions- und verfassungsgeprägt ist, weil sämtliches Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände letztlich verfassungskonform sein muss. Im Vordergrund stehen die maßgeblichen Verfassungsprinzipien sowie die aus ihnen ableitbaren Verfassungszwecke6 und Verfassungsziele. Diese Strukturentscheidungen und programmatischen Direktiven7 verdichten sich zu Verwaltungsprinzipien und Verwaltungszielen. Sie sind von den Kommunen im Interesse ihrer verfassungsrechtlich gewollten Funktionsfähigkeit umzusetzen8. Substanziell betrachtet ist das Kommunalrecht folglich ein Spiegelbild des Verfassungsrechts.
Damit steht gleichzeitig fest:
Die klassische Aussage, wonach Verwaltungsrecht konkretisiertes Verfassungsrecht ist, gilt auch für die lokale Ausgestaltung des Verwaltungsrechts9. Es speist sich aus unterschiedlichen Rechtsquellen einschließlich der Rechtsprechung und berücksichtigt den Verfassungswandel.
Diesem Ansatz entspricht es ebenfalls, wenn man Kommunalrecht als verfassungsgeleitetes Steuerungsrecht10, die kommunale Selbstverwaltung als staatsformende Institution im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV oder die örtliche Exekutive als Teil der „Guten Verwaltung“ gemäß Art. 41 EU GR Charta qualifiziert11(s. u. § 15 III 1). Dieses methodische Vorgehen deckt sich schließlich mit der Verfassungsanforderung, dass auch Kommunen das in Art. 20 Abs. 1 Satz 1 und Art. 28 GG niedergelegte Homogenitätsgebot beachten müssen12. Ein Blick in die Verwaltungslehre bekräftigt diesen Befund, wenn die Kommunalverwaltung als „Dritte Säule“ der deutschen Verwaltung charakterisiert wird13.
Zwischenfrage: Können Sie die Aussage begründen, dass Kommunalrecht ein Spiegelbild des Verfassungsrechts ist?
III.Zur Vernachlässigung der verfassungsrechtsprinzipiellen Seite und zu den Zielen dieses Lehrbuches
5Die aufgezeigte verfassungskonzentrierte Rolle des Kommunalrechts wird im Schrifttum nur rudimentär beleuchtet14, obwohl nur sie eine Darstellung der Kommunalverwaltung aus einer übergeordneten systematischen Perspektive und aus einem inhaltsbezogenen Guss gestattet. Meistens werden verfassungsrechtliche Bezüge nur am Rande in diversen Sachzusammenhängen angeschnitten. Wenn überhaupt, werden lediglich die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 GG, die landesrechtlichen Entsprechungen, die demokratische Komponente15 oder die unionsrechtliche Seite präzisiert16, teilweise unter dem verkürzten Aspekt der „Verfassungsgarantie“17. Es ist vor Allem erstaunlich, dass in der Literatur eigenständige landesverfassungsrechtliche Staatsziele aus den Bereichen Bildung und Kultur (s. u. § 9) nur selten als Legitimationsgrundlage oder Auftrag für kommunales Handeln vertieft werden, obwohl diese Gebiete typisches „Hausgutder Bundesländer“ sind18.
Diese Vernachlässigung der Verfassungsprinzipien zeichnet ein schiefes Bild des Kommunalrechts. Sie verhindert umfassende und ausgewogene Analysen sowie fundierte Problemlösungen, die insbesondere hinsichtlich der künftigen Entwicklung des lokalen Sektors von zentraler Bedeutung sind.
Deshalb führt dieses Lehrbuch die maßgeblichen Verfassungsprinzipien zusammen, stellt deren inhaltliche Ausprägungen vor, erklärt das Kommunalrecht entlang der Kette der einschlägigen Verfassungsaussagen und subsumiert sämtliche kommunalrelevanten Ausformungen unter dieses Rechtsdach.
Zwischenfrage: Was sind die Ziele dieses Lehrbuches?
IV.Welche Verfassungsprinzipien sind relevant?
6Um welche Verfassungsprinzipien geht es im Einzelnen? Die zentralen Verfassungsvorstellungen finden sich meistens an prominenter Stelle in den jeweiligen Verfassungstexten19. Hierzu zählen neben den Grundrechten (Art. 1 bis Art. 19 GG – s. u. § 15) insbesondere die Art. 20, 20a, 23 und 28 GG, die auch für die Kommunen geltende zentrale Aussagen enthalten. Zu nennen ist das in Art. 23 GG angelegte Unionsprinzip, das die Stellung der Gemeinden im Rahmen der Verbundverwaltung zur Realisierung der Europäischen Union ausgestaltet. Für sie gelten ferner das
– das Bundesstaatsprinzip (s. u. § 3),
– das Demokratieprinzip (s. u. § 5),
– das Rechtsstaatsprinzip (s. u. § 7),
– das Sozialstaatsprinzip (s. u. § 6),
– das Umweltstaatsprinzip (s. u. § 8) und die
– Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung (s. u. § 4).
Soweit das Republikprinzip gelegentlich materiell verstanden wird, kann es für das Kommunalrecht vernachlässigt werden. Denn die daraus abgeleitete Verpflichtung aller verfassungsrechtlich vorgesehenen Organe auf das Gemeinwohl ist immanenter Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung20.
Weitere Verfassungsprinzipien finden sich eher mittelbar in unterschiedlichen Sachzusammenhängen.
Beispiele: Infrastrukturprinzip, Abgabenprinzip (Art. 28 Abs. 2 Satz 3, 104b–d, Art. 105 ff. GG), Wirtschaftlichkeitsprinzip (Art. 114 Abs. 2 GG).
Aus der Perspektive der Bundesländer steht das bereits erwähnte, in den Landesverfassungen verankerte und ausgeformte Bildungs- undKulturstaatsprinzip im Fokus (Art. 3 Abs. 1 Bay LV). Daneben partizipieren die Kommunen am föderal normierten Sicherheits- und Ordnungsprinzip (s. u. § 14) sowie am Wirtschaftsförderungsprinzip (Art. 153 Bay LV und u. § 13). Teilweise wiederholen einige Landesverfassungen deklaratorisch die im EU-Recht und im Grundgesetz enthaltenen Werte.
Beispiel: Art. 3a BayVerf und Art. 64 HeVerf hinsichtlich der EU.
Unklar ist in diesem Verfassungskontext, welche rechtliche Bedeutung dem in Art. 5 EUV und Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG niedergelegten Subsidiaritätsprinzip zukommt, das den Aufgabenbereich der Kommunen in mehrfacher Hinsicht betrifft.
Beispiele: Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen, Verhältnis zwischen kommunalen, kirchlichen und privaten Trägern.
Nachdenkaufgabe: Welche Verfassungsprinzipien halten Sie für die Aufgabenwahrnehmung auf der kommunalen Ebene für besonders wichtig?
V.Abgrenzung von ähnlichen Erscheinungsformen
Die aufgezeigte Ausgangslage lässt sich allerdings nur dann sachgerecht entfalten, wenn das Kommunalrecht von ähnlichen Erscheinungsformen abgegrenzt wird, deren Vertiefung nicht Gegenstand dieser Abhandlung ist.
1.Kommunalverfassungsrecht und Staatsverfassungsrecht
7Einerseits gleichen sich Kommunalverfassungsrecht und Staatsverfassungsrecht in bestimmten Punkten auf den ersten Blick. Man denke nur an den Aufbau, den Aufgabenbereich und die Rechtsstellung der Organe. Andererseits handelt es sich bei dem Kommunalverfassungsrecht nicht um Verfassungsrecht im staatsrechtlichen Sinne. Das Verfassungsrecht von Bund und Ländern beruht auf ihrer „Hoheitsmacht“ und ihren Befugnissen als Staatsgebilde, die den Gemeinden nicht zusteht. Sie besitzen lediglich das Recht der Selbstverwaltung und unterfallen den Gesetzen. Ferner verfügen sie nicht über Rechtsprechungsfunktionen. Sie sind nur Untergliederungen der Länder und ihr Status ist in EU-Regeln, Bundes- und Landesgesetzen geregelt, die im Gegensatz zum Unions- und Staatsverfassungsrecht leichter geändert werden können.
2.Kommunalrecht und Verwaltungsrecht
8Als Rechtsgebiet wird das Kommunalrecht dem Besonderen Verwaltungsrecht zugeordnet, weil es sich nur mit einem Ausschnitt der Verwaltungstätigkeit, nämlich die Verwaltung der Gemeinden, Städte und Kreise, befasst. Diese Stellung teilt es mit anderen Materien des Besonderen Verwaltungsrechts, wie etwa dem Polizei- und Ordnungsrecht, dem Baurecht, dem Kulturverwaltungsrecht, dem Sozialrecht und dem Öffentlichen Wirtschaftsrecht21, die gleichzeitig weitere Grundlagen für kommunales Handeln liefern.
Beispiele: Die Kommunen sind nach § 10 BauGB für den Erlass von Bebauungsplänen zuständig. Sie setzen nach §§ 64 ff. GewO und dem entsprechenden Landesrecht Messen und Märkte fest und wirken als Träger der Sozialhilfe (§ 3 SGB VIII).
Darüber hinaus bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, das vielfältige organisations- und verfahrensrechtliche Vorgaben für die Aufgabenerledigung der Kommunen enthält.
Zwischenfrage: Können Sie die angeführten Beispiele der Aufgabenerfüllung wiederholen?
3.Kommunalrecht im weiteren Sinne
9Die erörterten Materien bilden das Kommunalrecht im engeren Sinne. Diese Festlegung erschöpft jedoch nicht die Breite und Tiefe kommunaler Aktivitäten. Da unsere Rechtsordnung traditionell auf einer Zweiteilung in Öffentliches und Privates Recht beruht, ermöglicht sie es den Kommunen, sich jenseits des Sonderrechts auch privatrechtlicher Gestaltungsmittel zu bedienen, soweit der Grundsatz der Wahlfreiheit sie dazu berechtigt22.
Beispiele: Gründung privatrechtlicher Gesellschaften, Erhebung privatrechtlicher Entgelte, Beschäftigung von Angestellten.
Darüber hinaus greifen die Kommunen zur Ahndung von Verwaltungsunrecht auf das Ordnungswidrigkeitenrecht zurück und Bedienstete als auch ehrenamtlich Tätige können verantwortlich gemacht werden
Beispiele: Korruption, Untreue23.
Diese und andere Vorschriftenkomplexe lassen sich zum Kommunalrechtim weiteren Sinne zusammenfassen. Seine praktische Bedeutung zeigt sich daran, dass diese Abgrenzung über Zuständigkeiten, Rechtswege und Haftungsfolgen entscheidet.
4.Konsolidiertes und kodifiziertes Kommunalrecht
10Das Kommunalrecht im weiteren Sinne ist nicht identisch mit der Frage nach einer Kodifikation im Sinne eines Kommunalgesetzbuches, das alle kommunalrelevanten Vorschriften der lokalen Ebene in einem Gesetz vereint, wie das etwa für das Sozialgesetzbuch der Fall ist. Allenfalls könnte man von einer Konsolidierung sprechen, würde man die existierenden Vorschriften in einer Sammlung zusammentragen24.
Bislang haben drei Bundesländer Teilkodifikationen erlassen:
– Das saarländische Selbstverwaltungsgesetz besteht aus den Teilen Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Stadtverbandsordnung.
– Mecklenburg-Vorpommern hat ein Kommunalverfassungsgesetz, das die Gemeindeordnung, die Landkreisordnung und die Amtsordnung einschließt.
– Niedersachsen verfügt ebenfalls über ein Kommunalverfassungsgesetz, das die Gemeindeordnung, die Kreisordnung. Gesetze über die Region Hannover, Göttingen-Gesetze sowie die Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen umfasst.
Damit haben diese Landesparlamente zentrale Grundlagen des Kommunalrechts in einem einheitlichen Text vorbildlich zusammengeführt. Dieser erste Schritt ist ein guter Ausgangspunkt für die Schaffung eines Kommunalgesetzbuches, das auch das Kommunalwahlrecht, das Kommunalabgabenrecht und das Recht der kommunalen Zusammenarbeit integriert. Derartige Gesetzeswerke sind für Bürger und Einwohner sowie für die ehrenamtlich engagierten Menschen hilfreich und sinnvoll, weil sie das Verständnis für und die Durchdringung des Kommunalrechts erleichtern.
Zwischenfrage: Beruht das geltende Kommunalrecht auf einer Kodifikationsstrategie?
5.Kommunalrecht und Kommunalwissenschaften
11Das Kommunalrecht ist Bestandteil der Kommunalwissenschaften, die als Teildisziplin der Rechtswissenschaft und als Querschnittsmaterie fungieren25.
Die Kommunalwissenschaften befassen sich unter sämtlichen Gesichtspunkten mit der Erfassung, Untersuchung, Verarbeitung und Lösung von Fragen, Bezügen, Erscheinungsformen, Bedingungen und Konzeptionen der Kommunalverwaltung im Sinne einer umfassenden Urbanismus-Forschung26.
Die Kommunalwissenschaften sind die Folge davon, dass sich moderne Kommunalverwaltung nicht in juristisch vorgeformter Aufgabenerfüllung erschöpft. Sie impliziert daneben ein hohes Maß an metajuristischer Verantwortung und muss im Interesse der Bürger und Einwohner, der lokalen Gesellschaft, der örtlichen Wirtschaft und Kultur im Interesse der Weiterentwicklung und Pluralität der kommunalen Verwaltungstätigkeit intra- und interdisziplinär sowie transfergeeignet angelegt sein. Die Kommunalwissenschaften erstrecken sich daher auf zahlreiche hier exemplarisch vorgestellte benachbarte Disziplinen27.
– Kommunale Rechtsvergleichung (Auswertung unterschiedlicher nationaler und ausländischer Kommunalverfassungssysteme),
– Kommunale Rechtsetzungslehre (Optimierung des Satzungserlasses),
– Berücksichtigung der Verwaltungslehre und der Verwaltungswissenschaft,
– Allgemeines und Besonderes Öffentliches Recht,
– Privatrecht (Zivilrechtliche Handlungs- und Organisationsformen),
– Volkswirtschaftslehre (Finanzwissenschaft, Konjunkturpolitik, Stadtökonomie),
– Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung (Verwaltungsbetriebslehre),
– Ökonomische Analyse des Kommunalrechts (Kommunalversagen, Wirtschaftlichkeit),
– Verwaltungssoziologie,
– Regionale Raum- und Stadtplanungswissenschaft,
– Kommunalgeografie (Kommunale Gliederung und Gebietsänderungen),
– Verwaltungspsychologie,
– Kulturwissenschaft,
– Stadtökologie und
– Kommunalethik (Erfüllung von Compliance-Anforderungen)28.
Zwischenfrage: Welche kommunalwissenschaftlichen Aufgabenfelder sind Ihnen nach der Lektüre der bisherigen Ausführungen bekannt?
6.Kommunalrecht und Kommunalpolitik
12Das Kommunalrecht schafft die Voraussetzungen und setzt die Grenzen für die Kommunalpolitik29. Sie ist Voraussetzung und Folge kommunaler Wahlen, parteipolitischer Willensbildung und Mitwirkung auf der lokalen Ebene. Sie eröffnet Gestaltungsspielräume, mit denen unterschiedliche Zweckmäßigkeitsvorstellungen und politische Konzepte realisiert werden können. Währen sich das Kommunalrecht mit dem geltenden Recht und dem Ist-Zustand dieser Materie auseinandersetzt, befasst sich die Kommunalpolitik mit der Ausfüllung der vom Verfassungsrecht und dem Gesetzgeber zugestandenen Freiräume30.
Beispiele: Ansiedlungspolitik, Sozialpolitik, Umweltpolitik, Wirtschaftsförderungspolitik.
7.Kommunalpolitik und Kommunalrechtspolitik
13Ein weiterer Zweig der Kommunalwissenschaften ist die Kommunalrechtspolitik. Sie vergleicht das positive Kommunalrecht mit der tatsächlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation sowie der Umsetzung der Verfassungsordnung. Sie setzt sich als mit dem Soll-Bestand sowie dem Soll-Zustand der Normen auseinander und ermittelt die erforderlichen Zielsetzungen zur Optimierung und Weiterentwicklung des Kommunalrechts. Kommunalrecht ist insoweit geronneneKommunalrechtspolitik. Sie trägt der Dynamik des lokalen Rechts und dem sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Wandel Rechnung und spiegelt divergierende Ansichten über die Verwirklichung der Kommunalrechtsordnung wider.
Die Kommunalrechtspolitik hat im Wesentlichen drei Aktionsfelder:
Ordnungspolitisch geht es um das Grundproblem, welches Kommunalverfassungssystem realisiert werden soll und insbesondere darum, ob und inwieweit Kommunen bestimmte Aufgaben erledigen sollen. Das ist im Kern eine Frage nach der Regulierung und Deregulierung, Kommunalisierung und Privatisierung kommunaler Einrichtungen sowie Formalisierung und Entbürokratisierung kommunalen Handelns unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips.
Strukturpolitisch geht es um die verwaltungsrechtliche Verbesserung der Funktions- und Entwicklungsfähigkeit der Kommunen sowie die Förderung der Anpassungsfähigkeit bei Bedürfnis- und Strukturwandel. Zur Umsetzung und Weiterentwicklung kommunalpolitischer Vorstellungen enthalten einige Gemeindeordnungen Experimentierklauseln (§ 129 NWGO, § 63 NWKrO).
Prozesspolitisch geht es um die kurz- und mittelfristige Steuerung des kommunalen Verwaltungsablaufes.
Zwischenfrage: Was bedeutet der Satz, dass Kommunalrecht geronnene Kommunalrechtspolitik ist?
Nachdenkaufgabe: Können Sie sich nach der Lektüre dieser Ausführungen vorstellen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?
VI.Herausforderungen an das Kommunalrecht
1.Kommunen im permanenten Transformationsprozess
14Die eben beschriebene kommunalpolitische Komponente belegt, dass sich Gemeinden, Städte und Kreise in einem permanenten Transformationsprozess befinden, aus dem sich komplexe Herausforderungen für Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur und Politik ergeben. Diese Umbrüche betreffen sämtliche Aufgabenbereiche. Sie müssen teilweise neu gedacht, definiert und ausgerichtet werden, um geänderten Bedürfnissen angemessen Rechnung zu tragen und Kommunen resilient zu machen. Diese Laborsituation wird mit folgenden Stichworten umschrieben, denen unterschiedliche Szenarien31 und Strategien zugrunde liegen:
– Attraktivität der Stadt,
– Zukunft der Stadt,
– Erlebnisraum Stadt,
– Neuerfindung der Stadt
– Nachhaltige Stadt oder
– Smart City.
Beispiel: Während früher Märkte und Markthallen das ökonomische Leben der Gemeinden prägten, haben im 19. Jahrhundert Warenhäuser und im 20. Jahrhundert Shopping Malls weitgehend diese Rolle übernommen. Im 21. Jahrhundert dominiert der Online-Handel, der überkommene Geschäftsmodelle substituiert und die tradierte Versorgungsrolle der Gemeinden verdrängt.
Selbst wenn sich ein allgemeiner Stadttrend abzeichnet, übersieht diese Diskussion, wie etwa die Themenverengung des 73. Deutschen Juristentages zur nachhaltigen Stadt der Zukunft belegt, die Perspektiven des ländlichen Raumes und der Landkreise. Ihre Interessen dürfen nicht ausgeklammert werden, weil auch sie sich vielfältigen Veränderungen stellen müssen. Deshalb wird zu Recht ein funktionales Zusammenspiel von Städten und Landkreisen gefordert32.
2.Aufgabenbezogene Herausforderungen
15Wendet man sich den aktuellen Herausforderungen an die Kommunen detailliert zu, dann liefert eine skizzenhafte Realanalyse folgenden Befund:
Aus ökonomischer Perspektive haben sich Stadt- und Gemeindezentren in jüngerer Vergangenheit wegen der gewandelten Handels- und Dienstleistungsstruktur und des Konsumverhaltens stark verändert. So führte insbesondere die Zunahme des Online-Handels zu Leerständen von Ladenflächen auch in Klein- und Mittelstädten und einer schleichenden Verödung der Innenstädte bei gleichzeitiger Möblierung und Kommerzialisierung öffentlicher Räume.
Beispiele: Schließung von Mode- und Schuhgeschäften, Warenhäusern und Bankfilialen.
Gleichzeitig wird versucht, den KFZ-Verkehr sowie Parkflächen bei gleichzeitiger Erreichbarkeit für Unternehmen zu reduzieren und durch urbane Logistik zu kompensieren.
Beispiele: Umnutzung von Parkhäusern zu Hotels. Sharing-Dienste. Lebensmittel-Lieferdienste und Paketstationen.
Eine wirtschaftliche Belebung nach der Devise „think global, act local“ (s. u. § 13) kann über sog. Business Improvement Districts33 sowie ein Gewerbeflächenmanagement erfolgen. Ziel ist, Rahmenbedingungen zur innovativen Stärkung ortsansässiger Handels-, Handwerks-, Produktions- und Dienstleistungsfirmen innerhalb eines bestimmten Quartiers zu schaffen34.
Aus sozialer Perspektive stellt die demographische Entwicklung der Ortsbevölkerung (Überalterung versus Babyboom) die kommunale Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Vorhaltung entsprechender Einrichtungen und Dienste vor große Herausforderungen. Ferner ist die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum eine offene Flanke, die das sog. Baulandmobilisierungsgesetz (s. u. § 6 III 3) nicht hinreichend schließt. Vielmehr bedarf es eines zukunftsfähigen Bauflächenmanagements (Nachverdichtung, Bestandsanierung, Konversion von Brachflächen) sowie einer Renaissance herkömmlicher wohnortnaher Versorgung. Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen ganzheitlich gestalteter und konfliktarm funktionierender Konzepte ein Miteinander von Leben, Wohnen, Arbeiten Handeln und Produzieren (§ 6a BauNutzVO) in einer Zeit zu ermöglichen, in der das Modell „Homeoffice“ an Bedeutung gewinnt. Hinzu kommen vielfältige Integrations- und Inklusionsaufgaben.
Aus infrastruktureller Perspektive (s. u. § 10) sind Gemeinden häufig gezwungen, kommunale Einrichtungen und Leistungen zu reduzieren (Schließung von Schwimmbädern aus finanziellen Gründen), auszubauen (Umsetzung von Ansprüchen auf KITA-Plätze und Ganztagesbetreuung) oder renovierungsbedürftige Anlagen zu sanieren (Straßen, Schulen, Brücken). In diesem Zusammenhang haben die Kommunen zu entscheiden, ob sie in die Erledigung dieser und anderer Aufgaben die Privatwirtschaft einbinden (Public Private Partnership), die Aufgabe beibehalten oder ausgelagerte Sektoren rekommunalisieren.
Außerdem bestimmt die Notwendigkeit einer politisch geforderten Verkehrs- und Mobilitätswende die kommunale Agenda35. Dabei geht es einerseits um eine optimale, alle Interessen berücksichtigende Neuaufteilung des Verkehrsraumes zwischen LKW/PKW-Verkehr und Sharing-Modellen (Stadteilauto, E-Scooter- und Leihräder) sowie andererseits um den Ausbau des Fahrradverkehrs (Schaffung und Erweiterung von Velorouten) bei Vorhaltung einer integrativen urbanen Verkehrsplanung im Sinne eines „Sustainable UrbanMobility Plans“36.
Aus ökologischer Perspektive (s. u. § 8) steht die Forderung nach einer „grünen Kommune“ und sustainable city“ im Vordergrund. Sie hat den Klimaschutz37- und die Klimaanpassung zu managen, damit Gemeinden weniger anfällig für negative Auswirkungen des Klimawandels sind. Ferner ist die Energie- und Wärmewende vor Ort umzusetzen und weiteren Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Rechnung zu tragen.
Beispiele: Umstellung auf erneuerbare Energien wie Windkraft, Solarthermie und Erdwärme, Flächenentsiegelungen, Baumanpflanzungen, Neugestaltung von Grünflächen durch Begrünung von Dächern und Häuserfronten, Verbot von Steingärten, Weiterentwicklung der Recycling-Abfallwirtschaft unter Nutzung von „Urban Mining“ zur Aufbereitung und Wiedernutzung gebrauchter Rohstoffe, Anlegung von Wasserrückhaltebecken.
Aus technologischer Perspektive sind die Kommunen auf dem Weg zur „smart city“, die dem Leitbild einer digital vernetzten, effizient und papierlos arbeitenden lokalen E-Government-Struktur nach der Maxime „Digital First“ entsprechen sollen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 OZG-Änderungsgesetz)38. Im Zentrum dieser Verwaltungsevolution steht die umfassende Zurverfügungstellung verwaltungsrechtlich vorgesehener elektronischer Dienstleistungen für die Bevölkerung.
Beispiele: EGovG, § 3a, § 35a, § 71e VwVfG; § 6a und § 10a BauGB. Verkehrslenkung, Parkplatzüberwachung.
Die dazu vorhandenen Verwaltungsplattformen und Portalverbünde (s. etwa § 10 Abs. 2 BauGB) sollen den Benutzern einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu sämtlichen Verwaltungsdienstleistungen ermöglichen § 7 OZG-Änderungsgesetz). Voraussetzung ist ein Nutzerkonto in Gestalt einer IT-Komponente zur einmaligen oder dauerhaften Identifizierung und Authentifizierung der Nutzer. Es wird als Bürger- oder Organisationskonto bereitgestellt (§ 2 Nr. 5 OZG-Änderungsgesetz)39.
Beispiel: Verkehrsbetriebe bieten eine Plattform für den städtischen Verkehr an, über die Kunden mit einer Registrierung verschiedene Verkehrsmittel buchen können.
Zwischenfrage: Vor welchen aktuellen Herausforderungen stehen die Kommunen?
3.Verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Verantwortung
16Die Betonung der verfassungsrechtlichen Ausrichtung der örtlichen Ebene sowie die objektive kommunale Verantwortung für das Gemeinwohl muss ferner elementare verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Aspekte bedenken.
Verwaltungsintern stellen sich für die Gemeinden hauptsächlich drei Fragenkomplexe:
– Wie können sie die beschriebenen Herausforderungen finanziell bewältigen? (s. u. § 11 XI)
– Wie können sie geeignetes Personal für die Verwaltung begeistern und rekrutieren?
– Wie können sie zur lokalen Entbürokratisierung beitragen?
Verwaltungsextern ist der Gedanke der Eigen- und Mitverantwortung der Ortsbevölkerung und der Unternehmen für das Gemeinwohl aus zwei Richtungen fruchtbar zu machen:
– Soll eine bestimmte Aufgabe von der Gemeinde selbst erledigt werden oder kann sie von einem privaten Unternehmen oder einer gemeinnützigen Organisation wahrgenommen werden?
– Soll eine bestimmte Maßnahme hauptamtlich oder im Rahmen bürgerschaftlicher Selbstverwaltung ehrenamtlich ausgeführt werden40?
VII.Gemeinden in der Sandwichposition
17Die vorläufige verfassungssystematische und transformatorische Analyse belegt die Multidimensionalität und Komplexität des Kommunalrechts. Dieses komplizierte Beziehungsgeflecht kann man am Ehesten mit dem Bild eines Sandwiches erfassen, bei dem die kommunale Selbstverwaltung als Sandwichbelag fungiert, der vertikal und horizontal herausgefordert wird und ausgleichend wirken muss.
Abbildung 1: Sandwichposition der Gemeinde
18Lösung der ersten Nachdenkaufgabe:
Welche Aufgaben haben die Kommunen (s. o. § 1 V 2).
Vor welchen Herausforderungen stehen die Gemeinden (s. o. § 1 VI).
Wie würden Sie den Gegenstand Kommunalrecht gegenüber anderen Personen erklären? (s. o. § 1 I).
Welche Verfassungsprinzipien beeinflussen nach Ihrer Meinung die kommunale Aufgabenerfüllung? (s. o. § 1 IV).
VIII.Ausgewählte Hilfsmittel
1.Kommunalrechtliche Literatur
19Zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Kommunalrecht bedarf es einer zuverlässigen und umfassenden Kenntnis des dazu erforderlichen Handwerkzeuges. Bevor deshalb näher inhaltlich auf das Kommunalrecht eingegangen wird, wird zunächst ausgewählte Lehrbuchliteratur vorgestellt, während auf die Wiedergabe von Fundstellen für Kommentare und Nachschlagewerke verzichtet wird.
, Becker Ulrich, Kommunalrecht, in Becker u. A. Öffentliches Recht in Bayern, 8. Aufl. 2022.
, Brüning Christoph/Schmidt Thorsten Ingo, Kommunalrecht, in: Ehlers/Fehling/Pünder (Hg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Band 3, 4. Aufl. 2020.
, Burgi Martin, Kommunalrecht, 7. Aufl. 2024.
, Engels Andreas/Krausnick Daniel, Kommunalrecht, 2. Aufl. 2020.
, Ennuschat Jörg, Kommunalrecht, in: Ennuschat/Ibler/Remmert, Kommunalrecht in Baden-Württemberg, 4. Aufl. 2022.
, Erbguth Wilfried/Mann Thomas/Schubert Mathias (Hg.), Besonderes Verwaltungsrecht Teil I, 15. Aufl. 2019.
, Erichsen Hans-Uwe/Dietlein Johannes, Kommunalrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 3. Aufl., 2021.
, Gern Alfons/Brüning Christoph, Deutsches Kommunalrecht, 5. Aufl. 2025.
, Geis Max Emanuel, Kommunalrecht, 6. Aufl., 2023.
, Gönnenwein Otto, Gemeinderecht, 1963.
, Haack Stefan, Kommunalrecht, in: Steiner/Brinktine (Hg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018.
, Hellermann Johannes, Kommunalrecht, in: Dietlein/Hellermann, Öffentliches Recht in Nordrhein-Westfalen, 9. Aufl. 2022.
, Lange Klaus, Kommunalrecht, 2. Aufl. 2019.
, Röhl Hans Christian, Kommunalrecht, in: Schoch (Hg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 2018.
, Schmidt Thorsten Ingo, Kommunalrecht, 2. Aufl. 2014.
2.Kommunalrechtliche Rechtsprechung
20Rechtsprechungsberichte zum Kommunalrecht finden sich in der NVwZ (Siehe zuletzt NVwZ 2024, 473; 2025, 462).
3.Kommunalrechtliche Online-Recherche
21Beck-Online-Datenbank „Beck Kommunalpraxis Plus“. NomosOnline Kommunaljurist.
§ 2Kommunalrecht und Unionsprinzip
Praxisfall: Der in Paris ansässige Pierre Labuday möchte bei einer von der Stadt Dortmund veranstalteten Tourismusmesse einen Stand mieten, um seine Ferienwohnungen in Frankreich anzubieten. Die Stadt Dortmund antwortet auf seine Bewerbung, dass nach dem Messekonzept Stände nur an „bekannte und bewährte“ Personen und Firmen vergeben würden.
Ist diese Auffassung zutreffend? Prüfen Sie die materielle Rechtslage!
I.Die EU als Kommunalunion
22Die bisherigen Ausführungen haben die unionsrechtliche Seite des Kommunalrechts nur kurz gestreift. Sie ist nunmehr unter dem Aspekt zu vertiefen, welche Bedeutung unionsrechtlichen Vorgaben zukommt. Zwar existiert kein eigenständiges gesamteuropäisches Kommunalrecht. Und die politische Forderung, das kommunale Selbstverwaltungsrecht in EU-Verfassungstexten zu verankern, ist gescheitert (s. Art. I–5, Art. 1–9 III des Entwurfs eines Verfassungsvertrages für Europa)41.
Das EU-Recht erfasst jedoch als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Art. 3 Abs. 2 EUV, Art. 67 AEUV) alle Gemeinden und Gemeindeverbände in den Mitgliedsstaaten, die elementarer Bestandteil der Europäischen Union sind und an dem europäischen Integrationsprozess partizipieren. Sie beruhen zwar nicht auf einer gemeinsamen Verfassungsüberlieferung kommunaler Selbstverwaltung im Sinne eines allgemeinen Grundsatzes nach Art. 6 Abs. 3 EUV. Jedenfalls bilden sie aber, unbeschadet verschiedenartiger Kommunalverfassungssysteme in den Mitgliedstaaten als Kommunalunion in dem verantwortungsgeteilten Mehrebenen-Verwaltungssystem42 die vierte Ebene nach der EU, der Bundesrepublik und den Bundesländern43. Diese Einbettung in das Gesamtverwaltungssystem ist deklaratorischer Bestandteil von Art. 18 NWVerf. Dort heißt es:
„Nordrhein-Westfalen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und damit Teil der Europäischen Union. Das Land gliedert sich in Gemeinden und Gemeindeverbände.“ (s. auch Art. 1 Abs. 2 NdsVerf)
Aufgrund der in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG eröffneten Möglichkeit, Hoheitsrechte auf die EU zu übertragen, ist das kommunale Selbstverwaltungsrecht zwar nicht unmittelbar europafest44. Gleichwohl erfasst die Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG auch über den dort aufgeführten Grundsatz der Subsidiarität sowie die Berufung auf das Demokratieprinzip die kommunale Selbstverwaltung als Facette der institutionellen Rechtssubjektsgarantie und als identitätsstiftendes Merkmal45. Diese Verankerung begründet gegenüber dem Bund eine objektivrechtliche Unterstützungspflicht kommunaler Belange bei EU-Organen (§ 10 EuZBLG).
Zwischenfrage: Was verstehen Sie unter der Mehrebenen-Verwaltung?
Diese Interpretation bietet nur rudimentären Schutz, der insbesondere auf eine gemeindefreundliche Auslegung von Rechtstexten gerichtet ist46. Gleichzeitig sind die Kommunen unionsrechtlichen Einflüssen nicht rechtlos ausgeliefert, zumal das Unionsrecht die Verwaltungs- und Organisationshoheit der Mitgliedstaaten weitgehend unberührt lässt. Allerdings sind die Kommunen Verwaltungsstellen der Mitgliedstaaten,47 die auf unterschiedliche Weise in den Vollzug des Unionsrechts eingeschaltet sind. Das hat zur Konsequenz, dass sie im Interesse der Verwirklichung der Unionsziele EU-Vorgaben hinnehmen und ihren Verwaltungsvollzug darauf ausrichten müssen (s. auch Art. 4 Abs. 3 EUV), um dem Unionsrecht zu praktischer Wirksamkeit zu verhelfen. Folglich bestimmt das EU-Recht zunehmend auch den Handlungsspielraum von Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik im Rahmen des aus Art. 23 und Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG folgenden Anwendungsvorrangs48, der das Kommunalrecht auf vielfältige Weise verdrängt, überlagert oder modifiziert49.
Beispiel: Natürliche und juristische Personen aus dem EU-Ausland können sich gegenüber deutschen Gemeinden und Kreisen auf alle unmittelbar geltenden Bestimmungen des Unionsrechts berufen.
Ein zentrales Regelungsinstrument auf der Sekundärebene sind EU-Richtlinien (Art. 288 Abs. 3 AEUV). Sie sind in nationales Recht umzusetzen und beeinflussen damit das kommunale Handeln.
Beispiel: Kommunalwahlrichtlinie50.
II.Die Rechtsgrundlagen der Kommunalunion
23Erstmals hat der Vertrag von Lissabon (2009) die lokale Ebene ausdrücklich in das Europäische Vertragswerk aufgenommen51. So erkennt Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV die „lokale Selbstverwaltung“ als Teil der nationalen Identität an (Art. 5 Abs. 3 und Abs. 1 EUV) und bezieht die lokale Ebene in das Subsidiaritätsprinzip ein. Danach darf die EU nur handeln, wenn ein Ziel nicht angemessen von den Mitgliedstaaten einschließlich deren regionaler und lokaler Ebene umgesetzt werden kann. Diese Aufwertung räumt den Kommunen aber ebenso wenig ein wehrfähiges, mit Art. 28 Abs. 2 GG vergleichbares Recht ein wie das dem Vertrag von Lissabon zur Auslegung des Art. 14 AEUV beigefügte „Protokoll über Dienste vonallgemeinem Interesse“. Art. 1 lautet:
„Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikel 14 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zählen insbesondere die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung…“
Jenseits dieser allgemeinen kommunalrelevanten Aussage kann jedoch der Ausschuss der Regionen, der auch aus Vertretern lokaler Gebietskörperschaften besteht (Art. 300 Abs. 3 AEUV) die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Art. 8 Abs. 2 des Protokolls über die Anwendungder Grundsätze der Subsidiarität gerichtlich einfordern. Im Übrigen sind die Kommunen darauf angewiesen, über ihre Verbände Einfluss auf die sie tangierende EU-Rechtsetzung zu nehmen.
Zwischenfrage: Können Sie den Inhalt des Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV wiederholen?
Ergänzend ist die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung zu erwähnen52, die den Rang eines Bundesgesetzes nach Art. 59 Abs. 2 GG einnimmt. Sie ist aber weder Bestandteil des Unionsrechts noch ein allgemeiner Rechtsgrundsatz im Sinne eines acquis communautaire. Denn sie wurde nur von Europarat verabschiedet und mehrere Staaten haben von der in Art. 12 vorgesehenen „a la carte“ Klausel Gebrauch macht, die Ausnahmen gestattet. Inhaltlich stimmt die in Art. 3 der Charta niedergelegte Definition der kommunalen Selbstverwaltung mit Art. 28 Abs. 2 GG überein. Sie lautet:
„Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften, im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner zu regeln und zu gestalten.“
Die Bedeutung der Charta liegt darin, dass sie die politischen Gedanken der Dezentralisierung und Subsidiarität betont sowie die Leistungsfähigkeit und Integrationswirkung kleiner Verwaltungseinheiten hervorhebt. Die Rolle des mit der Charta geschaffenen Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates ist auf die Abgabe von Empfehlungen und Stellungnahmen beschränkt.
Im Gegensatz dazu gilt die EU-Charta der Grundrechte für die Organe und Einrichtungen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Rechts der Union (Art. 51 EU GR Charta). Die Präambel bekennt sich unter Anderem zur Erhaltung und Entwicklung der gemeinsamen Werte, zu denen auch die Achtung der Organisation staatlicher Gewalt auf lokaler Ebene zählt. In diesem Zusammenhang wird Art. 41 EU GR Charta relevant, der ein Recht auf gute Verwaltung enthält. Zutreffend wird darauf hingewiesen, dass diese Vorschrift ein verfassungsgeprägtes Leitbild der Verwaltung im Sinne eines Good-Governanca-Konzeptes transportiert, welches das Verfassungsverständnis in den Mitgliedstaten prägt und von ihnen praktiziert wird53.
Zwischenfrage: Wie unterscheidet sich die Europäische Charta der Kommunalen Selbstverwaltung von der EU-Charta der Grundrechte?
III.Der Einfluss des Unionsrechts auf das Kommunalrecht
24Die im Schrifttum aufgestellte Prognose, das europäische Recht werde die entscheidende Grundlage des kommunalen Handelns sein54, hat sich inzwischen erfüllt. Denn unbeschadet der in Art. 5 EUV niedergelegten Grundsätze der begrenzten Ermächtigung und der Subsidiarität ist zu beobachten, dass die EU ihre Kompetenzen stetig ausweitet, weshalb Experten eine Erosion der örtlichen Selbstverwaltung diagnostizieren55. Diese Einschätzung trifft zu, weil es kaum einen Sektor des Unionsrechts gibt, der nicht gleichzeitig auf die Kommunen und ihre Selbstverwaltung mit dem Ziel einwirkt, möglichst einheitliche Regelungen vor Ort zu etablieren. Es sei nur an folgende Bereiche erinnert:
– Kommunales Satzungsrecht
– Kommunales Organisationsrecht,
– Kommunale Wirtschaftsförderung (Art. 107 ff. AEV)56
– Kommunale Infrastruktur einschließlich Verkehrsplanung (Art. 170 AEUV)57
– Kommunale Unternehmen (Art. 14 und 101 ff. AEUV)58
– Kommunale Bauleitplanung und Raumordnung59
– Kommunale Finanzen (Art. 126 AEUV)60
– Kommunale Daseinsvorsorge (Art. 14 AEUV)61
– Kommunales Gesundheitswesen (Art. 168 AEUV)
– Kommunales Vergabewesen (Art. 56 f. AEUV)
– Kommunale Ausländer- und Asylpolitik
– Kommunale Sparkassen62
– Kommunaler Umweltschutz (Art. 191 ff. AEUV)
– Kommunale Bildung und Kultur (Art. 165 ff. AEUV)
– Kommunaler Verbraucherschutz (Art. 12, 169 ff. AEUV)
– Kommunales Wahlrecht (Art. 22 Abs. 1 AEUV)
– Kommunales Personalwesen (Art. 19 und 45 Abs. 4 AEUV, Art. 21 EU GR Charta).
Diese exemplarische Auflistung stellt Kommunen, Bürger und Einwohner jedoch nicht schutzlos, weil die kommunale Bindung an das EU-Recht – wie dargelegt – zugleich bewirkt, dass sich Staatsangehörige auf die Einhaltung ihrer Rechte berufen können.
Beispiele: Vergibt die städtische Messe-GmbH im Rahmen einer Tourismusausstellung Verkaufsstände, hat sie Art. 56 f. AEUV zu beachten. Danach darf sie nicht nur ausschließlich Einwohner der Stadt oder frühere Bewerber nach dem Motto „Bekannt und bewährt“ zulassen. Sie muss vielmehr in dem Auswahlverfahren auch Neubewerber aus dem gesamten EU-Raum berücksichtigen. Andernfalls würde die Gemeinde den Zugang für EU-Staatsangehörige oder Unternehmen rechtswidrig ausschließen63.
Personen aus EU-Staaten können sich auf kommunale Stellen bewerben, wobei Art. 45 Abs. 4 AEUV bezüglich Ausnahmen für die Wahrnehmung von Hoheitsaufgaben eng auszulegen ist und eine Einzelfallprüfung erfordert.64
Die Gemeindevertretung darf in ihrer Beschäftigtenordnung eine Verpflichtung zur exklusiven Neutralität einführen, wenn sie darauf abzielt, allen Arbeitnehmern in der Gemeinde am Arbeitsplatz zu verbieten, irgendein sichtbares Zeichen religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung zu tragen65.
Zwischenfrage: Erläutern Sie, in welchen Sektoren das Unionsrecht auf das Kommunalrecht einwirkt.
IV.Mitwirkung und Schutz der Gemeinden
25Der beträchtlichen Einwirkung des Unionsrechts auf die Kommunen stehen zwar Mitwirkungsrechte der Gemeinden und ihrer Zusammenschlüsse gegenüber, die das sog. Gegenstromprinzip verwirklichen:
– Kommunale Repräsentanz im Ausschuss der Regionen (Art. 305 AEUV66 und § 10 EuZBLG67.
– Kommunale Rechte bei EU-Vorhaben (Art. 307 AEUV), wobei die regionale Komponente auch auf die Wahrnehmung lokaler Interessen angewendet wird68.
Diese und andere Schutzmechanismen zugunsten der Kommunen sind jedoch nur schwach ausgeprägt69 und vor dem Hintergrund unzureichend, dass das im Primärrecht verankerte Subsidiaritätsprinzip nach seinem klaren Wortlaut nur im Verhältnis zwischen Union und Mitgliedstaat gilt. Seine Erstreckung auf Gemeinden70 wäre auch deshalb zu begrüßen, weil die EU nach Art. 1 Abs. 2 EUV dem Grundsatz der Bürgernähe verpflichtet ist, der insbesondere durch die kommunale Selbstverwaltung realisiert wird71. Deshalb wird zutreffend gefordert, den Rechtsgedanken der Europäischen Charta der Selbstverwaltung als allgemeinen Rechtsgrundsatz im Primärrecht zu verankern. In der Verwaltungspraxis wird vornehmlich moniert, dass die EU-Kommission den kommunalen Sachverstand erst dann abfrage, wenn die Gesetzesprojekte weit vorangeschritten sind. Dadurch komme es bei der Ausführung zu Fehlsteuerungen auf der kommunalen Ebene.
V.Rechtsschutz
26Kommunen können vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar oder individuell betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter klagen (Art. 256 Abs. 1 i. V. m. Art. 263 Abs. 4 AEUV).
Lösung des Praxisfalls: Die Stadt Dortmund hat bei ihrer Antwort an den französischen Bewerber Art. 56 f. AEUV verletzt, wonach bei einem Auswahlverfahren auch Neubewerber aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. Die Ausgestaltung ihres Messekonzeptes verstößt deshalb gegen den AEUV.
§ 3Kommunalrecht und Bundesstaatsprinzip
Praxisfall: Der Bundestag plant mit Zustimmung des Bundesrates, den Gemeinden und Gemeindeverbänden die „Verantwortung für die Cybersicherheit“ als neue Aufgabe zu übertragen. Dagegen wehren sich die Kommunalverbände, die das Gesetzesvorhaben für verfassungswidrig halten.
Wie ist die materielle Rechtslage?
I.Kommunalrecht als gestaltbare Landesangelegenheit
27Kommunen sind nicht nur ein Teil der Europäischen Union. Sie verkörpern gleichzeitig ein Stück Bundesstat, der sich aus Kreisen und Gemeinden zusammensetzt. Diese Zuordnung folgt aus der Verneinung der Staatsqualität der Gemeinden, der Grundgesetzregelung im Abschnitt „Bund und die Länder“ (Art. 20 ff. GG) sowie aus der finanzrechtlichen Festlegung, dass Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden als Einnahmen und Ausgaben der Länder gelten (Art. 106 Abs. 9 GG). Folglich ist das Kommunalrecht aus bundesstaatlicher Perspektive fruchtbar zu machen. Danach muss auch die verfassungsmäßige Ordnung in den Gemeinden und Kreisen den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaats entsprechen. Dieser Homogenitätsgrundsatz (s. o. § 1 II) verlangt allerdinge weder Konformität noch Uniformität, weil die Ausgestaltung des kommunalen Rechts mangels bundesgesetzlicher Regelungskompetenz den Ländern obliegt.
Zwischenfrage: Was bedeutet das Homogenitätsprinzip für die Ausgestaltung des Kommunalrechts?
II.Der Einfluss des Bundesgesetzgebers
28Die prinzipielle Zuständigkeit der Bundesländer zur Normierung des Kommunalrechts schließt Einwirkungen des Bundes zur Wahrung der bundesstaatlichen Ordnung nicht aus. Voraussetzung ist jedoch, dass der Bund hierzu eine Gesetzgebungskompetenz besitzt. Zwar darf der Bund für den Vollzug von nach Art. 73 ff. GG erlassenen Bundesgesetzen durch die Länder mit Zustimmung des Bundesrates die Einrichtung der Behörden regeln (Art. 84 Abs. 1 und Art. 85 Abs. 1 GG). Dabei darf er aber nicht in die kommunale Organisations- und Finanzhoheit eingreifen. Denn seit der Föderalismusreform72 ist es dem Bund nicht gestattet, den Gemeinden und Gemeindeverbänden neue Aufgaben zu übertragen. Dieses in Art. 84 Abs. 1 S. 7 und Art. 85 Abs. 1 S. 2 GG ausdrücklich normierte absolute Aufgabendurchgriffsverbot73 erlaubt allerdings im Umkehrschluss den Bundesländern, Kommunalbehörden in die Aufgabenerledigung einzubinden.
Eine weitere Weichenstellung für das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ergibt sich aus der bundesstaatlich inspirierten Grundsatzentscheidung zur Ausführung von Bundesgesetzen. Art. 83 GG stellt die Regel auf, dass die Bundesländer die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen. Das bedeutet, dass sie auch darüber befinden, ob in einem Bundesland die Landesverwaltung oder die Kommunalverwaltung für die Aufgabenwahrnehmung zuständig ist. Folglich dürfen Bundesgesetze lediglich auf die Regelungsbefugnis der Länder hinweisen.
Beispiel: Nach § 26 Abs. 1 SGB I i. V. m. § 24 Wohngeldgesetz entscheidet da Landesrecht, welche Stelle zur Ausführung des Gesetzes zuständig ist.
Nach Art. 72 Abs. 1 GG können jedoch kommunalrelevante Bundesgesetze im Interesse der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit erlassen werden, soweit sie im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich sind (Art. 72 Abs. 2 GG). Der Bund ist insoweit begründungspflichtig und seine Gesetzgebung unterfällt der gerichtlichen Kontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2a GG).
Beispiel: Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG).
III.Grundgesetzliche Bezüge zum Kommunalrecht
29Unabhängig davon wird das Verhältnis zwischen dem Bund, den Bundesländern und den Gemeinden in zahlreichen, nachfolgend aufgeführten Grundgesetzartikeln angesprochen, die der Gesetzgeber ausfüllen muss.
– Art. 1 Abs. 3 (Grundrechtsbindung der Kommunalverwaltung)
– Art. 20 Abs. 1 (Demokratie und sozialer Bundesstaat)
– Art. 20 Abs. 3 (Gesetzesbindung der Exekutive)
– Art. 21GG (Mitwirkung der Parteien bei der kommunalpolitischen Willensbildung)
– Art. 24 Abs. 1a (Grenznachbarschaftliche Einrichtungen)
– Art. 28 Abs. 1 (Gemeinde- und Kreisvertretung, Wahlrecht für Unionsbürger, Gemeindeversammlung)
– Art. 28 Abs. 3 (Gewährleistungspflicht des Bundes für die Einhaltung des Art. 28 GG)
– Art. 29 Abs. 7 und 8 (Anhörungspflicht für Gemeinden und Kreise bei bestimmten Gebietsänderungen)
– Art. 33 Abs. 4 (Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse)
– Art 34 (Haftung der kommunalen Körperschaften)
– Art. 84 f. (Ausführung von Bundesgesetzen durch Gemeinden und Grenzen der Aufgabenübertragung)
– Art. 91c (Informationstechnische Festlegung von Standards für Kommunikationssysteme)74
– Art. 91e (Zusammenwirken von Bund, Ländern und Gemeinden auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende und Zulassung zur alleinigen Wahrnehmung)
– Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b (Verfassungsbeschwerde für Gemeinden und Gemeindeverbände)
– Art. 104b–d (Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in den Bereichen Bildungsinfrastruktur und sozialer Wohnungsbau)
– Art. 105 Abs. 2a (Gesetzgebungskompetenz über örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern sowie die Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer)
– Art. 105 Abs. 3 (Steueraufkommen für die Gemeinden und Gemeindeverbände)
– Art. 106 Abs. 5 (Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer)
– Art. 106 Abs. 5a (Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer)
– Art. 106 Abs. 6 (Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, Festlegung der Hebesätze)
– Art. 106 Abs. 7 (Beteiligung an den Gemeinschafts- und Landessteuern)
– Art. 106 Abs. 8 (Ausgleich von Sonderbelastungen)
– Art. 107 Abs. 2 (Berücksichtigung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs der Gemeinden und Gemeindeverbände)
– Art. 108 Abs. 4 Satz 2 (Übertragung der Steuerverwaltung auf die Gemeinden für die ihnen allein zufließenden Steuern)
– Art. 109 Abs. 4 (Gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, die Haushaltswirtschaft und die Finanzplanung)
– Art. 115c Abs. 3 (Garantie der Lebensfähigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände auch in finanzieller Hinsicht im Verteidigungsfall)
– Art. 137 Abs. 1 (Wählbarkeitsbeschränkungen für Angehörige des öffentlichen Dienstes in den Gemeinden).
Zwischenfrage: Können Sie einige grundgesetzliche Bezüge zum Kommunalrecht repetieren?
IV.Unterschiedliche bundesstaatliche Kommunalrechtssysteme und Aufgabentypen
30Nach den bisherigen Ausführungen liegt die Ausgestaltung des Kommunalrechts mangels grundgesetzlicher Vorstrukturierung in der parlamentarischen Gestaltungsmacht der Bundesländer75, soweit sie die bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben beachten. Bundesstaatlichkeit in diesem Sinne bedeutet Autonomie und politische Selbstbestimmung mit eigenen Handlungsspielräumen76. Die Länder können folglich zwischen unterschiedlichen Kommunalverfassungsmodellen wählen. Sie haben diese Gestaltungsoptionen sowohl in ihren Landesverfassungen als auch in den Gemeinde- und Kreisordnungen umgesetzt und unterschiedlich strukturierte Kommunalformate entwickelt, die lebendiger Ausdruck föderaler Vielfalt77 und konkretisiertes Landesverfassungsrecht sind.
Die Ausschöpfung dieser Möglichkeiten hat zu einer Zersplitterung des Kommunalrechts geführt, weil von der Wahlmöglichkeit reichlich Gebrauch gemacht wurde. Partielle Rechtsidentität besteht lediglich im Sektor Haushaltsrecht, da der Bund berechtigt ist, auch für die Gemeinden geltende Haushaltsgrundsätze aufzustellen (Art. 109 Abs. 4 GG, § 1 HGrG s. u. § 12).
Eine gegenwärtig kaum praktizierte und hier zu vernachlässigende Modellvariante ist in Art. 28 Abs. 1 Satz 4 GG angelegt. Danach können an die Stelle der Wahl und Entscheidung von Gemeindevertretungen Gemeindeversammlungen treten (s. u. § 5 I 2).
Beispiel: § 54 SH GO für Gemeinden bis zu 70 Einwohnern.
Allerdings ist angesichts des Rufes nach mehr partizipativer Demokratie denkbar, dass Modelle unmittelbarer Demokratie künftig an Bedeutung gewinnen. Gemeindeversammlungen sind nicht identisch mit Bürgerversammlungen (s. u. § 5 I 3 d), denen nur Mitberatungsrechte zustehen (Bayern, Sachsen).
Im Übrigen nehmen die Landesverfassungen nur punktuell zur Ausgestaltung der Kommunalverfassungen Stellung, weshalb die konkrete Ausformung nur in den Gemeinde- und Kreisordnungen erfolgt.
Beispiele: Sicherung der Aufgabenerfüllung, Einräumung der Abgabenhoheit, Vorgaben für die Wahl der Gemeindevertretung (Art. 72 f. BWVerf). Förderung der technischen und digitalen Infrastruktur (Art. 26a HeVerf).
V.Einzelne Kommunalrechtssysteme
1.Rats-, Bürgermeister- und Magistratsverfassung
31Dementsprechend haben sich in der Vergangenheit unterschiedliche Kommunalverfassungssysteme herausgebildet, die herkömmlich in Norddeutsche und Süddeutsche Rats-, Bürgermeister- undMagistratsverfassung eingeteilt werden. Maßgebliches Unterscheidungskriterium ist die Anzahl der erstzuständigen Hauptorgane, wobei es entscheidend auf das Letztentscheidungsrecht ankommt. Nach dieser Einteilung werden Ausprägungen als monistische Systeme betrachtet, bei denen die Vertretungskörperschaft alle Entscheidungsbefugnisse besitzt, während bei den dualistischen Systemen die Erstzuständigkeit bei der Gemeindevertretung und der Verwaltungsspitze liegen. In der jüngeren Zeit wurden die Kommunalverfassungssysteme mit der Folge reformiert, dass sich die Süddeutschen Ratsverfassung als Standardmodell durchgesetzt hat78.
Eindeutig dualistisch ausgestaltet ist die Süddeutsche Ratsverfassung mit dem Rat als Hauptorgan, der für grundlegende Entscheidungen, Planungen, Kontrolle usw. zuständig ist. Zweites Organ ist der unmittelbar vom Volk gewählte Bürgermeister. Er ist zuständig für initiierende und koordinierende Lenkung, vorbereitende und durchführende Verwaltung, Außenverwaltung sowie Aufgabenerledigung im übertragenen Wirkungskreis. Zwischen beiden Organen besteht eine starke organisatorische, personelle und funktionelle Verzahnung. So ist der Bürgermeister Vorsitzender des Rates mit Widerspruchsrecht und Eilentscheidungsbefugnis. Er führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt die Gemeinde nach außen.
Abbildung 2: Süddeutsche Ratsverfassung
2.Aufgabenmonismus und Aufgabendualismus
32Die im Grundgesetz angelegte Länderzuständigkeit für das Kommunalrecht wirkt sich nicht nur auf die monistische oder dualistische Festlegung der Kommunalorgane, sondern auch auf die Systematisierung der Kommunalaufgaben aus. Auch insoweit können sich die Kommunalgesetzgeber für eine monistische oder einedualistische Aufgabenerledigung entscheiden, sofern sie die Vorgaben der Art. 84 f. GG (Weisungsbefugnis des Bundes) beachten.
Der von den Innenministern der Länder und den kommunalen Spitzenverbänden erarbeiteten sog. Weinheimer Entwurf aus dem Jahre 1948 geht von einem einheitlichen Begriff öffentlicher Aufgaben aus. Danach obliegt den Gemeinden in ihrem Gebiet die Erfüllung aller öffentlicher Aufgaben allein und in eigener Verantwortung, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen (monistisches Modell). Diese Zuordnung realisiert das Prinzip Dezentralisierung im Sinne einer Stärkung der lokalen Verwaltung (s. u. § 3 V).
Beispiele: Art. 78 Abs. 2 und 4 NWVerf79, § 2 Abs. 3 BWGO, § 2 HeGO, § 2 Abs. 3 SächsGO.
Folglich sind die Gemeinden nicht nur Träger spezifischer kommunaler Aufgaben, sondern sie erledigen auch sämtliche staatlichen Aufgaben auf der Ortsebene. Dementsprechend differenziert dieses Modell zwischen freiwilligen Aufgaben, Pflichtaufgaben und Pflichtaufgabenzur Erfüllung nach Weisung (Weisungsaufgaben).
Beispiel: Die Wahrnehmung polizei- und ordnungsrechtlicher Aufgaben ist etwa im Rahmen der Überwachung von Geschwindigkeitsüberschreitungen oder der Befolgung von Lichtzeichenanlagen als Weisungsaufgabe ausgestaltet (§ 3 NW Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden – s. u.§ 14).
Demgegenüber beruht das dualistische Modell auf dem gewandelten Verhältnis zwischen Staat und Kommunen. Danach war ursprünglich die Aufgabenerfüllung in dem Sinne geteilt, dass der Staat alle die Gesamtheit betreffenden Aufgaben wahrnahm, während die Gemeinden, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzelnden Aufgaben erledigten. Seit dem 19. Jahrhundert erfüllen die Gemeinden auch Aufgaben, die über den örtlichen Bereich hinausreichen, aber aus Zweckmäßigkeitsgründen der kleineren politischen Einheit übertragen wurden. Dabei spielt vornehmlich der Gedanke der sach- und bürgernahen Verwaltung und der Einsparung staatlicher Behörden auf der unteren Verwaltungsebene im Sinne einer Dekonzentration eine Rolle (s. u § 3 V).
Das dualistische Aufgabenmodell gliedert den Aufgabenbereich der Gemeinden in Selbstverwaltungsaufgaben und Staatsaufgaben. Die Selbstverwaltungsaufgaben bilden, wenn man sie auf das dualistische Modell überträgt, den eigenen Wirkungskreis. Hingegen sind die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises den Gemeinden „zur Besorgung namens des Staates“ (Art. 8 Abs. 1 Bay GO, § 6 NKomVG) zugewiesen und mit Weisungsrechten verbunden80. Bei dieser Auftrags- oder Fremdverwaltung (Art. 11 Abs. 3 Bay Verf.)