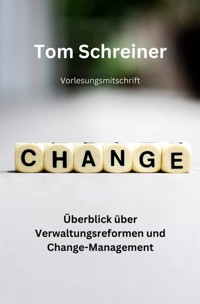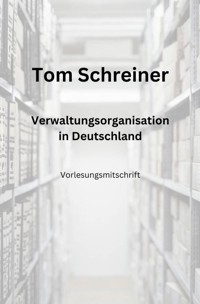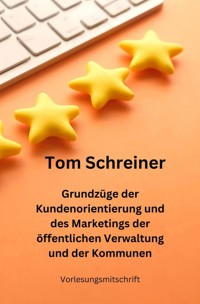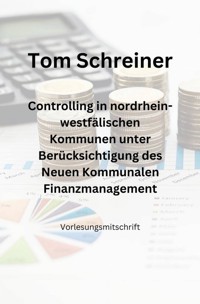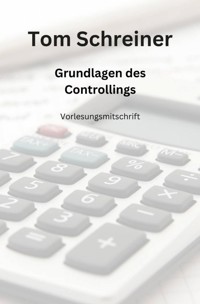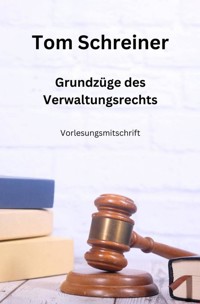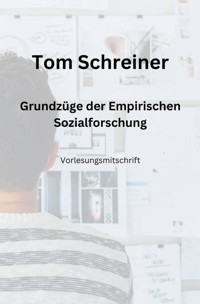
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Bei diesem Titel handelt es sich um eine Vorlesungsmitschrift aus einem forschungsmethodischen Modul in einem Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaften. Behandelt werden dabei unter anderem qualitative und quantitative Forschungsmethoden, Methoden zur Datenerhebung und die Datenanalyse. Der Autor hat das Modul erfolgreich mit einer sehr guten Note abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Grundzüge der Empirischen Sozialforschung
Vorlesungsmitschrift
Inhaltsverzeichnis
1. Grundlagen der empirischen Forschung
1.1 Einblick in die Wissenschaftstheorie
1.2 Grundpositionen der Erfahrungswissenschaften
1.3 Deduktiv-logische Wissenschaft vs. Kritische-rationale Wissenschaft
2. Qualitative und quantitative Forschung
2.1 Grundlagen
2.2 Qualitativ vs. quantitativ
2.3 Gemeinsamkeiten qualitativer und quantitativer Ansätze
3. Theorien und Hypothesen
3.1 Hypothesen im kritischen Rationalismus
3.2 Statistische Hypothesen
4. Datenerhebung: Planung und Vorbereitung
4.1 Untersuchungsplanung
4.2 Methoden der Datenerhebung
4.2.1 Empirische Inhaltsanalyse
4.2.2 Beobachtung
4.2.3 Befragung
4.2.3.1 Mündliche Befragung
4.2.3.2 Schriftliche Befragung
4.3 Zählen, urteilen und testen
4.3.1 Zählen
4.3.2 Urteilen
4.3.3 Testen
4.4 Stichprobenverfahren
4.5 Skalenniveaus
4.5.1 Nominalskala
4.5.2 Ordinalskala
4.5.3 Intervallskala
4.5.4 Ratioskala
5. Ausarbeitung und Formulierung eines Forschungsablaufs
5.1 Phase 1: Formulierung des Forschungsvorhabens
5.2 Phase 2: Konstruktion des Erhebungsprozesses
5.3 Phase 3: Festlegung der Untersuchungsform
5.4 Phase 4: Stichprobenverfahren
5.4.1 Zufallsgesteuerte Verfahren
5.4.2 Nicht-zufallsgesteuerte Verfahren
5.5 Phase 5: Pretest
6. Datenerhebung: Anwendung und Umsetzung
6.1 Phase 6: Anwendung des erprobten Erhebungsinstruments
6.1.1 Grundregeln der Frageformulierung
6.1.2 Fragebogenkonstruktion
6.2 Vorbereitung zur Datenerhebung
6.2.1 Rücklaufquote
6.2.2 Datenschutz
7. Datenauswertung
7.1 Phase 7: Aufbau eines analysefähigen Datenfiles
7.2 Phase 7: Statistische Datenanalyse
7.2.1 Deskriptive Auswertung
7.2.1.1 Häufigkeitsverteilung
7.2.1.2 Maße der zentralen Tendenz (Lagemaße)
7.2.1.3 Dispersionsmaße
7.2.1.4 Schiefe und Exzess
7.2.2 Verfahren zur Überprüfung von Zusammenhanghypothesen
7.2.3 Verfahren zur Überprüfung von Unterschiedshypothesen
7.2.3.1 Verfahren mit Nominaldaten
7.2.3.2 Verfahren mit Ordinaldaten
7.2.3.3 Punktverfahren für Intervalldaten
7.2.4 Verfahren zur Überprüfung von Zusammenhangshypothesen – Lineare Regression
7.2.5 Signifikanztests zur Prüfung von Unterschieden in der zentralen Tendenz
8. Berichterstattung
8.1 Phase 9: Umsetzung von Forschungsergebnissen
1. Grundlagen der empirischen Forschung
Dieses Kapitel führt in die Grundlagen der empirischen Forschung ein. Dabei wird auf die Wissenschaftstheorie, die Erfahrungswissenschaften und die kritisch rationale Wissenschaft eingegangen.
1.1 Einblick in die Wissenschaftstheorie
Die Methoden des empirischen Forschens tangieren häufig das gesellschaftliche Leben.
In der Politik und der Verwaltung ist die Hauptaufgabe, durch Forschung „wahre“ Ergebnisse zu erzielen, um politische Ziele legitimieren zu können. Das kann jedoch kritisch werden, wenn ein Gegengutachten zu einem anderen Ergebnis führt. Häufig haben hier aber immer beide Studien „recht“.
Empirische Forschung wird umgangssprachlich auch Erfahrungswissenschaft genannt. Das liegt an der griechischen Übersetzung „auf Erfahrung beruhend“. Hierbei entstehen zwei Probleme. Erstens: Erfahrung ist immer die subjektive Bewertung eines Phänomens. Zweitens: Erfahrung ist immer ein Prozess, unterliegt also dem Wandel. Sie wird daher bei Außenstehenden als beliebig wahrgenommen.
Wissenschaft hängt von subjektiven Erfahrungen ab, indem der gesellschaftliche Kontext als Alltagserfahrung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führen kann. Die Verwertung dieser Erkenntnisse unterliegt meistens jedoch wieder gesellschaftlichen Konventionen.
1.2 Grundpositionen der Erfahrungswissenschaften
Erkenntnisse hängen stark von den Kontextfaktoren ab und demzufolge auch, ob das beobachtete Phänomen als solches beschrieben wird. Phänomene können als „unerklärlich“ deklariert oder als Tatsächliches verstanden werden.
Beides setzt allerdings voraus, dass etwas Beschreibung, Würdiges beobachtet wird, das durch menschliche Sinne erfahrbar ist.
Die empirische Wissenschaft hebt sich durch eine stärkere Selektivität und der anschließenden verallgemeinernden Schlussfolgerung von der Alltagserfahrung ab.
Eine besondere Unterscheidung zur Alltagserfahrung liegt darin, dass beobachtete Phänomene beschrieben und klassifiziert und damit allgemein beziehungsweise allgemeingültige Regeln gefunden werden.
Die Erfahrungswissenschaft geht von einer tatsächlichen Welt aus, über deren Wirklichkeit sie Erkenntnisse gewinnen will. Die Wahrnehmung eines Beobachters hat dabei keinen Einfluss auf die tatsächliche Welt.
Aussagen hinsichtlich Ursache und Wirkung von Ereignissen im Sinne eines Kausalitätsprinzips sind möglich, da von einer Regelhaftigkeit in der tatsächlichen Welt ausgegangen wird.
Das funktioniert jedoch nur bei bezifferbaren Erfahrungswerten, bei unbestimmten Werten, die jeder anders formuliert (beispielsweise Glück) ist das schwieriger. Manche Werte werden sich nie beschreiben lassen können.
Der empirischen Forschung kommt dabei die Aufgabe zu, zu erfahren, welche Kompetenzen Menschen werten, zu schreiben, um über Analogien und Wiederholungen der Aussagen eine möglichst große Überschneidung zu erfahren. Kriterien der empirischen Forschung sind:
Getroffene Aussagen sind interpersonell
Getroffene Aussagen lassen sich an der Wirklichkeit überprüfen
Getroffene Aussagen sind hinsichtlich ihrer Gültigkeit und Zuverlässigkeit nachvollziehbar.
Wenn Worte wissenschaftlich untersucht werden, so werden sie nur als „seiend“ und nicht als „gültig“ innerhalb des Prozesses des Begründungszusammenhangs behandelt.
Empirische Wissenschaft endet dort, wo die Grenze zur Metaphysik überschritten wird oder es sich um rein logische Sätze handelt.