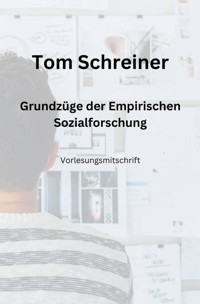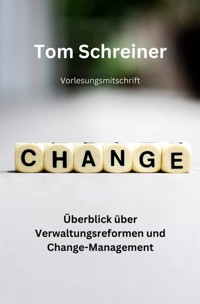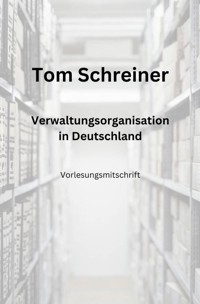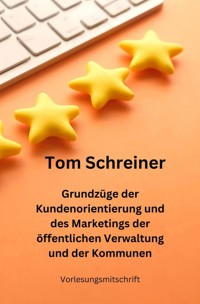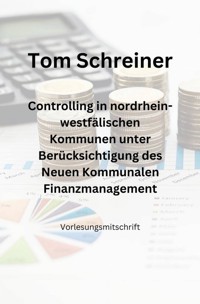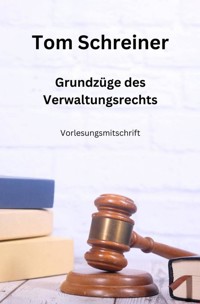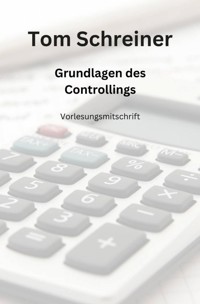
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei diesem Titel handelt es sich um eine Vorlesungsmitschrift aus einem Modul zu den Grundlagen des Controllings aus einem Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaften. Behandelt werden dabei unter anderem die Grundbegriffe des Controlling, die Anforderungen an einen Controller, verschiedene Analysemöglichkeiten und vieles mehr. Der Autor hat das Modul erfolgreich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundlagen des Controllings
Vorlesungsmitschrift
Simon Winzer
Rückertstr. 69
48165 Münster
Inhaltsverzeichnis
1 Phasen des Controlling-Prozesses
1.1 Ziele des Controllings
1.2 Phasen des Controllingablaufs
1.3 Besonderheiten des Controllingprozesses in der öffentlichen Verwaltung
2 Controlling im Führungssystem einer Organisation
2.1 Aufbau des Führungssystems
2.2 Controlling und Zielbildung
2.3 Controlling und Mitarbeiterführung
2.4 Controlling und Organisation
3 Organisatorische Eingliederung des Controllings
3.1 Übernahme der Controlling-Funktionen durch andere Bereiche
3.2 Controlling als Stabsstelle
3.3 Controlling als Linienstelle
3.4 Das Anforderungsprofil an einen Controller
4 Controlling im Informationssystem
4.1 Datenbestände des Informationssystems
4.2 Dimension des Berichtswesens
4.3 Anforderungen an Berichte
4.4 Regelmäßigkeit der Berichterstattung
5 Grundlagen der Planung
5.1 Grundbegriffe der Planung
5.2 Grundsätze der Planung
5.3 Aufgaben der Planung
5.4 Zeitliche Differenzierung der Planung
6 Strategische Planung
6.1. Aufgaben und Merkmale der strategischen Planung
6.2 Chancen-Risiken-Analyse
6.3 Stärken-Schwächen-Analyse
6.4 Portfolio-Analyse zur Strategieentwicklung
7 Projektplanung
7.1 Begriff und Arten von Projekten
7.2 Ablauf des Projektmanagement
7.3 Aufgaben des Controllings im Rahmen des Projektmanagements
8 Operative Planung
8.1 Grundlagen der operativen Planung
8.2 Formen der Auftragserteilung
8.3 Teilpläne der operativen Planung
9 Kontrolle und Steuerung
9.1 Aufgaben von Kontrollen
9.2 Kontrollmöglichkeiten in der strategischen Planung
9.3 Kontrolle der Projektplanung
9.4 Kontrolle der operativen Planung
10 Instrumente des strategischen Controllings
10.1 Modell der Lebenszykluskurve
10.2 Konzept der Kostenerfahrungskurve
10.3 Modell der Branchenstrukturanalyse
11 Methoden zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung und Risikoanalyse
11.1 Produktbewertungsmodelle
11.2 Statistische Verfahren der Investitionsrechnung
11.3 Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung
11.4 Methoden der Risikoanalyse
12 Rationalisierungsinstrumente
12.1 Produktwertanalyse
12.2 Gemeinkostenwertanalyse
12.3 Geschäftsprozessoptimierung
13 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
13.1 Begriff und Aufgaben von Kennzahlen
13.2 Kennzahlen zu Vermögens- und Kapitalstrukturen
13.3 Kennzahlen zur Rentabilität und Liquidität
13.4 Kennzahlensysteme
13.5 Spezifische Kennzahlen in Verwaltungscontrolling
14 Kapazitätserweiterungen
14.1 Begriff und Bedeutung der Kapazität
14.2 Formen der Kapazitätserweiterung
14.3 Entscheidungen über die Erweiterung von Endstufen
14.4 Entscheidungen über die Erweiterungen von Vorstufen
15 Kapazitätsverminderungen
15.1 Motive für Kapazitätsverminderungen
15.2 Entscheidungskriterien zur Bestimmung des wirtschaftlichen Stilllegungszeitpunktes
15.3 Qualitativ-wirtschaftliche Aspekte von Stilllegungen
16 Outsourcing
16.1 Begriff und Formen des Outsourcings
16.2 Motive für die Verringerung der Fertigungsziele
16.3 Ökonomische Probleme von Fremdvergaben
16.4 Wirtschaftlichkeitskriterien zur Beurteilung von Outsourcing-Maßnahmen
17 Balanced Scorecard
17.1 Konzepte der Balanced Scorecard
17.2 Das Perspektivenkonzept
17.3 Die Kennzahlen der Balanced Scorecard
17.4 Beurteilung des Konzepts der Balanced Scorecard
18 Zielkostenmanagement
18.1 Konzeption des Zielkostenmanagements
18.2 Bestimmung von Verkaufspreisen und Zielgewinnen
18.3 Aufspaltung der Zielkosten
18.4 Zielkostenmanagement und Rationalisierung
19 Controlling: Begriff und Aufgaben
19.1 Historische Entwicklung des Controllings
19.2 Begriffsabgrenzung
19.3 Controlling-Aufgaben im Überblick
19.4 Spezifische Aufgaben in öffentlichen Organisationen
1 Phasen des Controlling-Prozesses
In diesem Kapitel werden die Ziele des Controllings in Profit- und Non-Profit-Organisationen beschrieben.
Ferner wird auf die Phasen des Controlling-Prozesses eingegangen und die Besonderheiten für Verwaltungsorganisationen beschrieben.
1.1 Ziele des Controllings
Die Hauptziele des Controllings sind immer ähnlich den Zielen der unternehmerischen Tätigkeit bzw. der Ziele von (nicht gewinnorientierten) öffentlichen Institutionen. Häufig unterscheiden sich die Ziele von gewinnorientierten und nicht gewinnorientierten Organisationen:
Organisationen mit Gewinnerzielungsabsicht
Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht
Sicherung der langjährigen Unternehmensexistenz
Wirtschaftliche und politische Existenzsicherung
Gewinnmaximierung
Bedarfsdeckung
Liquiditätssicherung
vollständige und teilweise Kostendeckung
Substanzerhalt
Substanzerhalt
Anpassung an veränderte Märkte
Umsetzung und Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen
Hinzugewinnen von Marktanteilen
Diese Ziele haben unterschiedliche zeitliche Reichweiten. Während die erstgenannten eher längerfristig angelegt sind, sind die letztgenannten kurzfristiger.
1.2 Phasen des Controllingablaufs
Für das Erreichen der Ziele aus dem Controlling wird ein Planungs- und ein Kontrollsystem benötigt. Diese sind wesentliche Voraussetzungen für die Erfüllung der aus dem Controlling erwachsenen Aufgaben.
Die Controlling-Aufgaben werden mit verschiedenen Aktivitäten erfüllt. Diese erfolgen zumeist in einer festgelegten Reihenfolge. Das geschieht teils parallel, teils nacheinander. Ebenfalls können sich die Aktivitäten vielseitig beeinflussen.
Ausgangspunkt eines Controllingprozesses sind zwei Faktoren:
Externe Einflussfaktoren
interne Einflussfaktoren
Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen
technische Umstellungen
Entwicklung auf Absatz- und Beschaffungsmärkten
Ausbildungsstand der Mitarbeitenden
Ansehen des Unternehmens
Anschließend läuft der Controlling Prozess in den folgenden Phasen ab:
Bei der Zielbildung werden auf Grundlage der internen und externen Eingabegrößen die möglichen Ziele ausgewählt. Die Unternehmensführung erklärt hieraus anschließend die verbindlichen Ziele.
Bei der Strategieerarbeitung werden aus den langfristigen Zielen Strategien entwickelt und in der Leitung verabschiedet. Strategien sind die Maßnahmen, die für das Erreichen des Ziels erforderlich sind. Strategien müssen nicht für die gesamte Organisation gelten. Sie können auch lediglich in einzelnen Abteilungen Anwendung finden.
Bei der operativen Planung werden konkrete Aktionen geplant, anhand derer die Strategien umgesetzt werden sollen. In einer ersten Phase werden hier in einer Analyse Handlungsmöglichkeiten ermittelt, die zur Umsetzung der Strategien geeignet sind.
Anschließend werden in der Alternativprognose die Auswirkungen der einzelnen Handlungsmöglichkeiten auf die Zielgrößen geprüft und eine Prognose erstellt. Im letzten Schritt erfolgt in der Alternativbetrachtung die Betrachtung der als grundsätzlich als geeignet empfundenen Alternativen. Entscheidung erfolgt in den Schritten noch nicht.
Bei der Entscheidung werden eine oder mehrere zur Verfügung stehende Möglichkeiten ausgewählt. In der Regel obliegt die Entscheidung der Leitung. Die nächstgelegenen Bereiche erarbeiten zumeist Entscheidungsvorschläge.
Bei der Durchsetzung und Realisierung muss die Entscheidungsetage zunächst die Umsetzung bei den dafür geeigneten Stellen veranlassen. Dieser Schritt wird Durchsetzung genannt. Den Funktionsträgern obliegt dann die konkrete Realisierung der getroffenen Entscheidungen.
Bei der Kontrolle erfolgt die Gegenüberstellung von tatsächlich eingetretenen Ist-Werten mit Plan- bzw. Sollwerten.
Bei der Abweichungsanalyse werden die Abweichungen zwischen den Ist- und den Planwerten bzw. Sollgrößen analysiert und die Ursachen für diese Abweichungen ermittelt. Diese Ursachen sind die Eingabegröße für den folgenden Steuerungsprozess, bieten aber auch Erkenntnisse für folgende Planungsaufgaben.
Bei der Steuerung werden Korrekturen und Veränderungen in den betrieblichen Abläufen erarbeitet und umgesetzt. Hierbei sollen die ergebenen Abweichungen beseitigt werden. Sind Korrekturen nicht möglich oder erfolglos, wird der ursprüngliche Plan angepasst.
Um sicherzustellen zu können, dass die Controlling-Prozesse wirtschaftlich ausgeführt werden, ist es innerhalb einer Organisation wichtig, die Koordination der einzelnen Teilbereiche zu regeln.
Hierfür werden innerhalb einer Organisation Zielvorgaben für die Teilbereiche erarbeitet. Diese werden mit der Gegenüberstellung der geplanten Werte und den Istwerten überwacht.
Die Beobachtungsaufgabe lässt sich mit folgenden Controllingablauf vollziehen:
Erarbeitung von Vorgaben für die einzelnen Teilbereiche. Diese richten sich an den Zielen der Organisation aus.
Aus diesem Vorgehen resultieren Sollgrößen. Diese sind mit den Ist-Größen zu vergleichen.
Die Ursachen der aufgetretenen Abweichungen werden analysiert.
Innerhalb des vorgegebenen Ziels und Handlungsrahmens werden Vorschläge für Korrekturmaßnahmen abgeleitet.
Sind Korrekturen nicht möglich, werden Vorschläge zur Änderung des Ziel-Handlungsrahmens gemacht.
Bei Punkt 4 soll möglichst im Einvernehmen mit den betreffenden Fachabteilungen ohne Einschaltung höherer Stellen zusammengearbeitet werden.