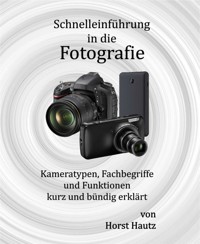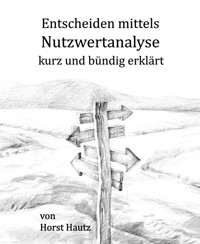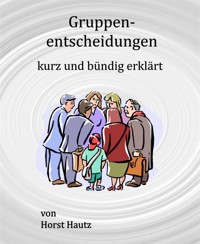
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Häufig ist es notwendig oder gewünscht Entscheidungen in einer Gruppe zu treffen. Dieses Buch erklärt mögliche Vorgehensweisen, zeigt Vor- und Nachteile auf und gibt Hilfestellung für Moderation und Datensammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wege zum Ziel
In Gruppen gemeinsam entscheiden
Aggregation über individuelle Entscheidungen
Abstimmungsregeln
Der Moderator
Vorteile von Gruppenentscheidungen
Nachteile von Gruppenentscheidungen
Verfahren zur Datensammlung
Brainstorming
Brainwriting
Einleitung
Oftmals ist es nicht möglich oder auch nicht gewünscht Entscheidungen alleine zu treffen. Zu Gruppenentscheidungen kommt es einerseits durch Vorgaben und Vorschriften oder andererseits in Erwartung besserer Ergebnisse durch Miteinbeziehung mehrerer Personen. Speziell komplexe Fragen erfordern eine möglichst breite Sicht auf das Problem, welche meist nur durch eine Gruppe von Entscheidern gegeben ist. Im Berufsleben werden Gruppenentscheidungen oftmals durch Gesetze und Satzungen erzwungen. Aber wie erhält man aus einer Vielzahl von Meinungen ein optimales Ergebnis? Nur in den seltensten Fällen ist eine einheitliche Meinung aller Beteiligten gegeben. Dieses Buch zeigt Wege, wie unterschiedliche Meinungen der Entscheider in eine kollektive Entscheidung geformt werden können.
Wege zum Ziel
In der Literatur findet man zwei grundlegende Ansätze der Entscheidungsfindung. Einerseits kann versucht werden in der Gruppe gemeinsam zu entscheiden. Aber auch eine individuelle Entscheidung aller Beteiligten mit anschließendem Zusammenführen der Einzelentscheidungen zu einer Gruppenentscheidung ist möglich. Diesen Vorgang bezeichnet man als Aggregation. Zuerst ist es meist sinnvoll zu versuchen eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Ist dies nicht möglich können individuelle Entscheidungen getroffen und diese anschließend mittels Abstimmung zu einer Gruppenentscheidung aggregiert werden.
In Gruppen gemeinsam entscheiden
Hier erfolgt eine Diskussion in der Gruppe zu allen relevanten Fragen und Punkten. Dadurch wird das gesamte Wissen der Gruppe an jeden Einzelnen weitergegeben. Anschließend muss eine Einigung auf einen gemeinsamen Standpunkt bzw. ein gemeinsames Ergebnis erzielt werden. Die Gruppe trifft alle Entscheidungen gemeinsam und wirkt dabei wie ein einzelnes Individuum. Ist es nicht möglich sich auf einen gemeinsamen Standpunkt zu einigen, so muss mit Individualentscheidungen und anschließender Aggregation fortgefahren werden.
Aggregation über individuelle Entscheidungen
Kann gemeinsam keine Entscheidung getroffen werden, so ist es möglich zuerst Individualentscheidungen zu treffen und diese anschließend zu einem Gruppenergebnis zu aggregieren. Um eine möglichst gute Informationsbasis zu erhalten ist es sinnvoll möglichst viele Schritte des Entscheidungsprozesses gemeinsam durchzuführen. Die Diskussion in der Gruppe ermöglicht einen Wissensaustausch und verbreitert dadurch die Entscheidungsbasis. Die Gruppendiskussion sollte daher so ausgiebig wie möglich ausfallen. Einzelne Streitpunkte können ausgeklammert und damit übergangen werden. Diese Punkte können die Beteiligten anschließend nach eigenen Vorstellungen in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Wurden alle Punkte ausreichend diskutiert, trifft jeder Beteiligte die Entscheidung für sich alleine. Liegen die Einzelentscheidungen vor, so erfolgt die Bestimmung der Gruppenentscheidung durch eine Abstimmung.
Abstimmungsregeln
Bevor die Gruppenentscheidung getroffen werden kann, muss durch die Gruppenmitglieder die anzuwendende Abstimmungsregel gewählt werden. Zur Auswahl stehen folgende in der Literatur durch Eisenführ/Weber1 , Laux2 und Bamberg/Coenenberg/Krapp3 genannte Abstimmungsregeln:
Das Einstimmigkeitskriterium. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidung fällt nur wenn eine Alternative sämtliche Stimmen erhält. Ist dies nicht möglich, muss der Informationsbeschaffungs- und Informationsverarbeitungsprozess fortgesetzt werden. Besonders bei rasch zu treffenden Entscheidungen ist das Einstimmigkeitskriterium daher problematisch.
Regel der einfachen Mehrheit oder Single-Vote-Kriterium. Jedes Gruppenmitglied hat eine Stimme und wählt damit seine präferierte Alternative. Die Alternative mit den meisten Stimmen gewinnt. Hier ist nur ein Wahlgang notwendig.
Regel der absoluten Mehrheit. Jedes Gruppenmitglied hat eine Stimme. Die Alternative mit mehr als 50 % gewinnt. Erreicht keine Alternative im ersten Wahlgang die 50 %, so kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Alternativen mit den meisten Stimmen.
Die Hare-Regel. Hier erfolgt die Abstimmung in mehreren Wahlgängen, wobei jedes Mitglied jeweils eine Stimme hat. Erhält eine Alternative die absolute Mehrheit, so ist sie gewählt. Ist dies nicht der Fall wird die Alternative mit der geringsten Stimmenzahl eliminiert und es erfolgt ein weiterer Wahlgang. Dies wird so lange wiederholt bis eine Alternative gewählt wurde.
Regel der Mehrheit der Paarvergleiche. Es erfolgt ein Paarvergleich für alle möglichen Alternativenpaare. Pro Paar erfolgt die Abstimmung durch die Regel der einfachen Mehrheit. Jene Alternative mit den meisten gewonnenen Paarvergleichen gewinnt.
Regel der sukzessiven Paarvergleiche. Hier findet ein Paarvergleich zufällig ausgewählter Alternativen statt. Pro Paar erfolgt die Abstimmung durch die Regel der einfachen Mehrheit, die Alternative mit weniger Stimmen scheidet aus. Es erfolgt ein weiterer Paarvergleich, wobei wieder eine Alternative ausscheidet usw. Der Sieger des letzten möglichen Paarvergleichs ist schließlich gewählt.