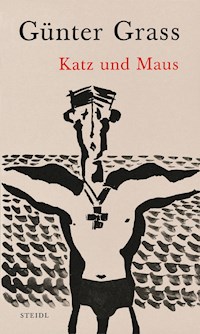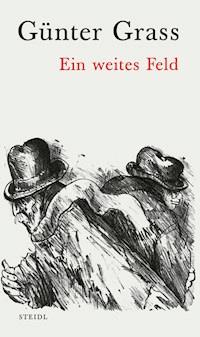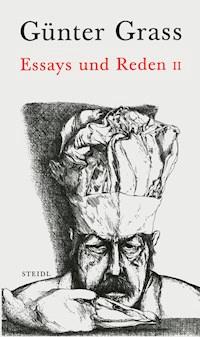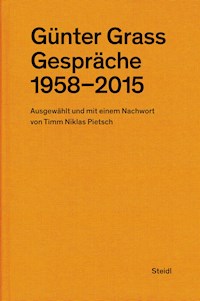
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Tanzen Sie noch? Leiden Sie unter dem Alter? Was war das größte Unglück in Ihrem Leben? Wären Sie lieber eine Frau?« – Es ist bemerkenswert, mit welcher Ausdauer Günter Grass über sechs Jahrzehnte auf die unterschiedlichsten Fragen seiner Gesprächspartner eingegangen ist, mal mit Humor, mal kompromisslos, stets auf hohem Sprach- und Reflexionsniveau. Ob als Schriftsteller, Bildhauer oder Grafiker, ob als gelernter Sozialdemokrat, Staatsbürger mit besonderer Reputation oder Literaturnobelpreisträger, immer wieder wurde er bis an sein Lebensende wie kaum ein Zweiter »ausgefragt«. Und stets nahm er in wechselnden Rollen Stellung zu ästhetischen, gesellschaftspolitischen und tagesaktuellen Problemen. Jederzeit auskunftsfreudig erläuterte der engagierte Zeitgenosse seine künstlerischen Ansätze und bewährte Arbeitsprozesse, äußerte sich zu Fragen der Poetik und zu Vorbildern seines Schaffens in Literatur und Politik, sprach offen über Frühprägungen, späte Einsichten und anhaltend belastende Traumata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass Gespräche 1958–2015
Ausgewählt und mit einem Nachwort von Timm Niklas Pietsch
Steidl
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Den Menschen entlarven. Der Bildhauer-Dichter Günter Grass (Februar 1958)
Ich sehe keinen Grund, den Schauplatz Danzig zu wechseln (März 1962)
Ein Reduzieren der Sprache auf die Dinglichkeit hin (Dezember 1963)
Manche Freundschaft zerbrach am Ruhm (September 1965)
Gespräch über Deutschland (Dezember 1966)
Terror taucht auf, wenn Angst erzeugt wird (Oktober 1967)
Als ich siebzehn war (Mai 1968)
Die Ideologien haben versagt (Februar 1969)
Ein Tempus kann auch ein Stilmittel sein (Mai 1969)
Ich und meine Rollen (September 1969)
Ich bin Sozialdemokrat, weil ich ohne Furcht leben will (Dezember 1970)
Ein Gegner der Hegelschen Geschichtsphilosophie (Mai 1971)
Die Verzweiflung arbeitet ohne Netz (September 1974)
Ich kann mir die Themen nicht aussuchen (März 1975)
Die Ambivalenz der Wahrheit zeigen (September 1975)
Im Ausland geschätzt – im Inland gehaßt (Oktober 1977)
Die liegengebliebenen Themen (Januar 1980)
Von morgens bis abends mit dem deutschen pädagogischen Wahn konfrontiert (Mai 1980)
Phantasie als Existenznotwendigkeit (Januar 1981)
Einsicht ist nicht immer gerade eine christliche Tugend gewesen (August 1982)
Wir sind die Verfassungsschützer (Dezember 1983)
Sisyphos und der Traum vom Gelingen (Juni 1985)
Fiktionen sind Lügen, die die Wahrheit erzählen (Juni 1985)
Mir träumte, ich müßte Abschied nehmen (März 1986)
Die Zeit heilt alle Wunden oder Die Schuld hört nie auf (September 1989)
Viel Gefühl, wenig Bewußtsein (November 1989)
Deutschland, einig Vaterland? (Februar 1990)
Gegen meinen Willen setzt bei mir so eine Art Absonderung ein (Juli 1990)
Mit Johnson konnte man handwerklich sprechen (März 1991)
Der Autor und sein verdeckter Ermittler (Januar 1996)
Die Disziplin wechseln, beim Gegenstand bleiben (März 1996)
Eine Verführung für Nichtleser (März 1997)
Aus dem Bildnerischen ins Wörtliche (Sommer 1997)
Nicht von der Bank der Sieger aus (Oktober 1997)
Ich bin ein lebenslustiger Pessimist (Juni 1999)
Zivilisiert endlich den Kapitalismus! (Dezember 1999)
Kein Raum für Spekulationen (April 2002)
Vor falschem Beifall habe ich nie Angst gehabt (Mai 2002)
Helden? Ach was, die brauchen wir nicht (Juni 2003)
Es ist nicht meine Aufgabe als Schriftsteller, Hosianna zu rufen (Oktober 2003)
Die in sich geschlossene Idylle nehme ich wahr im Verhältnis zu ihrer Gefährdung (2004)
Wir werden uns veröstlichen (Mai 2004)
Mein Verhältnis zum polnischen Gdańsk ist mit den Jahren gewachsen (August 2004)
Das gesprochene Wort ist Teil der Literatur (Februar 2005)
Immer noch ein weites Feld (Juli 2005)
Ich stand zwischen den Fronten (Mai 2006)
Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche (Juli 2006)
Im Vakuum heiter bleiben … (Juli 2009)
Leisetreter gab es genug (März 2010)
Der Sozialdemokratie fehlen konsequente Personen (April 2013)
Der Schriftsteller darf nie auf Seiten des Siegers stehen (Sommer 2013)
Ich bin ein umgänglicher Mensch (April 2014)
Ursache ist im Grunde immer der Schmerz (März 2015)
Timm Niklas Pietsch: »Ich bewege mich zwischen allen Stühlen.« Nachwort
Bibliographische Nachweise
Personenregister
Editorische Notiz
Den Menschen entlarven. Der Bildhauer-Dichter Günter Grass
(Februar 1958)
GÜNTER GRASS Ihr Journalisten wollt alle so viel wissen, als ob ein Dichter selber wüßte, worum es ihm geht. Aber Sie werden lachen, ich weiß genau um mein ›Anliegen‹, wenn mir auch beim Schreiben so allerhand Gedanken und Bilder kommen, die ich nicht vorausahnen konnte, die aber genau da hingehören, wo sie am Ende stehen. Die Tragödie des Menschen mit den Mitteln der Komödie bewältigen – ich weiß nicht, ob Sie mit einem solchen Satz etwas anfangen können –, aber das ist es wohl, worum es mir geht. Der Mensch muß entlarvt werden, die Klischees müssen zertrümmert, die äußeren Fassaden niedergerissen werden, damit die eigentliche Existenz sichtbar werden kann.
In »Onkel, Onkel« zeige ich einen anscheinend harmlosen, gutmütigen Menschen, der ein Massenmörder ist, zum Schluß aber an der Welt der Kinder scheitert. Ich nenne ihn einfach einen ›Systematiker‹, weil er mit einer kaum zu fassenden Gründlichkeit sein Mord-Metier betreibt.
Sie fragen mich nach meinen geistigen Ahnen: Büchner, Büchner, immer wieder Georg Büchner! Von ihm kommt alles her. Die Becketts, Ionescos, Adamovs haben alle von ihm gelernt. Im übrigen geht es darum, das Erkannte darzustellen, ich meine: zu zeichnen, es optisch werden zu lassen. Direkte Aussagen kommen nicht an. Im Leben ist alles Geistige transponiert, und so muß es auch auf der Bühne sein …
Ich sehe keinen Grund, den Schauplatz Danzig zu wechseln
(März 1962)
HORST BIENEK Herr Grass, darf ich mit einer ganz einfachen Frage unser Gespräch beginnen? Sie haben zunächst Bildhauerei und Graphik studiert. Wie kamen Sie dazu, Gedichte und später Prosa zu schreiben?
GÜNTER GRASS Bevor ich Schüler auf der Kunstakademie Düsseldorf wurde, habe ich in Düsseldorf in einem Grabsteingeschäft eine Steinmetz- und Steinbildhauerlehre abgelegt. Während dieser Zeit kurz nach dem Krieg habe ich schon Gedichte geschrieben, und zwar zuerst auf dem Friedhof und dann – als der Wiederaufbau begann, nach der Währungsreform – auf dem Baugerüst beim Sandsteinversetzen. Leider sind diese Gedichte nicht besonders gelungen – es wäre natürlich wunderbar, sagen zu können, ich hätte auf dem Friedhof lustige Gedichte und auf dem Gerüst in Vorahnung des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders traurige Gedichte geschrieben, aber dem ist nicht so. Sonst wäre dadurch ja auch der realistische Sozialismus bestätigt.
BIENEK Können Sie mir sagen, wer Ihnen literarisch die ersten Anregungen gegeben hat?
GRASS Ja, ich sehe in der Entwicklung drei Stadien. Das erste Stadium war der Bücherschrank meiner Mutter, als ich ungefähr vierzehn Jahre alt war. Den habe ich planlos von oben nach unten durchgelesen. Das fing an mit Vicki Baum, ging über Dostojewski, Tolstoi und was nicht alles von der Deutschen Buchgemeinschaft. Das habe ich als erstes gelesen. Nach dem Krieg kam das Nachholbedürfnis; man kannte ja nichts, ich kannte kaum etwas von der modernen Literatur. Dann kamen Rilke, Ringelnatz, Apollinaire in der Übersetzung, Lyrik, Prosa, später Hemingway, Kafka, Faulkner. Wie den Bücherschrank meiner Mutter habe ich weiter kunterbunt durcheinander gelesen. Erst später fing ich dann an, etwas wählerisch zu werden, weil ich merkte, daß sich übersetzte Literatur kaum als Basis für eigene Versuche verwenden läßt. Dann las ich deutsche Klassiker. Also ein umgekehrter Bildungsweg: erstmal der Heißhunger auf die ausländische Literatur und dann Jean Paul, Goethe, Hoffmann und Keller.
BIENEK Sie haben zunächst Gedichte veröffentlicht. Nun hätte man erwarten können, daß Sie dann kurze Prosa schreiben, Erzählungen oder einen Roman. Sie aber haben gleich ein gewaltiges episches Werk mit über 750 Seiten geschrieben. War das nun von Anfang an so geplant oder haben sich Form und Umfang erst bei der Niederschrift, gleichsam wie von selbst ergeben?
GRASS Nein, ich habe mich eigentlich immer für einen Theaterautor gehalten, während ich Lyrik schrieb, von den Gedichten auf dem Friedhof angefangen, und habe lange versucht, diesen gesamten Stoffkomplex der »Blechtrommel« mit dem Dialog anzugehen. Aber diese Stoffe waren zu breit, flossen auseinander, und die Figur des Oskar Matzerath ließ sich durch den Dialog alleine nicht deutlich machen. Bei der Aufführung des Theaterstücks »Onkel, Onkel« in Köln, das nichts mit der »Blechtrommel« zu tun hat, erfaßte mich über den Betrieb des deutschen, subventionierten Theaters ein solcher gerechter oder ungerechter Zorn … Jedenfalls hat mir dieser Zorn geholfen, vom Dialogschreiben, vom Theaterschreiben vorübergehend Abstand zu nehmen. Ich habe es aus Wut gewagt, einen Roman zu schreiben, um es den Leuten vom Theater zu zeigen, mit der Vermessenheit, »ich werd’s euch mal zeigen, schreibt eure Stücke selber, ich schreibe jetzt Prosa«.
BIENEK Wie kamen Sie überhaupt zum Thema der »Blechtrommel«? Und da muß man gleich fragen: Wie kamen Sie zu der Figur des Zwerges Oskar, denn ohne ihn ist ja der Roman nicht denkbar?
GRASS Da muß ich schon wieder bei der Lyrik anfangen. Etwa 1950/51 fuhr ich das erste Mal nach Frankreich und habe dort einen sehr langen, metapherngeladenen, aber nicht sehr guten Zyklus geschrieben. Dieser Zyklus hieß: »Der Säulenheilige«. Es handelte sich um einen jungen Mann – heutzutage sollte das spielen –, einen Maurer, der plötzlich genug hatte vom Leben in seinem Dorf und sich mit Hilfe seines Handwerks, seines Könnens, eine Säule mauerte, auf diese Säule stieg und sich von seiner Mutter ernähren ließ, die ihm an einer Stange sein Frühstück brachte. Von dort oben herab, aus dieser Perspektive hat der junge Mann – lyrisch, wie ich es geplant hatte – das Leben im Dorf beschrieben. Aus Oskar ist dann später ein umgekehrter Säulenheiliger geworden. Es erwies sich, daß der Mann auf der Säule zu statisch ist, um ihn Prosa sprechen zu lassen. Deswegen ist Oskar von der Säule heruntergestiegen. Es blieb nicht bei der normalen Größe, sondern er ist noch ein bißchen mehr in die Erde gegangen und hatte schließlich einen Blickwinkel, der dem Blickwinkel des Säulenheiligen entgegengesetzt ist.
BIENEK Also hat er die Welt dann sozusagen aus der Froschperspektive gesehen?
GRASS Ja, er ist zwar ein großer Frosch, aber nennen wir es so.
BIENEK Herr Grass, darf ich Ihnen ein paar detaillierte Fragen zur Form stellen? Machten Sie sich einen genauen Plan, bevor Sie an die »Blechtrommel« herangingen, eine Art architektonischen Grundriß?
GRASS Ja, aber die erste Frage war für mich, den Ton zu finden. Zuerst war da der erste Satz des Romans, dieses ›Zugegeben‹, Doppelpunkt, dann gleich Oskars verschlagenes Bekenntnis, er sei Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Dann begann ich, weil ich den ganzen Stoffkomplex ja seit Jahren parat hatte, Kapitelpläne zu machen und den Stoff zu raffen, weil er immer schon zu Überschwemmungen neigte. Ich mußte ihn eindämmen, mußte Deiche bauen. Das war, so wie Sie es nennen, die architektonische Vorarbeit.
BIENEK Standen die Figuren, sagen wir die Hauptfiguren, von Anfang an fest, auch in deren Entwicklung?
GRASS Nein, es stand nur eine Figur fest, und das war Oskar Matzerath mit seiner Entwicklung, daß er im Alter von drei Jahren das Wachstum einstellt, mit 21 Jahren der Normalentwicklung gemäß beschließt, ein Stückchen zu wachsen und zum Buckel kommt. Und es stand fest, daß das Buch mit seinem 30. Geburtstag endet.
BIENEK Darf ich fragen, wie Sie auf die Idee kamen, den Oskar im dritten Lebensjahr nicht mehr wachsen zu lassen? Das ist ja immerhin ungewöhnlich. Wollten Sie damit einen bestimmten Blickwinkel und eine bestimme Naivität erreichen, in der er die Welt beobachtete?
GRASS Ja, das ist der eine Grund, warum er in dieser Höhe stehenbleibt, aber gleichzeitig hat er von der Geburt an, vom ersten Augenblick an, den Verstand und die Hellsicht eines Erwachsenen, mit allen Fehlern und Fehlspekulationen. Von den Erwachsenen wird er aber später nicht als Erwachsener erkannt, sondern bleibt immer der Dreikäsehoch. Dazu kommt natürlich der Reiz, daß er alles aus dieser Perspektive, von unten nach oben sieht, nicht nur die Leute um sich herum, sondern die gesamte Epoche.
BIENEK Kann es Ihnen passieren, daß Sie mitten im Schreiben ins Fabulieren kommen? Plötzlich merken Sie, daß Sie eine Figur eingeführt haben, die Sie eigentlich nur beschreiben, mit ein paar Beispiel charakterisieren wollten, und nun wird sie gewaltig und sprengt den Rahmen?
GRASS Nein, dazu darf es nicht kommen, daß sie den Rahmen sprengt. Sie muß – in begrenztem Maß – natürlich Zügel haben. In einer Konzeption muß die Zügellosigkeit der Nebenfiguren, muß das Wuchern eingeplant sein, muß der Zufall eingeplant sein. Eine starke, durchgeplante Konzeption bis zum Schluß des Romans schließt nicht aus, daß es innerhalb der Konzeption sehr viel Spielraum und Entwicklungsmöglichkeit für die Nebenfiguren, die Handlung, den Zuwachs an Schauplätzen gibt. Das muß alles in der Konzeption enthalten sein – im Grunde ist es eine Konzeption der Konzeptionslosigkeit.
BIENEK Ich frage deshalb, weil man die Vermutung geäußert hat, daß die Figur des Joachim Mahlke in Ihrer neuen Novelle »Katz und Maus« vielleicht eine Nebenfigur aus der »Blechtrommel« sei, die dort den Rahmen gesprengt hätte und die im Grunde einer eigenen Form bedurfte.
GRASS Ja, das stimmt. Nur hat es wenig mit der »Blechtrommel« zu tun. Ich stieß auf diesen Komplex, diesen Fall Joachim Mahlke, bei der Arbeit am neuen Roman. Zu Anfang dachte ich, es handelte sich um eine Episode, um ein Kapitel vielleicht, um eine Figur, die dann und wann wieder auftaucht. Ich merkte aber bald, daß der Fall Mahlke zu gewichtig war und die Gefahr bestand, daß er den Rahmen des neuen Romans sprengt. Also habe ich ihn ausgeklammert und eine Novelle aus ihm gemacht. In dieser Novelle gibt es nun ein paar Nebenfiguren, die Hauptfiguren in dem neuen Roman sind.
BIENEK Haben Sie bewußt die Arbeit an dem neuen, großen Roman unterbrochen, um diese Novelle zu schreiben oder stand die Idee schon vorher fest?
GRASS Nein, sie war mir während der Arbeit im Wege. Ich mußte sie erst schreiben, und jetzt kann ich am Roman weiterarbeiten.
BIENEK Sie hat Ihnen sozusagen geholfen, sich freizumachen und das andere Vorhaben fortzusetzen. Inwieweit ist die »Blechtrommel« biographisch oder sogar autobiographisch? Wie sehr brauchen Sie tatsächliche, selbst erlebte Ereignisse als Vorwand zum Schreiben?
GRASS Soweit ich mich an mein eigenes Leben zurückerinnern kann, finde ich weder in der »Blechtrommel« noch in der Novelle »Katz und Maus« Passagen aus meinem Leben. Ich habe auch nicht die Absicht, etwas Autobiographisches zu erzählen, sondern glaube, daß es unmöglich ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Erinnerungen an angedeutete Erlebnisse, Erlebnisse, die nur auf ein paar Worten, einem Geruch, einem Anfassen, auf einem Vernehmen vom Hörensagen beruhen. Diese Dinge, diese Fragmente lassen sich viel leichter in eine Erzählung umsetzen. Dazu kommt noch, daß insgesamt jedes Buch mit allen Nebenfiguren, mit dem Helden, mit der Landschaft, mit der Auswahl des Tones natürlich ein Stück des Autors ist, ein bestimmtes Stück. Das bedeutet auch eine Selbstentdeckung des Autors.
BIENEK Aber es läßt sich doch nicht leugnen, Herr Grass, daß Sie in Ihren Büchern besonders lokal gebunden sind, an Ihre Heimat, an Ihre Kindheit, mehr doch als andere Autoren, sagen wir mal Nossack oder Thomas Mann.
GRASS Ja, es wäre mir zum Beispiel unmöglich, einen Roman über Passau oder über Würzburg zu schreiben, sosehr es mich lockt. Aber ich glaube auch nicht, daß ich mich hinsetzen und nach Passau oder Würzburg fahren, mir einen Stadtplan kaufen, mir diese Stadt erarbeiten, ins Archiv gehen und dieses und jenes lesen könnte. Das mag mit der Form des Kolportageromans gehen, aber die Form, die ich betreibe, eignet sich nicht dafür. Ich sehe auch keinen Grund, den Schauplatz zu wechseln. Im Grunde beschreibe ich den Vorort Langfuhr, weniger die Stadt Danzig selbst. Diesen Vorort mit seinen ungefähr 75 000 Einwohnern, den Straßenwinkeln kenne ich ganz gut. Wenn ich mir nun in jedem Roman ein bestimmtes Viertel vornehme, Nebenstraßen mit einem Platz in der Mitte, kann ich noch 15, 16 Romane allein über diesen Vorort schreiben, das habe ich mir auf dem Stadtplan von Danzig ungefähr ausgerechnet. Ich bin also mit Danzig-Langfuhr, mit der Weichselmündung, mit der Hafenvorstadt, mit den Badeorten Zoppot und Umgebung, mit dem kaschubischpolnischen Teil, mit dem Werder und Westpreußen überhaupt vollkommen ausgelastet. Es gibt gar keinen Anlaß, den Schauplatz zu wechseln.
BIENEK Aber Sie leben ja nun auch schon eine ganze Weile in Berlin und kennen auch hier die Straßen und den Grunewald, den Kurfürstendamm …
GRASS Ja, das ist ja auch schon in der »Blechtrommel« so, in der das dritte Buch in Düsseldorf spielt. Ein Großteil meines nächsten Romans spielt in Berlin. Es zeigt sich, daß der Vorort Langfuhr um mehrere Vororte bereichert werden kann, zum Beispiel um Düsseldorf oder um Berlin. Das Zentrum ist immer Danzig. Ich gruppiere alles drum herum – ohne daß ich es übrigens vorgehabt hätte, es ist mir so begegnet.
BIENEK Also, ich möchte so sagen: Sie sind gar nicht so sehr abhängig von dem Schauplatz Danzig-Langfuhr oder Danzig, sondern von einer präzisen Beschreibung einer bestimmten Stadt oder eines bestimmten Teils einer Stadt, sozusagen vom Topographischen.
GRASS Ich möchte das nicht verallgemeinern. In dieser Beziehung bin ich ein Glückspilz. Durch den Verlust dieser Provinzen, der deutschen Ostgebiete – so sagt man –, bin ich in einer Lage, über eine Stadt schreiben zu können, in der es heute keine deutsche Bevölkerung mehr gibt. Durch zwei Polenreisen habe ich mir die Möglichkeit eröffnet, auch über Danzig oder Gdańsk mit polnischer Bevölkerung schreiben zu können. In meinem neuen Roman spannt sich der Bogen also bis ins heutige, polnische Gdańsk – von Danzig zu Gdańsk. Dazu kommt, daß ich mit dem Dialekt dieser Stadt umgehen kann wie mit einer toten Sprache. Für mich ist Danziger Platt etwa das, was für einen Studienrat Latein bedeutet.
BIENEK Ihre Figuren – das sagten Sie auch vorhin selbst – haben alle von vornherein schon etwas Statisches. Vielleicht reizt Sie dabei auch eine Stadt, die wie unter einer Glasglocke unveränderlich für Sie ist.
GRASS Ja. Als ich jetzt wieder da war, habe ich beobachtet und gesehen, wie jetzt eine ganz andere Generation dort aufwächst. Ich habe in Zoppot Ferien gemacht, wenn man das so nennen will, und dort leben heute sechzehn-, siebzehnjährige junge Menschen, die dort geboren sind.
BIENEK Aber dadurch ist Danzig eine ganz andere Stadt geworden.
GRASS Ja. Die Leute, die in Danzig wohnen, kommen zumeist aus Wilna und Umgebung, also vom flachen Land. Ich habe an der Mottlau, einem Nebenfluß der Weichsel, der durch Danzig fließt, Männer gesehen, die schon wieder diesen etwas wiegenden Gang haben, wie ihn eigentlich nur Leute haben, die in einer Hafenstadt geboren sind. Es mag doch sein, daß so etwas mitformt, und über die Nationalitäten hinweg prägend ist.
BIENEK Bestimmte Figuren tauchen bei Ihnen immer wieder auf, zum Beispiel erscheint in einer Nebenepisode von »Katz und Maus« einmal der Blechtrommler. Auch Tulla Pokriefke – eine Nebenfigur in Ihrer Novelle – soll in Ihrem neuen Roman die Hauptfigur sein.
GRASS Nicht die Hauptfigur, der neue Roman hat mehrere Hauptfiguren, gleichwertig in vielen Generationen nebeneinander.
BIENEK Soll das heißen, Herr Grass, daß Sie eine Art Panorama von Danzig geben wollen oder einen Zyklus von mehreren in sich geschlossenen, aber doch zusammen gehörenden Werken?
GRASS Ich habe es nicht vorgehabt. Es hat sich bei der Arbeit erwiesen. Zum Beispiel habe ich bei der Arbeit an der Novelle nicht vorgehabt, Oskar Matzerath wieder auftreten zu lassen, aber bei der Beschreibung einer Straße und des Badeortes Brösen war er auf einmal da und ließ sich nicht leugnen. Er ist für mich existent, und ich sehe keinen Grund, weswegen ich ihn auswandern lassen soll.
BIENEK Darf man fragen, wie es kommt, daß Ihre Vorliebe ein wenig ins Groteske – im klassischen Sinne – gezeichneten Figuren gilt? Sie sind meist körperlich mißgestaltet oder gar verkrüppelt, Oskar eben, der mit drei Jahren aufhört zu wachsen, der Hafenkellner mit dem Narbenlabyrinth auf dem Rücken, Mahlke mit dem übergroßen Adamsapfel oder auch Tulla Pokriefke, die Sie ja in einer demonstrativen Magerkeit zeigen.
GRASS Sie sagten ganz richtig in einer klassischen Groteske, weil in dieser klassischen Groteske alle Elemente, das Tragische, das Komische, das Satirische nebeneinander Raum haben und sich gegenseitig stützen. Das Phantastische und das Realistische kontrollieren sich gegenseitig, heben sich nicht auf, sondern steigern sich. Ich glaube, daß ich beim Prosaschreiben innerhalb der Groteske am meisten Möglichkeiten habe, wenn sie von weit her geplant ist. Es passen dann auch Figuren mit Adamsapfel hinein oder Leute, die klein bleiben – und Leute, die auf einer Säule leben, ohne daß sie künstlich wirken, falls ich mal einen Roman schreibe über Säulenheilige. Die Figuren müssen dabei realistisch bleiben, und ein Dreijähriger, der beschließt, sein Wachstum einzustellen, muß wie eine realistische Figur anmuten, nicht wie ein Kunstgeschöpf.
BIENEK Es läßt sich ja nicht leugnen, daß Sie eine gewisse Faszination dafür haben, daß bei Ihnen solche Figuren häufiger auftauchen als bei anderen Autoren. Das ist sozusagen eine bestimmte, typische Grasssche Situation.
GRASS Ja, nun sind ja alle Figuren um Oskar Matzerath herum zumeist Kleinbürger und in ihrer Art, in ihrer Groteske alle Originale, wie man in Deutschland sagt. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, daß auch wir alle Originale sind. Diese soziologischen Lehren, die nicht mehr an die Existenz des Individuums glauben wollen und die eine ziemliche triste Gleichmacherei betreiben – das ist meiner Meinung nach nicht bewiesen. Ich sehe selbst in einer vollbesetzten Straßenbahn keine Masse, sondern lauter Originale, lauter Individuen: Der eine hat einen Kropf, der andere hat einen dicken Adamsapfel, der eine ist groß, der andere ist klein, der eine schnäuzt sich ständig und hat keinen Schnupfen, der andere hat einen Schnupfen und schnäuzt sich nicht.
BIENEK Wie lange haben Sie an der »Blechtrommel« geschrieben?
GRASS Die Vorarbeit an dem gesamten Komplex liegt schon sehr lange zurück, ungefähr sieben Jahre. Zunächst hatte ich noch vor, aus dem Stoff Theaterstücke zu machen oder ein Theaterstück. Die eigentliche Schreibarbeit am Manuskript dauerte dann ungefähr anderthalb Jahre. Die Vorstudien brauchten sehr viel Zeit.
BIENEK Herr Grass, wenn Sie erst einmal die Idee für ein neues Werk haben, schreiben Sie dann direkt hintereinander oder braucht es dafür gewisse Voraussetzungen?
GRASS Zum Beispiel kann ich kein Wort mehr schreiben, sowie ich Alkohol trinke – obgleich ich gerne ein Glas trinke. Was ich aber zum Schreiben brauche, sind Zigaretten. Ich rauche sehr viel dabei, während meine Romanhelden als Ich-Erzähler zum Schreiben immer eine Stimulanz haben. Oskar Matzerath hat eben seine Trommel, und Pilenz, der Messdiener, hat den Schuldkomplex, weil er sich mehr oder weniger zu Recht einbildet, an Mahlke schuldig geworden zu sein, als er ihm die Katze an den Hals gesetzt hat. Das ist für ihn der Motor, die Sache aufzuschreiben.
BIENEK Haben Sie – während Sie die »Blechtrommel« geschrieben haben – von vornherein gewußt, daß dieses Buch ein Erfolg werden wird?
GRASS Ich habe beim Schreiben gemerkt, daß mir das Buch gelingen wird. Es lief darauf zu, und daraus habe ich den Schluß gezogen, daß es auch auf dem Buchmarkt ein Erfolg werden wird.
BIENEK Können Sie jetzt nach dem Erfolg von Ihren Tantiemen leben?
GRASS Ja, ich lebe seit ein paar Jahren eigentlich nur oder vorherrschend von der »Blechtrommel«, im gewissen Sinn arbeitet Oskar Matzerath für mich. Ich brauche ihm gar nichts sagen, er macht das von ganz alleine. Das ist eine wechselseitige Beziehung.
BIENEK Sie sagten einmal, die »Blechtrommel« ist nur deshalb geschrieben worden, weil die deutschen Theaterintendanten Ihre Stücke nicht spielen wollten. Soll das heißen, daß Sie überhaupt am liebsten Theaterstücke schreiben?
GRASS Ja, das ist meine heimliche Liebe, obgleich ich viel lieber ins Kino gehe. Aber ich schreibe gerne Theaterstücke. Nur sehe ich zur Zeit – umgeben vom deutschen subventionierten Theater – kaum eine Möglichkeit für einen Autor hier in Deutschland, weiterarbeiten zu können. Man kann ein Gedicht, man kann auch einen Roman für die Schublade schreiben. Aber für ein Theaterstück ist die Schublade nicht der richtige Aufenthaltsort, das muß auf die Bühne. Man darf es nicht nur einmal sehen, man muß es mehrmals sehen. Unsere Dramaturgen machen sich sehr viel Sorgen um die Zukunft des deutschen Theaters und sprechen immer von der Krise des Theaters. Sie können es aber trotzdem nicht lassen, immer nur Uraufführungen anzupreisen und auf Uraufführungen hinzuarbeiten. Als Autor sehe ich da kaum eine Möglichkeit, mit dem Theater, wie es jetzt existiert, weiterarbeiten zu können. Man müßte alle Dramaturgen – das ist ein Vorschlag, als Experiment – fristlos entlassen und den direkten Umgang zwischen Regisseur und Schauspieler fördern, die ja nicht lesen. Schauspieler und Regisseure werden durch die Dramaturgen am Lesen gehindert. Wenn man dieses Zwischenglied herausnähme, könnte ich mir eine Weiterarbeit vorstellen. Man müßte auch die Subventionen streichen, dann gäbe es vielleicht einen neuen Anfang. Das wäre eine Möglichkeit, um wieder zum Stückeschreiben zu kommen und die Krise des deutschen Theaters, die eigentlich eine Krise der Dramaturgen ist, zu beseitigen.
BIENEK Sie meinen also den direkten Kontakt zwischen Autoren, Regisseuren und Schauspielern ohne den Umweg über einen Dramaturgen?
GRASS Man beruft sich ja immer auf Brecht und sagt, in totalitären Ländern pumpt der Staat ja das Geld hinein, da könne man eben das Berliner Ensemble gründen. Es muß ja nicht so sein. Es fehlt an jungen Leuten, die Lust haben, ein Stück aufzuführen und die abseits vom subventionierten Theater, von der Studentenbühne her, Uraufführungen machen, weiterarbeiten, in die Provinz gehen. Solange sie im Studententheater sind, geht es. Ich habe sehr viele begabte Leute im Studententheater in Erlangen kennengelernt, aber sobald diese Leute eine feste Anstellung bekommen – sie gehen meistens zum Rundfunk oder zum Fernsehen –, gewöhnen sie sich einen Lebensstil an, der das freie Jonglieren und das Auf-Verdacht-Arbeiten nicht mehr erlaubt. Dazu kommen dann das Heiraten und das Übliche, der Bildungsgang, und damit ist schon die Zusammenarbeit getötet. Das Gegenteil habe ich in Frankreich gesehen, in Paris: Dort gibt es allerorten Leute, die mit Privatmitteln, mit Schulden, die sie nie bezahlen können, schlechte und gute Filme drehen, aber sie drehen, und sie machen Theater, und die Theater machen pleite. Das fehlt alles bei uns.
BIENEK Sie sprachen davon, daß Sie gerne ins Kino gehen. Hätten Sie nicht mal Lust, einen Film zu schreiben?
GRASS Sehr gerne. Ich würde gerne einen Film schreiben, und ich würde auch gerne mal beim Film dabeisein. Aber auch da sehe ich überhaupt keinen Ansatzpunkt, denn das Geld für solche Projekte ist in Deutschland immer mit Auflagen versehen. Auch wenn der Regisseur, die Produktionsgesellschaft sagt: Machen Sie, was Sie wollen!, so ist immer gleich ein Aber hinterher und der ganze Kontrollapparat. Das passiert oft absichtslos, läßt aber das beste Vorhaben scheitern.
BIENEK Sagen Sie, Herr Grass, sind Sie der Meinung, daß es heute nicht nur eines besonderen Talentes bedarf, um sich durchzusetzen, sondern auch eines gewissen Managements?
GRASS Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe in meinem Fall keinen einzigen Manager – außer Walter Höllerer, der mich sehr unterstützt hat, in jeder Beziehung, der meine ersten Gedichte gedruckt hat, der mir auch mit Hilfe der Akzente finanziell geholfen hat, daß ich die »Blechtrommel« überhaupt schreiben konnte. Ich mußte deswegen also keinen Vorschuß vom Verleger aufnehmen. Ich sehe eigentlich in meinem Fall keinen einzigen Manager – im Gegenteil: eher Leute, die der Sache mit Skepsis begegneten. Die Gruppe 47 ist natürlich eine Art Sprungbrett, aber auch dort kann man nicht von Management sprechen. Die Kritik ist dort so scharf, daß ein halbes Talent selbst durch einen guten Manager nicht gehalten werden kann.
BIENEK Ja, aber gerade weil die Kritik in der Gruppe 47 so stark ist …
GRASS … Es ist ein Sprungbrett, eine Art Fegefeuer.
BIENEK Sind Sie mit Ihrem Verleger zufrieden oder meinen Sie, er könnte eigentlich noch mehr tun, um einem Autor zu helfen?
GRASS Ich war mit meinem Verleger solange unzufrieden, solange ich einen Optionsvertrag mit ihm hatte, den ich beim ersten Gedichtband hatte. Als er dann die »Blechtrommel« übernahm, habe ich zur Bedingung gemacht, daß die restliche Option gestrichen wird. Ich mache keine Optionsverträge mehr, sondern einen neuen Vertrag bei jeder abgeschlossenen Arbeit, bei jedem Manuskript. Das hält das Verhältnis zwischen Autor und Verleger lebendig. Der Verleger muß sich um den Autor bemühen, er kann sich des Autors nie sicher sein. Zudem bin ich mit meinem Verleger besonders deswegen zufrieden, weil jeder Autor im Luchterhand Verlag 12,5 Prozent vom Ladenverkaufspreis des Buches und von der nächsten Auflage an 15 Prozent erhält. Das ist in etwa soviel, wie Thomas Mann bekommen hat.
BIENEK Sie sind zwar als junger Autor sehr rasch arriviert, aber Sie haben es doch zu Anfang auch sehr schwer gehabt. Können Sie sagen, welche Schwierigkeiten Ihnen am Anfang am meisten zu schaffen gemacht haben?
GRASS Tja … Wissen Sie, ich habe Gedichte geschrieben … Alle Gedichte aus »Die Vorzüge der Windhühner« habe ich zum Beispiel geschrieben, bevor ich auch nur ein Gedicht veröffentlicht hatte. Ich war damals Bildhauer in Berlin und bin durch einen Zufall zur Literatur gekommen. Meine Frau hat eines Tages in der Frankfurter Allgemeinen eine Kulturnotiz gelesen, daß der Süddeutsche Rundfunk einen Lyrikwettbewerb ausgeschrieben hatte. Sie hat drei Gedichte von mir eingeschickt, daraufhin bekam ich den dritten Preis und war somit entdeckt. Die Schwierigkeiten bestanden für mich zuerst im Wechsel des Umgangs – mein bisheriger Umgang bestand ja aus Bildhauern, Malern und Modellen. Dann kamen auf einmal schätzenswerte Menschen wie Joachim Kaiser und Walter Jens, die ohne weiteres – nachdem sie ein Manuskript angelesen oder nur etwas gehört hatten –, druckreif sprechen konnten. Sie verblüfften mich. Eigentlich habe ich keine Neigung zu Minderwertigkeitskomplexen, aber wenn ich welche bekommen hätte, wäre damals der Moment gewesen. Joachim Kaiser hätte mir beim ersten Auftreten Minderwertigkeitskomplexe einjagen können.
BIENEK Aber er hat es dann doch nicht getan.
GRASS Er hat es nicht geschafft, und es war natürlich auch nicht seine Absicht.
BIENEK Aber er hat Sie gereizt, sich mit ihm zu messen?
GRASS Was mir geholfen hat, war, daß Joachim Kaiser zwar sehr fließend sprach, aber mit einem leichten ostpreußischen Tonfall. Und da dachte ich mir: Es kann nicht so schlimm sein.
BIENEK Hatten Sie anfänglich bestimmte Schwierigkeiten formaler Art beim Schreiben Ihrer Prosa?
GRASS Ja, die ersten Prosaversuche, die ich machte, das war so ein Salat aus Kafka und Ringelnatz mit sehr viel Metaphern – die eine trat der anderen auf den Schwanz. Aber wenn ich das heute lese, bin ich erstaunt, wie begabt ich damals war. Allerdings bin ich froh, daß es nicht gedruckt wurde.
BIENEK Sie kommen gerade aus Paris zurück, wo Ihre »Blechtrommel« in französischer Übersetzung Premiere hatte. Wie man hört, ist sie auch dort ein Erfolg geworden. Was mag nach Ihrer Ansicht die Franzosen gerade an diesem Werk begeistern?
GRASS Man hat mir gesagt, das sei der erste deutsche Roman nach dem Krieg, der eine ganze Epoche zeigt. Die Kritiken, die ich gelesen habe, gehen zumeist nur von literarischen Maßstäben aus, was sie sehr stark von den deutschen Kritiken unterscheidet. Die Worte Pornographie und Blasphemie, die fast in jeder deutschen Kritik auftauchen, auch wenn sie lobend gemeint waren, gibt es dort nicht. Das ist wohltuend. Es mag daran liegen, daß es in Paris noch ein richtiges literarisches Klima gibt. Man kann dort ein Buch noch zentral im besten Sinne des Wortes lancieren, während es in Deutschland passieren kann, daß ein Buch zwar in Hamburg ein Erfolg ist, aber in Würzburg vom bischöflichen Ordinariat zu einem Mißerfolg gestempelt wird.
BIENEK Haben Sie Gründe mit Würzburg?
GRASS Ja, ich bekomme ab und zu Briefe von katholischen Buchhändlern, die mir sagen, daß sie zu Anfang die »Blechtrommel« überhaupt nicht verkaufen wollten, und dann haben sie doch verkauft. Jetzt sähen sie an der neuen Novelle aber überhaupt keinen Grund mehr zu verkaufen, und wollen sich – wie sie sagen – noch weitere Schritte überlegen oder rufen zum Boykott auf. Nur ist es Gott sei Dank so, daß selbst katholische Buchhändler gerne Geld verdienen und dieser Boykott nach einer gewissen Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Das läßt mich für die katholischen Buchhändler und auch für die Zukunft meiner Bücher hoffen.
BIENEK Sie haben mit Ihrer Prosa viel Beachtung gefunden, mehr als mit Ihrer Lyrik. Trotzdem schreiben Sie weiterhin Gedichte. Glücklicherweise gehören Sie nicht zu jenen Autoren, für die die Lyrik eigentlich nichts Weiteres ist als der Übergang zur Prosa.
GRASS Für mich sind Gedichte immer Nebenprodukte, weil ich nie kontinuierlich an der Lyrik arbeite. Mein Arbeitsraum ist kein Labor, ich experimentiere nicht, sondern schreibe Gelegenheitsgedichte. Es fällt mir etwas ein und diesen Einfall bearbeite ich so lange, bis er sich mit der Sprache deckt.
BIENEK Sie haben auf der Tagung der Gruppe 47 im vergangenen Jahr ein Stück aus einem neuen Roman vorgelesen, der den Arbeitstitel »Kartoffelschalen« trägt. Soll dies auch ein großes, umfangreiches Werk ergeben, und wann soll es erscheinen?
GRASS Nach meinem Plan sieht es so aus, daß es 570 Seiten haben wird. Ich habe lange Zeit, fast anderthalb Jahre, mit der Frage zu tun gehabt, ob das Buch 570 oder 910 Seiten haben soll. Jetzt glaube ich, daß ich es jetzt mit 570 Seiten schaffe. Es wird wahrscheinlich im übernächsten Jahr abgeschlossen sein.
BIENEK Ein Kritiker hat kürzlich geschrieben: Was aber macht Günter Grass, wenn er einmal nicht mehr Danzig beschreibt – eine Frage, die den Kritiker eigentlich nichts angeht. Trotzdem möchte ich Sie fragen: Haben Sie nicht einmal Lust, ein Thema anzugehen, das von der Faszination des Kaschubischen ganz abgeht?
GRASS Ja natürlich. Auch die »Blechtrommel« beginnt ja in Westdeutschland. Bei längerem Nachdenken mußte ich immer weiter zurückgehen. Die Zukunft lag für mich in der Vergangenheit. Ich mußte immer weitergraben und landete dann im Jahr 1899 mitten in der Kaschubei. Das ist mir bis jetzt jedesmal passiert, ob ich nun in Westdeutschland oder in Berlin anfange. Ich muß immer von dorther ausholen.
BIENEK Herr Grass, nachdem Sie mit der »Blechtrommel« den Bremer Literaturpreis in eine Krise gestürzt haben, hat ein Kritiker Ihr neues Buch »Katz und Maus« dafür vorgeschlagen.
GRASS Nun, ich kann nicht glauben, daß die Bremer sich dazu entschließen werden. Ich bin auch nicht der Meinung, daß die »Blechtrommel« aus moralischen Gründen von den Bremern abgelehnt wurde. Das ist ein uralter Streit, ein historischer Konflikt zwischen den beiden Hansestädten Danzig und Bremen, ein Kaufmannszwist, der sich jetzt noch einmal entladen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Bremer Senat einem ehemaligen Bürger der Stadt Danzig einen Literaturpreis gibt, genau wie umgekehrt der Danziger Senat niemals einem Bremer Autor einen Preis geben wird. Rudolf Alexander Schröder zum Beispiel hätte in der Stadt Danzig nie einen Literaturpreis bekommen. Man hätte ihn – vielleicht sogar auch aus moralischen Gründen – abgelehnt.
Ein Reduzieren der Sprache auf die Dinglichkeit hin
(Dezember 1963)
SCHÜLER Herr Grass, Sie lasen eben aus »Katz und Maus« vor. Unter anderem haben Sie in diesem Stück »Wirliebendiestürme« und mehrere andere Worte zusammengeschrieben. Hat das einen besonderen Zweck? Soll darauf besonders hingewiesen werden?
GÜNTER GRASS Ja, das sind so Begriffe. Es sind eigentlich Schlagworte, Klischees. Es wurde gesagt: »Wir singen jetzt Wirliebendiestürme«, und das ist phonetisch auch übernommen. Hinzu kommt, daß dieses »Wirliebendiestürme« ein Zeitkolorit ist, es wurde immer zu einer bestimmten Zeit zu bestimmten Anlässen gesungen. Deswegen läßt sich das so zusammenfassen.
SCHÜLER Außerdem war hier noch im gleichen Stück von »Vondirunddeinemtunallein« die Rede. Ich finde, das ist viel unverständlicher zu lesen, man muß öfter hinsehen, um den Sinn erst einmal herauszubekommen.
SCHÜLER Ich finde auch, man kann es schlecht überblicken. Manche Dinge fassen Sie zusammen wie zum Beispiel: »Ichweißnichtwas«. Ich glaube aber, daß diese Begriffe nicht immer so sehr Begriffe sind, daß man ein Recht darauf hat, sie einfach so zusammenzufassen.
SCHÜLER Ich glaube, von Recht kann man hier nicht sprechen, denn der Schriftsteller hat ja die traditionelle dichterische Freiheit, von der er natürlich ohne weiteres Gebrauch machen kann.
SCHÜLER Aber man darf sich doch nicht einfach über die Rechtschreibung der deutschen Sprache hinwegsetzen.
SCHÜLER Ich glaube, Herr Grass, Sie haben das eben sehr gut erklärt, und wenn Sie eben auf diese klischeeartigen Ausdrükke besonders hinweisen wollen, dann ist das durchaus gut, daß Sie das machen. Vor allen Dingen ist es vielleicht auch einmal sehr wichtig, daß man ein Wort zwei- oder dreimal liest und es nicht gleich beim ersten Male versteht.
GRASS Zuerst noch einmal zu den zusammengeschriebenen Phrasen. Das ist natürlich kein beliebiges Stilmittel, sondern bewußt gesetzt: Teilweise werden Klischees übernommen, teilweise werden Formulierungen vom Autor, also vom Erzähler her, zusammengefaßt und zu einem Begriff geformt. Beides zusammen ergibt ein Zeitkolorit und zwingt gleichzeitig den Leser zu stutzen, innezuhalten, eine Sekunde lang nochmals zu überfliegen. Und jetzt sind wir schon bei diesen Passagen: Sehr viel Wichtiges – und oftmals die Dinge, die die Handlung vorantreiben – steht nicht als Hauptsatz unbedingt da, sondern kündigt sich in Nebensätzen und eingeschobenen Hauptsätzen an. Es ist oft nur ein einzelnes Wort, das eine Wendung beschreibt, und das mit Bewußtsein. Das ist also dieses Unterhalten, den Leser unterhalten, aber ihn dabei gleichzeitig aktiv halten, damit er sich nicht von der Prosa wegtragen läßt und die Seite frißt als handlungsfördernden Stoff, sondern damit er wach bleibt, oder wenn er ermüdet wird, innehalten und einen neuen Anlauf nehmen muß.
SCHÜLER Ihr Stil ist doch – soweit ich weiß – in der Form neu. Es würde mich nun interessieren, ob es Ihnen ein inneres Bedürfnis ist, so zu schreiben, oder haben Sie sich lange überlegt: Wie bringe ich meinen Stil, damit er etwas Neues darstellt und vielleicht auf diese Art ankommt?
SCHÜLER Der Stil ist durchaus nicht neu, würde ich sagen. Es gibt soundsoviele andere Dichter, die es genauso machen. Ich möchte auf Uwe Johnson verweisen, der genau das gleiche wie Sie macht. Er beschreibt Dinge völlig im Detail, und er faßt auch Worte zusammen.
SCHÜLER Sie haben auch eigene Vorstellungen von der Zeichensetzung. Ich persönlich bin der Meinung, daß es eigentlich ein bißchen problematisch ist, wenn man von dichterischer Freiheit liest – was ist überhaupt dichterische Freiheit? – und wenn man sagt, der Dichter kann mit der Sprache praktisch machen, was er will. Also ich glaube, die Sprache ist nicht, wie vielleicht für Sie als Bildhauer, ein Stück Gips, das Sie an die Wand werfen können oder mit dem Sie schöne Figuren machen können. Meiner Meinung nach muß man sich gewissen Gesetzen fügen und kann nicht nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Gefühlen die Sache willkürlich verändern.
SCHÜLER Dem möchte ich entgegnen: Die Sprache ist doch immer ein Ausdruck der Kultur und des Volkes in einer bestimmten Zeit, deshalb kann sich die Sprache doch auch wandeln. Wenn wir eben nun in ein neues Stadium einer anderen Kultur eintreten, dann muß die Sprache auch das mitmachen, und vielleicht ist die Sprache das erste Anzeichen.
SCHÜLER Ich glaube, Sie sollten uns jetzt einmal die Frage beantworten, warum Sie den Stil geändert haben. Weil der alte schlecht war oder weil Sie glauben, daß er eine neue Epoche einleiten soll?
GRASS Ich habe also eine Menge Einwände gehört. Ich gehe erst mal davon aus, daß die deutsche Sprache, verglichen z. B. mit dem Französischen, sehr weich ist und Einflüssen unterworfen ist, nicht immer den besten Einflüssen. Das Deutsch z. B., das heute gesprochen wird, ist sehr stark vom Wirtschaftsdeutsch geprägt, vom Amtsdeutsch geprägt, im Gedanklichen von Heidegger geprägt. Die Substantivierung nimmt immer größere Ausmaße an, und mit diesem Material muß ich als Schriftsteller arbeiten. Es ist also nicht nur mit dem Konjunktiv getan, und es ist auch nicht eine Sache der Kommata, sondern es gibt zum Beispiel Sätze, in denen das Verbum weggelassen wird. Die Satzaussage fehlt, weil ich dem Leser bei einem angefangenen Satz dann und wann überlassen kann, die Satzaussage selber auszufüllen, weil sie auf der Hand liegt. Und vielleicht habe ich nebenbei den kleinen Ehrgeiz, die deutsche Sprache etwas zu verkürzen. Sie ist furchtbar umständlich. Ich glaube, daß innerhalb der deutschen Satzstellung sich einiges – ohne jetzt als Sprachenreformer vordergründig auftreten zu wollen – von dem, was ich sagen und beschreiben will, zur Satzverkürzung anbietet, ein Reduzieren also der Sprache auf die Dinglichkeit hin. Und dann entstehen Dinge, die Sie als Unkorrektheiten betrachten. Jetzt noch eine Sache. Vorhin wurde davon gesprochen, daß das also nichts Neues sei. Natürlich ist das nichts Neues. Das gibt es schon bei Döblin, also vor allen Dingen in der expressionistischen Prosa, und bei James Joyce, und heute bei Arno Schmidt und eben auch bei Johnson. Es ist also eine Stilgebärde, wenn Sie wollen, die weit verbreitet ist. Da kann natürlich jeder Autor nur einen bestimmten Anteil haben, und zwar den Anteil, der zu seinem Stoff paßt, zu dem, was er sagen will. Aber insgesamt verändert das die deutsche Sprache, und ich glaube nicht zum Schlechten.
SCHÜLER Herr Grass, im Inhalt Ihrer Bücher kommen drei Sachen vor: die Beschreibung von ekelhaften Dingen, die Beschreibung von sexuellen Dingen – das ist ein alter Hut –, jetzt kommt vielleicht etwas Neues: Sie bringen auch viel Blasphemie rein. Da habe ich jetzt ein Beispiel, da beschreiben Sie, wie ein paar Jungens in einem Schiff sitzen und Möwenmist kauen. Dazu schreiben Sie: »Das Zeug schmeckte nach nichts oder nach Gips oder nach Fischmehl oder nach allem, was sich vorstellte: nach Glück, Mädchen, nach dem lieben Gott.« Die Stelle »nach dem lieben Gott« möchte ich besonders betonen; über »nach Mädchen und Glück« könnte man sich eventuell noch streiten, aber wieso kann Möwenmist nach dem lieben Gott schmecken?
SCHÜLER Ich finde, das ist wohl ganz einfach zu interpretieren. Ich glaube, Sie wollen damit sagen, daß der Möwenmist nach allem schmecken kann. Man kann es einfach nicht genau definieren, wonach er schmeckt. Man kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Man kann sich dabei ausmalen, was man will.
SCHÜLER Es gibt immerhin Leute, die glauben an den lieben Gott, und es müßte ihnen – wenn sie gute Christen sind – entweder, Herr Grass, sehr leid tun, oder sie müßten sich angegriffen fühlen. Und ich glaube doch, daß auch ein Schriftsteller, der offiziell wird, eine gewisse Form der Höflichkeit zu wahren hat.
SCHÜLER Ich glaube, wenn Sie da von »Mädchen« und »Glück« oder vom »lieben Gott« schreiben, so hängt es eben von der Person ab, die im Moment den Möwenmist kaut. Die eine denkt an Mädchen, die andere an Glück, und die dritte denkt an den lieben Gott.
GRASS Bei der »Möwenmist-Episode« geht es darum, daß viele Jungen gleichzeitig Möwenmist kauen, und jeder hat einen anderen Geschmack. Ich versuche nun, das Unpräzise, das Ungenaue, das Verschiedenartige des Geschmacks in dieser Reihung aufzuzählen, und außerdem mache ich darauf aufmerksam, daß es nicht heißt »Gott«, sondern »lieben Gott«. Das ist ein Unterschied. Es gibt zum Beispiel in »Hundejahre« eine Passage, wo der Amsel seine Zähne im Schnee sucht, nachdem sie ihm ausgeschlagen wurden. Da wird gefragt: »Was sucht er, sucht er das Glück im Schnee, oder sucht er Gott im Schnee?« Da heißt es nicht: »lieber Gott«. »Lieber Gott« ist schon eine Verniedlichungsform und hat etwas Süßes. Es kann sich doch ohne weiteres eine kindliche Vorstellung vom lieben Gott mit dem Geschmack von Möwenmist decken.
SCHÜLER Ich nehme Ihnen das, ehrlich gesagt, gar nicht ab. Ich habe den Verdacht – natürlich werde ich mich wahrscheinlich sogar irren –, daß Sie die Sache absichtlich so geschrieben haben, daß Sie sich das überlegt und nach dem Durchlesen gedacht haben: »Na, Donnerwetter, das wird aber ziehen, die werden aber staunen, was ich mich so alles traue.«
GRASS Wenn für mich als Autor der Begriff »lieber Gott« etwas genauso Banales und Liebenswertes und Unbestimmtes ist wie der Begriff »Mädchen«, dann kann ich das ohne weiteres in einer Reihe nennen. Aber daß Sie den lieben Gott für so leicht zu beleidigen halten, das wundert mich.
SCHÜLER Ich wollte noch eine provozierende Frage stellen: Sind die Beschreibungen von unästhetischen Widerwärtigkeiten das einzige Mittel, Tabus einzureißen?
GRASS Ich habe noch nie unästhetische Widerwärtigkeiten beschrieben.
SCHÜLER Aber Sie beschreiben zum Beispiel in den »Hundejahren« eine Fehlgeburt. Für meine Begriffe dürfte das in dieser Beschreibung bestenfalls den medizinischen Fachbüchern vorbehalten bleiben.
SCHÜLER Aber sehr eindeutig beschrieben, und auch vom Bildlichen her so beschrieben, daß man sich das genau vorstellen kann.
GRASS Genau das wollte ich erreichen. Nun begreife ich einfach nicht, warum ein Abortus ein Tabu sein soll.
SCHÜLER Das sehe ich sogar ein, daß das kein Tabu ist. Aber in der Beschreibung kommen Sie doch sehr stark an das provozierende Tabueinreißen heran.
GRASS Ja, aber das liegt doch nicht am Abortus, sondern daß ich den Nekrolog im Heideggerdeutsch schreibe.
SCHÜLER Aber Sie könnten doch das Thema auch so bringen, daß Sie es anders beschreiben.
GRASS Nein, nein. Denn beide Väter, die für dieses Kind in Frage kommen, sind von Heidegger beeinflußt. Der Feldwebel direkt, und der Luftwaffenhelfer Störtebeker über den Feldwebel. Er spricht das Heideggerdeutsch als Schülersprache. Und deswegen muß dieser Nekrolog zwangsläufig teilweise in Heideggerdeutsch geschrieben werden. Und es reimt sich ja diese abstrakte Heideggersprache mit der Realität, nämlich dem Abortus.
SCHÜLER Herr Grass, worauf führen Sie es nun zurück, daß Ihre Bücher einen so großen Publikumserfolg zu verzeichnen haben?
GRASS Wahrscheinlich, weil sie so viele überflüssige Stellen haben.
SCHÜLER Wie machen Sie das eigentlich, Sie schreiben gewöhnlich sehr umfangreiche Romane, Sie greifen das Thema sehr umfassend auf, Sie beschreiben sehr viel; haben Sie das alles im Kopf, wenn Sie schreiben, oder wissen Sie von vornherein genau, wie die Sache enden wird, wie sich die einzelnen Figuren verhalten werden, oder laufen diese praktisch mit Ihnen weg, und nicht Sie mit denen?
GRASS Es ist ein wechselseitiges Verhältnis. Auf der einen Seite habe ich eine optische und – in großen Zügen – klare Vorstellung von dem, was in diesem Roman zur Sprache kommen wird. Aber die Figuren machen sich natürlich nach einer gewissen Zeit selbständig. Es ist eine Art des Wagenlenkens und der Zügelführung, ob ich die Figuren zu kurz halte, oder ob ich ihnen etwas Spielraum lasse. Das Führen der Leine ist sehr wichtig für den Autor in diesem Fall, wenn man eben die Figuren als ›Zugpferde‹ bezeichnen will. Ich weiß zwar genau das Ziel, aber ich weiß die Wege und Umwege noch nicht genau, die dieses Gefährt zu nehmen vorhat. Da kommt es eben auf den Autor an, ob er nun direkt aufs Ziel zusteuert oder ob er es den Pferden ab und zu überläßt, eine Kurve so oder so zu nehmen oder auch einen Umweg einzuschlagen.
SCHÜLER Jetzt eine Frage zur Technik: Wie bereiten Sie das vor, oder wie machen Sie das?
GRASS Ich zeichne vorher. Vorher mache ich sehr viele Romanentwürfe graphischer Art auf großen Bögen, ordne die Komplexe, die ein ungeheures Stoffvolumen haben, von dem vielleicht am Ende ein Drittel in den Roman hineinkommt, so daß also dauernd ausgesondert werden muß, vereinfacht und zusammengefaßt wird. Sobald ein Romanentwurf, solch ein Schema, fertig ist, ist es schon wieder überholt, und ich muß ein neues anfangen. Und dann, wenn dieser Stoff sich einigermaßen bis zu dem Punkt abgeklärt hat, von dem ab dieses Mittel – eben Schematazeichnen – nicht mehr ausreicht, dann formulieren sich auch schon die ersten Sätze, und zwar in der Sprache des zu schreibenden Romans. Es schreibt also jetzt nicht mehr die Privatperson Günter Grass, sondern es schreiben die erwählten Erzähler, und dann beginnt die eigentliche Arbeit am Manuskript. Das setzt natürlich viel Neben- und Vorarbeit voraus, Stoffgebiete betreffend. In den Kapiteln über die Polnische Post in der »Blechtrommel« z. B., die im Handlungsablauf authentisch sind, aber einen teils phantastischen Inhalt haben, bestand die Schwierigkeit darin, authentischen Text und phantastischen Text nahtlos ineinander übergehen zu lassen. Das setzte viel Lesearbeit voraus und auch eine Reise nach Danzig, beinahe eine Detektivarbeit, um Überlebende aus dem Polnischen Postgebäude aufzuspüren, mit ihnen über Fluchtwege zu sprechen. Es kann also nicht alles am Schreibtisch erarbeitet werden.
SCHÜLER Wie lange dauert etwa so eine Vorbereitung zeitlich, bis man praktisch schreiben kann?
GRASS Bei der »Blechtrommel« habe ich vielleicht drei Jahre Vorarbeit gehabt und zwei Jahre am Manuskript gearbeitet, und an »Hundejahre« vier Jahre.
SCHÜLER Herr Grass, Sie sind doch gleichzeitig Schriftsteller, Maler …
GRASS Maler bin ich nicht.
SCHÜLER Entschuldigung, Graphiker und Bildhauer. Wie vereinbart sich das? Wie ist eigentlich Ihr Tagesablauf? Machen Sie alles durcheinander? Schaffen Sie das überhaupt? Sie scheinen einer der produktivsten Künstler überhaupt zu sein. Sie scheinen sehr viel zu arbeiten. Wie machen Sie das?
GRASS Zur Bildhauerei komme ich seit Jahren nicht mehr, weil Bildhauerei und Romanschreiben sich ausschließen, weil beides als Arbeitsprozeß zu ähnlich ist. Man muß Stunden arbeiten, um an einer Plastik irgendeine Stelle zu verändern oder fertigzumachen, genauso ist es bei einem Roman. Aber das Zeichnen nebenbei und zwischendurch läßt sich ohne weiteres einbauen, genauso, wie sich Bildhauerei und Lyrik nicht ausschließen, rein als Arbeitsprozeß. Aber ausgefüllt ist mein Tagesablauf schon!
SCHÜLER Sind Sie ein Dichter mit Weltanschauung, der eine gewisse Idee unter dem Volk verbreiten möchte?
GRASS Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, das heißt zum Großteil auch mit meiner Vergangenheit. Ich suche dauernd, solange ich schreibe, nach stilistischen Möglichkeiten, um von meinem Beruf als Schriftsteller her diese Vergangenheit lebendig zu erhalten, damit sie nicht historisch abgelegt wird.
SCHÜLER Glauben Sie, daß Sie als Dichter eine direkte Wirkung auf das Volk ausüben können, daß Sie ihm wirklich diese Ereignisse ins Gedächtnis zurückrufen können und daß Sie, indem Sie das schildern, Ihr Publikum direkt beeinflussen können? Oder sind Sie da recht pessimistisch?
GRASS Ich gehe zuerst einmal von mir aus. Ich sagte ja, daß ich mich mit meiner Vergangenheit – jetzt meine ich nicht meine private Vergangenheit, sondern meine Vergangenheit im Zusammenhang mit dieser Epoche – beschäftige, weil ich sie auch für mich lebendig halten will. Diese Aufgabe nimmt mich so in Anspruch während der Arbeit, daß ich eigentlich gar keine Zeit finde, darüber nachzudenken, ob das auch andere Leute interessieren könnte. Nun hat mir die »Blechtrommel« gezeigt, daß auch andere Leute sich für meine Sicht dieser Epoche interessieren; das sehe ich an den Verkaufszahlen. Und ich werde gerne gelesen, ich nehme das wahr. Und da meine Art zu erzählen auf Interesse stößt, werde ich auch weiterschreiben. Ich meine, ich hätte es auch sonst getan, für mich.
SCHÜLER Wenn ich Sie richtig interpretiere, sind Sie eben nur Dichter aus Egoismus.
GRASS Ja. Nicht nur, sondern zuerst. Wenn ich am Schreibtisch sitze und meine Arbeiten für einen Roman mache, ist das eine – ich weiß nicht, wie Sie das Wort ›Egoismus‹ auffassen – notwendigerweise egoistische Arbeit.
SCHÜLER Wie würden Sie die Aufgaben des Schriftstellers gerade in unserer Zeit definieren?
SCHÜLER Sie sagten einmal, daß der Schriftsteller nicht das ›Gewissen der Nation‹ sein soll.
GRASS Ja, das ist eine politische Frage.
SCHÜLER Sie haben, zusammen mit Herrn Schnurre, nach dem 13. August 1961, der Errichtung der Mauer in Berlin, einen Brief an Anna Seghers, an den Zonenschriftstellerverband geschrieben, der zu einem Protest auffordern sollte. Und Sie haben ihn dann selbst zusammen mit Herrn Schnurre nach Ost-Berlin gebracht. Wie vereinbart sich das aber damit, wenn Sie neulich in einer Diskussion in Tempelhof sagten, daß Sie nicht ›Gewissen der Nation‹ sein wollten?
GRASS Ich habe nicht die DDR aufgerufen, ich habe die Schriftsteller aufgerufen, also meine Kollegen.
SCHÜLER Ja, aber Sie haben doch wohl eine andere Möglichkeit als die über die Schriftsteller?
GRASS Ja, eben, weil ich diese Möglichkeit sah und weil ich wenige Wochen zuvor mit Frau Seghers ein Gespräch hatte in Ost-Berlin, hatte ich auch die Möglichkeit, rein von der Form her, Frau Seghers persönlich in einem Brief anzusprechen. Das Koppeln Schriftsteller – ›Gewissen der Nation‹ ist zu einem Klischee geworden und birgt die Gefahr in sich, auch in unserem Land, daß, wenn man den Schriftstellern das ›Gewissen der Nation‹ aufbürdet, die restliche Bevölkerung – und die ist ziemlich groß – ohne Gewissen dahinvegetieren kann. Und das lehne ich ab. Ich reagiere nicht zuerst als Schriftsteller, sondern als Bürger dieses Staates. Und ich mache da einen recht deutlichen Unterschied.
Manche Freundschaft zerbrach am Ruhm
(September 1965)
GÜNTER GAUS Herr Grass, Sie gelten bei vielen als die bemerkenswerteste Kraft der westdeutschen Literatur. Mindestens in der Umstrittenheit nehmen Sie einen einsamen ersten Rang ein. Ihre drei Prosawerke – »Die Blechtrommel«, »Katz und Maus« und »Hundejahre« – haben Rekordauflagen erreicht, auch im Ausland. Für einen Mann Ihres Alters bedeutet das einen frühen Ruhm. Am 16. Oktober 1927 geboren, waren Sie zur Zeit des ersten großen Erfolges, im Jahre 1959 beim Erscheinen der »Blechtrommel«, gerade erst 32 Jahre alt. Wie schmeckt so früher Ruhm? Was hat es für Sie bedeutet, ins Licht zu geraten?
GÜNTER GRASS Ja, ich habe mit dem Ruhm um die Zeit, die Sie eben erwähnten, Bekanntschaft gemacht. Was die Sache im ersten Jahr erschwert hat, war: Ich bin 1956 von Berlin weggegangen als Bildhauer und praktisch unbekannter Schriftsteller.
GAUS Nach Paris.
GRASS Ja, nach Paris. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Gedichtband herausgegeben: »Die Vorzüge der Windhühner«. Das erregte einiges Interesse bei einigen Literaturkritikern, bei einigen Kollegen. Die Auflage lag damals vielleicht bei 700 bis 800 verkauften Exemplaren. Ich bin dann nach Paris gefahren und vier Jahre in Paris gewesen mit meiner Frau und habe dort die »Blechtrommel« geschrieben. Und als ich zurückkam nach Berlin, 1960, traf ich natürlich meine alten Freunde der Berliner Zeit, Bildhauer zumeist, Maler. Da ist es für viele dieser Freunde und sicher auch für mich schwer gewesen, den rechten Ton zu finden.
GAUS Sie waren jetzt berühmt, und die anderen waren in Berlin geblieben.
GRASS Ja, ich kehrte als berühmter Mann zurück. Und da ist manche Freundschaft auf Zeit kaputtgegangen, manches hat sich wieder reparieren lassen. Aber das war eigentlich die große Probe. Und dann 1961/1962, als es zunahm und immer schwieriger wurde, da tauchten natürlich gelegentlich Gedanken auf: raus aus dem Land und weg. Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich mit meinem Ruhm zu befreunden.
GAUS Sind Sie heute mit ihm befreundet?
GRASS Er war bis jetzt immer lästig, eine Belastung, aber ich habe mich mit ihm arrangiert. Es fällt mir also heute weniger schwer, über die Straße zu gehen. Ich bemerke es nicht mehr, wenn ich angestarrt werde. Und Berlin ist ein angenehmes Pflaster in der Beziehung. Die Berliner sind Großstädter und spielen mit. Ich werde also selten angesprochen in Gaststätten. Und jetzt kam zum erstenmal in diesem Jahr die Möglichkeit, mit dem Ruhm auch etwas Nützliches zu tun: im Wahlkampf.
GAUS Beschränkt sich die Nützlichkeit des Ruhms wirklich auf das politische Wirken? Hilft er nicht auch dem Schriftsteller in seinem eigentlichen Metier, weil der Ruhm der poetischen Arbeit, dem poetischen Werk Beachtung sichert? Hilft das nicht?
GRASS Also ich habe noch nie eine so schöne Arbeitszeit gehabt wie während des ersten Gedichtbandes; das ist eine Sammlung von Einzelstücken, von Gelegenheitsgedichten, wenn Sie wollen. Aber auch die Zeit an der »Blechtrommel« war eine unbeobachtete Zeit. Ich habe in Paris vielleicht sieben, acht Freunde gehabt. Ich habe tagelang niemanden gesehen.
GAUS Wie viele Freunde haben Sie heute?
GRASS Das läßt sich schwer feststellen, eben weil man berühmt ist.
GAUS Eben. Schmeckt er also bitter, der frühe Ruhm, oder der Ruhm überhaupt?
GRASS Er schmeckt. Ich sagte schon, ich habe mich jetzt mit ihm arrangiert. Er ist da.
GAUS Woran sind denn die Freundschaften zugrunde gegangen, jene Freundschaften, die Sie geschlossen hatten, als Sie so wenig berühmt waren wie Ihre Berliner Freunde? Woran sind diese Freundschaften zugrunde gegangen, als der Ruhm gekommen war?
GRASS Sehen Sie: Maler haben es schwer in diesem Land und Bildhauer auch, sich durchzusetzen.
GAUS Sie sind zunächst Graphiker und Bildhauer gewesen?
GRASS Ja. Und ich spreche natürlich von diesen Kollegen und Freunden. Wir haben keinen Kunsthandel in Deutschland, unsere Kunstkritik ist wirklich provinziell. Die Leute haben es schwer, sich durchzusetzen. Wir haben zwar sehr viel reiche Leute in diesem Land, aber es wird nicht gesammelt, und wenn gesammelt wird, dann wird in Richtung einer Mode gesammelt oder einer sehr waghalsigen Kapitalanlage. Da sind natürlich sehr oft Kollegen zu mir gekommen und haben gesagt: Schreib mir einen Ausstellungskatalog. Ich habe das prinzipiell nicht gemacht, und ich werde es auch nicht machen.
GAUS Warum haben Sie es nicht gemacht?
GRASS Ich kann das nur machen, wenn ich ein direktes Verhältnis zu der Arbeit habe. Ich kann es nicht machen, weil ich berühmt bin. Das würde dann auch Schule machen, und den Kollegen wäre damit nicht gedient und nicht geholfen, und das würde auch den Dialog stören.
GAUS Sind die Schwierigkeiten mit alten Freunden der Zwangspreis des Ruhms, oder gibt es dabei auch eine Schuld? Wer hatte Schuld, wenn es dabei eine Schuld gab? Günter Grass oder die anderen?
GRASS Wahrscheinlich ist das von Fall zu Fall verschieden. Für beide Teile war es schwer, den rechten Ton zu finden. Es ist sicher auch so gewesen, daß ich in manchen Fällen nicht den rechten Ton gefunden habe.
GAUS Treffen Sie ihn heute, den richtigen Ton?
GRASS Leichter, leichter.
GAUS Sind Ihnen heute jüngere Schriftsteller, die sich noch um Anerkennung bemühen, unverständlich, lästig, ein Ärgernis, oder haben Sie Verständnis für sie? Können Sie sich erinnern an Ihre eigene schwere Zeit?
GRASS Ja, das kann ich sehr gut. Hier in Deutschland haben wir ja die herrliche, wenn auch manchmal penetrante Schule der Gruppe 47, also jedes Jahr einen direkten Umgang mit neuen Schriftstellern, mit jüngeren Schriftstellern, die zum erstenmal dort lesen. Allein deswegen ist diese Institution schon wohltuend und angenehm, weil man’s dort lernt, erstens sich an die eigenen Anfänge zu erinnern und zweitens den Ton zu Anfängern zu finden.
GAUS Heute, Herr Grass, sind Sie also ein erfolgreicher und gutverdienender Schriftsteller. Wenn wir einmal von der materiellen Seite absehen: Gesetzt den Fall, Sie müßten mit Ihrer schriftstellerischen Arbeit nicht auch Geld verdienen, könnten Sie dann sozusagen für die Schublade arbeiten? Wären Sie sich mit Ihrer Arbeit selbst genug, oder brauchen Sie das Echo der Beachtung, sei es des Erfolges oder wenigstens doch der Kontroverse?
GRASS Ja, ich muß davon ausgehen, daß ich ja relativ spät mein erstes Buch herausgegeben habe.
GAUS Finden Sie 32 relativ spät, wenn Sie jetzt von der »Blechtrommel« reden?
GRASS Nein, nein. Mein erstes Buch sind die »Windhühner«.
GAUS Dann ist es noch weniger spät.
GRASS Heute wird viel früher veröffentlicht. Wir haben doch eine ganze Reihe Autoren, die schon mit zwanzig Jahren ein Buch …
GAUS Sie haben 1956 die »Windhühner« herausgebracht. Damals waren Sie 29 Jahre alt. Das finden Sie relativ spät?
GRASS Vergleichsweise ja. Aber für mich fand ich das richtig; ich finde das ein gutes Alter. Ich bin dagegen, daß man zu früh veröffentlicht. Ich habe diese Gedichte nie geschrieben im Blick auf Veröffentlichung.
GAUS Also für die Schublade.
GRASS Ja, zum Wegwerfen zum Teil; und zum Vergessen. Die Perioden und auch die Stileinflüsse von anderer Seite her wechseln in dem Alter sehr rasch.
GAUS Lorca übte einen solchen Einfluß aus?
GRASS Ja, das lag zugrunde und Ringelnatz und alles mögliche; eigentlich alles, was an übersetzter und expressionistischer Literatur nach dem Kriege eben auf meine Generation zukam, fand auch Einlaß.
GAUS Brauchen Sie heute, da Sie älter geworden sind und sozusagen selbständig, die Beachtung?
GRASS Nein, ich glaube nicht. Sehen Sie, ich arbeite ja auch vier Jahre an einem Roman, bis er fertig ist. Es ist zwar nicht die Schublade, aber es ist doch ein dauerndes Umschichten. Und um das Finanzielle noch einmal zu klären: Ich habe einen Beruf als Steinmetz für Grabsteine, ich kann auch als Steinbildhauer arbeiten. In kurzer Zeit würde ich wieder in dem Beruf drinnen sein. Es ist also eine große Beruhigung, daß ich notfalls mein Geld auch mit Grabsteinen verdienen könnte.
GAUS Ihre Romane, Herr Grass, spielen im sogenannten kleinbürgerlichen Milieu, im unteren Mittelstand, und Sie entstammen selbst diesem unteren Mittelstand. Ihr Vater ist Kolonialwarenhändler in Danzig gewesen, Ihrem Geburtsort, dem Ort Ihrer Kindheit und Jugend. Sie haben diese kleinbürgerliche Welt mit großer Detailkunst beschrieben. Sagen Sie mir bitte: Wie ist Ihr Verhältnis zu den von Ihnen beschriebenen Menschen heute? Ihre Umwelt ist heute eine andere. Sehnen Sie sich manchmal nach der engen, fast miefigen Welt des Kleinbürgertums, nach der Art etwa, wie Kleinbürger ihre Familienfeste feiern, oder ist Ihnen das heute unbehaglich, wenn nicht gar verschlossen?
GRASS Nun, zurücksehnen wäre gewiß zuviel gesagt. Diese Feste der Kleinbürger – ich weiß nicht, in welchem Maße sie heute noch stattfinden. Was ich beobachten konnte, ist, daß also früher diese Feste mit billigem Wermut oder mit Rum und Arrak gefeiert wurden, während Kleinbürger heute Sekt trinken.
GAUS Ändert das etwas am Kleinbürgertum?
GRASS Ja, wissen Sie, da fängt das Kaschieren an. Jeder Kleinbürger hat immer den Zug zum Gutbürgerlichen gehabt. Aber heute wird nun auf höchster Ebene der Kleinbürger als gutbürgerlich dargestellt. Da wirkt er natürlich grotesk, da setzt die Satire ein. Das sind die Veränderungen des Kleinbürgertums im Vergleich zu der Zeit vor dem Krieg. Dort war natürlich noch viel Ländliches drinnen. Zum Beispiel war bei meiner Familie von der Mutterseite her erst die zweite Generation in der Stadt. Da gab es den ganzen Hintergrund der ländlichen Verwandtschaft noch, das Zusammentreffen zwischen Kleinbürgern und ländlicher Bevölkerung. Das ist heute wohl etwas anders.
GAUS Sind Sie traurig, daß es etwas anderes ist? Glauben Sie, daß etwas verlorengegangen ist, das wert gewesen wäre, erhalten zu bleiben?
GRASS Wissen Sie, ich habe nur sehr wenig restaurative Züge.
GAUS Das ist ganz wertfrei, es gibt heute gute und weniger gute restaurative Züge.
GRASS Ja. In Teilen finden Sie ja heute auch noch das unverfälschte Kleinbürgertum. Deutschland ist ein sehr föderalistisches Land. Kleinbürgertum in Schwaben ist zum Beispiel ein anderes als im Ruhrgebiet.
GAUS Wo würden Sie eher das Ihnen gemäße finden?
GRASS Ja, ich nenne mit Absicht das Ruhrgebiet. Wenn ich aus Berlin wegmüßte, dann würde ich in Deutschland im Ruhrgebiet wohnen.
GAUS Weil Sie glauben, daß dort das Kleinbürgertum noch nicht kaschiert wird?
GRASS Der Hintergrund ist dort noch deutlich und auch verständlich, der Hintergrund des Proletariats. Da steht man entweder zum Hintergrund oder zum Herkommen, oder man schämt sich dessen. Aber das ist alles übersichtlich.
GAUS Sie schämen sich dessen nicht?
GRASS