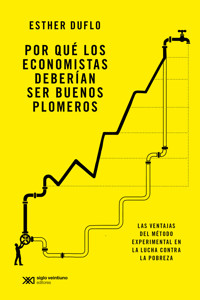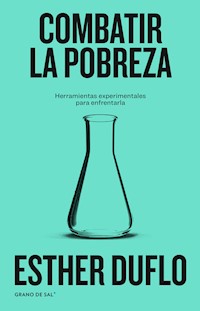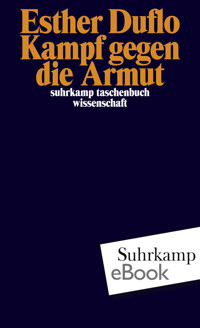2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftsnobelpreis 2019 und Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020! Zwei preisgekrönte Ökonomen über Versagen und Verantwortung der Wirtschaftswissenschaftler
Ungleichheit, Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme, die weltweit täglich die Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären Wissen und Rat von Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite haben sie verschlafen, oft verstellen ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen wie dem Euro haben sie sich gescheut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Duflo und Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der drängenden Weltprobleme beitragen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ungleichheit, Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme, die weltweit täglich die Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären Wissen und Rat von Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite haben sie verschlafen, oft verstellen ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen wie dem Euro haben sie sich gescheut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Duflo und Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der dringenden Weltprobleme beitragen kann.
Über die Autoren
Esther Duflo, geboren 1972 in Paris, zählt zu den einflussreichsten Ökonomen der Welt. Sie ist Professorin für Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo sie zusammen mit Abhijit V. Banerjee das »Poverty Action Lab« gründete, das ein weltweites Netz von Soziologen und Ökonomen koordiniert. Duflo erhielt 2011 die John Bates Clark Medal, die nach dem Nobelpreis als wichtigste Ehrung für Wirtschaftswissenschaftler gilt, sowie 2015 den angesehenen Prinzessin-von-Asturien-Preis. 2019 wurde sie gemeinsam mit Abhijit V. Banerjee mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Abhijit V. Banerjee, geboren 1961 in Bombay, gehört ebenfalls zu den renommiertesten Wirtschaftswissenschaftlern der Welt. Gemeinsam mit Esther Duflo beschäftigt er sich vor allem mit neuen Wegen der Armutsbekämpfung. Er ist Professor am MIT und berät die UNO, die Weltbank und die indische Regierung. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. 2014 mit dem Bernhard-Harms-Preis des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und 2019 gemeinsam mit Esther Duflo mit dem Wirtschaftsnobelpreis.
»Wenn Sie ein politisches Buch lesen in diesem Jahr – nein, in diesem Jahrzehnt –, dann lesen Sie dieses!« Cass Sunstein
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Abhijit V. Banerjee
Esther Duflo
Gute
Ökonomie
für
harte
Zeiten
Sechs Überlebensfragen
und wie wir sie besser
lösen können
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer, Heike Schlatterer und Thorsten Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
Good Economics for Hard Times. Better Answers to Our Biggest Problems
bei Allen Lane/Penguin Random House UK
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © der Originalausgabe 2019 Abhijit Banerjee und Esther Duflo
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Christina Kruschwitz
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,
unter Verwendung einer Vorlage des Originalverlags
Umschlagsmotiv: © Jose Luis Stephens/EyeEm/Getty Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-25152-9V002
www.penguin-verlag.de
Für unsere Kinder, Noemie und Milan,
in der Hoffnung, dass sie in einer
gerechteren und humaneren Welt aufwachsen,
und für Sasha, der diese Chance nicht bekam.
Inhalt
VORWORT
KAPITEL 1
MEGA: Make Economics Great Again
KAPITEL 2
Aus dem Maul des Haifischs
KAPITEL 3
Die negativen Folgen des Handels
KAPITEL 4
Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse
KAPITEL 5
Das Ende des Wachstums?
KAPITEL 6
In heißem Wasser
KAPITEL 7
Player Piano
KAPITEL 8
Staatliche Legitimation
KAPITEL 9
Cash and Care
SCHLUSS
DANK
ANMERKUNGEN
VORWORT
Vor zehn Jahren schrieben wir ein Buch über unsere Forschungsarbeit. Zu unserer Überraschung fand es zahlreiche Leser. Das hat uns geschmeichelt, aber für uns war klar, dass es damit sein Bewenden haben würde. Wirtschaftswissenschaftler mögen es im Grunde nicht, Bücher zu schreiben, am wenigsten Bücher, die gewöhnliche Menschen lesen können. Wir haben es trotzdem gewagt und sind irgendwie damit davongekommen. Es war an der Zeit, dass wir uns wieder unserer normalen Arbeit zuwenden, die darin besteht, Forschungsaufsätze zu schreiben und zu veröffentlichen.
Dies taten wir, als auf die Morgenröte der frühen Obama-Jahre der psychedelische Wahnsinn des Brexits, die Gelbwesten und das Trump’sche Projekt einer Grenzmauer zu Mexiko folgten – und als Diktatoren stolz erhobenen Hauptes (oder ihre gewählten Pendants) dem unausgegorenen Optimismus des Arabischen Frühlings ein Ende bereiteten. Die Ungleichheit explodiert, Umweltkatastrophen und weltpolitische Desaster drohen, aber wenn es darum geht, angemessene Antworten darauf zu finden, hören wir wenig mehr als Plattitüden.
Wir schrieben dieses Buch, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Um uns selbst klar vor Augen zu führen, was falsch gelaufen ist und warum, aber auch um uns all das, was positiv verlaufen ist, in Erinnerung zu rufen. Es ist ein Buch ebenso sehr über die Probleme wie über aussichtsreiche Lösungsansätze. Dies setzt allerdings zunächst eine schonungslos ehrliche Diagnose voraus. Es ist ein Buch darüber, wo die Wirtschaftspolitik versagt hat, wo uns die Ideologie geblendet hat und wo uns das Offensichtliche entgangen ist, aber auch wo und warum eine kluge Ökonomie, insbesondere in unserer heutigen Welt, sinnvoll und nützlich ist.
Die Tatsache, dass ein solches Buch geschrieben werden muss, bedeutet nicht, dass wir die richtigen Personen sind, um es zu schreiben. Viele der globalen Probleme unserer Zeit finden im reichen Norden besonders große öffentliche Aufmerksamkeit, während im Mittelpunkt unserer Forschungstätigkeit arme Menschen in armen Ländern stehen. Es war offensichtlich, dass wir uns in viel neue Fachliteratur vertiefen müssten, und dennoch bestand immer die Gefahr, dass uns etwas entginge. Wir brauchten eine Zeit lang, um uns selbst davon zu überzeugen, dass es auf jeden Fall einen Versuch wert wäre.
Wir beschlossen schließlich, es zu wagen, nicht zuletzt deshalb, weil wir die Rolle der distanzierten Beobachter leid waren, während gleichzeitig der öffentliche Diskurs über zentrale wirtschaftliche Fragen – Zuwanderung, Außenhandel, Wachstum, Ungleichheit oder Umweltschutz – immer bizarrer wurde. Aber auch weil wir, je gründlicher wir darüber nachdachten, erkannten, dass die Probleme, mit denen die reichen Länder konfrontiert sind, oftmals auf unheimliche Weise denjenigen ähneln, die wir in den Entwicklungsländern erforschten: Zurückgelassene des Entwicklungsfortschritts, explodierende Ungleichheit, mangelndes Vertrauen in Staat und Behörden, fragmentierte Gesellschaften und politische Strukturen und so weiter. Wir haben während der Arbeit an diesem Buch viel gelernt, und dies hat uns Vertrauen in das eingeflößt, worauf wir uns als Wirtschaftswissenschaftler am besten verstehen: die Fakten nüchtern zur Kenntnis zu nehmen, einfachen Antworten und Patentlösungen zu misstrauen, sich ehrlich einzugestehen, was man weiß und versteht und was nicht, und, vielleicht am wichtigsten, bereit zu sein, Ideen und Lösungen auszuprobieren und dabei Fehler zu machen, solange uns dies dem eigentlichen Ziel, nämlich eine humanere Welt zu schaffen, näher bringt.
KAPITEL 1
MEGA: Make Economics Great Again
Eine Frau erfährt von ihrem Arzt, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Der Arzt rät ihr, einen Wirtschaftswissenschaftler zu heiraten und nach South Dakota zu ziehen.
Die Frau: »Werde ich dann wieder gesund?«
Der Arzt: »Nein, aber das halbe Jahr wird Ihnen ziemlich lang vorkommen.«
Wir leben in einem Zeitalter wachsender Polarisierung. Von Ungarn bis Indien, von den Philippinen bis zu den Vereinigten Staaten, von Großbritannien bis Brasilien, von Indonesien bis Italien ist aus der öffentlichen Diskussion zwischen der Linken und der Rechten mehr und mehr ein lautstarkes gegenseitiges Beschimpfen geworden, bei dem hemmungslos ausgeteilte Ruppigkeiten einem praktisch keine Möglichkeit mehr lassen zurückzurudern. In den Vereinigten Staaten, wo wir leben und arbeiten, kommt es heute seltener denn je vor, dass ein Bürger bei einer Wahl, bei der mehrere Ämter zu besetzen sind, seine Stimmen auf Kandidaten unterschiedlicher politischer Parteien aufteilt.1 81 Prozent derjenigen, die sich mit einer Partei identifizieren, haben eine negative Meinung von der anderen Partei.2 61 Prozent der Anhänger der Demokraten sagen, Republikaner seien rassistisch, sexistisch und intolerant. 54 Prozent der Republikaner nennen Demokraten gehässig. Ein Drittel aller Amerikaner wäre enttäuscht, wenn ein naher Verwandter jemanden von der anderen Seite heiraten würde.3
In Frankreich und Indien, den beiden anderen Ländern, in denen wir viel Zeit verbringen, wird der Aufstieg der politischen Rechten in den Kreisen der liberalen, »aufgeklärten« Elite, in denen wir verkehren, in zunehmendem Maße als eine drohende Apokalypse dargestellt. Man ist fest davon überzeugt, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, auf der Grundlage von Demokratie und rationalem Diskurs, in Gefahr ist.
Als Sozialwissenschaftler ist es unsere Aufgabe, Tatsachen und Interpretationen von Tatsachen vorzulegen, von denen wir hoffen, dass sie dazu beitragen werden, diese Gräben zu überbrücken, indem jede Seite den Standpunkt der jeweils anderen besser versteht und sie so zu einer Art vernünftig begründetem Dissens, wenn schon keinem Konsens gelangen. Eine demokratische Gesellschaft kann mit verschiedenen Meinungen leben, solange man sich gegenseitig respektiert. Aber Respekt verlangt ein gewisses Maß an Verständnis für denjenigen, der anderer Meinung ist.
Das besonders Beunruhigende an der gegenwärtigen Situation ist die Tatsache, dass der Raum für solche Gespräche immer kleiner zu werden scheint. Es kommt augenscheinlich zu einer »Tribalisierung« der Anschauungen nicht nur in Bezug auf Politik, sondern auch im Hinblick auf die Frage, was die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme sind und was man gegen sie tun kann. Bei einer großangelegten Erhebung zeigte sich, dass die Anschauungen der Amerikaner in Bezug auf eine breite Palette von Themen sich wie Weinbeeren an einer Traube scharen.4 Personen, die gewisse Grundüberzeugungen teilen, etwa über Geschlechterrollen oder hinsichtlich der Frage, ob sich harte Arbeit immer auszahlt, haben offenbar zu einer ganzen Reihe von Fragen – von Einwanderung bis zu internationalem Handel, von Ungleichheit bis zu Steuern und zur Rolle des Staates – die gleiche Meinung. Diese Grundüberzeugungen sagen ihre politischen Anschauungen verlässlicher vorher als ihr Einkommen, ihre demografische Gruppe oder ihr Wohnort.
Diese Themen stehen im Zentrum des politischen Diskurses, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Zuwanderung, Handel, Steuern oder die Rolle des Staates sind in Europa, Indien, Südafrika oder Vietnam genauso umstritten. Aber Meinungen zu diesen Fragen basieren allzu oft ausschließlich auf bestimmten persönlichen Wertvorstellungen (»Ich bin für Zuwanderung, weil ich ein großmütiger Mensch bin«, »Ich bin gegen Zuwanderung, weil Zuwanderung unsere nationale Identität bedroht«). Und sofern sie sich überhaupt auf irgendetwas stützen, dann auf einseitig interpretierte Zahlen und stark vereinfachende Auslegungen der Tatsachen. Niemand denkt wirklich gründlich über die Probleme selbst nach.
Das ist fatal, denn wir durchleben offensichtlich schwere Zeiten. Die Jahre schwungvollen globalen Wachstums, das von der Handelsausweitung und dem erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolg Chinas gespeist wurde, sind möglicherweise vorüber, da sich das Wachstum in China abschwächt und allenthalben Handelskriege ausbrechen. Länder, die von dieser weltwirtschaftlichen Dynamik profitierten – in Asien, Afrika und Lateinamerika –, beginnen, sich bange zu fragen, wie es jetzt wohl weitergehen wird. Selbstverständlich ist in den meisten Ländern des reichen Westens niedriges Wachstum kein neues Phänomen, aber was diese Wachstumsschwäche besonders beunruhigend macht, ist die rasche Auflösung des Gesellschaftsvertrags, die wir in all diesen Ländern sehen. Wir scheinen in die Dickens’sche Welt von Harte Zeiten zurückversetzt worden zu sein, in der die Begüterten gegen die zunehmend entfremdeten Habenichtse kämpfen, ohne dass ein Ausgleich der Interessen in Sicht wäre.5
Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Fragen sind von zentraler Bedeutung für die gegenwärtige Krise. Lässt sich das Wachstum ankurbeln? Sollte dies überhaupt eine Priorität für den wohlhabenden Westen sein? Was sonst? Was ist mit der explodierenden Ungleichheit überall? Ist der internationale Handel das Problem oder die Lösung? Wie wirkt er sich auf die Ungleichheit aus? Wie sieht die Zukunft des Welthandels aus? Können Länder mit niedrigeren Arbeitskosten die globale Industrieproduktion von China weglocken? Und was ist mit Migration? Gibt es tatsächlich eine zu hohe Zuwanderung von Geringqualifizierten? Wie steht es mit neuen Technologien? Sollte uns zum Beispiel der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI) beunruhigen, oder sollten wir ihn begrüßen? Und, was vielleicht am dringendsten ist: Wie kann die Gesellschaft all jenen Menschen helfen, die die Märkte zurückgelassen haben?
Die Antworten auf diese Probleme lassen sich nicht in einem Tweet formulieren. Und daher gibt es den Wunsch, ihnen einfach aus dem Weg zu gehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund tun Staaten sehr wenig, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen; vielmehr nähren sie weiterhin die Wut und das Misstrauen, die uns polarisieren. Und dies macht uns noch unfähiger, miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsam nachzudenken und etwas gegen diese Probleme zu unternehmen. Es scheint, als wären wir in einem Teufelskreis gefangen.
Wirtschaftswissenschaftler haben viel über diese grundlegenden Probleme zu sagen. Sie erforschen Zuwanderung, um herauszufinden, wie diese sich auf die Löhne auswirkt, Steuern, um in Erfahrung zu bringen, ob sie unternehmerische Initiative hemmen, Umverteilung, um zu ergründen, ob sie Trägheit fördert. Sie denken über die Folgen des Handels zwischen Nationen nach, und sie machen nützliche Vorhersagen darüber, wer wahrscheinlich die Gewinner und die Verlierer sein werden. Sie haben sich intensiv darum bemüht, zu verstehen, warum einige Länder wachsen und andere nicht und was, gegebenenfalls, Regierungen tun können, um das Wachstum zu fördern. Sie sammeln Daten, um diverse Fragen beantworten zu können: Was macht Menschen großzügig beziehungsweise misstrauisch? Was veranlasst einen Menschen dazu, seine Heimat zu verlassen und in die Fremde zu gehen? Wie machen sich soziale Medien unsere Vorurteile zunutze?
Die jüngsten Studien warten, wie sich zeigt, mit oftmals überraschenden Erkenntnissen auf, vor allem für diejenigen, die die oberflächlichen Antworten von »Wirtschaftsexperten« im Fernsehen und in gymnasialen Lehrbüchern gewohnt sind. Sie können diese Diskussionen bereichern.
Leider vertrauen nur sehr wenige Menschen Ökonomen so sehr, dass sie ihnen aufmerksam zuhören. Unmittelbar vor der Abstimmung über den Brexit bemühten sich unsere britischen Kollegen verzweifelt, die Öffentlichkeit zu warnen, der Brexit werde teuer. Sie hatten jedoch das Gefühl, mit dieser Botschaft nicht durchzudringen. Sie hatten recht. Niemand schenkte ihnen viel Beachtung. Anfang 2017 führte YouGov eine Umfrage in Großbritannien durch, in der die Frage gestellt wurde: »Den Meinungen welcher der folgenden Berufsgruppen vertrauen Sie am meisten, wenn deren Vertreter über ihr jeweiliges Fachgebiet sprechen?« An erster Stelle rangierten Krankenpflegekräfte. 84 Prozent der Befragten vertrauten ihnen. Politiker kamen an letzter Stelle, mit 5 Prozent (auch wenn Unterhausabgeordneten des eigenen Wahlbezirks, mit 20 Prozent, etwas mehr Vertrauen entgegengebracht wurde). Ökonomen rangierten mit 25 Prozent knapp vor Politikern. Das Vertrauen in Meteorologen war doppelt so hoch.6 Im Herbst 2018 stellten wir 10 000 Personen in den Vereinigten Staaten die gleiche Frage (sowie mehrere weitere, die sich auf Ansichten zu wirtschaftlichen Themen bezogen, auf die wir an verschiedenen Stellen in diesem Buch eingehen werden).7 Auch hier vertrauten nur 25 Prozent der Befragten dem Sachverstand von Ökonomen. Nur Politiker rangierten noch niedriger.
Dieses Vertrauensdefizit spiegelt sich in der Tatsache wider, dass sich der fachliche Konsens von Ökonomen (sofern er vorhanden ist) oftmals systematisch von den Ansichten der Durchschnittsbürger unterscheidet. Die Booth School of Business an der Universität Chicago befragt regelmäßig eine Gruppe von rund vierzig renommierten Wirtschaftsprofessoren, allesamt führende Vertreter ihres Fachs, über ihre Meinung zu wirtschaftlichen Fragen. Wir werden uns in diesem Buch immer wieder auf die Antworten dieses IGM-Booth-Expertengremiums beziehen. Wir wählten zehn Fragen aus, die den Mitgliedern dieses Gremiums gestellt worden waren, und legten sie den Personen vor, die im Rahmen unserer Erhebung befragt wurden. Bei den meisten dieser Fragen waren die Wirtschaftswissenschaftler und die von uns befragten Personen entgegengesetzter Auffassung. So widersprachen beispielsweise sämtliche Wissenschaftler im IGM-Booth-Expertengremium der Aussage »Die Verhängung neuer US-Zölle auf Stahl und Aluminium wird das Wohlstandsniveau der Amerikaner erhöhen«.8 Dagegen stimmte knapp über ein Drittel der von uns befragten Personen dieser Aussage zu.
Im Allgemeinen waren die von uns befragten Personen pessimistischer als die Ökonomen: 40 Prozent der Wirtschaftswissenschaftler stimmten der Aussage zu, dass »der Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland ab Sommer 2015 Deutschland während des folgenden Jahrzehnts wirtschaftliche Vorteile bringen wird«, und die meisten anderen waren unsicher oder äußerten keine Meinung (nur einer widersprach).9 Dagegen stimmte nur ein Viertel der von uns befragten Personen dieser Aussage zu, während 35 Prozent nicht zustimmten. Die Teilnehmer an unserer Umfrage waren auch häufiger der Ansicht, der Vormarsch von Robotern und der KI werde zu verbreiteter Arbeitslosigkeit führen, und sie äußerten viel seltener die Meinung, der dadurch geschaffene zusätzliche Wohlstand reiche aus, um die Verlierer zu entschädigen.10
Dies hängt nicht damit zusammen, dass Ökonomen immer in höherem Maße wirtschaftsliberale Rezepte befürworten als der Rest der Bevölkerung. Eine vorausgehende Studie verglich, wie Wirtschaftswissenschaftler und eintausend zufällig ausgewählte Amerikaner die gleichen zwanzig Fragen beantworteten.11 Dabei kam heraus, dass Ökonomen viel häufiger die Erhöhung von Bundessteuern befürworteten (97,4 Prozent der Ökonomen waren dafür, gegenüber 66 Prozent der Durchschnittsamerikaner). Sie hielten auch deutlich mehr von den Maßnahmen, die die US-Regierung nach der Krise von 2008 ergriff (Bankenrettungen, das Konjunkturpaket usw.), als der Durchschnitt der Bevölkerung. Andererseits stimmten 67 Prozent der Durchschnittsamerikaner, aber nur 39 Prozent der Ökonomen der Aussage zu, die Vorstandschefs von Großunternehmen seien überbezahlt. Insgesamt zeigt sich das Bild, dass der durchschnittliche Wirtschaftsprofessor völlig anders denkt als der Durchschnittsamerikaner. Über alle zwanzig Fragen hinweg gibt es eine enorme Kluft von 35 Prozentpunkten zwischen den Zustimmungsquoten von Wirtschaftswissenschaftlern und Durchschnittsamerikanern zu einer bestimmten Aussage.
Außerdem ändern die befragten Durchschnittsbürger ihre Auffassung nicht, wenn man sie darüber informiert, was bekannte Ökonomen über diese Themen denken. Bei drei Fragen, bei denen die Experten einen deutlich anderen Standpunkt vertraten als der Bevölkerungsdurchschnitt, variierten Forscher die Formulierung der Frage. Bei einigen Befragten schickten sie der eigentlichen Frage die Bemerkung voraus »Fast alle Experten sind der Meinung, dass …«; anderen stellten sie einfach nur die Frage. Dies hatte keinen Einfluss auf die Antworten, die sie erhielten. Auf die Frage, ob das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) das Wohlstandsniveau des Durchschnittsbürgers angehoben habe (welche 95 Prozent der Ökonomen bejahten), antworteten 51 Prozent der Befragten mit Ja, wenn ihnen die Meinung der Ökonomen mitgeteilt wurde, und 46 Prozent, wenn dies nicht getan wurde. Das ist eine geringe Differenz. Daraus lässt sich ableiten, dass anscheinend ein großer Teil der Bevölkerung nichts mehr auf die Meinung von Ökonomen zu wirtschaftlichen Sachverhalten gibt.
Wir glauben keineswegs, dass Ökonomen immer recht haben, wenn sie und der nicht fachkundige Bürger unterschiedlicher Auffassung sind. Wir, die Wirtschaftswissenschaftler, sind oftmals in unseren Modellen und Methoden gefangen und vergessen manchmal, wo die Wissenschaft endet und die Ideologie beginnt. Wir beantworten politische Fragen auf der Grundlage von Annahmen, die uns zur zweiten Natur geworden sind, weil sie die Bausteine unserer Modelle sind, aber das bedeutet nicht, dass sie immer stimmen. Dennoch verfügen wir über nützliches Fachwissen, das sonst niemand besitzt. Das (bescheidene) Ziel dieses Buches ist es, einige dieser Fachkenntnisse mit dem Leser zu teilen und wieder einen Dialog über die drängendsten und umstrittensten Themen unserer Zeit zu eröffnen.
Hierzu müssen wir verstehen, was das Vertrauen in Ökonomen untergräbt. Ein Teil der Antwort lautet, dass vermeintliche Experten wirtschaftliche Zusammenhänge oft falsch oder verzerrt darstellen. Diejenigen, die die »Ökonomen« im öffentlichen Diskurs repräsentieren, sind in der Regel nicht dieselben Personen, die dem IGM-Booth-Expertengremium angehören. Die selbsternannten Wirtschaftsexperten im Fernsehen und in der Presse – der Chefvolkswirt der Bank X oder Firma Y – sind, bis auf wenige bedeutende Ausnahmen, in erster Linie Sprachrohre der wirtschaftlichen Interessen ihrer Arbeitgeber, die oftmals nicht zögern, die Aussagekraft empirischer Daten zu ignorieren. Außerdem haben sie eine relativ vorhersagbare Neigung zu einem »Marktoptimismus« um jeden Preis, die die Öffentlichkeit Ökonomen im Allgemeinen zuschreibt.
Leider lassen sich diese im Fernsehen auftretenden »Wirtschaftsexperten« aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds (Anzug und Krawatte) und ihrer Sprechweise (jede Menge Fachjargon) kaum von Wirtschaftsprofessoren unterscheiden. Der wichtigste Unterschied besteht vielleicht in der Bereitwilligkeit, mit der sie Kommentare abgeben und Vorhersagen machen, was sie leider umso glaubwürdiger erscheinen lässt. Aber tatsächlich liegen sie mit ihren Vorhersagen meistens ziemlich daneben, zum Teil, weil Vorhersagen oftmals schier unmöglich sind – aus diesem Grund halten sich die meisten akademischen Ökonomen von der Futurologie fern. Eine der Aufgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) besteht darin, die Wachstumsrate der Weltwirtschaft in der nahen Zukunft vorherzusagen. Allerdings ohne großen Erfolg, wie man hinzufügen könnte, obwohl der IWF dabei auf die Dienste eines Teams aus vielen sehr gut ausgebildeten Ökonomen zurückgreifen kann. Die Zeitschrift Economist hat einmal ausgerechnet, wie weit die Vorhersagen des IWF in dem Zeitraum 2000 bis 2014 im Durchschnitt danebenlagen.12 Für zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der Vorhersage (zum Beispiel die im Jahr 2012 für das Jahr 2014 vorhergesagte Wachstumsrate) betrug der durchschnittliche Vorhersagefehler 2,8 Prozentpunkte. Das ist etwas besser, als wenn sie jedes Jahr eine Zufallszahl zwischen –2 Prozent und 10 Prozent ausgewählt hätten, aber ungefähr genauso schlecht wie die Annahme einer konstanten Wachstumsrate von 4 Prozent. Wir vermuten, dass derartige Dinge in erheblichem Umfang zu der allgemeinen Skepsis gegenüber den Wirtschaftswissenschaften beitragen.
Ein weiterer wesentlicher Faktor, der zu dem mangelnden Vertrauen beiträgt, ist die Tatsache, dass an Hochschulen lehrende Wirtschaftswissenschaftler sich nur selten die Zeit nehmen, die oftmals komplexen Gedankengänge, die ihren nuancierteren Schlussfolgerungen zugrunde liegen, zu erläutern. Nach welchen Kriterien haben sie aus den vielen möglichen alternativen Interpretationen der empirischen Daten die ihnen als zutreffend erscheinende ausgewählt? Welche Datenpunkte, oftmals aus verschiedenen Gebieten, mussten sie miteinander verbinden, um die plausibelste Antwort zu erhalten? Wie plausibel ist diese? Können wir uns daran orientieren, oder sollten wir besser noch abwarten? Die heutige Medienkultur schafft von sich aus keine Freiräume für subtile oder weit ausholende Erklärungen.
Jeder von uns beiden geriet bereits mit Fernsehmoderatoren aneinander, weil wir unsere ganze Geschichte erzählen wollten (während sie nur Ausschnitte davon senden wollten). Von daher verstehen wir, warum an Hochschulen lehrende Wirtschaftswissenschaftler oftmals nicht die Verantwortung übernehmen wollen, ihre Stimme zu erheben. Es ist sehr anstrengend, sich in angemessener Weise Gehör zu verschaffen, und es besteht immer das Risiko, dass man sich unausgegoren anhört oder dass die Worte, die man sorgfältig gewählt hat, so verdreht werden, dass sie etwas ganz anderes bedeuten.
Selbstverständlich gibt es diejenigen, die ihre Stimme erheben, aber sie sind, bis auf wenige bedeutende Ausnahmen, diejenigen mit den entschiedensten Meinungen und der geringsten Bereitschaft, sich intensiv mit den besten Arbeiten der modernen Volkswirtschaftslehre zu befassen. Einige, die so sehr einer bestimmten Denkschule verfallen sind, dass sie jede Tatsache, die nicht in Einklang mit deren Doktrinen steht, einfach ignorieren, wiederholen alte Ideen wie ein Mantra, auch wenn diese längst widerlegt worden sind. Andere gießen Hohn und Spott über die herrschende wirtschaftswissenschaftliche Lehre aus, was sie manchmal verdienen mag; aber dies bedeutet oft, dass sie eher nicht auf der Höhe der besten wirtschaftswissenschaftlichen Forschung sind.
Unserem Eindruck nach sind die besten wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten häufig die »unspektakulärsten«. Die Welt ist so komplex und voller Rätsel, dass das Wertvollste, was Ökonomen anzubieten haben, oftmals nicht ihre Schlussfolgerung ist, sondern der Weg, der sie dorthin führte – die Fakten, die sie herausfanden, ihre Interpretation dieser Fakten, die Schlüsse, die sie zogen, die verbleibenden Quellen ihrer Ungewissheit. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass Wirtschaftswissenschaftler anders als zum Beispiel Physiker keine Naturwissenschaftler sind und nur sehr selten absolute Gewissheit anbieten können. Jeder, der die Sitcom-Serie The Big Bang Theory gesehen hat, weiß, dass Physiker auf Ingenieure herabsehen. Physiker denken tiefe Gedanken, während Ingenieure mit Materialien herumspielen und sich bemühen, diesen Gedanken Form zu geben; oder zumindest wird das in der Serie so dargestellt. Sollte es jemals eine Fernsehserie geben, die Ökonomen durch den Kakao zieht, dann, so vermuten wir, würden wir mehrere Stufen unter Ingenieuren stehen oder zumindest der Art von Ingenieuren, die Raketen bauen. Anders als Ingenieure (zumindest diejenigen, die in der Big Bang Theory auftreten) können wir uns nicht darauf verlassen, dass uns ein Physiker genau sagt, welche Schubkraft eine Rakete benötigt, um der Erdanziehung zu entkommen. Ökonomen gleichen eher Klempnern; wir lösen Probleme mit einer Kombination aus wissenschaftlich unterfütterter Intuition, erfahrungsgeleiteter Spekulation und jeder Menge praktischem Herumprobieren.
Dies bedeutet, dass sich Ökonomen oftmals irren. Auch uns wird dies in diesem Buch zweifellos viele Male passieren. Nicht nur in Bezug auf die Wachstumsrate, deren Vorhersage zumeist ein hoffnungsloses Unterfangen ist, sondern auch im Hinblick auf begrenztere Fragestellungen wie etwa: Wie sehr helfen Kohlenstoffsteuern bei der Bekämpfung des Klimawandels? Wie würde es sich auf die Vergütung von Vorstandschefs auswirken, wenn die Steuern stark erhöht würden? Wie würde sich ein allgemeines Grundeinkommen auf die Struktur der Beschäftigung auswirken? Aber Ökonomen sind nicht die Einzigen, die Fehler machen. Jeder liegt mal daneben. Gefährlich ist es nicht, Fehler zu machen, sondern so sehr in den eigenen Standpunkt vernarrt zu sein, dass man sich von Fakten nicht beirren lässt. Um Fortschritte zu machen, müssen wir ständig zu den Fakten zurückkehren, unsere Fehler eingestehen und weitermachen.
Im Übrigen gibt es auch eine Menge sehr solider wirtschaftswissenschaftlicher Arbeiten. Diese setzen bei unverstandenen Fakten an, formulieren gewisse Hypothesen auf der Basis dessen, was wir bereits über menschliches Verhalten wissen, und von Theorien, die sich in anderen Zusammenhängen bewährt haben, überprüfen diese Hypothesen anhand von Daten, verfeinern ihre Vorgehensweise auf der Grundlage der neuen Fakten und gelangen schließlich, mit etwas Glück, zu einer Lösung. Diesbezüglich hat unsere Arbeit große Ähnlichkeit mit der medizinischen Forschung. Siddhartha Mukherjees wunderbares Buch über den Kampf gegen den Krebs, Der König aller Krankheiten, erzählt, wie bei der Entwicklung eines neuen Medikaments (bis zur Marktreife) inspiriertes Mutmaßen, sorgfältiges Testen und unermüdliches Optimieren zusammenwirken.13 Die Arbeit eines Wirtschaftswissenschaftlers hat große Ähnlichkeit damit. Wie in der Medizin sind wir nie sicher, ob wir die Wahrheit entdeckt haben, vielmehr sind wir gerade so sehr von der Richtigkeit einer bestimmten Antwort überzeugt, dass wir uns einstweilen daran halten, in dem Wissen, dass wir womöglich später unsere Meinung ändern müssen. Ebenfalls wie in der Medizin endet unsere Arbeit nicht, sobald die Grundlagenforschung erledigt und die Schlüsselidee bewiesen ist; anschließend beginnt der Prozess der Umsetzung dieser Idee in der realen Welt.
In gewisser Hinsicht ist dieses Buch eine Art Bericht »von der Front«, wo diese Forschung stattfindet: Was sagen uns die besten wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten von heute über die grundlegenden Probleme, mit denen unsere Gesellschaften kämpfen? Wir beschreiben, was die besten Ökonomen der Gegenwart über die Welt denken; nicht nur ihre Schlussfolgerungen, sondern auch, wie sie zu diesen gelangten, wobei sie sich unentwegt darum bemühen, Tatsachen und Hirngespinste, kühne Annahmen und solide Ergebnisse, Hoffnungen und gesichertes Wissen auseinanderzuhalten.
Es ist wichtig, dass wir bei diesem Projekt menschliche Bedürfnisse und Wünsche und das, was ein gutes Leben ausmacht, in einem weiten Sinne verstehen. Wirtschaftswissenschaftler neigen zu einem allzu engen Begriff des Wohlbefindens, das sie mit einem gewissen Mindesteinkommen oder mit materiellem Konsum gleichsetzen. Dabei brauchen wir alle viel mehr als das, um ein erfüllendes Leben zu führen: die Achtung der Gemeinschaft, die Freuden enger sozialer Kontakte, Würde, Leichtigkeit, Genuss. Die Fokussierung auf das Einkommen allein ist nicht nur eine bequeme Vereinfachung. Es ist eine verzerrende Sichtweise, die schon viele der gescheitesten Ökonomen in die Irre führte, Entscheidungsträger zu Fehlentscheidungen veranlasste und allzu viele von uns falsche Prioritäten setzen ließ. Sie bringt viele von uns dazu zu glauben, die ganze Welt warte an unserer Tür, um uns unsere gut bezahlten Jobs wegzunehmen. Sie hat dazu geführt, dass viele in westlichen Nationen eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit hohen Wirtschaftswachstums zurückbringen wollen. Sie macht uns gleichzeitig zutiefst misstrauisch gegenüber denjenigen, die kein Geld haben, und flößt uns die Angst ein, uns an ihrer Stelle wiederzufinden. Sie lässt den Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und dem Überleben des Planeten so unüberwindlich erscheinen.
Ein produktiveres Gespräch setzt voraus, dass wir den tiefen menschlichen Wunsch nach Würde und menschlichem Kontakt anerkennen und nicht als eine Nebensächlichkeit behandeln, sondern als eine Möglichkeit, einander besser zu verstehen und scheinbar unüberbrückbare Gegensätze zu überwinden. Wenn wir der Menschenwürde wieder den zentralen Stellenwert einräumen, der ihr gebührt, so unsere These in diesem Buch, dann bringt uns dies dazu, unsere wirtschaftlichen Prioritäten und die Art und Weise, wie sich Gesellschaften um ihre Mitglieder – insbesondere die schwächsten und schutzbedürftigsten – kümmern sollten, grundlegend zu überdenken.
Gleichwohl gelangen Sie vielleicht bei einzelnen Themen, mit denen wir uns in diesem Buch beschäftigen, oder auch bei allen zu einer anderen Schlussfolgerung als wir. Wir hoffen, Sie dazu zu bringen, uns nicht reflexartig zuzustimmen, sondern ein kleines bisschen von unseren Methoden zu übernehmen und einige unserer Hoffnungen und Befürchtungen zu teilen, sodass wir zu guter Letzt in einer konstruktiven Weise miteinander ins Gespräch kommen.
KAPITEL 2
Aus dem Maul des Haifischs
Migration schlägt hohe Wellen, so hohe, dass das Thema gegenwärtig die politische Debatte in vielen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten beherrscht. Angefangen von Präsident Donald Trumps äußerst wirkungsmächtiger Beschwörung vermeintlicher Horden mordlüsterner mexikanischer Migranten bis zur ausländerfeindlichen Rhetorik der Alternative für Deutschland, des französischen Front National und der Brexit-Anhänger, ganz zu schweigen von den regierenden Parteien in Ungarn und der Slowakei und bis vor einiger Zeit auch in Italien, ist sie vielleicht das beherrschende politische Thema in den reichsten Ländern der Welt. Selbst Politikern aus den etablierten europäischen Parteien fällt es nicht leicht, angesichts der Bedrohung, die sich in ihren Augen auf der anderen Seite des Mittelmeeres zusammenbraut, den liberalen Traditionen, denen sie sich verpflichtet fühlen, treu zu bleiben. In den Entwicklungsländern ist das Phänomen zwar weniger sichtbar, aber die Übergriffe gegen Flüchtlinge aus Simbabwe in Südafrika, die Rohingya-Krise in Bangladesch und das Staatsbürgerschaftsgesetz im indischen Bundesstaat Assam sind für diejenigen, gegen die sie sich richten, gleichermaßen beängstigend.
Woher kommt die Panik? Der Anteil grenzüberschreitender Migranten an der Weltbevölkerung war im Jahr 2017 ungefähr so groß wie im Jahr 1960 oder 1990: 3 Prozent.14 In die Europäische Union (EU) kommen jährlich im Durchschnitt zwischen 1,5 Millionen und 2,5 Millionen Migranten aus Nicht-EU-Ländern. Zweieinhalb Millionen sind weniger als ein halbes Prozent der EU-Bevölkerung. Die meisten von ihnen sind legale Zuwanderer, Menschen mit Stellenangeboten oder Personen, die zu Familienangehörigen nachziehen. In den Jahren 2015 und 2016 gab es einen ungewöhnlich hohen Zustrom von Flüchtlingen, aber 2018 sank die Zahl der Asylsuchenden in der EU wieder auf 638 000, und nur 38 Prozent der Asylanträge wurde stattgegeben.15 Dies entspricht etwa einer Person je 2500 EU-Einwohnern. Nicht gerade eine Sintflut.
Rassistische Panikmache aus Angst vor einer »Vermischung der Rassen« und getragen vom Mythos der Reinheit ignoriert die Fakten. Eine Befragung von 22500 nicht zugewanderten Bürgern aus sechs Ländern, in denen die Zuwanderung eines der Hauptthemen der politischen Debatte ist (Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien und die Vereinigten Staaten), enthüllte massive Fehleinschätzungen bezüglich der Anzahl und der Herkunft von Zuwanderern.16 So beläuft sich zum Beispiel in Italien der tatsächliche Anteil von Zuwanderern an der Bevölkerung auf 10 Prozent, während dieser Anteil von den Befragten im Durchschnitt auf 26 Prozent geschätzt wird.
Die Befragten haben auch den Anteil muslimischer Einwanderer erheblich überschätzt, ebenso den Prozentsatz derjenigen, die aus dem Nahen Osten und Nordafrika zugewandert sind. Ihrer Meinung nach sind Einwanderer niedriger gebildet, ärmer und mit höherer Wahrscheinlichkeit arbeitslos sowie häufiger auf staatliche Unterstützung angewiesen, als es tatsächlich der Fall ist.
Politiker schüren diese Befürchtungen, indem sie Missbrauch mit den Fakten treiben. Im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahl von 2017 behauptete Marine Le Pen wiederholt, 99 Prozent der Einwanderer seien erwachsene Männer (tatsächlich sind es 58 Prozent) und 95 Prozent der Migranten, die sich in Frankreich ansiedelten, würden »vom Staat umsorgt«, weil sie in Frankreich nicht arbeiteten (in Wirklichkeit waren 55 Prozent der Migranten in Frankreich Erwerbspersonen).17
Zwei neuere Experimente zeigen, dass dies eine erfolgversprechende Wahltaktik ist, selbst in einer Welt systematischer Faktenüberprüfung. In einer Studie in den Vereinigten Staaten arbeiteten Forscher mit zwei Gruppen von Fragen. Eine Gruppe zielte darauf ab, die Meinungen der Befragten zum Thema Migration in Erfahrung zu bringen, die andere darauf, ihr Faktenwissen über die Zahlen und die Merkmale von Migranten abzufragen.18 Diejenigen, die zuerst die faktenbezogenen Fragen beantworteten, bevor sie nach ihrer Meinung gefragt wurden (und die daher an ihre eigenen verzerrten Wahrnehmungen von Migranten erinnert wurden), waren mit viel höherer Wahrscheinlichkeit gegen Einwanderung. Als man ihnen die tatsächlichen Zahlen nannte, änderte sich zwar ihr Faktenwissen, nicht aber ihre grundsätzliche Einstellung zur Zuwanderung. In Frankreich kam bei einem vergleichbaren Experiment ein ähnliches Ergebnis heraus. Personen, die gezielt Marine Le Pens falschen Behauptungen ausgesetzt wurden, stimmten mit höherer Wahrscheinlichkeit für sie.19 Leider blieb dies auch dann so, nachdem Le Pens Aussagen vor ihnen einer Faktenüberprüfung unterzogen wurden. Die Wahrheit hat ihre Meinungen nicht beeinflusst. Es genügt bereits, dass Menschen über Migration nachdenken, um sie engstirniger zu machen. Fakten dürfen ihnen nicht in die Quere kommen.
Es gibt einen wichtigen Grund, warum Fakten ignoriert werden, und dieser beruht auf einem ökonomischen Sachverhalt, der anscheinend so vollkommen selbstverständlich ist, dass viele einfach nicht weiter darüber nachdenken, selbst wenn empirische Daten das Gegenteil sagen. Die ökonomische Analyse der Zuwanderung läuft auf einen verlockend einfachen Syllogismus hinaus. Die Welt ist voller armer Menschen, die offensichtlich viel mehr verdienen würden, wenn sie es hierher (wo auch immer dies konkret sein mag) schafften, wo es eindeutig viel besser ist; wenn sie daher die kleinste Chance erhalten, werden sie sich auf den Weg machen und zu uns kommen, und dies wird unsere Löhne senken und die meisten von uns Alteingesessenen schlechter stellen.
Das Bemerkenswerte an diesem Argument ist seine Übereinstimmung mit der Standardformulierung des Gesetzes von Angebot und Nachfrage, wie es im Fach Wirtschaftslehre am Gymnasium unterrichtet wird. Menschen wollen mehr Geld und ziehen daher alle dorthin, wo die Löhne am höchsten sind (das Angebot steigt). Da die Nachfragekurve für Arbeit schräg abfällt, führt der Anstieg des Arbeitskräfteangebots zu niedrigeren Löhnen für alle. Die Zuwanderer werden vielleicht davon profitieren, aber die einheimischen Arbeitnehmer werden dadurch schlechtergestellt. Genau diesen vermeintlich eindeutigen Zusammenhang versucht Präsident Trump auszunutzen, wenn er behauptet, die USA seien »voll«. Das Argument ist so einfach, dass es auf die Rückseite einer sehr kleinen Serviette passt, wie in Abbildung 2.1 zu sehen.
Abbildung 2.1: »Servietten-Ökonomie«. Warum uns Zuwanderer ärmer machen müssen.
Die Logik ist einfach, bestechend und falsch. Erstens haben Lohnunterschiede zwischen Ländern (beziehungsweise, ganz allgemein, Standorten) relativ wenig damit zu tun, ob es Wanderungsbewegungen von Menschen gibt oder nicht. Während offensichtlich viele Menschen den Ort, an dem sie sich gerade aufhalten, verlassen wollen, ist es nach wie vor eine ungelöste Frage, warum so viele andere nicht aufbrechen, obwohl sie es könnten.
Zweitens gibt es keine stichhaltigen Belege dafür, dass selbst ein relativ großer Zustrom von geringqualifizierten Migranten der ortsansässigen Bevölkerung einschließlich jener Mitglieder der einheimischen Bevölkerung, die in Bezug auf ihr Qualifikationsniveau den Migranten am ähnlichsten sind, Wohlfahrtseinbußen bescheren wird. Tatsächlich spricht vieles dafür, dass Zuwanderung die meisten Menschen – Zuwanderer ebenso wie Einheimische – besserstellen wird. Dies hat viel mit der besonderen Natur des Arbeitsmarkts zu tun. Der Arbeitsmarkt ist nämlich so beschaffen, dass der übliche Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage dort nur sehr eingeschränkt gilt.
Seine Heimat verlassen
Die britisch-somalische Dichterin Warsan Shire schreibt:
Niemand verlässt seine Heimat, es sei denn seine Heimat ist das Maul eines Haifischs Du rennst nur zur Grenze, wenn du siehst, dass die ganze Stadt dorthin rennt, deine Nachbarn rennen schneller als du, blutigen Atem in ihren Kehlen, der Junge, mit dem du zur Schule gegangen bist, der dich hinter der alten Konservenfabrik küsste, bis dir schwindlig wurde, hält ein Gewehr, das größer ist als er Du verlässt deine Heimat nur, wenn in deiner Heimat kein Bleiben ist.20
Mit ihrer Einschätzung liegt sie sicher richtig. Die hauptsächlichen Fluchtländer – Länder wie Irak, Syrien, Guatemala und auch der Jemen – sind keineswegs die ärmsten Länder der Welt. Das Pro-Kopf-Einkommen im Irak, bereinigt um die Unterschiede in den Lebenshaltungskosten (was die Ökonomen »Kaufkraftparität« nennen), ist etwa zwanzigmal so hoch wie in Liberia und mindestens zehnmal so hoch wie in Mosambik oder Sierra Leone. Trotz eines drastischen Rückgangs des Nationaleinkommens war der Jemen 2016 noch immer dreimal wohlhabender als Liberia (es gibt keine neueren Daten). Mexiko, das Land, auf das Präsident Trump besonders gern eindrischt, ist ein sogenanntes Land mit mittlerem Nationaleinkommen im oberen Bereich, das über ein viel gelobtes und vielfach nachgeahmtes Sozialsystem verfügt.
Die Menschen, die diese Länder verlassen wollen, leben wahrscheinlich nicht in jener extremen Armut, in der der durchschnittliche Einwohner Liberias oder Mosambiks sein Dasein fristet. Vermutlich finden sie ihr Leben vor allem wegen des völligen Normalitätsverlusts im Alltag unerträglich: Die Unvorhersagbarkeit und die Gewalt, die die Drogenkriege in Nordmexiko über sie gebracht haben, die furchtbare Militärjunta in Guatemala und die Bürgerkriege im Nahen Osten. Eine Studie in Nepal kam zu dem Ergebnis, dass selbst schlechte Erntejahre nicht viele Nepalesen dazu bewogen, ihr Land zu verlassen.21 Tatsächlich wanderten in schlechten Jahren weniger Menschen aus, weil sie sich die Reise nicht leisten konnten. Erst als langjährige Aufstände der maoistischen Rebellenbewegung wieder zu massiver Gewalttätigkeit führten, packten die Menschen ihre Koffer. Sie flohen aus dem Maul des Haifischs. Und wenn das geschieht, ist es praktisch unmöglich, sie aufzuhalten, weil es ihrer Wahrnehmung nach keine Heimat gibt, in die sie zurückkehren könnten.
Selbstverständlich gibt es auch das Gegenteil: Der ehrgeizige Migrant, der sein Land um jeden Preis verlassen will. Das ist Apu, der Protagonist von Aparajito, dem zweiten Film aus der wunderbaren Apu-Trilogie des indischen Regisseurs Satyajit Ray. Er ist hin- und hergerissen zwischen seiner einsamen Mutter in ihrem Heimatdorf und den vielen aufregenden Möglichkeiten, die die Stadt bietet.22 Dies ist der Einwanderer aus China, der zwei Jobs hat und eisern spart, damit seine Kinder eines Tages an der Universität Harvard studieren können. Wir alle wissen, dass es solche Menschen gibt.
Und dann gibt es diejenigen in der Mitte, die große Mehrzahl derjenigen, die nicht durch extreme innere oder äußere Zwänge zur Auswanderung gedrängt werden. Sie scheinen nicht hinter jedem zusätzlichen Dollar her zu sein. Selbst wenn es keine Grenzkontrollen und keine Einwanderungspolizisten gibt, denen man ausweichen müsste, bleiben sie dort, wo sie sind, zum Beispiel auf dem Land, ungeachtet der großen Lohnunterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten innerhalb desselben Landes.23 Bei einer Umfrage unter Slumbewohnern in Delhi, viele davon erst in jüngster Zeit aus Bihar und Uttar Pradesh zugewandert, den beiden riesigen Bundesstaaten östlich von Delhi, kam heraus, dass die durchschnittliche Familie nach Abzug der Kosten für die Unterkunft von etwas mehr als 2 Dollar pro Tag (kaufkraftbereinigt) lebt.24 Dies ist viel mehr als die unteren 30 Prozent in jenen beiden Bundesstaaten, die kaufkraftbereinigt von weniger als 1 Dollar pro Tag leben. Dennoch haben die übrigen sehr armen Menschen (rund 100 Millionen) nicht beschlossen, nach Delhi zu ziehen, um ihr Einkommen mehr als zu verdoppeln.
Nicht nur in Entwicklungsländern ziehen Menschen nicht um, obwohl sie andernorts bessere wirtschaftliche Bedingungen vorfinden würden. Zwischen 2010 und 2015, dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, die Griechenland erschütterte, sind weniger als 350 000 Griechen ausgewandert.25 Dies entspricht höchstens 3 Prozent der Bevölkerung Griechenlands, obwohl die Arbeitslosenquote in den Jahren 2013 und 2014 27 Prozent betrug und sich die Griechen als EU-Bürger innerhalb der gesamten EU frei bewegen und überall arbeiten dürfen.
Die Migrationslotterie
Aber vielleicht ist dieses Verhalten gar nicht so rätselhaft, vielleicht überschätzen wir die Vorteile von Migration. Ein wichtiges allgemeines Problem bei der Einschätzung der mit Migration verbundenen Vorteile besteht darin, dass wir in der Regel nur die Löhne derjenigen betrachten, die sich entschließen, fortzuziehen, und nicht die vielen Gründe, die sie dazu bewogen haben, und die vielen Faktoren, die es ihnen ermöglichten, dies erfolgreich zu tun. Die Auswanderer haben vielleicht besondere Fähigkeiten oder ein ungewöhnliches Durchhaltevermögen und würden daher auch dann, wenn sie in ihrer Heimat blieben, mehr verdienen. Während Migranten viele Dinge erledigen, die keine besonderen Qualifikationen erfordern, verrichten sie oftmals anstrengende, erschöpfende Arbeiten, die großes Durchhaltevermögen und viel Geduld erfordern (man denke nur an den Hausbau oder das Obstpflücken, die Tätigkeiten, die viele Migranten aus Lateinamerika in den Vereinigten Staaten erledigen). Nicht jeder hält dies Tag für Tag durch.
Daher kann man nicht in einer naiven Weise das Einkommen von Migranten mit dem Einkommen derjenigen vergleichen, die in ihrer Heimat bleiben, und schlussfolgern, wie es viele Befürworter von mehr Zuwanderung tun, der Nutzen von mehr Zuwanderung müsse immens sein. Dies ist das, was Wirtschaftswissenschaftler ein Identifikationsproblem nennen. Um behaupten zu können, ein Lohnunterschied sei ausschließlich durch den Ortsunterschied und nichts anderes verursacht, müssen wir einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Ursache und der Wirkung nachweisen.
Dies lässt sich leicht anhand von Visa-Lotterien erforschen. Gewinner und Verlierer einer Lotterie gleichen einander tendenziell in jeder Hinsicht, abgesehen von diesem einen glücklichen Umstand. Daher kann der Einkommensunterschied, der aus dem Gewinn der Visa-Lotterie resultiert, auf nichts anderes zurückzuführen sein als auf den Wechsel des Wohnorts, den er ermöglicht. Vergleicht man Gewinner und Verlierer der neuseeländischen Visa-Lotterie für Teilnehmer von der winzigen südpazifischen Insel Tonga (die meisten von ihnen sind recht arm), zeigt sich, dass die Gewinner innerhalb eines Jahres nach ihrer Übersiedlung ihr Einkommen mehr als verdreifachten.26 Am anderen Ende des Einkommensspektrums findet man indische Software-Ingenieure, die in den Vereinigten Staaten eine Anstellung erhielten, weil sie die Visa-Lotterie gewannen: Sie verdienten sechsmal mehr als ihre Kollegen, die in Indien blieben.27
Lavabomben
Das Problematische an diesen Zahlen ist zugleich das, was sie leicht interpretierbar macht: Sie stützen sich auf Vergleiche zwischen denjenigen, die an Visa-Lotterien teilnahmen. Aber diejenigen, die nicht teilnehmen, haben vielleicht ganz andere Merkmale. Vielleicht würde es ihnen wenig bringen, in ein anderes Land auszuwandern, weil sie nicht die richtigen Qualifikationen besitzen. Allerdings gibt es einige sehr aufschlussreiche Studien über Menschen, die aufgrund eines gänzlich zufälligen Ereignisses gezwungen waren, woanders hinzuziehen.
Am 23. Januar 1973 gab es einen Vulkanausbruch auf den Westmännerinseln, einem prosperierenden Fischerei-Archipel vor der Küste Islands. Die 5200 Bewohner der Inselgruppe wurden innerhalb von vier Stunden evakuiert, und nur eine Person starb. Die Eruption dauerte jedoch fünf Monate, und Lava zerstörte etwa ein Drittel der Häuser auf den Inseln. Die zerstörten Häuser befanden sich im östlichen Teil (direkt in Fließrichtung der Lavaströme), hinzu kamen einige Häuser in anderen Gebieten, die zufällig von »Lavabomben« getroffen wurden. Man kann keine »lavafesten« Häuser bauen, und von daher entschieden allein Standort und Pech darüber, welches Haus zerstört wurde. Das östliche Viertel schien in keiner Weise ungewöhnlich zu sein; zerstörte Häuser hatten den gleichen Marktwert wie nicht zerstörte Häuser, und die Bewohner von beiden unterschieden sich nicht. Sozialwissenschaftler nennen dies ein natürliches Experiment: Die Natur hat gewürfelt, und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass zwischen denjenigen, deren Häuser zerstört wurden, und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall war, ex ante (vorab) keine Unterschiede bestanden.
Aber anschließend gab es einen wichtigen Unterschied. Diejenigen, deren Häuser zerstört wurden, erhielten einen Geldbetrag, der dem Wert ihres Hauses und ihres Grundstücks entsprach. Mit diesem Geld konnten sie ihr Haus wiederaufbauen, ein anderes Haus kaufen oder fortziehen. 42 Prozent derjenigen, deren Häuser zerstört worden waren, entschlossen sich wegzuziehen (und 27 Prozent derjenigen, deren Häuser nicht zerstört wurden, zogen ebenfalls fort).28 Island ist ein kleines, aber gut organisiertes Land, und mithilfe von Steuerakten und anderen Archivunterlagen lassen sich die langfristigen ökonomischen Entwicklungspfade sämtlicher ursprünglichen Einwohner der Westmännerinseln nachvollziehen. Umfangreiche genetische Daten erlauben darüber hinaus, jeden Nachfahren der Personen, die von der Eruption betroffen waren, seinen Eltern zuzuordnen.
Durch Auswertung dieser Daten fanden Forscher heraus, dass für jede Person, die zum Zeitpunkt der Eruption unter 25 Jahre alt war, der Verlust eines Hauses zu erheblichen ökonomischen Gewinnen führte.29 Im Jahr 2014 verdienten diejenigen, deren Elternhäuser zerstört worden waren, über 3000 Dollar pro Jahr mehr als diejenigen, deren Elternhäuser nicht zerstört worden waren, obwohl nicht alle von ihnen weggezogen waren. Der Effekt konzentrierte sich auf diejenigen, die zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs jung waren. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Studium absolviert hatten. Es scheint auch so zu sein, dass die Notwendigkeit wegzuziehen, die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass sie eine Arbeit fanden, in der sie gut waren, statt wie die meisten Bewohner der Westmännerinseln lediglich Fischer zu werden. Dies dürfte für einen jungen Menschen, der noch nicht Jahre investiert hatte, um Fischfang zu lernen, viel leichter gewesen sein. Dennoch mussten die Menschen zum Wegzug gezwungen werden (durch das zufällige »Geschenk« der Lava); diejenigen, die ihre Häuser behielten, blieben überwiegend Fischer, die, wie viele Generationen vor ihnen, gerade so über die Runden kamen.
Ein noch bemerkenswerteres Beispiel für diese Art von Trägheit kommt aus dem Finnland der unmittelbaren Nachkriegsjahre. Da Finnland im Krieg auf der Seite Deutschlands gekämpft hatte, musste es nach dessen Niederlage einen erheblichen Teil seines Territoriums an die Sowjetunion abtreten. Die gesamte Bevölkerung dieses Gebiets, rund 430 000 Menschen, 11 Prozent der Bevölkerung Finnlands, musste in andere Regionen des Landes umgesiedelt werden.30
Vor dem Krieg waren diese (späteren) Vertriebenen in der Regel weniger urbanisiert, und der Anteil der Personen mit regulärer Beschäftigung war geringer als im Rest der finnischen Bevölkerung, aber ansonsten gab es kaum Unterschiede zwischen ihnen. 25 Jahre später waren diese Vertriebenen trotz der Traumata, die dieser überstürzte und chaotische Aufbruch hinterlassen haben musste, wohlhabender als der Durchschnitt, hauptsächlich deshalb, weil sie mobiler, urbaner und häufiger regulär beschäftigt waren. Die Vertreibung schien ihre Vertäuung gelockert und sie abenteuerlustiger gemacht zu haben.
Die Tatsache, dass es eines Katastrophenszenarios oder eines Krieges bedarf, um Menschen dazu zu bewegen, an einen Ort mit den höchsten Löhnen umzusiedeln, zeigt, dass ökonomische Anreize allein oftmals nicht ausreichend sind, um Menschen zur Migration zu veranlassen.
Wissen sie es?
Eine Möglichkeit ist selbstverständlich, dass ärmere Menschen sich der Chancen, ihre wirtschaftliche Lage durch Wegziehen zu verbessern, einfach nicht bewusst sind. Ein interessantes Feldexperiment in Bangladesch verdeutlicht, dass dies nicht der einzige Grund ist, aus dem sie nicht abwandern.
Es gibt keine rechtliche Schranke für Wanderungsbewegungen innerhalb von Bangladesch. Aber selbst während der kargen Jahreszeit, die gemeinhin als monga (»Zeit des Hungers«) bezeichnet wird, wenn es in ländlichen Regionen kaum Gelegenheiten zum Gelderwerb gibt, ziehen nur wenige Menschen in die Städte, die im Bau- und Verkehrssektor Erwerbschancen für Geringqualifizierte bieten, oder auch in die benachbarten ländlichen Gebiete, wo sich Feldfrüchte womöglich in einer anderen Vegetationsperiode befinden. Um die Gründe zu verstehen und saisonale Migration zu fördern, entschlossen sich Forscher, in Rangpur im Norden von Bangladesch während der monga verschiedene Methoden der Migrationsförderung zu erproben.31 Einige Dorfbewohner wurden von einer lokalen Nichtregierungsorganisation (NGO) nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, entweder Informationen über die Vorteile von Migration (hauptsächlich über die Höhe der Löhne in den Städten) oder die gleichen Informationen plus 11,50 Dollar in bar oder als Kredit zu erhalten (dieser Betrag entsprach ungefähr den Kosten der Reise in die Stadt und zur Deckung des Lebensmittelbedarfs für ein paar Tage), aber nur wenn sie migrierten.
Das Angebot veranlasste rund ein Viertel (22 Prozent) aller Haushalte, die es andernfalls nicht getan hätten, eines ihrer Mitglieder loszuschicken. Den meisten derjenigen, die in die Stadt zogen, gelang es, eine Beschäftigung zu finden. Diese Migranten verdienten während ihrer Migration durchschnittlich etwa 105 Dollar, weitaus mehr, als sie verdient hätten, wenn sie zu Hause geblieben wären. Von diesem Geld schickten oder brachten sie 66 Dollar mit zu ihren Familien, die sie zurückgelassen hatten. Infolgedessen nahmen die Familien, die einen Migranten losschickten, im Schnitt erstaunliche 50 Prozent mehr Kalorien zu sich; sie waren nicht länger dem Hungertod nahe, sondern konnten sich ausreichend mit Lebensmitteln versorgen.
Aber warum brauchten die Migranten den zusätzlichen Anstoß von der NGO, um sich zu entschließen, in die Stadt aufzubrechen? Warum genügte es nicht als Anschub, dem Hungertod nahe zu sein?
In diesem Fall ist völlig klar, dass Information nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Als die NGO die andere zufällig ausgewählte Gruppe von Menschen nur mit Informationen über die Verfügbarkeit von Stellen (ohne monetären Anreiz) versorgte, hatte diese Unterrichtung allein keinerlei Effekt. Zudem kehrten von den Leuten, die die finanzielle Unterstützung (und die Information) erhielten und die daraufhin die Reise machten, nur etwa die Hälfte in der nächsten monga-Saison zurück, obwohl sie eine Stelle gefunden und Geld verdient hatten. Zumindest bei diesen Personen konnten es nicht Zweifel an den Beschäftigungsmöglichkeiten sein, die sie zurückhielten.
Anders gesagt: Ungeachtet der Tatsache, dass diejenigen, die gezwungenermaßen oder aus anderen Motiven migrieren, wirtschaftlich besser dastehen, ist die Annahme, die meisten Menschen würden nur auf eine Gelegenheit warten, um alles aufzugeben und sich auf den Weg in ein reicheres Land zu machen, kaum haltbar. In Anbetracht der Größe der ökonomischen Anreize gibt es viel weniger Migranten, als man erwarten würde. Etwas anderes muss sie zurückhalten – wir werden später auf dieses Rätsel zurückkommen. Zuvor wollen wir uns die Funktionsweise des Arbeitsmarkts für Migranten ansehen und uns insbesondere der Frage zuwenden, ob das, was die Migranten gewinnen, auf Kosten der Einheimischen geht, wie es offenbar viele glauben.
Alle Boote flottmachen?
Diese Frage ist Gegenstand einer lebhaften Debatte unter Wirtschaftswissenschaftlern, aber insgesamt spricht viel dafür, dass selbst große Zuwanderungsschübe nur einen sehr geringen negativen Effekt auf die Löhne oder die Beschäftigungschancen der Erwerbspersonen in der aufnehmenden Gesellschaft haben.
Die Debatte geht vor allem deshalb weiter, weil man es normalerweise nicht leicht herausfinden kann. Länder begrenzen Zuwanderung, und ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Migranten sinkt insbesondere bei einer schlechten Wirtschaftslage. Migranten stimmen auch mit ihren Füßen ab, und sie neigen verständlicherweise dazu, dorthin zu gehen, wo sich ihnen bessere Möglichkeiten bieten. Bei einer Verknüpfung dieser beiden Gründe erhielte man, wenn man die Beziehung zwischen den Löhnen von Nichtmigranten und dem Anteil von Migranten an der Bevölkerung von Städten in einem Diagramm darstellen würde, eine hübsche ansteigende Gerade, das heißt, je mehr Migranten eine Stadt beherbergt, umso höher die Löhne. Das ist eine gute Neuigkeit für die Zuwanderungsbefürworter, aber vielleicht ist es auch ein ganz und gar trügerischer Zusammenhang.
Um die tatsächlichen Auswirkungen von Zuwanderung auf die Löhne von Einheimischen zu ermitteln, müssen wir uns Veränderungen der Migration ansehen, die keine direkte Reaktion auf die Löhne in dieser Stadt sind. Und selbst das mag noch nicht ausreichen, weil die Privatpersonen und die Unternehmen, die sich gegenwärtig in der Stadt befinden, ebenfalls mit ihren Füßen abstimmen. So könnte es zum Beispiel sein, dass der Zuzug von Migranten so viele einheimische Arbeitskräfte aus der Stadt treibt, dass die Löhne für die Zurückbleibenden nicht sinken. Wenn wir uns nur die Löhne jener Einheimischen ansehen würden, die in den Städten blieben, in denen sich Migranten ansiedelten, würden wir die Nöte derjenigen, die sich zum Wegzug entschlossen, gänzlich außer Betracht lassen. Es ist auch möglich, dass die neue Zuwandererpopulation Firmen in eine Stadt lockt, und zwar zulasten anderer Städte, und wir könnten die Kosten für die Arbeitnehmer in diesen anderen Städten übersehen.
David Card hat in seiner Studie über die Mariel-Bootskrise einige dieser Probleme geschickt zu umgehen versucht.32 Zwischen April und September 1980 trafen 125 000 Kubaner, die überwiegend ein niedriges bis sehr niedriges Bildungsniveau hatten, in Miami ein, nachdem Fidel Castro unerwartet eine Rede gehalten hatte, in der er ankündigte, sie dürften die Insel verlassen, wenn sie dies wünschten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Castro hielt die Rede am 20. April, und schon Ende April machten sich die ersten ausreisewilligen Kubaner auf den Weg. Viele der Bootsflüchtlinge ließen sich dauerhaft in Miami nieder. Die Zahl der Erwerbspersonen in Miami stieg um 7 Prozent.
Was geschah nun mit den Löhnen? Um dies herauszufinden, wandte Card den Differenz-von-Differenzen-Ansatz an, wie er später genannt wurde. Er verglich die Lohnentwicklung und die Arbeitslosigkeit von Personen, die bereits länger in Miami ansässig waren, vor und nach dem Eintreffen der Migranten mit den entsprechenden Kurven für die Einwohner in vier »ähnlichen« Städten in den Vereinigten Staaten (Atlanta, Houston, Los Angeles und Tampa). Auf diese Weise wollte er herausfinden, ob die Lohnzuwächse und die Zunahme der Beschäftigung unter den Personen, die beim Eintreffen der Marielitos bereits in Miami ansässig waren, niedriger waren als die Lohn- und Beschäftigungszuwächse vergleichbarer Personengruppen in diesen anderen vier Städten.
Card stellte keinen Unterschied fest, weder unmittelbar nach dem Eintreffen der Zuwanderer noch einige Jahre später; die Ankunft der Marielitos wirkte sich nicht negativ auf die Löhne der Einheimischen aus. Dies galt auch, als er sich spezifisch die Löhne kubanischer Einwanderer ansah, die vor der Bootskrise in die USA übergesiedelt waren und die vermutlich die größten Übereinstimmungen mit der neuen Welle kubanischer Einwanderer aufwiesen und daher durch den Zuzug neuer Immigranten am ehesten Nachteile erleiden würden.
Diese Studie war ein wichtiger Schritt, um eine belastbare Antwort auf die Frage nach den Auswirkungen von Migration zu erhalten: Miami wurde nicht wegen seiner Beschäftigungsmöglichkeiten ausgewählt; es war einfach der von Kuba aus gesehen nächstgelegene Ort für eine Überfahrt in die USA. Die Bootskrise kam unerwartet, sodass Arbeitskräfte und Unternehmen nicht die Möglichkeit hatten, darauf zu reagieren, zumindest nicht auf kurze Sicht (Arbeitskräfte durch Abwanderung, Unternehmen durch Zuzug). Cards Studie war sehr einflussreich, sowohl wegen ihrer Methode als auch wegen ihrer Schlussfolgerungen. Er wies als Erster nach, dass das Modell von Angebot und Nachfrage möglicherweise nicht eins zu eins auf Immigration anwendbar ist.
Zweifellos aufgrund dessen wurde die Studie auch intensiv diskutiert, wobei zahlreiche Gegenargumente vorgebracht wurden, die ihrerseits Entgegnungen hervorriefen. Vielleicht hat keine andere empirische wirtschaftswissenschaftliche Studie für so heftige Diskussionen gesorgt und die Gemüter dermaßen erhitzt. Ein langjähriger Kritiker der Studie über die Mariel-Bootskrise ist George Borjas, ein lautstarker Befürworter einer Politik der Abschottung gegen geringqualifizierte Migranten. Borjas hat das Mariel-Ereignis erneut analysiert, dabei eine größere Anzahl von Vergleichsstädten einbezogen und sich spezifisch auf die nicht hispanoamerikanischen männlichen Highschool-Abbrecher konzentriert, mit dem Argument, sie seien die Gruppe, um die wir uns am meisten Sorgen machen sollten.33 In dieser Stichprobe stellte er fest, dass die Löhne nach dem Eintreffen der Bootsflüchtlinge steil zu sinken begannen, was in den Vergleichsstädten nicht der Fall war. Aber eine anschließende abermalige Analyse zeigte, dass diese neuen Ergebnisse wiederum auf den Kopf gestellt werden, wenn Daten über hispanoamerikanische Highschool-Abbrecher (die eigentlich die naheliegendste Vergleichsgruppe für kubanische Migranten wären, aber aus irgendeinem Grund von Borjas nicht berücksichtigt werden) und Frauen (die Borjas ebenfalls ohne nachvollziehbaren Grund ausklammert) einbezogen werden.34 Weitere Studien haben beim Vergleich von Miami mit einer anderen Gruppe von Städten, in denen die Trends bei Löhnen und Beschäftigung ganz ähnlich waren wie in Miami vor dem Eintreffen der Mariel-Bootsflüchtlinge, ebenfalls keine Lohn- oder Beschäftigungseffekte festgestellt.35 Borjas ist jedoch noch immer nicht überzeugt, und die Debatte über die Mariel-Bootskrise geht weiter.36
Wenn Sie aus all dem nicht recht klug werden, sind Sie nicht allein. Um es ganz unverblümt zu sagen: Es ist nicht hilfreich, dass Wissenschaftler mit gegensätzlichen Ansichten stets auf ihren Standpunkten beharren und dass die Meinungen sich anscheinend mit ihren jeweiligen politischen Anschauungen decken. So oder so ist es unvernünftig, die Zukunft der Migrationspolitik von einem Ereignis abhängig zu machen, das sich vor dreißig Jahren in einer Stadt ereignete.
Glücklicherweise versuchte unter dem Eindruck von Cards Studie eine Reihe anderer Wissenschaftler, ähnliche Ereignisse zu identifizieren, bei denen Migranten oder Flüchtlinge praktisch ohne Vorwarnung in einem Land eintrafen und keine Kontrolle über das Zielland ihrer Auswanderung hatten. Es gibt eine Studie, die die Rückführung von Algeriern europäischer Abstammung nach der Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich im Jahr 1962 untersuchte.37 Eine andere Studie betrachtete die massive Einwanderung aus der Sowjetunion nach Israel, nachdem die Sowjetunion 1999 die Auswanderungsbeschränkungen aufhob; diese erhöhte die Einwohnerzahl Israels im Zeitraum von nur vier Jahren um 12 Prozent.38 Eine weitere Studie untersuchte die Auswirkungen des massiven Zuzugs europäischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten im Zeitalter der großen Migration (1910–1930).39 In all diesen Fällen stellten die Forscher nur sehr geringe negative Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung fest. Tatsächlich waren die Folgen manchmal positiv. So haben zum Beispiel europäische Einwanderer in den Vereinigten Staaten die Gesamtbeschäftigung in der einheimischen Bevölkerung ansteigen lassen, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Einheimische Vorarbeiter oder Abteilungsleiter werden, und die industrielle Produktion gesteigert.
Es gibt auch Erkenntnisse über die Folgen des Zuzugs von Flüchtlingen aus der ganzen Welt für die einheimische Bevölkerung in Westeuropa aus jüngerer Vergangenheit. Eine besonders interessante Studie betrachtet die Situation in Dänemark.40 Dänemark ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Land; so führen die Behörden detaillierte Aufzeichnungen über jeden Einwohner Dänemarks. Früher wurden Flüchtlinge ohne Rücksicht auf ihre Präferenzen oder ihre Fähigkeit, Arbeit zu finden, auf verschiedene Städte aufgeteilt. Entscheidend war allein die Verfügbarkeit von Sozialwohnungen und die Fähigkeit der Behörden, ihnen bei der Eingewöhnung zu helfen. Zwischen 1994 und 1998 kam es zu einem Einwanderungszustrom aus so unterschiedlichen Ländern wie Bosnien, Afghanistan, Somalia, Irak, Iran, Vietnam, Sri Lanka und Libanon, und die Einwanderer waren schließlich mehr oder minder zufällig über ganz Dänemark verstreut. Als die administrative Wohnsitzzuweisung im Jahr 1998 abgeschafft wurde, zogen die meisten Migranten dorthin, wo sich bereits andere Mitglieder ihrer ethnischen Gemeinschaft aufhielten. Daher siedelten sich zum Beispiel neuankommende irakische Migranten vornehmlich dort an, wo die erste Gruppe irakischer Einwanderer mehr oder minder zufällig gelandet war. Folglich erhielten einige Orte in Dänemark schließlich viel mehr Migranten als andere, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass sie zwischen 1994 und 1998 freie Ansiedlungskapazitäten gehabt hatten.
Diese Studie kam zu dem gleichen Ergebnis wie die älteren Studien. Der Vergleich der Entwicklung von Löhnen und Beschäftigung von geringqualifizierten Einheimischen in Städten, die diesem zufälligen Zuzug von Migranten ausgesetzt waren, mit derjenigen in anderen Städten erbrachte keine Belege für negative Auswirkungen.
Jede dieser Studien deutet darauf hin, dass geringqualifizierte Zuwanderer im Allgemeinen die Löhne und das Beschäftigungsniveau der Einheimischen nicht negativ beeinflussen. Aber der rhetorische Eifer in der gegenwärtigen politischen Debatte, unabhängig davon, ob er von den Fakten gestützt wird, erschwert es, über die politischen Grabenkämpfe hinauszublicken und die Menschen zu sehen, um die es in dieser Debatte geht. Wo ist dann eine ruhige, besonnene Stimme zu finden? Leser, die sich für die feinsinnige Kunst der Konsensbildung in den Wirtschaftswissenschaften interessieren, sollten sich vielleicht Seite 267 des (kostenlosen) Berichts über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einwanderung zu Gemüte führen, der von der US National Academy of Science herausgegeben wurde, der renommiertesten Wissenschaftsorganisation in den USA.41 Von Zeit zu Zeit beruft die National Academy Expertengremien ein, damit sie den wissenschaftlichen Konsens zu einem Thema zusammenfassen. Dem Expertengremium für den Einwanderungsbericht gehörten einige Zuwanderungsbefürworter und einige Zuwanderungsskeptiker an (darunter auch George Borjas). Die Experten mussten sicherstellen, dass sie das Gute, das Schlechte und das Unangenehme berücksichtigten, und ihre verschachtelten Sätze holen oftmals sehr weit aus, aber ihre Schlussfolgerung ist so unmissverständlich, wie man es von einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern überhaupt nur erwarten kann:
»Empirische Forschungen in den letzten Jahrzehnten deuten darauf hin, dass die Ergebnisse weiterhin im Großen und Ganzen mit denjenigen im New Americans National Research Council (1997) übereinstimmen; demnach sind die Auswirkungen der Immigration auf die Löhne von Einheimischen, über einen Zeitraum von über 10 Jahren gemessen, insgesamt sehr gering.«
Was ist an Einwanderern so besonders?
Warum gilt die klassische Theorie von Angebot und Nachfrage (je größer das Angebot an einem Gut, umso geringer dessen Preis) nicht für die Zuwanderung? Es ist wichtig, dieser Frage auf den Grund zu gehen, denn selbst wenn es eindeutig zutrifft, dass die Löhne von Geringqualifizierten durch Zuwanderung nicht gedrückt werden, werden wir uns immer fragen, ob vielleicht besondere Umstände vorlagen oder die Daten womöglich nicht repräsentativ sind, wenn wir die Ursache dafür nicht kennen.
Es zeigte sich, dass eine Reihe von Faktoren relevant sind, die das einfache Modell von Angebot und Nachfrage unter den Teppich kehrt. Erstens verschiebt der Zuzug einer neuen Gruppe von Arbeitskräften die Nachfragekurve in der Regel nach rechts, was dazu beiträgt, den Effekt der Abwärtsneigung wettzumachen. Die Neuankömmlinge geben Geld aus: Sie gehen in Restaurants, sie gehen zum Friseur, sie gehen einkaufen. Dies schafft Arbeitsplätze, größtenteils solche für andere Geringqualifizierte. Wie in Abbildung 2.2 dargestellt, erhöht dies tendenziell ihre Löhne und kompensiert unter Umständen die Verschiebung des Arbeitskräfteangebots.
Abbildung 2.2: Korrigierte »Servietten-Ökonomie«. Warum mehr Migranten nicht immer zu niedrigeren Löhnen führen
Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Migration bei Schließung des Nachfragekanals tatsächlich den »erwarteten« negativen Effekt auf Einheimische hat. Für eine kurze Zeit wurde tschechischen Arbeitskräften erlaubt, jenseits der Grenze, in Deutschland, zu arbeiten. Auf dem Höhepunkt waren bis zu 10 Prozent der Erwerbstätigen in den deutschen Grenzgemeinden Pendler aus der Tschechischen Republik. Die Löhne der Einheimischen änderten sich kaum, als dies geschah, aber die Beschäftigungsquote der Einheimischen ging stark zurück, weil im Unterschied zu allen anderen Fallbeispielen, die wir oben diskutiert haben, die Tschechen ihren Verdienst in ihrer Heimat ausgaben. Aus diesem Grund sind die Folgewirkungen auf die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland nicht eingetreten. Die Migranten kurbeln das Wachstum in ihren neuen Gemeinden wohl nur dann an, wenn sie ihren Verdienst auch dort ausgeben; wenn sie das Geld mit zurück in ihre Heimat nehmen, gehen die wirtschaftlichen Vorteile der Migration für die aufnehmende Gesellschaft verloren.42 Dann befinden wir uns wieder in der Situation in Abbildung 2.1, wo wir uns auf einer abwärts geneigten Arbeitskräftenachfragekurve bewegen, ohne dass es zu einer kompensierenden Verschiebung der Arbeitskräftenachfrage kommt.
Ein zweiter Grund, warum die Migration von Geringqualifizierten womöglich die Arbeitskräftenachfrage in die Höhe treibt, besteht darin, dass sie den Prozess der Mechanisierung verlangsamt. Die Aussicht auf ein verlässliches Angebot an Niedriglohnempfängern macht es weniger attraktiv, arbeitssparende Technologien einzuführen. Im Dezember 1964 wurden mexikanische landwirtschaftliche Tagelöhner, die braceros, aus Kalifornien ausgewiesen, eben mit der Begründung, sie würden die Löhne einheimischer Kalifornier drücken. Aber ihre Ausweisung hat den Einheimischen in keiner Weise geholfen: Löhne und Beschäftigung stiegen nicht.43 Dies ist darauf zurückzuführen, dass unmittelbar nach der Ausweisung der braceros