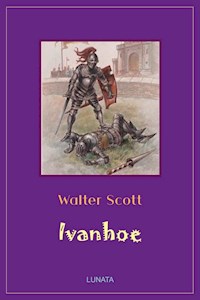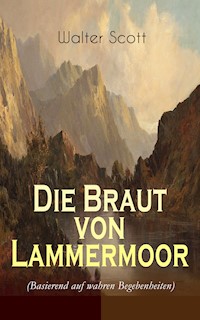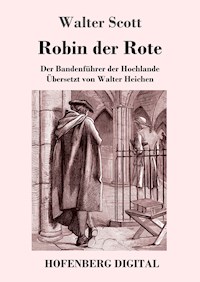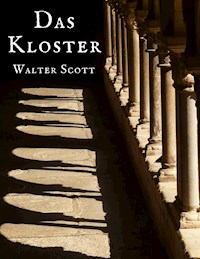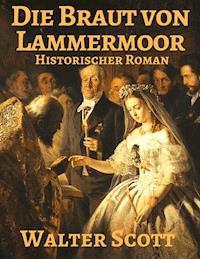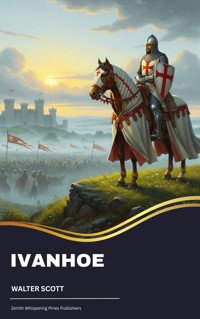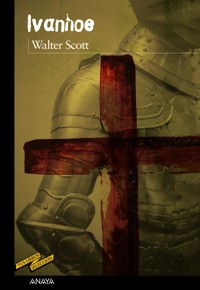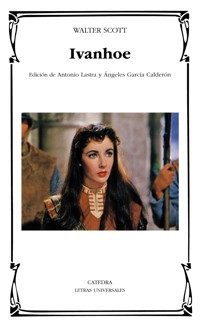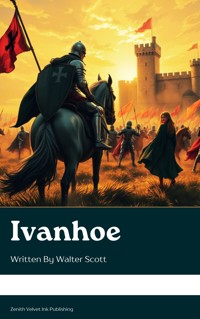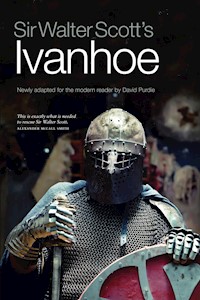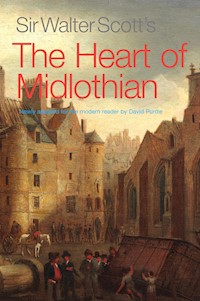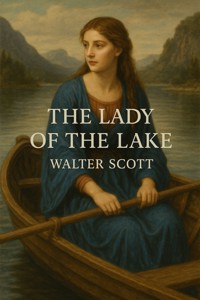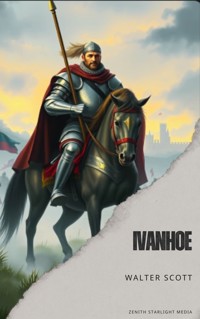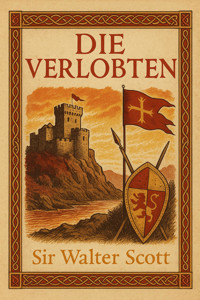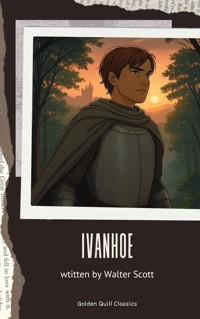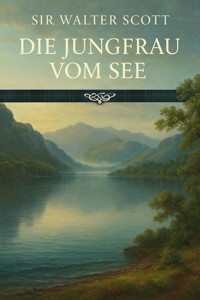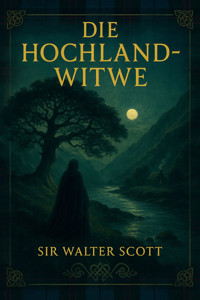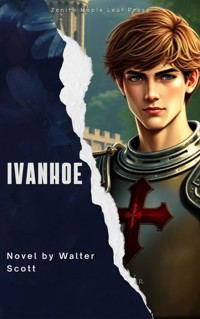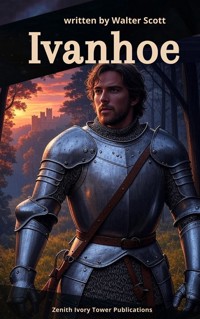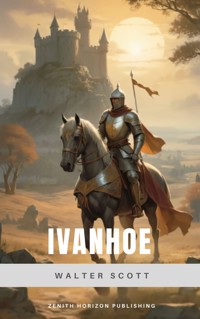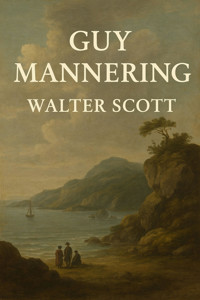
SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Guy Mannering ist ein Roman aus der Feder des Begründers des Historischen Romans Sir Walter Sott. Er spielt im Grenzland zwischen Schottland und England. Der Roman soll in nur sechs Wochen geschrieben worden sein. Hauptfigur ist der Edelmann und Soldat Guy Mannering, der als junger Mann bei der Geburt eines Jungen eine Weissagung anhand des Sternenhimmels machte. Wie sich sein und das Schicksal der anderen Figuren verknüpfen, wird in der unnachahmlichen Art und Weise von Scott geschildert. Übersetzt und herausgegeben von Michael Pick
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Guy Mannering
Sir Walter Scott
Impressum © 2025 Michael Pick
Alle Rechte vorbehaltenDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898 [email protected]
Guy Mannering
Sir Walter Scott
Übersetzung Michael Pick
Einleitung
Der Roman – oder sagen wir die Romanze – Waverley fand zunächst nur zögerlich Leser, gewann dann jedoch so rasch an Beliebtheit, dass der Autor sich zu einem zweiten Versuch ermutigt sah. Er suchte nach Titel und Stoff. Nichts veranschaulicht die Entstehungsweise dieser Romane besser als jene schlichte Erzählung, auf der Guy Mannering ursprünglich beruhte; allerdings verlor das Werk im Fortgang der Arbeit jede, auch nur entfernteste, Ähnlichkeit mit ihr. Die Geschichte wurde mir ursprünglich von einem alten Diener meines Vaters erzählt, einem vortrefflichen alten Highlander, makellos in jeder Hinsicht – es sei denn, man rechne es ihm als Fehler an, dass er Bergtau den milderen Spirituosen vorzog. Er glaubte an diese Geschichte ebenso fest wie an jeden Artikel seines Glaubens.
Nach dem Bericht des alten John MacKinlay geriet eine ernste und ältere Person auf einer Reise durch die wilderen Teile von Galloway in die Nacht. Mit Mühe erreichte er einen Landsitz, wo man ihn den Sitten von Land und Zeit gemäß bereitwillig aufnahm. Der Besitzer des Hauses, ein wohlhabender Herr, war von der ehrwürdigen Erscheinung seines Gastes sehr beeindruckt und entschuldigte sich bei ihm für eine gewisse Unordnung, die bei seinem Empfang unvermeidlich war. Die Dame des Hauses, so erklärte er, liege in ihren Gemächern und werde ihren Mann nach zehn Jahren Ehe zum ersten Mal zum Vater machen. In einem solchen Notfall, meinte der Laird, fürchte er, den Gast notgedrungen vernachlässigen zu müssen.
„Das betrifft mich nicht, Sir“, sagte der Fremde; „mein Bedarf ist gering und leicht zu befriedigen. Ich hoffe vielmehr, dass gerade die gegenwärtigen Umstände mir Gelegenheit geben, meine Dankbarkeit für Ihre Gastfreundschaft zu zeigen. Gestatten Sie mir nur, den genauen Zeitpunkt der Geburt zu erfahren; und ich hoffe, Ihnen einige Einzelheiten mitteilen zu können, die die Zukunftsaussichten des Kindes, das jetzt in diese geschäftige und wechselhafte Welt tritt, in entscheidender Weise beeinflussen können. Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich geübt darin bin, die Bewegungen jener Planetenkörper zu beobachten und zu deuten, die ihren Einfluss auf das Schicksal der Sterblichen ausüben. Es ist eine Wissenschaft, die ich, anders als manch selbsternannter Astrologe, nicht gegen Bezahlung betreibe. Ich verfüge über einen hinreichenden Nachlass und nutze das Wissen, das ich besitze, nur zum Nutzen derer, an denen ich Anteil nehme.“ Der Laird verneigte sich respektvoll und dankbar, und der Fremde wurde in einer Wohnung untergebracht, die einen weiten Blick über die Umgebung bot.
Der Gast verbrachte einen Teil der Nacht damit, die Position der Himmelskörper festzustellen und ihren wahrscheinlichen Einfluss zu berechnen. Schließlich bewog ihn das Ergebnis seiner Beobachtungen, den Vater rufen zu lassen und ihn auf das Feierlichste zu beschwören, die Gehilfen zu veranlassen, die Geburt, wenn möglich, um nur fünf Minuten zu verzögern. Das erwies sich als unmöglich; fast im selben Augenblick, als die Nachricht zurückkam, erfuhren der Vater und sein Gast von der Geburt eines Jungen.
Am nächsten Morgen begegnete der Astrologe der Gruppe, die sich um den Frühstückstisch versammelt hatte, mit einem Blick, der so ernst und bedrohlich war, dass er die Befürchtungen des Vaters weckte, der sich bisher über die Aussicht gefreut hatte, endlich einen Erben seines alten Besitzes zu haben, der andernfalls an einen entfernten Familienzweig gefallen wäre. Eilends zog er den Fremden in ein Privatzimmer.
„Ich fürchte, eurem Anblick nach“, sagte der Vater, „dass ihr mir schlechte Nachrichten über meinen jungen Fremden habt; vielleicht wird Gott den Segen, den er verliehen hat, wieder zurücknehmen, bevor er das Alter des Mannes erreicht, oder ist er etwa dazu bestimmt, der Zuneigung unwürdig zu werden, die wir von Natur aus unseren Nachkommen entgegenbringen?“
„Weder das eine noch das andere“, antwortete der Fremde; „wenn mein Urteilsvermögen nicht gänzlich fehlgeht, wird das Kind die Jahre der Minderjährigkeit überleben und in seinem Temperament und seiner Veranlagung alles zeigen, was seine Eltern sich nur wünschen können. Doch da in seinem Horoskop viel Gutes versprochen wird, steht ein stark vorherrschender böser Einfluss darin, der ihn mit einer unheiligen und unglücklichen Versuchung bedroht, wenn er das Alter von einundzwanzig Jahren erreicht. In welcher Form oder mit welcher besonderen Dringlichkeit diese Versuchung ihn bedrängen könnte, vermag meine Kunst nicht zu bestimmen.“
„Dein Wissen kann uns also keinen Schutz bieten“, sagte der besorgte Vater, „gegen das drohende Übel?“
„Verzeihung“, antwortete der Fremde, „der Einfluss der Sternbilder ist mächtig; doch der, der die Himmel erschaffen hat, ist mächtiger als alles andere, wenn man seine Hilfe aufrichtig und wahrhaftig anruft. Weihen Sie diesen Jungen dem unmittelbaren Dienst seines Schöpfers, mit derselben Aufrichtigkeit, mit der Samuel von seinen Eltern der Anbetung im Tempel geweiht wurde. Betrachten Sie ihn als ein vom Rest der Welt getrenntes Wesen. In der Kindheit, ja im Knabenalter müssen Sie ihn mit Frommen und Tugendhaften umgeben und ihn nach Kräften davor bewahren, irgendeine Verfehlung zu sehen oder zu hören, sei es in Wort oder Tat. Er ist in strengsten religiösen und moralischen Grundsätzen zu erziehen. Er soll die Welt nicht betreten, damit er nicht lernt, an ihren Torheiten oder vielleicht an ihren Lastern teilzuhaben. Kurz, bewahren Sie ihn so weit wie möglich vor aller Sünde, mit Ausnahme derjenigen, von der ein zu großer Teil dem gesamten gefallenen Geschlecht Adams zusteht. Mit dem Herannahen seines einundzwanzigsten Geburtstages beginnt die Krise seines Schicksals. Übersteht er sie, wird er auf Erden glücklich und wohlhabend sein und ein auserwähltes Gefäß unter denen, die für den Himmel ausgewählt sind. Sollte es anders kommen …“ Der Astrologe hielt inne und seufzte tief.
„Sir“, antwortete der Vater, nun beunruhigter denn je, „eure Worte sind so freundlich, euer Rat so ernst, dass ich euren Anweisungen die größte Aufmerksamkeit schenken werde; doch könnt ihr mir in dieser wichtigsten Angelegenheit nicht weiter beistehen? Glaubt mir, ich werde nicht undankbar sein.“
„Ich verlange und begehre keine Dankbarkeit dafür, dass ich eine gute Tat vollbracht habe“, sagte der Fremde, „zumal ich alles in meiner Macht Stehende dazu tue, das harmlose Kind, das letzte Nacht unter einer außergewöhnlichen Planetenkonjunktion geboren wurde, vor einem verabscheuungswürdigen Schicksal zu retten. Hier ist meine Anschrift; ihr könnt mir von Zeit zu Zeit über den Fortschritt des Jungen im religiösen Wissen schreiben. Wenn er so erzogen wird, wie ich es empfehle, ist es meiner Meinung nach das Beste, ihn zu mir nach Hause zu senden, wenn die verhängnisvolle und entscheidende Zeit naht, das heißt, kurz bevor er sein einundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat. Wenn ihr ihn schickt, wie erbeten, vertraue ich demütig darauf, dass Gott die Seinen vor allen starken Versuchungen schützen wird, denen sein Schicksal ihn aussetzen mag.“ Dann gab er seinem Gastgeber seine Adresse, einen Landsitz nahe einer Poststadt im Süden Englands, und verabschiedete sich herzlich.
Der geheimnisvolle Fremde ging, aber seine Worte blieben im Gedächtnis des besorgten Elternteils haften. Er verlor seine Frau, als sein Junge noch im Säuglingsalter war. Ich bin überzeugt, dass dieses Unglück vom Astrologen vorausgesagt worden war; und so wurde sein Vertrauen, das er, wie die meisten Menschen seiner Zeit, der Sternkunde aus freien Stücken geschenkt hatte, nur noch gefestigt und bestätigt. Daher wurde größte Sorgfalt darauf verwendet, den strengen und fast asketischen Bildungsplan, den der Weise angeordnet hatte, wirklich in die Tat umzusetzen. Für die Aufsicht über die Erziehung der Jugend wurde ein Erzieher mit den strengsten Grundsätzen eingesetzt. Er war von Dienern der verlässlichsten Art umgeben und wurde vom besorgten Vater selbst genau beobachtet und betreut.
Die Jahre des Säuglings-, Kindes- und Knabenalters verliefen so, wie der Vater es sich gewünscht hätte. Ein junger Nazarener hätte nicht strenger erzogen werden können. Alles Böse wurde seiner Beobachtung vorenthalten: Er hörte nur, was in der Lehre rein war, er sah nur, was in der Praxis vorbildlich war.
Doch als der Junge sich in seiner Jugend zu verirren begann, sah der aufmerksame Vater Anlass zur Beunruhigung. Anflüge von Traurigkeit, die nach und nach einen dunkleren Charakter annahmen, begannen die Stimmung des jungen Mannes zu trüben. Unwillkürliche Tränen, gestörter Schlaf, nächtliche Mondscheinwanderungen und eine Melancholie, für die er keinen Grund finden konnte, schienen gleichzeitig seine körperliche Gesundheit und die Stabilität seines Geistes zu bedrohen. Der Astrologe wurde brieflich um Rat gebeten und antwortete, dieser unruhige Geisteszustand sei nur der Beginn seiner Prüfung, und der arme Jugendliche werde immer verzweifeltere Kämpfe mit dem Bösen, das ihn heimgesucht habe, durchmachen müssen. Es gab keine andere Hoffnung auf Abhilfe, als dass er beim Studium der Schriften einen festen Geisteszustand bewahre. „Er leidet“, fuhr der Weise in seinem Brief fort, „unter dem Erwachen der Leidenschaften, dieser Harpyien, die mit ihm wie mit anderen schlummerten, bis zu dem Lebensabschnitt, den er jetzt erreicht hat. Besser, viel besser, dass sie ihn mit undankbaren Gelüsten quälen, als dass er bereuen muss, sie durch kriminelle Nachsicht befriedigt zu haben.“
Die Gemütsverfassung des jungen Mannes war so vorzüglich, dass er mit Vernunft und Religion gegen die Anfälle von Trübsinn ankämpfen konnte, die zeitweilig sein Gemüt überwältigten. Erst zu Beginn seines einundzwanzigsten Lebensjahres nahmen sie einen Charakter an, der ihm ernstlich zu schaffen und seinen Vater vor den Konsequenzen zittern ließ. Es schien, als würde die düsterste und abscheulichste aller Geisteskrankheiten die Form religiöser Verzweiflung annehmen wollen. Dennoch war der Jüngling sanft, höflich, liebevoll und dem Willen seines Vaters gehorsam, und widerstand mit aller Kraft den dunklen Eingebungen, die ihm, wie es schien, von einer Ausstrahlung des Bösen eingeflüstert wurden.
Endlich war die Zeit gekommen, da er eine damals lange und nicht ganz ungefährliche Reise antreten musste, zum Herrenhaus des frühen Freundes, der seine Geburt berechnet hatte. Sein Weg führte durch mehrere sehenswerte Orte. Er genoss das Vergnügen des Reisens mehr, als er selbst für möglich gehalten hätte. So erreichte er seinen Zielort erst gegen Mittag des Tages vor seinem Geburtstag. Es schien, als wäre er von einer ungewohnten Welle angenehmer Gefühle mitgerissen worden, so dass er in gewissem Maße vergaß, was sein Vater ihm über den Zweck seiner Reise eingeschärft hatte. Endlich blieb er vor einem achtbaren, doch einsam gelegenen alten Herrenhaus stehen, das ihm als Wohnsitz des Freundes seines Vaters bezeichnet worden war.
Die Diener, die kamen, um sein Pferd abzuholen, meldeten, dass er seit zwei Tagen erwartet wurde. Er wurde in ein Arbeitszimmer geführt, wo der Fremde, jetzt ein ehrwürdiger alter Mann, der Gast seines Vaters gewesen war, ihn mit einem Anflug von Unmut und ernstem Stirnrunzeln empfing.
„Junger Mann“, sagte er, „warum so langsam auf einer so wichtigen Reise?“
„Ich dachte“, antwortete der Gast, errötend und den Blick gesenkt, „dass es nicht schaden könnte, langsam zu reisen und meine Neugier zu befriedigen, vorausgesetzt, ich könnte bis heute euren Wohnort erreichen; denn das war die Vorgabe meines Vaters.“
„Es war nicht recht“, antwortete der Weise, „dass ihr gezögert habt, bedenkt man, dass der Bluträcher auf euren Fußstapfen lauert. Aber ihr seid endlich gekommen, und wir hoffen auf das Beste, auch wenn der Konflikt, in den ihr verwickelt werdet, umso schrecklicher wird, je länger er hinausgezögert war. Nehmt nun zuerst solche Erfrischungen zu euch, die die Natur braucht, um euren Appetit zu stillen, nicht aber, um ihn zu verwöhnen.“
Der alte Mann ging voran in eine Sommerstube, wo ein bescheidenes Essen auf den Tisch gestellt wurde. Als sie sich an die Tafel setzten, gesellte sich eine junge Dame von etwa achtzehn Jahren zu ihnen, die so hübsch war, dass ihr Anblick die Gefühle des jungen Fremden von der Besonderheit und dem Geheimnis seines eigenen Schicksals abwenden und seine Aufmerksamkeit auf alles fesseln konnte, was sie tat oder sagte. Sie sprach wenig, und wenn, dann über die ernstesten Themen. Sie spielte auf Befehl ihres Vaters auf dem Cembalo, begleitete sich jedoch mit Hymnen. Schließlich verließ sie auf ein Zeichen des Weisen hin den Raum und schenkte dem jungen Fremden beim Abschied einen Blick unaussprechlicher Sorge und teilnehmenden Interesses.
Der alte Mann führte den Jugendlichen dann in sein Arbeitszimmer und unterhielt sich mit ihm über die wichtigsten Punkte der Religion, um sich davon zu überzeugen, dass er Rechenschaft geben konnte von der Hoffnung, die in ihm war. Während der Untersuchung merkte der Jugendliche wider Willen gelegentlich, dass seine Gedanken abschweiften und seine Erinnerungen sich auf die Suche nach der schönen Vision machten, die mittags ihr Mahl geteilt hatte. Bei solchen Gelegenheiten blickte der Astrologe ernst und schüttelte den Kopf über diese Nachlässigkeit. Dennoch war er im Großen und Ganzen mit den Antworten des Jugendlichen zufrieden.
Bei Sonnenuntergang musste der junge Mann ein Bad nehmen. Nachdem er dies getan hatte, wurde er angewiesen, sich in ein Gewand zu kleiden, das dem der Armenier ähnelte, wobei sein langes Haar auf die Schultern gekämmt und sein Hals, seine Hände und Füße nackt waren. In dieser Gestalt wurde er in einen abgelegenen Raum geführt, in dem es bis auf eine Lampe, einen Stuhl und einen Tisch, auf dem eine Bibel lag, keinerlei Möbel gab.
„Hier“, sagte der Astrologe, „ich muss euch in Ruhe lassen, damit ihr die kritischste Zeit eures Lebens besteht. Wenn ihr durch die Erinnerung an die großen Wahrheiten, von denen wir gesprochen haben, die Angriffe abwehren könnt, die auf euren Mut und eure Prinzipien zielen, habt ihr nichts zu befürchten. Aber die Prüfung wird hart und beschwerlich sein.“ Dann nahmen seine Gesichtszüge eine rührende Feierlichkeit an, die Tränen standen ihm in den Augen, und seine Stimme stockte vor Bewegung, als er sagte: „Liebes Kind, bei dessen Ankunft auf die Welt ich diese tödliche Prüfung vorausgesehen habe: Möge Gott euch die Gnade geben, sie mit Festigkeit zu bestehen!“
Der junge Mann blieb allein zurück. Kaum war es so weit, stürzten die Erinnerungen an all seine Unterlassungs- und Begehungssünden – durch die gewissenhafte Erziehung nur noch greller beleuchtet – wie ein Schwarm Dämonen in sein Bewusstsein und fuhren, gleich Furien, bewaffnet mit feurigen Geißeln, auf ihn los; als seien sie entschlossen, ihn in Verzweiflung zu treiben. Während er diese Schreckbilder mit zerstreutem Gemüt, doch festem Verstand zurückdrängte, merkte er, dass seine Einwände von der Sophistik eines Anderen gekontert wurden – der Kampf spielte sich nicht länger nur in seinem eigenen Kopf ab. Der Urheber des Bösen stand leibhaftig im Raum, verstärkt von melancholischen Geistern; er legte die Hoffnungslosigkeit seines Zustands dar und drängte ihn, durch Selbstmord seiner sündigen Laufbahn ein Ende zu setzen. Er sah sich der Anklage ausgesetzt, seine Reise mutwillig verlängert und der Schönheit der jungen Frau zu viel Beachtung geschenkt zu haben, statt seine Gedanken den religiösen Reden ihres Vaters zu widmen. Er wurde als einer behandelt, der wider besseres Licht gesündigt habe und daher mit Recht dem Fürsten der Finsternis zur Beute zufalle.
Je weiter die verhängnisvolle Stunde fortschritt, desto verworrener wurden die Schrecken der hassvollen Gegenwart für seine sterblichen Sinne. Der Knoten jener verfluchten Sophistik zog sich immer fester zu, wenigstens für die Beute, die in seinen Schlingen zappelte. Ihm fehlte die Kraft, die ihm verheißene Begnadigung zu erklären oder den siegreichen Namen auszusprechen, auf den er vertraute. Doch sein Glaube verließ ihn nicht, auch wenn ihm zeitweilig die Worte fehlten. „Sagt, was ihr wollt“, entgegnete er dem Versucher; „ich weiß, dass zwischen diesen beiden Deckeln dieses Buches so viel niedergelegt ist, das mir Vergebung für meine Übertretungen und Sicherheit für meine Seele zusichert.“ Während er sprach, schlug die Uhr und kündigte das Ende der verhängnisvollen Stunde an. Augenblicklich kehrten Sprach- und Geisteskräfte vollständig zurück. Er begann zu beten und bekannte in den glühendsten Worten sein Vertrauen in die Wahrheit und in den Urheber des Evangeliums. Der Dämon wich, schreiend und beschämt; und der alte Mann, der eintrat, gratulierte ihm unter Tränen zu seinem Sieg in diesem entscheidenden Kampf.
Später heiratete der junge Mann die schöne Jungfrau, deren erster Anblick ihn so ergriffen hatte, und am Ende der Erzählung werden beide dem häuslichen Glück überlassen. So schließt die Legende John MacKinlays.
Der Verfasser von Waverley hatte erwogen, aus den Begebenheiten im Leben eines zum Scheitern verurteilten Mannes – dessen Bemühungen um Tugend durch finstere Eingriffe auf ewig vereitelt würden – eine interessante, vielleicht sogar anmutige Geschichte zu formen. Der Sieg sollte einem bösartigen Wesen zufallen, das aus dem schrecklichen Kampf als Überwinder hervorginge. Kurz, es entstand ein Plan, der der phantastischen Geschichte von Sintram und seine Gefährten des Barons de la Motte Fouqué ähnelte, obgleich der Autor sie, sofern sie damals schon existierte, nicht gekannt haben will.
Dieses Schema lässt sich in den ersten drei oder vier Kapiteln noch verfolgen; weitere Erwägungen bewogen den Autor jedoch, das Vorhaben fallenzulassen. Bei reiflicher Überlegung schien ihm, dass die Astrologie – obgleich ihr Einfluss einst von Bacon selbst anerkannt wurde – auf die heutige allgemeine Vorstellungswelt nicht mehr stark genug wirkt, um als Triebfeder einer Romanze zu taugen. Zudem zeigte sich, dass eine gerechte Behandlung des Themas nicht nur mehr Talent verlangte, als der Autor für sich beanspruchen mochte, sondern auch Lehren und Erörterungen nötig gemacht hätte, die für seinen Zweck und den Charakter der Erzählung zu ernst gerieten. Obwohl er den Plan noch während des Drucks änderte, bewahrten die ersten Bogen Spuren des ursprünglichen Tons – Überreste, die nunmehr als unnötige, ja unnatürliche Last erscheinen. Der Grund ihres Auftretens ist hiermit erklärt und entschuldigt.
Bemerkenswert ist, dass die astrologischen Lehren zwar allgemein verachtet und durch gröberen, weit weniger anmutigen Aberglauben ersetzt wurden, in neuerer Zeit aber doch einige Anhänger gefunden haben.
Einer der auffallendsten Anhänger dieser vergessenen und verachteten Wissenschaft war ein inzwischen verstorbener, bedeutender Professor der Kunst des Taschenspiels. Man sollte meinen, ein solcher Mann, der um die tausend Arten weiß, das menschliche Auge zu täuschen, wäre weniger als andere für die Grillen des Aberglaubens empfänglich. Vielleicht aber hat die gewohnte Anwendung jener abstrusen Berechnungen, mit deren Hilfe – oft zur eigenen Verwunderung des Künstlers – zahlreiche Kunststücke mit Karten u. dgl. gelingen, ihn auf die Idee gebracht, die Konstellationen von Sternen und Planeten zu studieren – in der Erwartung, daraus prophetische Ergebnisse zu gewinnen.
Er entwarf ein Schema seiner eigenen Geburt, berechnet nach den Regeln der Kunst, die er aus den besten astrologischen Autoren zusammengetragen hatte. Die Deutung der Vergangenheit fand er, verglichen mit seinem bisherigen Lebenslauf, erfreulich; doch im Blick auf die Zukunft ergab sich eine eigentümliche Schwierigkeit: Es gab zwei Jahre, in denen er keineswegs entscheiden konnte, ob er tot oder lebendig sein würde. Beunruhigt über diesen bemerkenswerten Befund legte er das Horoskop einem Bruder der Zunft vor, der nicht minder ratlos war. Bald schien das Subjekt gewiss am Leben, bald ebenso gewiss tot; zwischen diesen beiden Fristen aber spannten sich zwei Jahre, in denen weder Sein noch Nichtsein mit Sicherheit zu ermitteln war.
Der Astrologe vermerkte den Umstand in seinem Tagebuch und setzte seine Vorstellungen in verschiedenen Teilen des Reiches fort, bis jener Zeitraum erreicht war, in dem seine Existenz als gesichert gelten sollte. Da trug es sich zu, dass er vor zahlreichem Publikum seine gewohnten Taschenspielerkünste darbot: Plötzlich versagten die Hände, die so oft den schärfsten Beobachter verblüfft hatten; die Karten glitten zu Boden, und er brach, wie gelähmt, zusammen. In diesem Zustand siechte der Künstler zwei Jahre dahin, bis ihn zuletzt der Tod ereilte. Man sagt, das Tagebuch dieses modernen Astrologen werde bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Trifft der Bericht zu, so ist er einer jener seltenen Zufälle, die zuweilen auftauchen und jeder gewöhnlichen Berechnung spotten. Ohne solche Unregelmäßigkeiten böte das menschliche Leben denen, die in die Zukunft blicken, keinen Abgrund undurchdringlicher Finsternis. Liefen die Dinge stets nach dem üblichen Gang, stünde die Zukunft unter den Regeln der Arithmetik wie die Chancen beim Spiel; doch außergewöhnliche Begebenheiten und wunderliche Glücksserien entziehen sich der Rechnung und werfen dichte Schatten auf kommende Eventualitäten.
Der vorstehenden lässt sich eine noch neuere Anekdote beifügen. Kürzlich ehrte den Verfasser ein Schreiben eines in diesen Mysterien sehr bewanderten Herrn, der sich bereitfand, die Geburt des Schriftstellers Guy Mannering zu berechnen – man sollte meinen, ein Autor, der sich zur göttlichen Kunst bekannte, wäre ihr wohlgesinnt. Doch ließ sich kein Horoskop erstellen, selbst wenn der Nativ es gewollt hätte: Alle, die Tag, Stunde und Minute hätten bezeugen können, waren längst aus der Sphäre der Sterblichen geschieden.
Nachdem der Autor so die erste Idee, die grobe Skizze der Geschichte, dargelegt hat – von der er bald abwich –, hat er bei der Ausarbeitung des Plans der vorliegenden Ausgabe die Prototypen der Hauptfiguren in »Guy Mannering« zu benennen.
Einige örtliche Umstände boten dem Autor in der Jugend Gelegenheit, diese damals so genannte erniedrigte Klasse, die »Zigeuner« genannt wurde, ein wenig zu sehen und viel von ihr zu hören. Meist schien es sich um eine Mischbevölkerung zu handeln – aus den sogenannten alten Ägyptern, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts nach Europa gelangten, und Landstreichern europäischer Herkunft.
Die einzelne Gestalt, auf der die Figur der Meg Merrilies beruht, war um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Jean Gordon bekannt, wohnhaft im Dorf Kirk Yetholm in den Cheviot Hills an der englischen Grenze. Der Autor veröffentlichte in einer der ersten Nummern von Blackwood’s Magazine einen Bericht über diese bemerkenswerte Person, mit folgendem Zweck:
Mein Vater erinnerte sich an die alte Jean Gordon von Yetholm, die in ihrem Stamm großen Einfluss besaß. Sie war eine wahre Meg Merrilies und trug die wilde Tugend der Treue zur Vollendung. Weil man sie im Bauernhaus von Lochside nahe Yetholm oft gastfreundlich aufgenommen hatte, hütete sie sich peinlich, auf des Bauern Grund zu plündern. Ihre Söhne jedoch – neun an der Zahl – zeigten nicht dieselbe Zartheit und stahlen ihrem wohlwollenden Gastgeber eine Zuchtsau. Jean schämte sich dieses Undanks so sehr, dass sie Lochside jahrelang mied.
Später zwang eine vorübergehende Geldnot den Gutsherrn von Lochside, nach Newcastle zu reisen, um Mittel zur Pachtzahlung aufzutreiben. Er erledigte sein Geschäft; doch auf dem Rückweg über die Cheviot-Berge überraschte ihn die Nacht, und er geriet vom Weg ab.
Ein Licht, das aus dem Fenster einer großen Scheune schimmerte – dem letzten Überrest des einstigen Gehöfts –, wies ihm einen Unterschlupf. Auf sein Klopfen öffnete Jean Gordon. Ihre eindrucksvolle Erscheinung – nahezu sechs Fuß groß – sowie die markanten Züge und die Tracht ließen keinen Augenblick Zweifel an ihrer Person, obschon er sie seit Jahren nicht gesehen hatte. Einer Natur wie der ihrigen an so einsamem Ort zu begegnen, wohl auch nicht fern ihrem Clan, war für den armen Mann eine bange Überraschung; zumal seine Sorge, die mühsam erlangte Summe zu verlieren – was seinem Ruin gleichgekommen wäre –, ihn ganz in Beschlag nahm.
Jean stieß einen gellenden Schrei freudigen Erkennens aus …
„He, meine Herren! der Gudeman von Lochside! Licht herunter, Licht herunter; ihr werdet die Nacht hier verbringen, und das Haus eines Freundes ist nah.“ Der Bauer stieg ab und nahm das Angebot der »Zigeunerin« an, Abendbrot und ein Bett zu bekommen. In der Scheune fand sich reichlich Fleisch – wie es dorthin gelangt war, mochte dahingestellt bleiben –, und man bereitete ein üppiges Mahl vor, offenbar für zehn oder zwölf Gäste gedacht, wie der Bauer zu seiner großen Besorgnis bemerkte.
Er fragte seine Gastgeberin nach ihrem Befinden. Jean ließ ihn darüber in keinem Zweifel. Sie erinnerte ihn an die Geschichte der gestohlenen Sau und erwähnte, wie viel Schmerz und Ärger sie ihr bereitet hatte. Wie andere Philosophen klagte sie, die Welt werde täglich schlechter; wie andere Eltern, die Kinder entfernten sich von der Leitung der Älteren und missachteten die alten Gebote ihres Volks, die bei aller Plünderei das Eigentum der Wohltäter schonten. Schließlich kam sie auf das Wesentliche: Wie viel Geld der Bauer bei sich habe; und sie bat – oder befahl – eindringlich, sie zu seiner Geldverwalterin zu machen, da ihre „Kinder“, wie sie die Söhne nannte, bald heimkehren würden. Der arme Bauer machte aus der Not eine Tugend, erzählte seine Geschichte und übergab sein Gold in Jeans Obhut. Ein paar Schillinge ließ sie ihm in der Tasche: Es würde Verdacht erregen, träfe man ihn unterwegs völlig mittellos.
Nachdem diese Vereinbarung getroffen war, streckte sich der Bauer auf ein Strohlager, wie die Schotten es nennen, – zum Schlafen freilich war ihm nicht zumute.
Gegen Mitternacht kehrte die Bande mit verschiedenen Beutestücken zurück und erzählte von ihren Heldentaten in einer Sprache, die dem Bauern das Blut in den Adern gefrieren ließ. Bald merkten sie, dass ein Gast da war, und fragten Jean, wen sie da hereingebracht habe.
„Nur der brave Gudeman von Lochside, armer Kerl“, erwiderte Jean; „er war in Newcastle, um Geld für seine Pacht aufzutreiben – ein ehrlicher Mann; beim Donner, er hat’s geschafft, und gewiss kehrt er heim mit schwerem Beutel und leichtem Herzen.“
„Mag sein, Jean“, entgegnete einer der Kerle, „aber wir wollen seinen Beutel erst reifen lassen und sehen, ob die Geschichte wahr ist oder nicht.“ Jean fuhr auf über diesen Verstoß gegen die Gastfreundschaft, vermochte jedoch ihren Entschluss nicht zu ändern. Der Bauer hörte bald gedämpftes Flüstern und leise Schritte an seinem Lager und begriff, dass sie seine Kleidung durchsuchten. Sie fanden das kleine Geld, das ihm die Vorsehung – in Gestalt der Jean Gordon – gelassen hatte, und berieten, ob sie es nehmen sollten oder nicht; doch die Kleinheit der Beute und Jeans heftige Vorwürfe entschieden dagegen. Sie zechten, legten sich zur Ruhe, und bei Tagesgrauen weckte Jean ihren Gast, holte sein Pferd hervor, das sie hinter dem »Hallan« untergebracht hatte, und führte ihn Meilen weit, bis er auf der Landstraße nach Lochside war. Dort gab sie ihm seinen ganzen Besitz zurück; auch dringliches Bitten konnte sie nicht bewegen, auch nur eine einzige Guinee anzunehmen.
Ich habe die alten Leute in Jedburgh sagen hören, dass alle Söhne der Jean am selben Tag zum Tode verurteilt wurden. Es hieß, die Geschworenen seien darüber geteilter Meinung gewesen; doch ein „Freund der Justiz“, der die ganze Beratung verschlafen hatte, fuhr plötzlich empor und gab, mit den gewichtigen Worten „Hängt sie auf!“, seine Stimme für die Verurteilung. Da eine schottische Jury keine Einstimmigkeit verlangt, erging der Schuldspruch. Jean war anwesend und sagte nur: „Der Herr helfe den Unschuldigen an einem Tag wie diesem!“
Ihr eigener Tod vollzog sich unter Umständen roher Brutalität, die die arme Jean in vielerlei Hinsicht nicht verdient hatte. Zu ihren Vorzügen – oder Verdiensten, wie der Leser will – gehörte ihre feste Gesinnung als Jakobitin. Zufällig hielt sie sich kurz nach dem Jahr 1746 an einem Messe- oder Markttag in Carlisle auf, wo sie ihrer politischen Parteilichkeit Ausdruck gab – zum großen Anstoß des dortigen Pöbels. Eifernd in der Loyalität, sobald keine Gefahr drohte, und umso mehr, je zahmer man sich 1745 den Highlandern gefügt hatte, verhängte der Mob über Jean Gordon nichts Geringeres, als sie in der Eden zu ertränken. Das währte eine Weile, denn Jean war von kräftiger Statur und konnte sich im Ringen mit ihren Mördern mehrfach über Wasser halten; und solange sie Stimme hatte, rief sie in Abständen immer wieder: „Charlie! Charlie!“ Als Kind – und in den Kreisen, in denen ich oft zugegen war – hörte ich diese Geschichten häufig und weinte mitleidsvoll um die arme Jean Gordon.
Bevor ich die »Zigeuner« an der Grenze verlasse, möchte ich erwähnen, dass mein Großvater, als er über Charterhouse Moor ritt, damals ein sehr weites Allmendland, plötzlich in eine große Gruppe von Zigeunern geriet, die in einer von Büschen umgebenen Senke des Moores ein Fest hielten. Sie packten sofort unter vielen Zurufen das Zaumzeug seines Pferdes und riefen (denn die meisten kannten ihn gut), dass sie oft auf seine Kosten gegessen hätten und er nun bleiben und ihre gute Laune teilen müsse. Mein Vorfahr war etwas beunruhigt, denn wie der gute Mann von Lochside hatte er mehr Geld bei sich, als er in einer solchen Gesellschaft riskieren wollte. Da er jedoch von Natur aus ein kühner, lebhafter Mann war, ließ er sich auf die Laune des Augenblicks ein und nahm an dem Fest teil, das aus allerlei Wild, Geflügel, Schwein u. dgl. bestand – zusammengetragen nach Art ihres wahllosen Plünderungssystems. Das Abendessen war sehr fröhlich. Doch mein Verwandter bekam von einigen der älteren Leute den Hinweis, sich gerade dann zurückzuziehen, als Heiterkeit und Spaß rasch anschwollen und wild wurden; und indem er entsprechend auf sein Pferd stieg, nahm er französischen Abschied von seinen Anfeuerern, ohne auch nur den geringsten Verstoß gegen die Gastfreundschaft zu erfahren. Ich glaube, Jean Gordon war bei diesem Fest zugegen.
Eine Enkelin überlebte sie; ich entsinne mich, sie gesehen zu haben. Wie Dr. Johnson eine schattenhafte Erinnerung an Königin Anne – eine stattliche, schwarz gekleidete Dame mit Diamanten – bewahrte, so verfolgt auch mich die feierliche Gestalt einer Frau von mehr als weiblicher Größe, in einen langen roten Mantel gehüllt, die unsere Bekanntschaft damit begann, mir einen Apfel zu schenken; und doch betrachtete ich sie mit einer Ehrfurcht, wie sie der künftige Doktor, hochkirchlich und tory, kaum inniger der Königin entgegengebracht hätte. Ich vermute, dass es sich bei dieser Frau um Madge Gordon handelte, über die in demselben Artikel, in dem auch ihre Mutter Jean erwähnt wird, ein eindrucksvoller Bericht gegeben ist, wenn auch nicht vom Verfasser selbst:
Die verstorbene Madge Gordon galt damals als Königin der Yetholm-Clans. Sie war, wie wir annehmen, eine Enkelin der berühmten Jean Gordon und soll ihr im Äußeren sehr geglichen haben. Der folgende Bericht stammt aus dem Schreiben eines Freundes, der über viele Jahre häufig und günstig Gelegenheit hatte, die Eigenarten der Yetholm-Stämme zu beobachten: „Madge Gordon stammte mütterlicherseits von den Faas ab und war mit einem Young verheiratet. Sie war eine bemerkenswerte Persönlichkeit – von imposanter Ausstrahlung und großer Statur, fast 1,80 Meter groß. Sie hatte eine große Adlernase, durchdringende Augen, selbst noch im hohen Alter, buschiges Haar, das unter einer Zigeunerhaube aus Stroh um ihre Schultern fiel, einen eigentümlichen kurzen Umhang und einen langen Stab, fast so groß wie sie selbst. Ich erinnere mich gut an sie. Wöchentlich besuchte sie meinen Vater, als ich ein kleiner Junge war, und ich blickte Madge mit mehr als gewöhnlicher Ehrfurcht und nicht geringer Bangigkeit an. Wenn sie vehement sprach (denn sie klagte lautstark), pflegte sie ihren Stab auf den Boden zu stoßen und eine Haltung einzunehmen, der man unmöglich mit Gleichgültigkeit begegnen konnte. Sie sagte gern, sie könne Freunde aus den entlegensten Teilen der Insel herbeibringen, um ihren Streit zu rächen, während sie selbst regungslos in ihrer Hütte säße. Oft prahlte sie, es habe eine Zeit gegeben, da sei sie noch bedeutender gewesen; bei ihrer Hochzeit, sagte sie, habe es fünfzig gesattelte und zahllose ungesattelte Esel gegeben. War Jean Gordon das Vorbild für den Charakter der Meg Merrilies, so muss Madge, meiner Meinung nach, dem unbekannten Autor als leibhaftiges Modell gedient haben.“
Wie weit Blackwoods genialer Korrespondent mit dieser Vermutung Recht hatte, und wie weit er irrte, mag der Leser selbst ermessen.
Um zu einer Figur ganz anderer Art überzugehen – Dominie Sampson –, könnte der Leser leicht annehmen, dass ein armer, bescheidener Gelehrter, der sich durch die Klassiker gearbeitet hat, auf der Reise des Lebens jedoch ins Lee geriet, keine Seltenheit sei in einem Land, in dem ein gewisses Maß an Gelehrsamkeit leicht denen zufällt, die bereit sind, für Griechisch und Latein Hunger und Durst zu ertragen. Doch es gibt einen weit genaueren Prototyp des würdigen Dominie, auf dem die Rolle beruht, die er in der Romanze spielt – ein Vorbild, das aus bestimmten Gründen nur allgemein angedeutet werden kann.
Ein solcher Lehrer, wie Mr. Sampson gewesen sein soll, wirkte tatsächlich als Hauslehrer in der Familie eines wohlhabenden Herrn. Die Söhne, seine Zöglinge, wuchsen heran und gingen in die Welt; der Lehrer jedoch blieb im Hause – in früheren Zeiten in Schottland nichts Ungewöhnliches, wo man bescheidenen Freunden und Verwandten gern Kost und Logis gewährte. Die Vorfahren des Gutsherrn hatten unbedacht gewirtschaftet, er selbst war passiv und vom Unglück verfolgt. Der Tod raffte seine Söhne dahin, deren Lebensglück sein eigenes Pech und seine Unfähigkeit hätte ausgleichen können. Schulden wuchsen, Mittel schwanden – bis der Ruin kam. Das Anwesen wurde verkauft. Der alte Mann stand im Begriff, das Haus seiner Väter zu verlassen. Er wusste nicht, wohin – wie ein altes Möbel, das in seiner Ecke lange hält, doch zerbricht, sobald man es fortbewegt.
Da erwachte der Lehrer wie aus einem Traum. Er sah, dass seine Gönnerin gestorben war und dass deren einzig verbliebenes Kind – eine bereits ältere Frau, weder anmutig noch schön, falls sie es je gewesen war – durch dieses Unglück zur obdachlosen, mittellosen Waise geworden war. Fast mit den Worten, die Dominie Sampson an Miss Bertram richtet, erklärte er seine Entschlossenheit, sie nicht zu verlassen. Aus dem langen Schlummer seiner Kräfte geweckt, eröffnete er eine kleine Schule und unterhielt das Kind seiner Gönnerin bis an deren Lebensende – mit derselben bescheidenen Wachsamkeit und hingebungsvollen Fürsorge, die er ihr in Tagen des Wohlstands gewidmet hatte.
Dies ist der Umriss der wahren Geschichte hinter Dominie Sampson – ohne romantische Verwicklungen, ohne schwärmerische Leidenschaft; doch vielleicht rührt sie eben durch Rechtschaffenheit und Schlichtheit des Charakters das Herz und erfüllt das Auge des Lesers nicht minder, als würden die Nöte einer vornehmeren oder raffinierteren Gestalt geschildert.
Diese vorläufigen Bemerkungen zu der Geschichte von Guy Mannering und einigen ihrer Figuren ersparen dem Verfasser wie dem Leser hier die Mühe, eine lange Reihe vereinzelter Notizen zu verfassen und zu durchmustern.
Abbotsford, Januar 1829
Nachtrag: Das Motto dieses Romans ist dem „Lied vom letzten Minnesänger“ entnommen – um den Schlüssen jener zu begegnen, die zu meinen begannen, der Verfasser von Waverley zitiere niemals die Werke Sir Walter Scotts und die Umstände ließen sonst eine Identität vermuten.
Abbotsford, 1. August 1829
Zusätzliche Anmerkung –
Galwegische Orte und Persönlichkeiten, auf die im Roman angespielt werden:
Ein altes englisches Sprichwort sagt, dass mehr Leute Tom Fool kennen, als Tom Fool selbst weiß; und der Sinn dieses Sprichworts scheint sich auch auf Werke zu erstrecken, die unter dem Einfluss eines müßigen oder törichten Planeten entstanden sind. Viele Parallelen werden von den Lesern entdeckt, deren Existenz dem Autor unbekannt war. Er muss dies als großes Kompliment nehmen: Dass ihm die Schilderung rein imaginärer Vorfälle so nahe an die Wirklichkeit geriet, dass sie Leser an tatsächliche Ereignisse erinnert. Daher freut es ihn, einige Züge lokaler Geschichte und Tradition zu vermerken, die angeblich mit den fiktiven Personen, Begebenheiten und Schauplätzen von Guy Mannering übereinstimmen.
Als Prototyp des Dirk Hatteraick gilt ein niederländischer Skipper namens Yawkins. Dieser Mann war an den Küsten von Galloway und Dumfriesshire als alleiniger Eigentümer und Kapitän eines Buckkars – eines Schmugglerschiffs – bekannt, das den Namen „Black Prince“ trug. Er zeichnete sich durch nautisches Geschick und Unerschrockenheit aus. Sein Schiff fuhr häufig in Fracht, teils für andere, teils auf eigene Rechnung – im Dienst französischer, niederländischer, manxischer und schottischer Schmuggelunternehmungen.
Ein gewisser Mann, bekannt als „Buckkar-tea“ (wegen seines regen Tee-Schmuggels) und auch als „Bogle Bush“ nach seinem Wohnort, versicherte meinem freundlichen Gewährsmann Mr. Train, er habe häufig zweihundert Lingtow-Männer auf einmal zusammenkommen sehen, die, schwer beladen mit verbotener Ware, ins Landesinnere zogen.
In jenen „glücklichen“ Tagen des Freihandels betrug der Festpreis für den Transport einer Kiste Tee oder eines Ballens Tabak von der Küste Galloways nach Edinburgh fünfzehn Schilling; ein Mann mit zwei Pferden brachte vier solcher Pakete fort. Der Handel wurde durch Mr. Pitts berühmtes Kommutierungsgesetz völlig zerschlagen, das, durch Senkung der Zölle auf verbrauchsteuerpflichtige Artikel, dem rechtmäßigen Händler erlaubte, mit dem Schmuggler zu konkurrieren. In Galloway und Dumfriesshire hieß dieses Gesetz bei den Begünstigten des Schmuggels spöttisch „der Akt des Verbrennens und Aushungerns“.
Yawkins konnte sich an Land stets auf tatkräftige Hilfe verlassen und trat so kühn auf, dass sein bloßer Name die Finanzbeamten schreckte. Als ihn eines Nachts eine starke Abteilung Zollbediensteter überfiel – er war gerade allein mit beträchtlicher Ware angelandet –, wich er keineswegs zurück, sondern sprang vor und rief: „Nur zu, meine Burschen! Yawkins ist vor euch!“ Die Beamten ließen sich einschüchtern und gaben die Beute preis, obgleich sie nur durch Mut und Gewandtheit eines Einzelnen verteidigt war.
Auch auf See, in seinem eigentlichen Element, zeigte Yawkins Fortune. Einmal hatte er soeben am Manxmans Lake bei Kirkcudbright gelöscht, als gleichzeitig zwei Steuerkutter – die „Pigmy“ und die „Dwarf“ – auf unterschiedlichen Kursen in Sicht kamen, der eine bei den Isles of Fleet, der andere zwischen der Spitze von Rueberry und dem Muckle Ron. Der Unerschrockene lichtete auf der Stelle den Anker und lief mitten zwischen den Luggern hindurch – so dicht, dass er seinen Hut auf das Deck des einen und seine Perücke auf das des anderen warf – und hievte nebenbei noch ein Fass aufs Hauptdeck, um seine Beschäftigung zu zeigen. Um solche haarsträubenden Entkommenskunststücke zu erklären, behauptete der Volksglaube, Yawkins habe seinen berühmten Buckkar dadurch „versichert“, dass er auf jeder Reise ein Zehntel seiner Mannschaft dem Teufel bezahle. Wie dabei die Trennung von Grundeigentum und Zehnten vorgesehen war, bleibt unserer Mutmaßung überlassen. Vielleicht hieß der Buckkar gerade deshalb zu Ehren des imposanten Versicherers „Schwarzer Prinz“.
Der „Schwarze Prinz“ löschte früher in Luce, Balcarry und andernorts an der Küste; doch die Lieblingslandeplätze seines Eigners lagen am Eingang von Dee und Cree, nahe dem alten Schloss von Rueberry, etwa sechs Meilen unterhalb von Kirkcudbright. Unweit von Rueberry befindet sich eine große Höhle, die – wegen ihres häufigen Gebrauchs durch Yawkins und seiner vermuteten Verbindung zu den Ufer-Schmugglern – bis heute Dirk Hatteraicks Höhle genannt wird. Fremden, die diesen landschaftlich höchst romantischen Ort besuchen, zeigt man auch einen gewaltigen Abgrund namens Gaugers’ Loup, angeblich eben jenen, aus dem Kennedy gestürzt worden sei.
Meg Merrilies habe in Galloway ihren Ursprung in den Überlieferungen um die berühmte Flora Marshal, eine der königlichen Gemahlinnen Willie Marshals – besser bekannt als der Caird of Barullion, König der »Zigeuner« der westlichen Lowlands. Dieser Potentat verdient schon für sich Beachtung: Geboren um 1671 in der Pfarre Kirkmichael, starb er am 23. November 1792 in Kirkcudbright – mithin im hundertzwanzigsten Lebensjahr. Man kann nicht behaupten, diese ungewöhnlich lange Existenz sei durch besondere Tugenden der Lebensführung geziert gewesen. Willie wurde siebenmal in die Armee gepresst oder eingezogen und ebenso oft desertierte er; dreimal entfloh er zudem dem Marinedienst. Siebzehnmal war er rechtmäßig verheiratet; außerdem genoss er einen beträchtlichen Anteil ehelicher Annehmlichkeiten und bekannte sich sogar noch nach seinem hundertsten Jahr als Vater von vier Kindern eher inoffizieller Provenienz. Sein Greisenalter bestritt er mit einer Rente, die ihm der Großvater des heutigen Earl of Selkirk gewährte. Willie Marshal liegt in der Kirche von Kirkcudbright; sein Grabmal ist noch zu sehen, geziert von einem Wappen – passend mit zwei Tupshörnern und zwei Cutty-Löffeln.
In jungen Jahren pflegte er zuweilen nächtliche Spaziergänge auf der Landstraße, um Reisenden die Börse zu erleichtern. Einmal überfiel der Caird of Barullion den Laird von Bargally auf der Strecke zwischen Carsphairn und Dalmellington. Das Werk gelang nicht ohne harten Kampf; der »Zigeuner« verlor dabei seine Haube und musste fliehen, sie auf der Straße zurücklassend. Ein angesehener Pächter kam als Nächster des Weges, hob die Haube arglos auf und setzte sie sich – unbedacht – auf den Kopf. In diesem Augenblick traf Bargally mit Gehilfen ein, erkannte das Stück und beschuldigte den Mann von Bantoberick des Raubs; er nahm ihn in Gewahrsam. Da zwischen beiden eine gewisse Ähnlichkeit bestand, beharrte Bargally auf seiner Anzeige; und obgleich des Bauern untadeliger Ruf belegt war, nahm der Prozess vor dem Bezirksgericht seinen unerfreulichen Gang. Die verhängnisvolle Haube lag auf dem Tisch; Bargally beschwor, es sei genau die, die der Räuber getragen habe. Er und andere sagten, sie hätten den Angeklagten mit eben dieser Haube am Tatort angetroffen. Die Sache stand schlecht; selbst die Meinung des Richters schien ungünstig. Doch einer im Saal wusste genau, wer schuldig war und wer nicht: der Caird of Barullion selbst. Er drängte sich an die Schranke bei Bargally, riss unvermittelt die Haube an sich, setzte sie auf, blickte dem Laird geradewegs ins Gesicht und fragte mit einer Stimme, die das ganze Gericht aufhorchen ließ: „Seht mich an, Sir, und sagt bei eurem Eid: Bin ich nicht der Mann, der euch zwischen Carsphairn und Dalmellington beraubt hat?“ „Beim Himmel – ihr seid der Mann“, stammelte Bargally. „Seht ihr, welch treffliches Gedächtnis der Herr hat“, erwiderte der selbsternannte Fürsprecher. „Er schwört auf die Haube – gleichviel, was darunter steckt. Setzte Ihr sie auf, Mylord, er schwüre sogleich, Eure Lordschaft sei der Täter gewesen.“ Der Pächter von Bantoberick wurde einstimmig freigesprochen; und so rettete Willie Marshal mit geistreichem Kunstgriff einen Unschuldigen – ohne sich selbst preiszugeben, denn Bargallys Aussage musste jedem allzu wankelmütig erscheinen, um darauf ein Urteil zu gründen.
Während der „König der Zigeuner“ so rühmlich beschäftigt war, soll seine königliche Gemahlin Flora dem Richter die Kapuze des Talars entwendet haben. Für dieses Delikt, verbunden mit der mutmaßlichen Schuld, eine »Zigeunerin« zu sein, wurde sie nach Neuengland deportiert – und kehrte nie zurück.
Nun kann ich nicht zugestehen, dass die Gestalt der Meg Merrilies aus der zuerst erdachten Figur der Flora Marshal hervorgegangen sei, da ich bereits sagte, dass ich sie mit Jean Gordon identifizierte. Gern jedoch soll Meg als Repräsentantin ihrer Sippe und ihres Standes im Allgemeinen gelten – Flora und andere eingeschlossen.
Die übrigen Fälle, in denen meine gallovidischen Leser mich durch Zuschreibung verpflichtet haben, dem „luftigen Nichts“ eine „örtliche Behausung und einen Namen“ zu geben, will ich ebenfalls anerkennen, soweit der Verfasser sich dazu mit Recht verpflichtet fühlen darf. Passend hierzu erzählt der altbekannte Joe Miller eine treffliche Anekdote: Ein Museumsbesitzer zeigte – wie er behauptete – eben jenes Schwert, mit dem Bileam seinen Esel erschlagen wollte. Ein Besucher wandte ein, Bileam habe kein Schwert besessen, sondern sich eines gewünscht. „Ganz recht, Sir,“ erwiderte der schlagfertige Cicerone; „aber dies ist genau das Schwert, das er sich wünschte.“
In diesem Sinne hat der Verfasser nur hinzuzufügen, dass er, ohne sich der Übereinstimmung zwischen den Fiktionen der Geschichte und manchen wirklichen Umständen bewusst zu sein, gleichwohl zufrieden ist, wenn sie gefunden wird: Er mag unwillkürlich an Letzteres gedacht oder davon geträumt haben, während er an Guy Mannering arbeitete.
Einführung des Herausgebers zu Guy Mannering
Der zweite Romanversuch eines Autors, der mit seiner ersten Romanze triumphiert hat, ist ein heikles Wagnis. Der Schriftsteller wird unsicher, erinnert sich an die Ratschläge seiner Kritiker – ein fataler Fehler – und zittert vor dem Schatten seines eigenen Erfolgs. Er weiß, dass er viele Feinde haben wird, dass Hunderte bereitstehen, Fehler zu finden und zu schwören, er sei „ausgeschrieben“. Scott waren diese Befürchtungen nicht unbekannt. Nachdem er Marmion veröffentlicht hatte, schrieb er an Lady Abercorn:
„Niemand erlangt einen gewissen Grad an Popularität, ohne ein ebenso hohes Maß an Böswilligkeit bei denen hervorzurufen, die entweder aus Rivalität oder aus dem bloßen Wunsch heraus, das, was andere aufgebaut haben, zu Fall zu bringen, immer bereit sind, die erste Gelegenheit zu ergreifen, um die bevorzugte Person auf das herabzusetzen, was sie seinen ‚wahren Standard‘ nennen. Davon habe ich genug Erfahrung. Meine politischen Eingriffe, so nutzlos sie auch für meine Freunde sein mögen, haben mir immer wieder mehr als die übliche Anzahl an Feinden eingebracht. Aus Gerechtigkeit mir selbst und denen gegenüber, deren gute Meinung mich bisher beschützt hat, bin ich daher verpflichtet, mich nicht allzu oft in Gefahr zu bringen. Die Naturforscher sagen uns, dass, wenn man das Netz zerstört, das die Spinne gerade hergestellt hat, das Insekt viele Tage in Inaktivität verbringen muss, bis es in seinem Körper die notwendigen Materialien gesammelt hat, um ein neues zu weben. Jetzt, nachdem man ein Werk der Fantasie geschrieben hat, fühlt man sich fast in demselben erschöpften Zustand wie die Spinne. Ich glaube, kein Mensch schreibt heute schneller als ich (keine große Empfehlung); aber ich denke nie daran, Verse zu schreiben, bis ich über einen ausreichenden Vorrat an poetischen Ideen verfüge, um sie zu liefern – ich würde mich am liebsten den Israeliten in Ägypten bei ihrer schweren Aufgabe anschließen, Ziegel ohne Ton herzustellen. Außerdem weiß ich als Kleinbauer, dass eine gute Landwirtschaft darin besteht, nicht zu oft die gleiche Ernte vom gleichen Boden zu ernten; und da Rüben nach den besten Regeln der Landwirtschaft nach Weizen kommen, gehe ich davon aus, dass eine Ausgabe von Swift nach einer so geißelnden Ernte wie Marmion gut gedeihen wird.“[13. März 1808. Abschrift aus der Sammlung von Lady Napier und Ettrick.]
Diese furchtlosen Ängste waren Scott nicht fremd; doch bei der Arbeit an Guy Mannering schlug er sie kühn in den Wind. Er hatte eben sein Netz ausgesponnen, hatte The Lord of the Isles so gut wie eingebracht, und gerade die entmutigende Nachricht von dessen vergleichsweisem Misslingen erhalten, als er – weit entfernt vom „Einknicken“ – Guy Mannering in sechs Wochen niederschrieb und veröffentlichte. Molière erzählt, er habe die Fâcheux binnen vierzehn Tagen verfasst; ein französischer Kritiker spottete, man merke es dem Stück an. Ein selbstgewisser Zensor könnte Ähnliches über Guy Mannering sagen. Gewiss zeigt der Roman Spuren der Eile; die Handlung folgt oft dem eigenen Gutdünken. Man glaubt, der Autor habe bisweilen selbst keinen Ausweg gesehen. Doch das schadet wenig. „Wenn ich nicht weiß, was als Nächstes kommt“, bemerkte ein moderner Schriftsteller, „wie soll es dann die Öffentlichkeit wissen?“ Mindestens die Neugier wird durch Scotts unbekümmerte Art lebhaft gehalten. „Das Schlimmste daran ist“, schrieb er Lady Abercorn über seine Gedichte (9. Juni 1808), „dass ich nicht sehr gut und nicht geduldig bin im langsamen, sorgfältigen Verfassen; und manchmal erinnere ich mich an den betrunkenen Mann, der noch lange laufen konnte, nachdem er nicht mehr laufen konnte.“ Scott konnte gewiss sehr gut „laufen“, auch wenn ihm das schleppende Tempo zuwider war.
[Er dachte wohl an eine Edinburgher Berühmtheit, „Singing Jamie Balfour“. Jamie wurde einst stockbetrunken auf dem Trottoir liegend gefunden; aufrichten konnte er sich nicht – doch als man ihm half, rannte er mit seinem Retter zur Taverne und gewann.]
Lockhart berichtet Erstaunliches über das Jahr der Arbeit, das Guy Mannering vorausging. Er glaubt, Scott habe 1814 den größten Teil des Life of Swift, den größten Teil von Waverley und den Lord of the Isles geschrieben; außerdem Aufsätze für die Encyclopaedia verfasst und The Memorie of the Somervilles herausgegeben. Die Spinne mochte ausgesponnen und ermattet scheinen; doch Scotts Fruchtbarkeit und spontane Einbildungskraft standen – wenn überhaupt – nur derjenigen Alexandre Dumas’ kaum nach.
Am 7. November des arbeitsreichen Jahres 1814 schrieb Scott an Mr. Joseph Train und dankte ihm für ein Paket legendärer Überlieferungen, darunter die Galloway-Geschichte des „wandernden Astrologen“ und ein Katalog von Zigeunertraditionen. Die Astrologen-Erzählung fiel auf den fruchtbaren Boden von Scotts Fantasie und gab Guy Mannering Namen und Auftakt, während die Zigeunerstoffe zur Legende der Meg Merrilies aufblühten. Der Same des Romans war damit gesät. Doch zwischen dem 11. November und dem 25. Dezember schrieb Scott die drei letzten Gesänge von The Lord of the Isles. Noch ehe der Lord of the Isles am 18. Januar 1815 erschien, standen zwei Bände von Guy Mannering schon in Satz und Druck (Brief an Morritt, 17. Januar 1815). Der Roman selbst erschien am 14. Februar 1815.
Scott war, wie er einmal sagt, wie ein Bratspießhund, dem man heiße Asche ins Rad wirft, um seine Tätigkeit zu befeuern. „Heiße Asche“ waren für ihn Probebögen frisch aus der Presse; am fleißigsten arbeitete er, wenn der Druckerteufel wartete. Diesmal stand nicht nur der Druckerteufel, sondern auch der Wolf vor der Tür: Die Angelegenheiten der Ballantynes verlangten Geld. In beider Not schrieb Scott binnen zehn Tagen einen Band und veröffentlichte Guy Mannering aus finanziellen Gründen bei Longman, nicht bei Constable. Er sah sich in diesem Moment den Gläubigern und Schwierigkeiten gegenüber wie Napoleon den verbündeten Heeren – überall präsent, überall kühn, überall erfolgreich. Zwar war sein Lord of the Isles – wie James Ballantyne ihm schrieb – eine Enttäuschung. „Nun, James, so sei es; aber ihr wisst, wir dürfen nicht nachgeben, denn wir können es uns nicht leisten, aufzugeben. Wenn eine Linie fehlgeschlagen ist, bleiben wir eben bei etwas anderem.“ Damit entließ er mich, berichtet Ballantyne, und nahm den Roman wieder auf.
Unter diesen Vorzeichen war Guy Mannering alles andere als „inspiratorisch“ und eilte förmlich durch die Presse. Man kann zusehen, wie sich Erinnerungen und Erfahrungen im Kopf des Dichters kristallisieren und sich zu einer unvorhergesehenen Handlung gruppieren. Sir Walter gibt im Vorwort von 1829 die Legende wieder, die er von John MacKinlay, dem Highland-Diener seines Vaters, gehört hatte – auf deren Grundlage er zunächst eine Erzählung im eher „hawthornesken“ Ton, weniger in seinem eigenen, entwerfen wollte. Diesen Plan änderte er während der Drucklegung und ließ „gerade genug Astrologie übrig, um pedantische Rezensenten und törichte Puritaner zu verärgern“. Woher aber der Rest – der längst verschollene Erbe und so fort? Der „wahre Erbe“, ferngehalten, verkleidet, heimkehrend – seit Homer ein Lieblingsthema. Wahrscheinlich hatte Scott zugleich ein modernes Beispiel im Sinn.
Als der Herausgeber das alte Tagebuch-Manuskript im Branxholme Park (vgl. die Notiz zu Waverley) durchblätterte, stieß er auf eine eigentümliche Geschichte, die, nach Meinung des Diaristen, Sir Walter an Guy Mannering erinnert haben könnte. Die Ähnlichkeit zwischen Vanbeest Brown und dem Helden des Tagebuchschreibers war gering; aber in einem langen Brief Scotts an Lady Abercorn vom 21. Mai 1813 fand der Herausgeber genau jene Erzählung, die im Branxholme-Park-Journal aufgezeichnet ist. „Sonderbare Dinge geschehen“, bemerkt Sir Walter, und schildert einen eben vor Gericht verhandelten Fall, bei dem er als Sitzungsschreiber zugegen war. Kurz lautet die Anekdote so:
Ein gewisser Mr. Carruthers von Dormont verdächtigte seine Frau der Untreue. Während das Scheidungsverfahren lief, gebar Mrs. Carruthers eine Tochter – rechtlich natürlich ein Kind des Ehemanns. Er glaubte die Vaterschaft nicht, ließ das Mädchen in Unwissen um ihre Herkunft abgeschieden in den Cheviot Hills erziehen. Dort erfuhr sie schließlich die Wahrheit, heiratete einen Mr. Routledge, den Sohn eines Freibauern, und ließ sich ihre persönlichen Ansprüche (nicht jedoch die ihrer Nachkommen) gegen eine geringe Barsumme abfinden, die der alte Dormont zahlte. Sie gebar einen Sohn; bald darauf starben beide Eltern in Armut. Der Knabe wurde von einem Freund nach Ostindien geschickt und erhielt dort ein Paket Papiere, das er ungeöffnet bei einem Anwalt hinterlegte. Er machte in Indien Vermögen, kehrte nach Schottland zurück und geriet bei einer Schießerei in Dumfriesshire, nahe Dormont, in die Nähe seiner Herkunft. Er übernachtete in einem kleinen Wirtshaus; die Wirtin, vom Namen beeindruckt, schwatzte mit ihm über seine Familiengeschichte. Er wusste nichts, ließ, von der Geschichte berührt, das vergessene Aktenpäckchen kommen, prüfte es, holte Rechtsrat ein und erfuhr vom Präsidenten Blair, dass er einen beachtlichen Anspruch auf das Anwesen Dormont habe. „Die erste Entscheidung war positiv“, schreibt Scott. Der wahre Erbe feierte den juristischen Sieg mit einem Diner; die Freunde begrüßten ihn mit „Dormont!“ Am nächsten Morgen fand man ihn tot. Das ist die wahre Geschichte.
Da sie Scott 1813 beschäftigte und er 1814/15 an Guy Mannering schrieb, ist es gut möglich, dass sein „wandernder Erbe“, der zufällig auf die väterlichen Domänen zurückkehrt und seine Herkunft aus dem Munde einer Frau erfährt, dem Fall Dormont etwas verdankt. Zumindest war die Ähnlichkeit der Geschichten vor rund siebzig Jahren augenfällig genug, um einem scharfsinnigen Beobachter ins Auge zu springen.
Eine weitere mögliche Quelle der Handlung – gewiss romantischer im Ursprung – schlägt Mr. Robert Chambers in seinen „Illustrationen des Autors von Waverley“ vor. Ein Maxwell aus Glenormiston, „ein frommer und bigotter Einsiedler“, sandte seinen einzigen Sohn und Erben an ein Jesuitenkolleg in Flandern, überließ sein Anwesen der Verwaltung seines Bruders und starb. Der böse Onkel erklärte sodann, der Erbe sei ebenfalls tot. Das Kind, das nichts von seiner Herkunft wusste, wuchs heran, entfloh mit sechzehn den Jesuiten, trat in die französische Armee ein, focht bei Fontenoy, erhielt seine Fahne und landete 1745 als französischer Offizier im Moray Firth. Er durchlief den Feldzug, verbarg sich nach Drumossie in Lochaber und wurde auf dem Weg zu einem Hafen in Galloway gefasst und in Dumfries eingekerkert. Dort erkannte ihn eine alte Dienerin seines Vaters an „einem Mal, an das sie sich an seinem Körper erinnerte“. Freunde nahmen sich seiner Sache an; doch der usurpierende Onkel starb – und Sir Robert Maxwell erhielt seine Güter ohne Prozess zurück. Diese Anekdote entstammt dem New Monthly Magazine vom Juni 1819; einen Beleg dafür, dass Scott sie kannte, gibt es nicht.
Wie meist lieferten Scotts eigene Erfahrungen Anstöße für seine Figuren. Der Satz von Dominie Sampsons Vater – „Bitte Gott, mein Kind möge noch lange auf der Kanzel seinen Pow wedeln lassen“ – fiel ihm buchstäblich zu Ohren. Es gab einen Bluegown (Bedesman) wie Edie Ochiltree, dessen Sohn am Edinburgh College studierte. Scott war dem Jungen freundschaftlich zugetan; der Mann im blauen Habit lud ihn zum Abendessen ein, und bei dieser Tafel sprach der Alte jenen Spruch über Kanzel und Pow. Eine ähnliche Geschichte erzählt Scott in der Einleitung zu The Antiquary (1830).
Was den guten Dominie betrifft, bemerkt Scott, er müsse aus „bestimmten besonderen Gründen“ über sein Vorbild „ganz allgemein“ sprechen. Mr. Chambers hält es für einen Mr. James Sanson, Hauslehrer im Hause von Mr. Thomas Scott, Sir Walters Onkel. Es wirkt jedoch untypisch für Sir Walter, diesen verdienten Mann fast beim Namen zu nennen; zumal die Geschichte seiner Hingabe an die Tochter seines Gönners auf Mr. Sanson kaum zutreffen kann. Der Prototyp Pleydells war nach Scotts eigenem Zeugnis (Journal, 19. Juni 1830) „mein alter Freund Adam Rolland, Esq., in äußeren Umständen, nicht aber in Ausgelassenheit oder Fantasie“. Chambers wiederum erkennt das Original in Mr. Andrew Crosbie, einem Anwalt von großem Talent, der 1785 verarmt starb. Scott mag von diesem Patron der „High Jinks“ gehört haben; persönlich gekannt haben muss er ihn wohl nicht.
Dandie Dinmont ist schlicht der typische Grenzbauer. Mr. Shortreed, Scotts Begleiter auf seinen Liddesdale-Zügen, hielt Willie Elliot von Millburnholm für das große Original. Mr. James Davidson in Hindlee – der Besitzer aller „Mustards“ und „Peppers“ – begegnete Scott erst Jahre nach Abschluss des Romans; als man ihm Guy Mannering vorlas, schlief er ein. „Der freundliche, männliche Charakter des Dandie, der sanfte, liebenswürdige Charakter seiner Frau“ und die häuslichen Umstände, so Lockhart, seien Scott von seinem Freund, Verwalter und Amanuensis Mr. William Laidlaw nahegebracht worden – vermittelt durch Mrs. Laidlaw auf ihrer Farm zwischen Schafgarbenbüschen. Tatsächlich wimmelte die Grenze damals von Dandies und Ailies; in Liddesdale und Teviotdale, in Ettrick und Yarrow ist der Schlag bis heute nicht ausgestorben. Was „Senf“ und „Pfeffer“ betrifft, so gedeihen auch ihre Nachfahren im Land – tödliche Feinde alles Ungeziefers. Neugierige mögen Mr. Cooks Schrift über „The Dandie Dinmont Terrier“ zu Rate ziehen. Die Meute des Herzogs von Buccleuch ähnelt noch immer dem schönen Exemplar, das Gainsborough in seinem Porträt des Herzogs (zu Scotts Zeiten) festhielt. „Tod Gabbie“ wiederum, so Lockhart, entstand nach Studien an Tod Willie, dem Jäger der Höhen über Loch Skene.
Die Galloway-Landschaft kannte Scott wenig; er betrat „das Königreich“ erst 1793, als er den allzu ausgelassenen Mr. McNaught, Pfarrer von Girthon, verteidigte. Die herrliche, einsame Wildnis der Glenkens im Herzen Galloways – wo die Traditionen bis heute leben – blieb ihm leider terra incognita. Eine Galloway-Erzählung von einem Mord, der über die Stiefelabdrücke des Täters aufgedeckt wurde, inspirierte die Szene, in der Dirk Hatteraick auf ähnliche Weise überführt wird. Und in Colonel Mannering erkannte der Ettrick Shepherd bekanntlich „Walter Scott, von sich selbst gemalt“.
Der Empfang von Guy Mannering war so gut, wie man es sich nur wünschen konnte. William Erskine und James Ballantyne hielten den Roman für „weit interessanter als Waverley“. Mr. Morritt schrieb im März 1815, er sei „ziemlich entzückt von Dandie, Meg Merrilies und Dirk Hatteraick – Charakteren, die so originell, so naturgetreu und so kraftvoll entworfen sind, dass man fast sagen möchte, sie hätten von Shakespeare selbst gezeichnet werden können“. Auch das Publikum erwies sich dankbar: Bereits am Tag nach dem Erscheinen waren zweitausend Exemplare à eine Guinea verkauft, binnen drei Monaten weitere dreitausend. Die Berufskritik wiederum benahm sich genau so, wie Scott es vorausgesagt hatte. Zitieren wir den British Critic (1815):
„Es gibt kaum ein Schauspiel in der literarischen Welt, das beklagenswerter ist, als zu sehen, wie ein erfolgreicher Autor bei seinem zweiten Auftritt vor der Öffentlichkeit lahm hinter sich herhinkt und sich mühsam und unbeholfen in derselben Runde bewegt, die er bei seinem ersten Versuch mit Lebhaftigkeit und Applaus nachgezeichnet hatte. Wir wären nicht hart genug zu sagen, dass sich der Autor von „Waverley“ in dieser misslichen Lage befindet, aber wir sind höchst ungern gezwungen zu behaupten, dass das zweite Werk weit unter dem Standard des ersten liegt. In „Waverley“ steckte die Brillanz des Genies ... In „Guy Mannering“ gibt es kaum etwas anderes als die wilden Ausfälle eines ursprünglichen Genies, die kühnen und unregelmäßigen Bemühungen eines kraftvollen, aber erschöpften Geistes. Ihm wurde nicht genug Zeit gegeben, um seine Ressourcen, sowohl Anekdote als auch Witz, zu rekrutieren. Aber ermutigt durch die Anerkennung, die einem der damals vollendetsten Porträts, die der Welt jemals präsentiert wurden, zuteil wurde, hat er der Ausstellung eine nachlässige und hastige Skizze folgen lassen, die zugleich die Schwäche und die Stärke seines Autors verrät.
„Der Charakter von Dirk Hatteraick ist eine getreue Kopie der Natur – er ist eines dieser moralischen Monster, die uns für unsere Artgenossen fast beschämen lassen. Dennoch werden inmitten der brutalen und mörderischen Brutalität des Schmugglers einige Gefühle unserer gemeinsamen Natur mit nicht weniger Einfallsreichtum als der Wahrheit hineingeworfen. ... Die übrigen Persönlichkeiten gehen kaum über die Besetzung eines gewöhnlichen lebhaften Romans hinaus. ... Der Anwalt aus Edinburgh ist vielleicht das originellste Porträt. Auch die Saturnalien der Samstagabende werden nicht ohne Humor beschrieben. Der Dominie ist überzeichnet und inkonsistent; während die jungen Damen nichts Überdurchschnittliches bieten. ...
„Es gibt Teile dieses Romans, die niemand außer einem mit der Erhabenheit des Genies ausgestatteten Menschen hätte diktieren können; es gibt andere, die jeder gewöhnliche Charakterschuster genauso leicht zusammennähen könnte. Es gibt Funken von Pathos und Humor, selbst in den langweiligsten Teilen, die niemand außer dem Autor von „Waverley“ entlocken konnte. ... Wenn wir tatsächlich in einer abfälligen Weise über dieses, sein späteres Werk, gesprochen haben, ergibt sich unser Tadel nur aus seinem Vergleich mit dem ersteren. ...
„Wir können diesen Artikel jedoch nicht abschließen, ohne auf den absurden Einfluss hinzuweisen, den unser Autor zweifellos den Berechnungen der Gerichtsastrologie zuschreibt. Keine Macht des Zufalls allein hätte die gemeinsamen Vorhersagen von Guy Mannering und Meg Merrilies erfüllen können. Wir können nicht annehmen, dass der Autor mit genügend Torheit ausgestattet sein kann, um selbst an den Einfluss von Planetenkonjunktionen zu glauben, noch dass er eine so schlechte Vorstellung vom Verständnis seiner Leser hat, dass er sie zu einem ähnlichen Glauben für fähig hält. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass die Entstehungszeit dieses Romans nicht im dunklen Zeitalter liegt, sondern kaum vierzig Jahre her ist. Aus der allgemeinen Tendenz des Volksaberglaubens kann daher keine Hilfe abgeleitet werden. Was hinter dieser scheinbaren Absurdität steckt, können wir uns nicht vorstellen. Ob es der Autor im Scherz oder im Ernst meinte, wissen wir nicht, und in diesem Dilemma sind wir bereit anzunehmen, dass er sich selbst nicht kennt.“**
Die Monthly Review stimmte in die Klage über die vermeintliche Förderung astrologischer Torheiten ein; die Critical Review bemängelte, Guy Mannering sei „zu oft in einer Sprache geschrieben, die allen außer den Schotten unverständlich ist“. Auch der Critical Monthly hatte Skrupel – der Roman fördere das Duell, den allzu verbreiteten Blick in die Zukunft und sei in religiösen Dingen „nicht übermäßig zimperlich“. Der Quarterly Review schließlich tat sich – milde gesagt – durch eine bemerkenswerte Mischung aus Dünkel und Missgunst hervor: Die Sprache sei „gemein“, die Gesellschaft „vulgär“, Meg Merrilies „unnatürlich aufgebläht“; der Autor setze gar „Naturgesetze außer Kraft“, weil Colonel Mannering in der Nähe von Ellangowan wohne. Man müsse annehmen, „entweder glaube der Autor ernsthaft, was kein anderer lebender Mensch glaubt, oder er handele aus böswilliger Absicht“, und überhaupt wäre das Werk „im Großen und Ganzen durch eine Übersetzung ins Englische verbessert“. Gleichwohl endete selbst diese Rezension mit dem Eingeständnis, man habe den Roman mit Interesse gelesen – und sei dafür mit Amüsement belohnt worden.
In der Rezension zu The Antiquary beklagt sich der unsterbliche Narr des „Quarterly“ über „den dunklen Dialekt eines anglifizierten Erse“. Der gedruckte Tadel hat Scotts Stimmung indes nie wesentlich beeinflusst – wahrscheinlich las er Rezensionen nur selten. Er wusste, dass die Öffentlichkeit, wie Constables Freundin Mrs. Stewart, „den ganzen Tag Guy Mannering las und die ganze Nacht davon träumte“.
Tatsächlich ist es weit klüger, Guy Mannering