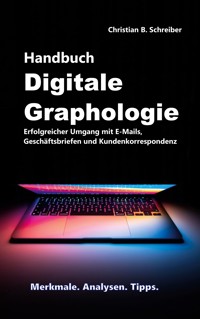
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kann anhand des Schriftbildes von E-Mails und gedruckten Dokumenten auf den Charakter des Verfassers geschlossen werden? Was steckt hinter doppelten Leerschritten, dreifachen Ausrufezeichen oder fehlenden Absätzen? Und wie lassen sich Fallstricke in der digitalen Kommunikation vermeiden? Christian B. Schreiber spannt in seinem Buch einen Bogen von den Merkmalen bestimmter digitaler Schriftbilder bis hin zu hilfreichen Vorschlägen für eine gelingende Korrespondenz per E-Mail, Messenger oder Geschäftsbrief. In einem umfangreichen zweiten Teil finden sich wertvolle Vorschläge zum besseren Formulieren und Gestalten. Mehrere Muster für Standardschreiben sowie eine Tabelle mit Tastaturkürzeln der wichtigsten Satz- und Sonderzeichen komplettieren das Werk. Ein nützliches Buch für alle, die erfolgreich schreiben wollen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Inhalt
Kann anhand des Schriftbildes von E-Mails und gedruckten Dokumenten auf den Charakter des Verfassers geschlossen werden? Was steckt hinter doppelten Leerschritten, dreifachen Ausrufezeichen und fehlenden Absätzen? Und wie lassen sich Fallstricke in der digitalen Kommunikation vermeiden?
Christian B. Schreiber spannt den Bogen von den Merkmalen bestimmter digitaler Schriftbilder bis hin zu hilfreichen Vorschlägen für eine gelingende Korrespondenz per E-Mail, Messenger oder Geschäftsbrief.
Der Verfasser
Christian B. Schreiber arbeitet seit Jahrzehnten als Texter und Autor. Die korrekte Anwendung der deutschen Sprache ist ihm ein ebenso großes Anliegen wie der Wunsch, mit Tipps und Wissensvermittlung zu einer gelingenden Kommunikation im geschäftlichen und privaten Bereich beizutragen.
Haftungsausschluss
Das Werk inklusive seiner Inhalte wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann weder seitens des Autors noch des Verlages eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit, Korrektheit und Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen werden. Die Benutzung dieses Buches und die Verwendung der darin enthaltenen Informationen erfolgt daher auf eigenes Risiko. Jegliche Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die sich aus einer Nutzung oder Nichtnutzung des Werkes ergeben könnten, ist ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Gibt es überhaupt eine Digitale Graphologie?
Wozu Digitale Graphologie?
Sprunghafte Gedanken
Zu wenige oder zu viele Absätze
Sonderlinge im Text: Das große Eszett
Die Verwendung des Personalpronomens „man“
Eigentlich gibt es eigentlich gar nicht
Angst oder Größenwahn? Mehr als ein Ausrufezeichen am Satzschluss
Der „Bummstrich“
Lustige Lexeme: Indizien für die regionale Herkunft
Sonderlinge im Text: Das Interrobang
Das Portemonnaie des Gymnasiasten aus Libyen: Wenn schwierige Wörter verwendet werden – oder eben nicht
Toleranz für alle? Genderstern & Co.
Gute Gründe für korrektes Schreiben
Den richtigen Gebrauch der Schriftsprache lernen ist nicht schwer
So geht es richtig: Wörtliche Rede in Texten
Vorsicht Autokorrektur!
So geht es richtig: Korrekt zitieren
Fallstricke im Text: Die Firma
So geht es richtig: Bindestriche und Gedankenstriche
Fallstricke im Text: Anredeform Du oder Sie?
So geht es richtig: Die drei Auslassungspunkte
Fallstricke im Text: Wörter oder Worte?
Exkurs Sprachrhythmus: Damit ein Text besser klingt
So geht es richtig: Abkürzungen
Fallstricke im Text: Der Apostroph
So geht es richtig: Die Gestaltung einer E-Mail
So geht es richtig: Geschützte Leerzeichen
Fallstricke im Text: Das &-Zeichen
Textvorschläge für Standardfälle in der geschäftlichen Kommunikation
Signaturanforderungen für geschäftliche E-Mails
Tastenkombinationen für Satz- und Sonderzeichen
Nachwort
1
Vorwort
Die Graphologie gehört wohl seit jeher zu den Forschungsgebieten, von denen eine besondere Faszination ausgeht. Seit Jahrhunderten wird versucht, anhand von Schriftzeichen auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale zu schließen und die komplizierten Zusammenhänge zwischen geschriebenem Text und den Charaktereigenschaften des jeweiligen Autors zu verstehen. Wahrnehmung, Analyse und Interpretation greifen hier ineinander und wollen nach bestimmten Mustern eingeordnet oder besser: zugeordnet werden.
Während sich die Graphologie als wissenschaftliche Disziplin mit verschiedenen Techniken und Methoden in der Vergangenheit vor allem mit der Handschrift eines Menschen beschäftigt hat und dabei die Untersuchung von Größe, Form, Neigung, Druck und Abstand der Buchstaben im Vordergrund stand, müssen in Zeiten, in denen der Informationsaustausch fast ausschließlich elektronisch oder in (aus-)gedruckter Form stattfindet, neue Wege beschritten werden, um ein möglichst umfassendes Bild der Persönlichkeit des Schreibers zeichnen zu können. In der digitalen Kommunikation per E-Mail, Messenger-Diensten oder auch per Geschäftsbrief lassen sich keine klassischen Merkmale wie eine bestimmte Schriftstärke, besonders hohe oder niedrige Buchstaben oder eine Schrägstellung in die eine oder andere Richtung feststellen. Auch Aussagen über harmonische oder unharmonische Schreibweisen sind nicht möglich, da Texte, die am Computer oder über die Tastatur des Smartphones getippt werden, per se einheitlich dargestellt werden. Ob der Schreiber in Eile war oder sich viel Zeit für die Niederschrift genommen hat, lässt sich – zumindest anhand des reinen Schriftbildes – kaum feststellen. Dennoch gibt es eine Reihe von Erkennungsmerkmalen in der digitalen Kommunikation, die nicht nur auf die Beherrschung der deutschen Sprache, sondern auch auf den Gemütszustand des Verfassers schließen lassen.
Diese Merkmale näher zu betrachten und zu beleuchten, wie eine gewinnbringende Analyse aussehen könnte, ist Ziel der nachfolgend angestellten Überlegungen. Außerdem soll dazu beigetragen werden, das eigene Geschick bei der Kommunikation auf elektronisch-schriftlichem Weg zu verbessern.
Dem englischen Dramatiker, Lyriker und Schauspieler William Shakespeare wird folgendes Zitat zugeschrieben:
„Gebt mir die Handschrift einer Frau und ich werde euch ihren Charakter nennen“
(Lehrbuch der Graphologie – Albertini, Laura, Stuttgart [u.a.], Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1909, Seite 256).
Der Frage, ob dies in Zeiten der digitalen Kommunikation auch noch möglich sein könnte und warum sich ein wenig Grundwissen rund um eine gelingende Korrespondenz sowohl im privaten wie vor allem im geschäftlichen Bereich lohnt, wird in diesem Buch nachgegangen.
2
Gibt es überhaupt eine Digitale Graphologie?
Graphologie – die Lehre vom Schreiben.
Grundvoraussetzung für jede graphologische Beurteilung von Schriftstücken sind die potentiellen Merkmale der realen Handschrift bzw. der Textvorlage. Diese Merkmale sind in der Regel über lange Zeiträume weitgehend unverändert und weisen immer die gleichen Eigenschaften auf. Lediglich Schriftstücke, die bewusst in „Schönschrift“ gestaltet oder aber flüchtig dahingeschmiert werden (der berühmte „schnelle Notizzettel“) weichen in einigen Punkten vom gewöhnlich verwendeten Schreibstil ab. Zudem gibt es zum Beispiel auch Schriftsteller oder Schauspieler, die bei Autogrammen oder Widmungen in Büchern zum Schutz vor Missbrauch absichtlich eine andere Unterschrift setzen als etwa auf Vertragsdokumente. Dies muss und wird bei graphologischen Gutachten stets berücksichtigt werden. Was die Arbeit der Sachverständigen heute aber viel stärker erschwert als bewusst oder unbewusst abweichende Handschriften ist die Tatsache, dass es in unserem digitalen Zeitalter kaum noch echte handgeschriebene Vorlagen gibt, die bewertet werden könnten. Viele – auch bedeutsame – Dokumente werden entweder bereits in elektronischer Form erstellt oder aber eingescannt, wobei das Original anschließend vernichtet wird. Merkmale wie die Druckstärke und ähnliche Parameter lassen sich vom Graphologen in diesen Fällen nicht mehr beurteilen. Umso wichtiger werden daher Anhaltspunkte, aus denen sich charakterliche Eigenschaften des Verfassers eines ausschließlich in digitaler Form vorliegenden Schriftstücks ablesen lassen. Dass dies angesichts der höchst komplexen Zusammenhänge zwischen psychologischen Sachverhalten, technischen Rahmenbedingungen und vielen unbekannten Größen stets Stückwerk bleiben muss, sollte klar sein.
Ich habe mich aus den vorgenannten Gründen ganz bewusst dafür entschieden, die Bezeichnung Digitale Graphologie als eine Art Eigenname zu verwenden und daher das Adjektiv „digital“ groß zu schreiben. Zudem verwende ich den Begriff „Digitale Graphologie“ weniger als einen fachlich engen Terminus Technicus, der die Wissenschaft von einer Echtheitsprüfung schriftlicher Dokumente beziehungsweise die einer psychologischen Einschätzung geschriebene Texte meint, vielmehr nutze ich den Begriff Graphologie hier in seinem ursprünglichen Wortsinn: Als Bezeichnung der Lehre vom Schreiben. Die Endung „-logie“ nämlich stammt von dem griechischen „lógos“ ab, was nicht nur „Wort“, sondern auch „Lehre“ bedeutet. Im deutschen Sprachgebrauch wird „-logie“ in der Regel in Verbindung mit einem näher bezeichnenden Begriff wie „Psycho-“, „Geo-“- oder „Theo-“ benutzt, um den Bezug zu einem bestimmten Gebiet auszudrücken. Und Graphologie bedeutet dann eben strenggenommen zunächst einmal nichts Anderes als „Lehre vom Schreiben“ oder auch „Lehre von der Schreibung/Darstellung“.
Neben alldem ist es weiterhin wichtig vorauszuschicken, dass es dem Anliegen dieses Buches in keiner Weise gerecht werden würde, wollte man die Digitale Graphologie als strenge Wissenschaft verstehen oder gar versuchen zu behaupten, mit ihr das Wesen des Verfassers eines Textes umfassend analysieren zu können. Vielmehr geht es darum, einzelne Muster in Texten näher zu betrachten und zu schauen, worauf bestimmte Besonderheiten in der Ausdrucksweise, Formatierung oder Zeichensetzung hinweisen könnten. Zudem soll das Verständnis für die richtige Verwendung der deutschen Sprache in der elektronischen Kommunikation geweckt und dazu ermutigt werden, durch eine kurzweilige Beschäftigung mit diesem Thema hinfort bessere Ergebnisse beim Verfassen von Schriftstücken zu erzielen.
3
Wozu Digitale Graphologie?
Herausfinden, mit wem man es zu tun hat …
Gerade für Laien, die keine Schwierigkeiten mit neuen Ideen haben und offen für interessante Überlegungen sind, kann die digitale Graphologie nicht nur ein unterhaltsames Thema sein, sondern auch eine Menge praktischer Tipps bereithalten. In jedem Fall dürften eine Beschäftigung mit der korrekten Anwendung unserer Muttersprache in der elektronischen Kommunikation und das Vermeiden von Fehlern beim Verfassen von E-Mails, Geschäftsbriefen und Nachrichten auf Social-Media-Plattformen, aber auch in Bewerbungsschreiben, Beschwerdebriefen und anderen wichtigen Schriftstücken sehr nützlich sein.
Auch ohne Künstliche Intelligenz (KI) sind Forscher heute in der Lage, mit einer Analyse bestimmter Eigenheiten des Schreibstils mehrere Autoren voneinander zu unterscheiden und bestenfalls die Urheberschaft eines Textes zu klären. Wichtig ist dies vor allem dann, wenn es um strafbare Handlungen wie beispielsweise einen in ausgedruckter Form vorliegenden Erpresserbrief oder Morddrohungen in Internetforen oder auf Social-Media-Seiten geht.
Die Forensik macht sich dabei sowohl die unterschiedliche Verwendung von Schriftarten, Farben und Signaturen als auch Tippfehler, die Verwendung von Abkürzungen, eine bestimmte Art der (falschen) Interpunktion sowie individuelle Ausdrücke und Begriffe zunutze. Sogar Verhaltensmerkmale bei Tastenanschlägen können als biometrische Indikation dienen und beispielsweise im Rahmen der sogenannten Multiauthentifizierung genutzt werden. Einige Unternehmen bewerten das Tippverhalten von Anwendern bereits, um die Identität des Nutzers zu bestätigen. Möglich wird dies durch die Messung und Analyse individueller Muster im Verhalten einer Person, etwa hinsichtlich der Geschwindigkeit, des Rhythmus und des Drucks während des Tippens.





























