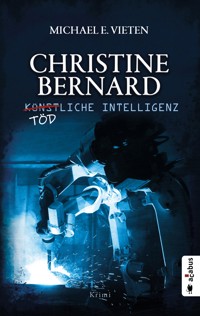Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Schaue nicht nach Westen, schaue nach Osten. Dort geht jeden Morgen eine neue Sonne auf."Was erwartet die Menschheit, wenn sie weitermacht, wie bisher? Anthropozän 2050. Das Ende des Industriezeitalters.Es ist genau das passiert, was jeder Mensch hätte wissen müssen. Die Menschen haben die Erde der Gier, der Selbstsucht und der Ignoranz geopfert. Die Umwelt ist größtenteils zerstört. Unbesiegbare Keime, Kriege, Hungersnöte und eine verheerende Pandemie haben den überwiegenden Teil der Menschheit dahingerafft. Der Rest kämpft allein oder in kleinen Gruppen ums Überleben. Jeder ist sich selbst der Nächste. In dieser feindlichen Umgebung lebt die junge Mila in der Hoffnung auf ein fernes Hochtal, in dem die Natur noch intakt sein soll. Mit dem alten Josh macht sie sich auf den gefährlichen Weg und kämpft mit den schrecklichen Folgen des Unterlassens und der Ignoranz der Menschen des 21. Jahrhunderts.Die Roman-Trilogie über ein großes Abenteuer, verzweifelte Hoffnung, grenzenlose Zuversicht und aufrichtige Freundschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 856
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein besonderer Dank geht an Birgit D. für ihre wertvolle Unterstützung und ihre Zuversicht.
Vieten, Michael E., Handbuch zur Rettung der Welt - Trilogie
Informationen über den Autor und seine Arbeit auf:www.mvieten.de
Der Inhalt dieses Buches beruht auf wahren Begebenheiten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Ereignissen sind beabsichtigt. Was beschrieben wurde findet bereits statt, irgendwo auf der Welt. Jeden Tag. Ich habe die Ereignisse lediglich zusammengetragen und dramaturgisch aufbereitet.
Die Umwelt als unser Lebensraum wird zerstört. Wir verlieren in jeder Sekunde einen unwiederbringlichen Teil unserer Lebensgrundlage. Menschen, Pflanzen und Tiere leiden und sie sterben. Millionen Menschen flüchten bereits vor den Folgen des Klimawandels in gemäßigte Regionen und treffen dort auf die Menschen, die den Klimawandel maßgeblich zu verantworten haben. Die daraus entstehenden sozialen Spannungen verändern bereits unsere Gesellschaften. Die Entscheider erscheinen gelähmt. Gegenmaßnahmen werden zwar beschlossen, aber nicht umgesetzt. Unser aller Schiff treibt ungebremst auf ein Riff zu und ich fürchte, wir werden daran zerschellen.
(Anm. des Autors im Jahre 2019 vor der globalen Katastrophe)
Wir alle leben heute im Anthropozän. Die Wissenschaft streitet noch darüber, ob dieses neue Zeitalter 1610 mit der Eroberung der „neuen Welt“ und den katastrophalen Folgen für den amerikanischen Kontinent seinen Anfang genommen hat oder erst um 1800 mit der industriellen Revolution in Europa.
Wie dem auch sei. Der Mensch hat begonnen seine Umwelt zu verändern, ohne fundiertes Wissen zu besitzen, welche Auswirkungen das haben wird.
Ein weiterer Begriff hat für das Verständnis des Geschehens in der Geschichte der Menschheit eine zentrale Bedeutung. Die neolithische Revolution, die gleichbedeutend mit der Vertreibung aus dem Paradies angesehen werden kann.
Beide Begriffe möchte ich nachfolgend kurz erläutern.
Inhaltsverzeichnis
Anthropozän
Neolithische Revolution
Auf ein Wort
Buch 1: Handbuch zur Rettung der Welt
Mila
Josh
Das Buch
Eine neue Hoffnung
Der Beginn einer langen Reise
Ein großer Verlust
Wolf
Anton
Die Hütte
Winter
Ein neuer Aufbruch
Buch 2: Handbuch zur Rettung der Welt - Mila
Aufbruch
Silber
Der Pass
Ein Rest Zuversicht
Lavi
Das Tal
Das Dorf
Milas Rache
Ruud
Abschied
Lavis Entscheidung
Ein Wiedersehen
Winter
Gottes Faust
Der letzte Marsch
Buch 3: Handbuch zur Rettung der Welt - Josh
Großes Glück
Wieder vereint
Die Siedlung
Irina
Milas Entscheidung
Der Turm
Pawel
Die Stadt
Familie
Kannibalen
Wie alles begann
Der Überfall
Irinas Entscheidung
3000 Kilometer
Der Fluss
Sicherer Boden
Die Anderen
Ein letztes Wort
Anthropozän
(Altgriechisch: „Das menschlich [gemachte] Neue“)
Der Begriff „Anthropozän“ beschreibt die Benennung einer neuen geochronologischen irdischen Epoche. Sie soll den Zeitabschnitt umfassen, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist.
Dazu zählen:
Albedo
(Gesamt-Rückstrahlvermögen der Erdoberfläche (Schwund der Eisflächen))
Artensterben, Artenverschleppung
Klimawandel
Abschmelzen der Gletscher und der Polkappen
Anstieg der Meeresspiegel
Rückgang von Permafrost
Veränderung der globalen Meeres- und Luftströmungen
Versauerung der Ozeane
Lichtverschmutzung, Lärmverschmutzung
Kohlenstoffdioxid, Ozonloch, Treibhausgase
Radioaktiver Staub, Atomversuche, -Unfälle, Risiko eines Atomkriegs
Übernutzung bzw. Verlust zur Verfügung stehender Ressourcen
insbesondere der Vorkommen (Peak-) Erdöl, Phosphor, Sand, seltene Erden
Bodendegradation, -erosion, -schutz oder –versauerung, Er-
schöpfung der vorhandenen Trinkwasservorkommen
Landraub durch Konzerne
Überfischung
Vermüllung der Umwelt „Plastik-Planet“
(Quelle: Wikipedia, gekürzt)
Neolithische Revolution
Der Begriff „neolithische Revolution“ beschreibt den Zeitpunkt in der Entwicklung des Menschen, an dem unsere Vorfahren erstmals das Leben als Jäger, Fischer und Sammler aufgegeben haben und mit Ackerbau und Viehzucht begannen.
Viele Wissenschaftler bezeichnen die neolithische Revolution als einen der bedeutendsten Umbrüche in der Geschichte der Menschheit.
Der Mensch löste sich aus der bis dahin erzwungenen Anpassung an die Umwelt und wurde sesshaft. Er produzierte Lebensmittel und betrieb Vorratshaltung.
Dies leitete die Epoche der Jungsteinzeit (Neolithikum) ein und bedeutete die Abkehr von einem Leben in Verbundenheit mit der Natur unter Berücksichtigung der natürlich vorhandenen Ressourcen.
Dieser Prozess gilt bis heute als unumkehrbar.
Aufgrund der Konzentration auf wenige Nahrungsmittel entstand eine Abhängigkeit von Erträgen. Bei Missernten drohten Hungersnöte. Monokulturen erhöhten das Verlustrisiko durch Unwetter, Schädlingsbefall oder Bodenerschöpfung.
Es bildeten sich soziale Schichten mit unterschiedlichem Zugriff auf Ressourcen. Durch Viehhaltung in Herden oder dem Horten von Feldfrüchten war erstmals die Bildung von Vermögen möglich. Dies führte zu den heute noch vorherrschenden Ungerechtigkeiten und zu Ausbeutung und Unterdrückung.
Der durch die Sesshaftigkeit stark angestiegene Bevölkerungszuwachs und die Unmöglichkeit von schnellen Ortswechseln schuf Konflikte, denen die Menschen nicht mehr ausweichen konnten.
Besitz musste fortan gegen Verlust durch Raub oder Untergang verteidigt werden.
(Quelle: Wikipedia, gekürzt)
Auf ein Wort
Für den Autor dieses Buches bedeutet die neolithische Revolution den Anbeginn der globalen Katastrophe.
Schon vor fünf Millionen Jahren lebten die Vorfahren des modernen Menschen auf der Erde als Fischer, Jäger und Sammler.
Vor etwa 150.000 Jahren folgte der Homo Sapiens.
Noch bis vor etwa 10.000 Jahren lebte der Mensch im Einklang mit der Natur. Er nahm sich, was er für sich und seine Familie zum Leben brauchte. Mehr zu erlegen oder zu sammeln als man benötigte, verschaffte niemandem zu dieser Zeit einen Vorteil. Was man nicht selbst essen konnte, wäre dann verdorben.
Mit der neolithischen Revolution änderte sich das.
Auf einmal war es möglich, der Natur mehr zu entnehmen als man selbst zum Leben brauchte. Es entstanden Arm und Reich, stark und schwach, Ausbeutung und Sklaverei und Mord und Totschlag um das Vermögen eines Anderen.
Geschwister waren nun nicht mehr gut aufeinander abgestimmte und erfolgreiche Jäger, sondern plötzlich Konkurrenten um den landwirtschaftlichen Besitz des Vaters, den nur ein Nachkomme weiterführen konnte, um mit den Erträgen seine Familie zu ernähren.
Der ganze Wahnsinn gipfelte dann in Siedlungen, Großstädten und längst untergegangenen Riesenreichen.
Vorausgegangen waren Bodenerschöpfung, Abholzungen bis zum Kahlschlag und schließlich der Zusammenbruch kompletter Gesellschaften.
Nicht nur das Römische Reich entwaldete bereits weite Teile des Mittelmeerraums für Hausbau, Schiffbau, Heizmaterial und durch Überweidung und nicht zuletzt durch sein gigantisches Heer. Einst fruchtbare und nun ungeschützte Böden wurden durch Erosion vernichtet und blieben bis heute verloren.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts folgte das Industriezeitalter, in dem der Mensch endgültig jeglichen Kontakt zu seinem natürlichen Lebensraum aufgegeben hatte. Die fortschreitende und rücksichtslose Urbanisierung ging einher mit Flächenversiegelung, Vernichtung von Naturreserven und der Ausrottung von Arten.
Und heute erleben wir das Anthropozän im Endstadium.
Beinahe 8 Milliarden Menschen übervölkern die Erde und sie verhalten sich uneinsichtiger und ignoranter als je zuvor. Und jeden Tag werden es mehr und alle wollen alles haben. Sie erschöpfen den Planeten und beuten seine Ressourcen rücksichtslos aus.
Der Mensch hat längst den Respekt vor der Natur verloren und ordnet deren Schutz kommerziellen Interessen unter.
Naiv, zu glauben, dass dieses Verhalten ein gutes Ende nimmt.
Nach erfolgreichen 5 Millionen Jahren als Fischer, Jäger und Sammler hat es die invasivste Spezies auf der Erde in nur 10.000 Jahren geschafft, die natürlichen Abläufe in seiner Umwelt an den Rand des Kollapses zu führen.
Leben in irgendeiner Form wird es vermutlich auch in Zukunft auf der Erde immer geben. Es stellt sich nur die Frage, ob der Mensch daran noch teilnehmen wird.
Durch sein anhaltendes Wirken verändern sich sogar globale Luft- und Wasserströmungen auf der Erde und es ist bis dahin nur wenig bekannt, wie sich derartige Veränderungen auf das Klima auswirken werden.
Die Vollendung des Manuskripts zu diesem Buch fand im Spätherbst 2018 in Mitteleuropa (Hunsrück, Deutschland) statt.
Nach einem Dürresommer mit Rekordtemperaturen, Gewitterstürmen, Starkregenereignissen, Insektensterben und den ersten Ernteausfällen erwarten wir 29 Grad Celsius am morgigen Tag. Es ist Freitag der 12. Oktober 2018. Wolkenfreier Himmel und Sonnenschein seit Ende März, und eine nennenswerte Wetteränderung ist weiterhin nicht abzusehen.
Die Flüsse führen Niedrigwasser, die Schifffahrt wurde eingeschränkt oder bereits ganz eingestellt, Kraftwerke wurden herunter gefahren oder abgeschaltet, die Wälder sind trocken, Brandgefahr droht. Viele Jungbäume sind verdurstet. Die Landwirtschaft bekommt Nothilfen vom Staat. Tankstellen werden nur noch unzureichend mit Treibstoff versorgt, die Preise steigen.
Wer den Suchbegriff „Dürre und Hitze in Europa 2018“ in eine Internetsuchmaschine eingibt, erhält zum jetzigen Zeitpunkt beinahe 200.000 Treffer.
Ungeachtet dieser Entwicklung verkündete die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, ihr Klimaziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, aufzugeben.
Die USA leisten sich einen Präsidenten, der den Klimawandel gleich ganz leugnet und es gibt Politiker, die tatsächlich die Sonne als alleinigen Verantwortlichen entdeckt haben wollen.
All jenes lässt mich oft sprachlos zurück und zwingt mich, ernsthaft daran zu zweifeln, dass die Menschheit unter den vorherrschenden Bedingungen noch eine Chance hat. Ohne Zweifel müsste sie sich dafür sehr verändern.
Ich zitiere an dieser Stelle den Astrophysiker, Naturphilosophen, Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator Harald Lesch, der in einer Fernsehsendung von zwei Planeten sprach, die sich treffen.
„Du siehst aber schlecht aus“, sagt der Eine. „Was ist denn los mit dir?“
„Ich habe Menschen.“
„Das vergeht.“
Buch 1
Handbuch zur Rettung der Welt
Anthropozän 2050 Sommer
„Schaue nicht nach Westen, schaue nach Osten. Dort geht jeden Morgen eine neue Sonne auf.“
Mila
Die brachiale Wucht des Aufpralls hätte sie beinahe umgeworfen. Vor Schreck blieb sie wie erstarrt stehen. „Kannibalen!“, schoss ihr sofort ein Verdacht durch den Kopf. Sie hatte schon davon gehört.
Vor wenigen Sekunden erst hatte sie das Buch im Mauerschutt des zerstörten Gebäudes gefunden und fasziniert von Staub und Sand befreit. Gab es wirklich einmal Menschen, die so dicke Bücher schreiben konnten? Das musste sehr lange her sein.
Schon seit Wochen durchstöberte sie den Schutt zusammengefallener Häuser, sie brauchte dringend neue Kleidung. Also streunte sie vorsichtig durch die Trümmerlandschaft und suchte nach Schuhen, Hosen, Jacken und Pullovern. Immer mit höchster Aufmerksamkeit für ihre gefährliche Umgebung.
Doch nun hatte das silbern glänzende Geschoss den Buchdeckel durchschlagen, und steckte tief in den Seiten. Als sie das Zischen des Bolzens hörte, war es schon zu spät.
Das Buch hatte ihr soeben das Leben gerettet. Dank der paar Zentimeter Papier in ihren Händen würde sie morgen tatsächlich 16 Jahre alt werden. Wenn sie bis dahin nicht noch einmal einen Fehler beging. Ein fürstliches Alter in schrecklichen Zeiten.
Immer noch hielt sie das schwere Buch in Brusthöhe vor sich und war nicht imstande, sich zu bewegen. Zu furchtbar war die Erkenntnis, dass sie dieses eine Mal so unvorsichtig gewesen war und dem Schützen die Gelegenheit geboten hatte, aus seiner Deckung heraus auf sie zu schießen. Zu sehr war sie mit dem Buch beschäftigt gewesen, hatte alle Aufmerksamkeit darauf gelenkt und ihre Umgebung vernachlässigt. Deswegen hatte sie den hinterhältigen Angreifer nicht bemerkt. Ihre Unaufmerksamkeit hätte ihr junges Leben im selben Augenblick beenden können. Sie musste handeln. Jetzt! Sofort! Endlich sickerte die Erkenntnis in ihr Bewusstsein. Sicher spannte der Schütze seine Armbrust in diesem Moment erneut, legte einen Pfeil auf und zielte wieder auf sie.
Plötzlich spürte sie eine Hand im Nacken. Sie griff in den Stoff ihres verschmutzten, löchrigen Kapuzen-Pullovers, und ein kräftiger Arm riss sie hinter einem Mauerrest in Deckung. Sie schrie vor Schreck spitz auf. Sekundenbruchteile später zischte der zweite Pfeil dicht an ihrem Gesicht vorbei und zersplitterte mit einem lauten Knistern an den Mauerziegeln. An ihrem linken Auge hatte sie den Luftzug spüren können. Das war knapp! Irgendwo da draußen versteckte sich ein ausgezeichneter Jäger, und er hatte es auf sie abgesehen.
Bereits zum zweiten Mal hatte der Glücksgott sie heute innerhalb weniger Sekunden gerettet. Sie wollte seine Gunst nicht überstrapazieren und nahm ihr Schicksal wieder in die eigene Hand.
Den Anfang machte ein kurzer Blick hinter sich. Sie schaute in das gebräunte, weißbärtige Gesicht eines alten Mannes. Faltig, mit buschigen Brauen. Darunter stahlblaue Augen. Die blickten sie beinahe unbeteiligt an. Leidenschaftslos, aber nicht gefährlich. Sie hatten wohl nur schon so viel Unerfreuliches gesehen. Das lange graue Haar des Mannes war zu einem Zopf gebunden.
„Danke“, brachte sie leise hervor und wusste doch gar nicht, ob er ihre Sprache sprach.
Er nickte stumm. Hatte er wirklich verstanden, was sie gesagt hatte oder nur ihren Dank entgegen genommen, ohne zu wissen, was das Wort bedeutete?
Es blieb keine Zeit, darüber nachzudenken.
Der Alte spannte seine Armbrust und legte einen Bolzen auf. Auch er verlor keine Zeit, und das war auch nötig, denn der Angreifer wusste, wo sie sich versteckten und würde versuchen, sie doch noch zu erwischen.
Jetzt erinnerte sie sich an ihren Bogen auf dem Rücken und die Pfeile. Sie ließ das Buch fallen.
Mit einer tausendfach trainierten Bewegung hatte sie die weittragende Waffe schussbereit gemacht und ging damit in den Anschlag. Dann legte sie einen Pfeil an die Sehne. Der Alte schob sie sanft beiseite und riskierte einen Blick. Schnell zog er den Kopf wieder hinter den Mauervorsprung zurück und zeigte mit einem Finger nach oben. Sie verstand sofort. Er wollte auf die obere Etage der Ruine klettern und den Angreifer von dort unter Beschuss nehmen.
Jetzt riskierte auch sie einen kurzen Blick. Aber sie konnte den Schützen nicht sehen. Nur die Reste des Verdecks eines verrosteten Traktors bewegten sich leicht im lauen Wind.
Schnell zog sie ihren Kopf wieder zurück. Fieberhaft überlegte sie, ob ihre Deckung gut genug war oder ob sie eine andere Stelle suchen sollte.
Dann hörte sie ein metallisches Klacken über sich und kurz darauf im Gelände vor der Ruine einen Schrei. Sofort hielt sie nach dem getroffenen Schützen Ausschau und entdeckte einen roten Haarschopf im hohen Gras in der Nähe des Traktorwracks.
Sie legte an, spannte die Sehne und ließ sie vorschnellen. Der Pfeil schoss davon und bohrte sich an der Stelle in den Boden, an der soeben noch der Schütze gelegen hatte. Doch der hatte das Manöver vorausgesehen und sich sofort davongerollt.
Sie hörte ein leises Wimmern. Der Alte jedenfalls hatte den Angreifer getroffen, so viel stand fest.
Er hatte von seiner erhöhten Position aus eine bessere Sicht und einen steileren Schusswinkel.
Sie entschied sich, zu bleiben. Vorerst waren sie in diesem Gemäuer sicher. Es sollte bald dunkel werden. Dann würde der Angreifer bestimmt einen Versuch unternehmen, sich heranzuschleichen. Sie durften nicht schlafen.
Aber was wollte der Schütze überhaupt von ihnen?
„Was willst du?“, rief sie in die Abenddämmerung hinein.
„Essen!“, erklang die Antwort aus geringer Entfernung. Der Schütze verlor keine Zeit und arbeitete sich offenbar immer näher an sie heran.
Es war eine weibliche Stimme mit Akzent. Doch sehen konnte sie die Angreiferin nicht.
„Wir haben nichts.“
„Doch! Ich habe gesehen.“
„Wir brauchen es selbst.“
Keine Antwort.
„Verschwinde, sonst töten wir dich.“
„Nein!“
„Wieso nicht? Du bist verletzt.“
„Kinder. Hunger. Sie sterben.“
Tja, so war die Lage also. Rotschopf musste sie bereits eine Weile beobachtet haben und hatte dann beschlossen, dass sich für die zu erwartende Beute ein Angriff lohnen würde. Und nun saßen sie fest. Alle drei. Jeder belauerte den anderen und wartete darauf, dass er den ersten Fehler machte. Das sah nach einer langen Nacht aus.
Über sich hörte sie einen leisen Pfiff. Sie schaute nach oben. Der Alte gab ihr zu verstehen, dass sie herauf kommen sollte. Sie zögerte nicht. Dort oben bot ihnen die Ruine mehr Schutz, als unten, und man hatte einen besseren Überblick über das umliegende Gelände.
Sie teilten die Überwachung der Umgebung auf. Jeder bezog seinen Beobachtungsposten. Er im Westen, sie im Osten.
Sie fühlte sich sicher. Gemeinsam hielten sie Wache. Dort oben waren sie im Vorteil. Mütterchen Rotschopf musste etwas riskieren und sich anschleichen. Und dabei würden sie sie erwischen. Oder sie gab auf und verschwand. Das dicke Buch hatte sie mitgenommen. Nun lag ihr Lebensretter neben ihr und der Pfeil darin schimmerte silbern im Mondlicht.
Mehr als zwei Stunden vergingen. Nichts war geschehen. Hatte Rotschopf aufgegeben und das Weite gesucht? Wie schwer war sie verletzt? Vielleicht war sie längst verblutet und lag tot dort unten im Gras.
Das schwache Restlicht am Horizont mischte sich mit dem Schein des aufgehenden Mondes.
Sie begann, über den Alten nachzudenken.
„Wie heißt du?“, flüsterte sie in das Halbdunkel hinein.
„Joshua. Und Du?“
„Mila.“
„Okay, Josh. Und wie geht es jetzt weiter?“
„Wir warten.“
„Ich muss pinkeln.“
„Nicht jetzt.“
„Doch!“
„Dann mach halt.“
„Hier?“
Sie bekam keine Antwort. Sie schaute sich um.
Nicht weit von ihrem Posten entfernt hing ein Stück des zusammengefallenen Daches herab. Das musste als Sichtschutz reichen.
Josh sah Mila hinter den Resten des Dachstuhls verschwinden. Aufmerksam beobachtete er weiter die Umgebung und lauschte nach jedem noch so leisen Geräusch. Ihm war klar, dass die Dunkelheit ihnen nun zum Nachteil wurde.
Nervös wartete er darauf, dass Mila wieder ihren Posten bezog.
„Was macht die denn da so lange?“, murmelte er kaum hörbar vor sich hin und drehte sich um. Und dann sah er die Silhouette scharf gegen das Mondlicht.
Ihre Armbrust war gespannt und auf ihn angelegt.
„Wo ist Freundin?“, fragte sie leise.
„Weg“, log er krächzend.
„Du lügst.“
Er antwortete nicht.
Sie gab sich offenbar damit zufrieden, zog die Armbrust fester an ihre Schulter und verschwand im Schatten eines Mauerrestes. Ihr tödlicher Schuss stand unmittelbar bevor.
„Du hast lange genug gelebt, alter Mann. Deine Zeit ist um.“
„Hier, du kannst alles haben“, bot Josh an und deutete auf seinen Rucksack.
„Ich weiß“, bestätigte sie kalt.
„Du musst mich nicht töten“, startete er einen letzten Versuch.
„Doch. Sonst tötest du mich und Kinder an einem anderen Tag.“
„Gib auf, wir wollen dich nicht töten“, erklang Milas Stimme plötzlich aus dem Dunkeln.
„Das geht nicht. Kinder haben Hunger.“
Unmerklich entlastete die Frau ihr linkes Bein und schnellte mit der Armbrust im Anschlag herum. Sie war überzeugt davon, dass der gefährlichere Gegner nicht alt und grau vor ihr am Boden saß, sondern jung und mit auf sie angelegtem Bogen schräg hinter ihr lauerte. Schnell trat sie einen Schritt zur Seite und erkannte augenblicklich ihren tödlichen Fehler. Sie verließ dadurch den schützenden Schatten des Mauerwerks und stand nun im fahlen Mondlicht, und das reichte aus, um sie gut sehen zu können.
Darauf hatte Mila gewartet. Denn von ihrer Position aus konnte sie Rotschopf bisher nicht gut genug erkennen, um einen sicheren Schuss abzugeben. Und die Zeit, um nach einem Fehlschuss einen zweiten Pfeil aufzulegen, würde Rotschopf ihr nicht lassen.
Die Mutter der hungernden Kinder hingegen hatte gehofft, dass ihre Gegnerin ihren Pfeil abfeuert, wenn sie sich umdreht. Durch ihren schnellen Schritt zur Seite wollte sie dem Geschoss entgehen. Dann wäre sie am Zug gewesen und könnte das Blatt zu ihren Gunsten wenden. Doch der Plan ging nicht auf.
Sie spürte sofort, dass ihr viel Blut aus dem Hals pulsierte, warm über ihre Brust ran und in ihre Kleidung sickerte. Der Pfeil steckte unterhalb des Kinns mit mehr als der Hälfte seiner Länge in ihrem Hals. Sie sackte auf ihre Knie und ließ die noch gespannte Armbrust sinken. Der Bolzen fiel hinunter.
Vor ihr trat Mila aus dem Schatten eines Dachrestes in das Mondlicht. Sie hatte bereits einen zweiten Pfeil angelegt und zielte mit dem gespannten Bogen auf die sterbende Frau. Ein großes Blutgefäß in ihrem Hals war durchtrennt worden. Ihr Todeskampf würde nicht lange dauern. An ihrer linken Wade entdeckte Mila einen schmutzigen, durchbluteten Verband.
Josh löste sich aus seiner Starre und stand auf. Die rothaarige Frau schwankte und drohte auf ihr Gesicht zu fallen. Josh fing sie auf und half ihr, sich auf den Rücken zu legen. Der Mond spiegelte sich in ihren weit aufgerissenen Augen.
„Wie heißt du?“, fragte Josh, während Mila weiterhin auf die Frau anlegte.
„Raissa“, erklang es kaum hörbar.
„Wo sind deine Kinder? Wie finden wir sie?“
Raissa wollte etwas sagen. Ihre Lippen bewegten sich, aber es kam kein Ton dazwischen hervor. Dann bewegten sie sich nicht mehr. Ihr Kopf fiel zur Seite. Ein Schwall Blut lief Raissa aus dem Mundwinkel. Mila entspannte ihren Bogen und ließ ihn sinken.
„Hättest du wirklich nach ihren Kindern gesucht?“
„Nein. Aber es hätte sie beruhigt und ihr Hoffnung gegeben, in den letzten Sekunden ihres Lebens.“
„Sie wollte uns für ihre Brut killen!“, protestierte Mila verständnislos.
„Ja“, antwortete Josh knapp und behielt den Rest dessen, was er hätte sagen wollen für sich. Denn es gab eine Zeit, in der die Menschenwürde und das Mitgefühl die höchsten Güter der Zivilisation waren. Aber das war lange vorbei, und Mila war zu jung, um etwas darüber zu wissen. Sie kannte nur den gnadenlosen Kampf ums Überleben. Du oder ich. Jeder gegen jeden. In ihrer Not fraßen die Menschen sich schon gegenseitig auf. Hatte man ihm erzählt. Glauben wollte er das nicht.
„Lass uns verschwinden“, schlug Mila vor und riss Josh aus seinen dunklen Gedanken.
Sie durchsuchten Raissas Kleidung und nahmen an sich, was sie gebrauchen konnten. Ihre Stiefel fielen etwas zu groß aus für Milas Schuhgröße. Sie tauschte sie trotzdem gegen ihre verschlissenen Turnschuhe. Die restlichen Kleidungsstücke waren von Raissas Blut durchtränkt und somit unbrauchbar. Josh griff nach ihrer Armbrust und untersuchte sie fachmännisch.
„Zusammenklappbar und besser, als meine“, stellte er fest.
Mila hatte ihre Stiefel fest geschnürt und stand auf.
„Behalt sie. Ich bleibe bei meinem Bogen.“
Josh suchte nach dem Bolzen, fand ihn und steckte ihn ein. Mila hob ihr Buch vom Boden auf und begann damit, den Pfeil herauszuziehen. Dann hatte sie es geschafft.
„Hier“, rief sie und warf Josh den Bolzen zu.
Geschickt fing er ihn auf. Überhaupt erschien Mila dieser alte Mann jünger, als er aussah. Drahtig. Gut trainiert. Ein gefährlicher Gegner, wenn man ihn zum Feind hatte.
Josh sah Mila mit dem Buch unter dem Arm im Mondlicht davongehen.
„Wo willst du hin?“
„Du hast deinen Weg, ich habe meinen. Mach’s gut. Wir sind quitt.“
So waren sie, die neuen Menschen. Eiskalt. Kalkulierend. Sie mussten in einer feindlichen Umgebung überleben. Da leistete man sich keine Gefühle. Doch Josh wurde vor mehr als 70 Jahren in eine längst untergegangene, andere Welt geboren.
„Was schleppst du da mit dir herum?“, ließ er nicht locker und wollte nicht glauben, dass Mila einfach so davon ging.
„Ein Buch.“
„Was für ein Buch?“
„Weiß nicht. Hab‘ noch nicht nachgesehen?“
„Kannst du lesen?“
„Ja.“
„Es ist schwer und sperrig. Wieso mühst du dich damit ab?“
„Es hat mir das Leben gerettet.“
„Was steht drin?“
Mila schlug den Buchdeckel auf und drehte sich in das Mondlicht. Einige Seiten des Buches waren an den Rändern verkohlt. Offenbar hatte es ein Feuer überstanden.
„Ethisch moralische Betrachtung der Menschheit des 21. Jahrhunderts“, las sie vor. „Von Jonathan Boyle. Klingt jetzt nicht so spannend.“
„Professor Doktor Jonathan Boyle“, vervollständigte Josh. „Wirtschaftswissenschaftler und Volkswirt.“
„Du weißt etwas über diesen Typen?“
„Ja. Und über das Buch.“
„Kanntest du ihn?“
„Zu meiner Zeit kannten ihn viele. Nicht persönlich, aber als Autor dieses Buches da in deinen Händen.“
Mila drehte es hin und her.
„Sieht nicht besonders wichtig aus.“
„Ist es aber“, widersprach Josh und trat dicht an Mila heran. „Es war das ‚Handbuch zur Rettung der Welt‘.“
Mila schnaufte.
„Hat ja super geklappt“, stellte sie ironisch fest.
„Dafür kann das Buch nichts. Heute hat es nur dich gerettet. Damals hätte es uns alle retten können.“
Mila dachte nach. Josh spürte ihre Unsicherheit.
„Lass uns zusammen ein Stück unseres Weges gehen. Ich bin nicht gern allein, und ich erzähle dir mehr über Jonathan Boyle und dieses Buch.“
Milas Neugier war geweckt. Neben dem täglichen Überlebenskampf gab es wenig Abwechslung. Und am Feuer abends eine gute Geschichte zu hören, war nicht das Schlechteste. Und sie konnte immer noch gehen, wenn ihr der Alte lästig wurde.
Dieses Buch war von nun an ihr Talisman und Josh würde ihr mehr darüber erzählen. Vor ein paar Stunden hatte es nur sie allein gerettet, aber wenn es die ganze Welt hätte retten können, dann wollte sie mehr erfahren.
„Einverstanden.“
Ein warmes, beinahe vergessenes Gefühl durchströmte Josh. Er empfand es vor langer Zeit für Menschen, die bereits alle tot waren. Und dieses aufgeschossene junge Mädchen dort mit seinen zottigen blonden Haaren erinnerte ihn wieder daran.
„Wie alt bist du eigentlich?“, fragte er und verließ die obere Etage der Ruine als Erster.
„16?“, hörte er Mila wenig überzeugt hinter sich antworten.
Draußen vor dem Gebäude blieb er stehen und drehte sich um.
„Du weißt es nicht?“
„Wieso? Kommt doch hin oder?“
Mila schaute ihn Bestätigung einfordernd an. Josh beließ es dabei. Er schätzte sie etwas älter. Aber was spielte das schon für eine Rolle? Ein Wunder, dass sie allein und herumstreunend überhaupt so alt geworden war.
Sie suchten im Mondlicht kurz nach einer Stelle im Gras, an der Raissa Dinge abgelegt haben könnte, die sie gebrauchen konnten. Fanden aber nichts. Vielleicht war sie auch nur mit dem unterwegs gewesen, was sie bei sich getragen hatte.
Mila zog ihren Pfeil aus dem Boden und holte ihren großen Rucksack aus einem Versteck. Dann verließen sie die zerstörte Ortschaft. Josh ging voraus. Er hatte anscheinend ein Ziel.
„Ich bin müde“, reklamierte Mila.
„Ist nicht mehr weit.“
Unter hohen Bäumen, von einem Dickicht aus Büschen umstellt parkte gut getarnt ein Toyota Pick-up mit auf der Ladefläche montiertem und mit grüner und brauner Farbe angestrichenem Wohnmobilaufbau.
Mila bemerkte das geländegängige Fahrzeug erst, als sie schon dicht davor stand.
„Fährt der noch?“, fragte sie überrascht und erstaunt zugleich.
„Wenn ich Häuser finde, deren Heizöltanks noch nicht leer sind, ja. Aber es wird immer schwieriger, Treibstoff aufzutreiben. Auch neue Reifen oder andere Ersatzteile sind ein Problem.“
Lange schon hatte Mila nicht mehr in einem Bett geschlafen. Geschützt vor dem Wetter und den Tieren der Nacht in einem Raum und wenigstens zwei Hände breit über dem Boden.
In Joshs Wohnkabine befanden sich gleich zwei Betten. Eines hoch oben im Alkoven und eines unten, in der kleinen Küche, wenn man die Sitzgruppe dazu umbaute.
„Du kannst oben schlafen. Ich bleibe hier unten.“
Das ließ Mila sich nicht zweimal sagen. Geschickt erklomm sie den Alkoven, legte ihren Bogen und ihre Pfeile neben sich ab und streckte sich auf dem Rücken liegend aus. Mit über ihrem Bauch gefalteten Händen lag sie da und hörte Josh unter sich rumoren. Dass er ihr noch eine gute Nacht wünschte, bevor er sich selbst niederlegte, hörte sie nicht mehr.
Josh
Josh war am nächsten Morgen als Erster aufgestanden und hatte sein Bett wieder zur Sitzgruppe umgebaut.
Das Frühstück für die beiden bestand aus einer Dose Pfirsichhälften, abgelaufen 2036, also vor 14 Jahren, aber noch einwandfrei. Dazu Brot. Trocken und hart, aber so schwer zu bekommen, dass man es nur gegen sehr wertvolle Dinge tauschen konnte. Gegen Waffen, Kleidung, Treibstoff, Medikamente oder gegen Sex.
Josh musste es in das Zuckerwasser der Pfirsiche stippen, damit er es kauen konnte.
„Wo hast du das her?“, fragte Mila mit vollem Mund und kaute krachend auf einem besonders harten Endstück.
Josh lehnte sich auf seiner Bank gesättigt zurück.
„Aus einer Siedlung. Ungefähr 100 Kilometer nördlich von hier.“
„Und? Sind die Menschen okay dort?“
Josh schaute aus dem Fenster.
„Ein verwanztes Dreckloch, wenn du mich fragst. Wie überall. Ich habe zugesehen, dass ich da schnell wieder wegkomme.“
„Es soll ein Tal geben, in dem es sich wunderbar leben lässt. Oben, in den Bergen.“
„In welchen Bergen?“
Mila zuckte mit den Schultern und stach mit ihrer Gabel nach der letzten Pfirsichhälfte in der Dose. Hungrig stopfte sie sich die ganze Frucht in den Mund. Zuckerwasser lief ihr am Kinn herab. Mit dem Ärmel ihres Kapuzenpullovers wischte sie es fort. Dann leckte sie das Besteck ab, schob es wieder zusammen und ließ es in einer Beintasche ihrer verschlissenen Cargohose verschwinden. Es war eines dieser zusammenschiebbaren Sets aus Militärbeständen bestehend aus Messer, Löffel, Gabel und einem Dosenöffner. Edelstahl. Sehr wertvoll in diesen Zeiten.
Mila deutete auf die Konservendose, in der sich nur noch das Zuckerwasser befand.
„Kann ich das haben?“
Josh nickte. Mila setzte die Dose an ihren Mund und stürzte die süße Brühe hinunter. Dann rülpste sie und ließ die Dose sinken.
„Ich hab’ ein Foto“, verkündete sie stolz.
„Von dem Tal?“, zweifelte Josh.
„Genau.“
Mila kramte in der anderen Beintasche ihrer Hose und holte tatsächlich ein Stück Papier heraus. Bevor sie es Josh gab, wischte sie beinahe liebevoll mit dem Ärmel ihres Pullovers darüber und sah es sich an. Josh griff danach und sah sofort, was er erwartet hatte. Ohne es sich weiter zu betrachten, gab er es Mila zurück.
„Was?“, fragte sie ungehalten.
„Das war mal eine Postkarte. Mehr nicht. Es gibt kein Tal. Es gibt nur zerstörtes Land, kranke, mordlustige Menschen und eine verseuchte Umwelt. Sonst nichts.“
Mila sprang auf. So heftig, dass der Tisch wackelte.
„Das stimmt nicht, alter Mann. Denn wenn es stimmen würde, was du sagst, gäbe es keine Hoffnung mehr.“
Seine Ehrlichkeit tat Josh nun leid. Er bereute, was er soeben gesagt hatte. Was sollte man auch als junger Mensch mit einem ganzen Leben noch vor sich anfangen, wenn es keine Hoffnung mehr gab?
„Vielleicht hast du ja recht“, beruhigte er Mila.
Misstrauisch steckte sie das Foto sorgfältig wieder zurück in ihre Tasche.
„Ich habe auch schon davon gehört“, log er ihr zuliebe.
„Wir müssen los“, verkündete er und erhob sich ebenfalls.
Josh hatte am Tag zuvor in dem zerstörten und verlassenen Ort in einem Keller einen Tank gefunden, in dem sich noch ein paar Dutzend Liter Heizöl befanden.
Der Pick-up hatte einen Dieselmotor und konnte mit dem bis auf die Farbe identischen Brennstoff fahren. Josh musste es nur aus dem Heizöltank heraus in Kanister pumpen.
Das war der gefährlichste Moment der Aktion. Denn sein Wohnmobil stand dann für jeden gut sichtbar in der Nähe der Ruinen, während er im Keller eines Hauses den Treibstoff abfüllte. Aber die schweren Kanister konnte er nicht weit tragen.
Heute würde Mila sein Risiko minimieren, von einem Fremden überrascht zu werden. Sie sollte Wache halten.
Josh hatte den Pick-up hinter einer Buschgruppe abgestellt. Damit war das Wohnmobil zwar nicht gerade unsichtbar, aber es stand zumindest nicht wie auf dem Präsentierteller.
Mila erkannte die Reste des Gebäudes sofort wieder. Oben, auf der zweiten Etage, hatten sie die Leiche von Raissa zurückgelassen.
Josh verlor keine Zeit und stieg mit zwei großen Blechkanistern in den Heizungsraum hinab. Mila erklomm das obere Stockwerk und erschrak. Rotschopf war weg!
Entweder war sie nicht tot und hatte sich davon geschleppt, oder jemand hatte ihre Leiche weggebracht. Blutige Schleifspuren auf dem Boden deuteten auf Letzteres hin.
Mila machte ihren Bogen schussbereit und zog einen Pfeil aus dem Köcher. Dann stellte sie sich so an eine Fensteröffnung im Mauerwerk, dass sie das Gelände beobachten konnte, welches Josh durchqueren musste, wenn er die Kanister zum Pickup schleppte.
Mit einem an die Sehne gelegten Pfeil stand sie gegen das grelle Sonnenlicht blinzelnd da und ließ ihren Blick aufmerksam über das hohe Gras schweifen.
Josh trat vor die Hausruine und stellte die ersten beiden Kanister davor ab.
„Psst. Josh“, zischte sie.
Er schaute nach oben.
„Raissa ist weg.“
Joshs Gesichtsausdruck verdunkelte sich. Er wusste, das konnte Ärger bedeuten.
Plötzlich hörte Mila hinter sich ein Geräusch und fuhr herum. In der Drehung ihres Körpers spannte sie den Bogen und legte sofort auf den Verursacher an. Eine Taube.
Der Pfeil durchbohrte sie, bevor sie auffliegen konnte. Die nächste Mahlzeit war also gesichert. Schnell entfernte sie den Pfeil aus dem Tier, klemmte es mit seinen Krallen unter ihrem Gürtel fest und bezog wieder ihren Posten.
Vier Kanister standen bereits vor der Hausruine. Zwei noch. In einiger Entfernung nahm Mila im hohen Gras eine Bewegung wahr. Wie am Abend zuvor in der Nähe des Traktorwracks. Ein fremder Mann. Er trug eine Armbrust bei sich und hatte sie offenbar noch nicht bemerkt. Er schlich geduckt im Schutz von niedrigen Büschen über das Gelände und konzentrierte sich auf Josh. Hatte er Raissas Leiche fortgeschafft? Mila verspürte wenig Lust, ihn danach zu fragen.
Noch war der Mann zu weit weg, um einen sicheren Schuss abgeben zu können. Doch Mila spannte vorsorglich ihren Bogen und legte auf ihn an. Geduldig lauerte sie in ihrem Hinterhalt.
Josh kam mit den letzten beiden Kanistern aus dem Keller und lief damit sofort in Richtung des Pick-ups.
Der Mann im hohen Gras beobachtete ihn und wartete, bis Josh außer Sicht war. Dann sprang er auf und sprintete los. Er wollte die Kanister, da war sich Mila sicher, und sie sorgte sich plötzlich um Josh. Was, wenn ihn am Pick-up ein zweiter Mann erwartete?
Milas Pfeil traf den Mann in vollem Lauf in die Brust. Nach einem einzigen Röcheln brach er zusammen und blieb liegen.
Josh war bereits auf dem Weg zurück zur Hausruine und hatte den Mann im hohen Gras fallen gesehen. Kurz darauf entdeckte er auch Mila. Sie rannte zu der Stelle hin, stellte ihren Fuß auf den leblosen Körper, riss ihren Pfeil mit einem heftigen Ruck heraus und entfernte sich sofort wieder.
Als Josh das Gebäude erreichte, lief sie ihm schon mit zwei Kanistern an den Armen und einem blutigen Pfeil im Köcher entgegen. Nur kurz hatte sie mit dem Gedanken gespielt, ihren Pfeil in dem toten Mann einfach stecken zu lassen, aber Pfeile waren zu wertvoll. Es machte viel Arbeit, das richtige Material zu finden und es zu bearbeiten.
Josh beeilte sich, die letzten beiden Treibstoffkanister ebenfalls zum Pick-up zu schleppen.
Sie verstauten die Kanister in der Wohnkabine und sprangen in den Wagen. Tanken konnten sie auch später. Josh startete den Motor. Jeden Moment erwarteten sie einen Angriff und duckten sich so tief wie möglich hinter das Blech der Türen. Josh gab zu viel Gas. Heftig rumpelte der Pick-up los. In der Wohnkabine polterte etwas zu Boden. Doch der befürchtete Angriff blieb aus. Niemand beschoss sie. Niemand versuchte, ihnen den Weg zu versperren.
Ungehindert lenkte Josh das schwere Fahrzeug auf die Reste einer Landstraße und ließ es über den aufgeplatzten Asphalt rollen. Mila zog die Taube von ihrem Gürtel und ließ das tote Tier in den Fußraum vor sich fallen.
Immer wieder geriet eines der Räder des alten Wagens in ein tiefes Schlagloch. Josh bemühte sich kaum, ihnen auszuweichen. Es waren zu viele.
Kleine Bäume hatten ihren Weg durch die Fahrbahndecke gefunden. Sie verschwanden mit einem dumpfen Schlag vor der Motorhaube und schabten am Unterboden entlang.
Mila ließ sich das Gesicht mit geschlossenen Augen von der Sonne bescheinen und genoss den lauen Fahrtwind, der ihr durch das offene Fenster die Haare zerzauste. Mehr, als sie es ohnehin schon waren.
„Du bist sehr geschickt im Umgang mit deinem Bogen“, rief Josh gegen den Motorlärm an. „Ein guter Schütze. Und ein guter Feldbogen. Carbon. Sehr wertvoll. Nicht nur in diesen Zeiten. Ein Schatz. Beinahe Reichtum. Man wird bereits für sehr viel weniger umgebracht. Woher hast du ihn?“
Mila öffnete ihre Augen.
„Von so einem Typen halt.“
„Lebt er noch?“
Mila antwortete nicht.
„Wo kommst du her?“
„Ist ’ne lange Geschichte.“
Josh grinste.
„Wir haben Zeit. Wenn wir auch nicht viel haben. Aber Zeit, davon haben wir genug.“
Mila sah ihn für einen Augenblick stumm an und begann, zu erzählen.
„Eines Abends zerrten sie uns aus unserer kleinen Wohnung, in der wir schon seit Wochen ohne Strom und fließend Wasser ausharrten, und holten mich und meine Mutter ab. Sie wollten uns angeblich in Sicherheit bringen. Vor wem und wohin sagten sie nicht. Noch am gleichen Abend wurde meine Mutter vor meinen Augen von ihnen vergewaltigt und enthauptet. Ich riss mich los und rannte so schnell ich konnte, bis ich zusammenbrach und mich übergab. Etliche Kilometer war ich gelaufen, und dann war ich am Ende meiner Kräfte und wartete darauf, gefangen genommen zu werden. Eine Stunde lang lag ich auf dem Rücken, bis sich mein Puls und meine Atmung beruhigt hatten. Doch es kam niemand. Sie hatten mich wohl aus den Augen verloren und die Verfolgung aufgegeben. Wozu sich auch anstrengen? Hunger und Durst, wilde Tiere oder eine Verletzung oder eine Infektion würden mich ohnehin in wenigen Tagen dahinraffen.“
Josh schwieg einen Moment, wich einem Baum aus, der zu dick war, um ihn einfach umzufahren und fragte endlich: „Wie lang ist das her?“
Mila zuckte mit den Schultern.
„Weiß nicht genau. 10 Jahre?“
Josh schwieg erneut und gab ihr Zeit darüber nachzudenken, ob sie ihm auch den Rest erzählen wollte.
„Ich schaffte es bis zu dem Lager einer Familie. Mitten im Wald. Sie nahmen mich auf. Ich musste für sie arbeiten und wurde dafür durchgefüttert. Der Mann hat sich irgendwann auf mich gelegt und an mir herumgefummelt. Sein Atem stank nach faulen Zähnen. Ich habe ihm einen seiner Pfeile in den Wanst gerammt.“
„Gehörte ihm der Bogen?“
Mila nickte.
„Ich habe mich allein durchgeschlagen. Wie das so lange gut gehen konnte, weiß ich bis heute nicht.“
Josh nickte und wusste, Mila musste schnell lernen und begreifen. Denn das Leben auf dem zerstörten Planeten war erbarmungslos.
Mila musste sich von da an selbst eine gute Mutter sein. Wenn sie nicht an sich und ihr Überleben dachte, wer sonst sollte es tun? Nur ein gesunder, starker Mensch, konnte in diesen Zeiten überleben.“
„Wie heißt du richtig?“
Mila schaute ihn verständnislos an.
„Vorname. Nachname“, korrigierte sich Josh.
Mila hob ihre Schultern und ließ sie wieder sinken.
„Ich streifte Jahre lang durch die Wälder und die Ruinen. Und eines Tages hatte ich meinen Vornamen vergessen. Niemand hatte mehr nach mir gerufen. Er war einfach weg. Nur an meinen Nachnamen erinnerte ich mich. Die Männer, die uns abgeholt hatten, haben meine Mutter so genannt. ‚Milanovic‘, haben sie sie gerufen. Ich nannte mich einfach Mila Novic.
Ich weiß auch nicht mehr, wie meine Mutter ausgesehen hat. Ich habe ihr Gesicht vergessen. Ich erinnere mich nur noch an ihre verzerrte Fratze unter ihren unerträglichen Qualen. Aber ich habe nicht vergessen, was sie als Letztes zu mir gesagt hat. ‚Schaue nicht nach Westen, schaue nach Osten. Dort geht jeden Morgen eine neue Sonne auf.‘“
Josh hatte genug gehört. An einem weiteren Gespräch scheinbar desinteressiert schaute er aus seinem Seitenfenster und übersah ein großes Schlagloch. Das Fahrwerk krachte und ächzte, als erst das rechte Vorderrad und dann das Hinterrad darüber hinweg polterten.
„Hey! Pass auf. Du bringst uns noch um“, protestierte Mila.
Erschrocken sah Josh wieder nach vorn.
Dass Mila ihren Namen vergessen hatte, wunderte ihn nicht. In besseren Zeiten deutete man solche Symptome als posttraumatische Belastungsstörung und man wurde krankgeschrieben. Ein Psychiater kümmerte sich dann um das Seelenleben des Patienten.
Josh dachte darüber nach, welchen Teil seiner Vergangenheit er Mila erzählen wollte und entschied sich für das Nötigste.
„Ich hatte auch mal eine Familie", begann er. „Mein Sohn starb an einem multiresistenten Keim, als es das marode und kaputtgesparte Gesundheitswesen noch gab. Meine Frau wurde von einem herumstreunenden Kerl erschossen, weil sie zwei Dosen Bohnen bei sich trug.“
Mila nickte. Ähnliche Geschichten hatte sie immer wieder gehört. Die Welt war aus den Fugen.
Sie griff nach ihrem Buch und strich liebevoll über den Deckel mit einem großen Loch darin. Dann schlug sie es auf und versuchte, zu lesen. Aber während der Wagen über die schlechte Straße rumpelte, wurden sie zu sehr durchgeschüttelt. Sie klappte es wieder zu.
„Erzähl mir etwas über das Buch.“
Das Buch
Josh überlegte kurz.
„Im Grunde steht da nichts drin, was die Menschen nicht schon gewusst hätten. Jonathan Boyle hat es nur zusammengetragen und mahnende Worte gefunden. Schutz der Umwelt. Nachhaltiges Wirtschaften. Schonung der Ressourcen. Gesellschaftlicher Nutzen vor Gewinnstreben. Banken und Konzerne entmachten. Arbeitsplätze, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden und nicht denen, der Maschinen. Sozialabgaben auf Maschinen und Techniken erheben, die Arbeitsplätze vernichten. Beenden des Artensterbens. Gemeinwohl vor Einzelwohl. Die menschliche Population begrenzen. Entscheidungen frei von Ideologien, Religion und Gesinnung treffen. Keine Verschwendung von Volksvermögen. Hunger und Not bekämpfen, in dem die, denen es gut geht, sich bescheiden und teilen. Kapitalflucht verhindern. Reiche nötigenfalls enteignen.“
„Und?“, unterbrach ihn Mila. „Was ging schief? Denn, dass ihr drauf geschissen habt, ist ja nicht zu übersehen.“
„Ja“, gab Josh zu. „Die Menschen haben drauf geschissen. Über 7 Milliarden Menschen. Und alle wollten alles haben. Das konnte nicht gut gehen. Alle sechs Sekunden verhungerte irgendwo auf der Welt ein Kind und in den Industriestaaten wurde über Belanglosigkeiten stundenlang debattiert. Es war lächerlich. 2030 kam es endgültig zum Kollaps. Die riesigen Ströme von Menschen auf der Flucht vor Hunger, Umweltverseuchung und Mangel an Wasser und medizinischer Versorgung brachten die westlichen Gesellschaften ins Wanken. Bürgerkriege brachen aus. Hungernde gegen Übersatte. Arme gegen Reiche. Das mittlerweile unterdimensionierte und Leistungsschwache, auf Profit ausgelegte Gesundheitswesen brach schnell zusammen. Lebensbedrohliche Keime und Bakterien breiteten sich ungehindert aus. Seuchen rafften viele Menschen dahin. Einer extremistischen Gruppe gelang es, an spaltbares Material zu kommen, sie zündete eine schmutzige Bombe. Halb Europa lag unter einem radioaktiven Fallout. Gleichzeitig gingen die Erträge auf den Feldern der Landwirtschaft zurück. Die hochgezüchteten Pflanzen kamen mit den ausgelaugten und überdüngten Böden und der zunehmenden Trockenheit aufgrund des Klimawandels nicht mehr zurecht. Da nützten auch keine Pflanzenschutzmittel mehr, die bereits 80 Prozent der Insekten ausgerottet hatten. Die Vögel fanden daraufhin nicht mehr ausreichend Futter. Und so ging es immer weiter. Immer mehr Teile des Systems, von dem der Mensch abhängig war, vielen aus. Und dann, letztendlich, gab uns ein mutiertes Virus den Rest. Aus dem heruntergekommenen Stall eines Geflügelzüchters entwichen wurde es von den Reisenden über die ganze Welt verteilt. Unsere Medikamente waren wirkungslos, weil wir sie zur Profitmaximierung in die Viecher gespritzt hatten. Die Pandemie raffte beinahe alle Menschen dahin. Sie starben wie die Fliegen. Wer sich angesteckt hatte, konnte nur verlieren und sein Todeskampf war nach zwei Tagen vorbei. Zu Beginn hat man die Leichen noch mit Radladern in Verbrennungsanlagen gefahren. Doch dann fehlte immer mehr Personal. Also blieben sie einfach dort liegen, wo sie umgefallen waren.
Die Erde schüttelte uns aus ihrem Pelz. Wir waren Schädlinge. Parasiten. Und mit uns geschah, was die Natur mit jeder Überpopulation tut. Sie rafft sie dahin.
Das Eis an den Polen war abgeschmolzen. Die Meeresspiegel stiegen. Inseln und tief liegende Länder versanken und liegen heute auf dem Boden der Ozeane. Wochenlange, ununterbrochene Regenfälle schwemmten ganze Dörfer fort. Harmlose Bäche wurden zu reißenden Wildwasserflüssen. Stürme tobten über das Land. 300 Stundenkilometer schnell. Denen war kein Gebäude gewachsen. Wirbelstürme wüteten durch die Städte und machten sie dem Erdboden gleich. Niemand konnte mehr so schnell aufbauen, wie alles hinweggerissen wurde. Versicherungen verweigerten ihren Schutz. Die meisten gingen an den hohen Schadenssummen in Konkurs. Infrastrukturen konnten nicht wieder hergestellt werden. Kein Strom, keine elektrischen Pumpen, also auch kein fließendes Wasser. Kläranlagen funktionierten nicht mehr. Das wenige noch zur Verfügung stehende Wasser war von Keimen hoch belastet. Man musste es kochen, bevor man es verwenden konnte. Wetterextreme wechselten von wochenlanger Trockenheit zu wochenlangen Regenfällen. Unter diesen Bedingungen war Landwirtschaft nicht mehr möglich. Die Ernteerträge brachen massiv ein. Die meisten Menschen hungerten. Dann die Sandstürme. Starkregen. Hitze. Und dann plötzlicher Schneefall. Blizzards, Hagelschlag. Ohne Strom funktionierten weder die Heizungen in den Häusern noch die Zapfsäulen an den Tankstellen. Viele Menschen erfroren in ihren Häusern oder in ihren liegen gebliebenen Autos.
Die Menschen staunten über die Naturereignisse, verstanden aber nicht, dass sie ihr Ende ankündigten. Das Wetter spielte total verrückt. April war das ganze Jahr hindurch.“
Josh nahm den Fuß vom Gas.
„Wir müssen tanken.“
Er hielt den Wagen an und schaltete den Motor ab. Mila stieg aus und erklomm mühelos das hohe Dach des Wohnaufbaus. Von dort oben hatte sie einen weiten Blick über das umliegende Gelände. Es bestand hauptsächlich aus Wiesen, kleinen Bäumen und Büschen. Ausreichend Möglichkeiten sich zu verstecken und sich unbemerkt heranzuschleichen.
Breitbeinig, ihren Bogen schussbereit, stand sie auf dem Dach und blinzelte gegen die Sonne. Der Wind spielte mit ihren Haaren. Der Geruch nach Heizöl stieg ihr in die Nase.
Josh hatte die Tür des Wohnaufbaus geöffnet, sich zwei Benzinkanister gegriffen und sie bis zum Tankstutzen geschleppt. 40 Liter Heizöl ließ er gurgelnd in den Tank laufen. Das sollte bis zum Abend reichen. Er schraubte den Tankdeckel zu.
Mila sprang vom Dach.
„Wohin fahren wir eigentlich?“
Josh sah sie lange an.
„Wir suchen dein Tal. Steig ein. Wir müssen weiter.“
Mila lächelte ihn an und hätte ihn beinahe umarmt. Aber so gut kannten sie sich ja noch nicht.
Josh steuerte den schweren Wagen weiter in Richtung Süden. Mila beobachtete die Umgebung und warf hin und wieder einen wachsamen Blick in den Rückspiegel auf ihrer Seite.
Es gab nicht mehr viele funktionierende Fahrzeuge auf der Welt. Und die, die noch fuhren, weckten Begehrlichkeiten. Es war unwahrscheinlich, dass sie verfolgt wurden, aber auch nicht unmöglich. Sie schaute wieder nach vorn. Gerade noch rechtzeitig, um eine Bewegung vor dem Pick-up wahrzunehmen.
Ein Kaninchen verließ plötzlich seine Deckung unter einem Busch und sprintete los. Das aufgeschreckte Tier lief zuerst Zickzack und dann in die falsche Richtung, und so wurde es von einem Rad der Hinterachse überrollt. Mila hatte die panische Flucht des Tieres interessiert verfolgt und im rechten Außenspiegel beobachtet, wie es zappelnd auf dem Asphalt liegen blieb.
„Stop!“, rief sie plötzlich und zog schon an dem Griff an der Tür zur Entriegelung. Josh trat auf die Bremse, und noch bevor der Pick-up zum Stehen kam, sprang Mila heraus.
Stolz hielt sie den blutenden Kadaver hoch, als sie damit wieder in den Wagen stieg.
„Abendessen!“, rief sie und ließ das tote Tier zu der Taube in den Fußraum vor sich fallen. „Heute ist ein guter Tag.“
Dann zog sie ihre Wagentür zu.
Josh legte einen Gang ein, schüttelte seinen Kopf und fuhr los.
Mila schaute ihn irritiert an.
„Was ist? Willst du nicht essen?“
„Doch! Doch!“, beruhigte er sie und ahnte mittlerweile, weshalb Mila überlebt hatte und nicht wie so viele andere Menschen verhungert war. Unter Skrupeln oder Befindlichkeiten litt sie jedenfalls nicht.
Sie konnten dem löchrigen Asphaltband nicht weiter folgen. Wasser hatte einen Teil der Straße unterspült und fortgerissen. Die Reste der Fahrbahndecke waren nachgesackt. Breite Risse trennten die einzelnen Teilstücke voneinander. Dahinter war die Straße bis zum Horizont von Sanddünen verweht. Unüberwindbar für ein Fahrzeug. Den weiteren Straßenverlauf konnte man nur noch erahnen.
Josh hielt den Wagen an und sprang heraus. Mila folgte ihm bis an die Kante des Asphalts. Beide schauten sie dem ausgetrockneten Flussbett nach und wandten ihren Blick beinahe gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung.
„Wir folgen dem Bett flussaufwärts.“
Mila kniff ihre Augen zusammen und versuchte, am Horizont etwas zu erkennen. Doch da war nur Dunst. Keine Berge in dem sich ein Hochtal befinden könnte. Für einen kurzen Augenblick wollte sich Enttäuschung in ihr breitmachen.
„Was hast du erwartet? Dass du dein Tal schon sehen kannst?“
Josh hatte die Veränderung an Milas Körpersprache abgelesen.
Sie wandte sich vom flimmernden Horizont ab und sah ihn an.
„Lass uns endlich weiterfahren, alter Mann.“
Josh grinste amüsiert.
Als Mila sich umdrehte, sah sie in ein paar Kilometern Entfernung Sand aufwirbeln. Sofort kletterte sie auf das Dach des Wohnmobils und versuchte zu erkennen, ob ihnen jemand folgte.
„Was ist?“, rief Josh zu ihr hinauf.
Mila streckte ihren Arm aus und deutete auf die aufsteigende Staubsäule.
Josh holte ein Fernglas unter dem Fahrersitz hervor und warf es Mila nach oben. Geschickt fing sie es auf und schaute hindurch.
„Nur eine Windhose“, rief sie, nach dem sie sich davon überzeugt hatte, dass keine Gefahr bestand.
Noch ein paar Minuten lang beobachtete sie mit dem Fernglas die Umgebung, dann sprang sie beruhigt vom Dach.
„Wir müssen da lang“, entschied sie und zeigte in die Richtung des Flussbetts. „Ich habe es durch das Fernglas gesehen. Dort führt eine Senke mit niedrigen Büschen von der Straße bis an den Fluss. Nur Sand und Kiesel. Keine großen Steine. Das schafft der Wagen.“
Josh verstaute sein Fernglas wieder und kletterte auf den Fahrersitz. Mila lief voraus und wies Josh den Weg.
Schaukelnd folgte ihr der schwere Wagen von der Straße herunter in das Gelände. Im Schritttempo überrollte er kleine Büsche, und der Allradantrieb arbeitete sich durch den weichen Sand. Vor einem angeschwemmten Baumstamm war die Fahrt zu Ende. Josh hielt den Wagen an. Mila zuckte entschuldigend mit den Schultern.
„Den habe ich von da oben nicht gesehen.“
Josh stieg aus seinem Toyota und begutachtete den schweren Stamm.
„Den bekommen wir da nicht weg“, stellte Mila hinter ihm resigniert fest. „Und umfahren können wir ihn auch nicht. Die hohen Büsche ringsherum sind zu dicht. Wir müssen zurück.“
„Nur ein kurzes Stück“, versicherte Josh und grinste geheimnisvoll. „Ich hab da was für alle Fälle.“
Mila blieb dort stehen, wo sie stand und beobachte den alten Mann, der seltsam aufgeregt zurück zum Wagen lief und in einer außen am Fahrzeug montierten Metallkiste kramte.
Über das ganze Gesicht strahlend kam er mit drei kleinen hellbraunen Papierrollen wieder zurück. Zumindest sah es für Mila danach aus. Und dann begriff sie.
„Du hast Sprengstoff?“, fragte sie ungläubig.
Josh nickte begeistert.
„Endlich kann ich den mal benutzen.“
Josh fiel vor dem Baumstamm auf die Knie und grub mit bloßen Händen ein Loch in den Sand unter dem Stamm. Dort legte er die Dynamit-Stangen ab. Dann steckte er drei Zündschnüre hinein und stand auf.
„Wir fahren erst den Wagen weg.“
Eifrig eilte er zum Toyota und schob sich auf den Fahrersitz. Mila wies ihn ein und Josh setzte das Wohnmobil rund dreißig Meter zurück. Dann liefen sie zur Sprengstelle und Josh riss ein Streichholz an.
Funken stieben davon, als sich die Lunten entzündeten. Langsam fraßen sich die Flammen zischend und qualmend in Richtung Dynamit. Schnell entfernten sich Josh und Mila und warfen sich hinter dem Pick-up in Deckung. Sekunden verstrichen. Nichts passierte. Mila riskierte einen kurzen Blick. Josh griff in ihren Pullover und riss sie zurück.
„Da passiert nichts“, stellte Mila ungeduldig fest. „Woher hast du die Stangen?“
„Von einem Typen aus der Stadt. Habe ihm ein Gewehr dafür gegeben mit 10 Schuss Munition.“
„Der hat dich beschissen.“
Mila wollte aufstehen, doch Josh hielt sie erneut zurück.
In diesem Moment zerriss ein ohrenbetäubender Knall die Stille. Sand und kleine Steine flogen durch die Luft und prasselten gegen den Pick-up. Unmengen Staub wurde aufgewirbelt, und dann fielen Holzstücke vom Himmel und landeten überall. Auf dem Toyota, auf den umstehenden Büschen und auf Mila und Josh. Die Holzspäne steckten in ihren Haaren, in ihrer Kleidung und die feinsten davon rieben in ihren Augen. Hustend rappelte sich Josh auf und begann wie ein Verrückter zu lachen.
„Was für ein Rums“, rief er begeistert und ballte seine Faust.
Mila klopfte sich Sand, Staub und Holzreste von der Kleidung und hörte ein Pfeifen in ihren Ohren.
„Das war viel zu viel“, beschwerte sie sich und stolperte durch den Staub voraus.
Doch sie fanden keinen Baumstamm mehr. Nur ein Loch im Boden. Und Holzreste so weit das Auge reichte. Wenn überhaupt noch größere Stücke Holz übrig geblieben waren, so waren sie davon geschleudert worden.
„Der Stamm muss total mürbe gewesen sein“, stellte Josh fest und begutachtete stolz sein Werk.
„Wir müssen weiter“, erinnerte ihn Mila, und sie lief bereits wieder voraus, noch bevor Josh sich auf den Fahrersitz schob, den Motor startete und einen Gang einlegte.
Vorsichtig umfuhr er den Sprengkrater. Dann schaukelte der Toyota langsam hinter Mila her, während die kopfschüttelnd und durch Gähnen und Bewegen ihres Kiefers versuchte, den lästigen Ton in ihren Ohren loszuwerden, der mittlerweile von einem Pfeifen in ein Klingeln übergegangen war.
Knirschend überrollten die Reifen auf den letzten Metern den Kies bis zum Flussbett. Mila stieg wieder in den Wagen und Josh steuerte ihn über den vom Wasser festgedrückten Sand Richtung Süden.
Sie kamen nicht mehr so schnell voran, wie auf der Straße. Langsam lenkte Josh das schwere Fahrzeug um umherliegendes Schwemmholz und große Steine herum. Oder er überfuhr tiefe, ausgewaschene Furchen im Schneckentempo. Aber das war immer noch besser, als laufen mit zwanzig oder gar dreißig Kilo Gepäck auf dem Rücken.
Am Abend fanden sie eine geschützte Stelle für ihr Nachtlager. Tief hatte sich der Fluss dort in die Erde gegraben. Josh sammelte Schwemmholz und baute ein Feuer auf einer flachen Sandbank. Mila zog dem Kaninchen das Fell ab und rupfte die Taube. Dann nahm sie die Körper aus, schnitt das Fleisch von den Knochen und dann in kleine Stücke.
Während sie am Feuer saß und das Geschnetzelte in Joshs Pfanne auf der Glut briet, hörte sie Musik aus dem Wagen.
Sie sah, wie sich Josh mit geschlossenen Augen im Takt der Musik bewegte. Im Licht der untergehenden Sonne spiegelten sich zwei feuchte Streifen auf seiner staubigen Gesichtshaut. Zwei Männer sangen in einer fremden Sprache zu einer melancholischen Melodie. Eine elektronische Gitarre weinte mit Josh um die Wette. Die Melodie brandete auf, die Gitarre spielte ein grandioses Solo. Josh befand sich in einer anderen Welt und erschrak, als er seine feuchten Augen öffnete und Mila plötzlich vor ihm an seinem Fenster stand.
„Alles okay mit dir?“
Josh wischte sich mit dem Handrücken über sein Gesicht, räusperte sich und schluckte trocken.
„Ja, ja.“, krächzte er. „Und nun lass uns nachsehen, ob man das, was du da gekocht hast, überhaupt essen kann.“
Die Gitarre wimmerte ihren letzten Akkord. Josh schaltete das Autoradio aus.
„Was war das da gerade?“
„Der Klang einer besseren Zeit“, krächzte Josh erneut und schob Mila beiseite. Seine Stimme klang seltsam belegt.
„Es klang sehr schön.“
„Eines der vier besten Gitarrensolos aller Zeiten. Ich war fünf, als ich diese Musik das erste Mal gehört habe und sie ließ mich nie mehr los.“
Plötzlich älter als noch vor ein paar Stunden, als er wie ein Schuljunge mit dem Dynamit hantierte, schlurfte Josh vor Mila her und setzte sich schließlich ans Feuer.
Abwechselnd gabelten sie kleine Fleischstücke aus der Pfanne. Josh stippte sie in die weiße Asche des Feuers und grinste zufrieden.
„Schmeckt gut, dein Taubenhase.“
Mila stippte auch ein Stück Fleisch in die weiße Asche und steckte es sich in den Mund.
„Schmeckt würzig“, stellte sie fest.
„Mineralien. Rückstände aus dem verbrannten Holz. Schmeckt salzig. Wichtig, wenn man viel geschwitzt hat.“
„Wieso hast du geweint?“
„Erinnerungen? Sehnsüchte? Rührung? Was weiß ich. Es passiert eben.“
„Was war das für eine Sprache, in der die Männer gesungen haben?“
„Englisch.“
„Es klang wirklich sehr schön. Kannst du es noch mal anmachen?“
Das Feuer war beinahe erloschen und glomm nur noch schwach in der Dunkelheit. Eine letzte dünne Rauchsäule stieg senkrecht in den Nachthimmel. Mila saß auf dem Beifahrersitz und hatte ihre Füße auf das Armaturenbrett gelegt. Josh startete die CD und beide lauschten einer Musik, die Mila noch nie gehört hatte. Sie war verstört. Wie ergreifend diese Musik für Josh war. Dem Alten liefen im fahlen Schein des Radios Tränen in seinen grauen Bart und er dachte, Mila bemerke es nicht. Es schien, als würde er Schmerzen empfinden. Was machten diese Töne mit ihm? Welche dunklen Erinnerungen riefen sie aus einer längst vergangenen Zeit wieder hervor?
Ein Kinderchor sang von einem weiteren Stein in einer Mauer, die es längst nicht mehr gab, und Mila schlief darüber ein. Josh saß noch lange in seinem Fahrersitz, lauschte der Musik und schaute durch die Windschutzscheibe in eine Ferne, die nur er sehen konnte.
Gegen Morgen zogen Wolken heran. Josh schlief noch, als die ersten Tropfen schwer auf das Wagendach trommelten. Mila genoss das Schauspiel und hielt ihre Hand in den Regen.
Bald wurde der Regen stärker. Erste kleine Rinnsale schwollen zu Bächen an, die sich schnell verbreiterten.
Von dem Rauschen des Wassers und der feuchten Kühle, die der Regen mitbrachte, erwachte Josh. Erschrocken schaute er sich um.
„Verdammt, wir müssen sofort hier weg!“
„Wieso? Was ist?“
Mila verstand Joshs Aufregung überhaupt nicht.
„Ja, wo sind wir denn hier?“
Hastig drehte er den Zündschlüssel. Der Anlasser kurbelte ein paar Mal, dann sprang der starke Motor endlich an.
„Scheiße! In einem Flussbett!“, rief Mila gegen das Geprassel an und begriff schließlich.
Aus den ersten schmalen Rinnsalen waren unfassbar schnell tobende Bäche geworden, die sich anschickten, sich zu einem reißenden Strom zu vereinen.
Der trockene, von der Sonne festgebackene Boden im Umland konnte das Regenwasser nicht aufnehmen. Die dahinschießenden Fluten rissen alles mit, was in ihrem Weg lag und warfen es in den Fluss. Äste, Sand, Geröll, ja ganze Baumstämme. Das Einzugsgebiet musste riesig sein. Es wirkte wie ein Trichter an dessen Ende sich Josh und Mila mit ihrem Toyota befanden und sich durch braunes schäumendes Flusswasser kämpften, welches dem Pick-up bereits bis über die Achsen gestiegen war.
Mila war ausgestiegen und watete voran. Dort, wo ihr das Wasser bis über die Hüften reichte, konnte der Toyota nicht mehr fahren. Sie musste eine Furt finden, über die Josh den Wagen auf die Sandbank steuern konnte. Seine Absicht, das Flussbett zu verlassen, hatte er schnell aufgegeben. Das Ufer war bereits unerreichbar. Die Sandbank war die letzte Rettung. Vorausgesetzt, der Pegel stieg nicht darüber hinaus. Denn dann mussten sie den Pick-up aufgeben und versuchen, schwimmend das Ufer zu erreichen.
Heftig tosend rissen die braunen Fluten an Milas Beinen. Immer wieder trat sie in ein tiefes Loch oder gegen einen verborgenen Stein und strauchelte. Der wilde Fluss wollte sie mitreißen, aber sie arbeitete sich Meter für Meter weiter auf die rettende Sandbank zu. Josh hielt den Atem an, solange er Milas Kampf im Strom beobachtete.
Ein großer Baumstamm schwamm auf sie zu. Sie bemerkte ihn nicht, weil sie um ihr Gleichgewicht in den reißenden Fluten kämpfte, während sie gleichzeitig mit ihren Füßen den Boden prüfte, ob er an dieser Stelle fest genug war, um mit dem Toyota darüber zu fahren. Josh erkannte endlich die tödliche Gefahr und reagierte sofort. Wild hupend und gestikulierend warnte er Mila, die dem heranschießenden Stamm erst in letzter Sekunde ausweichen konnte. Einen Augenblick später hätte er sie mitgerissen und sie wäre ertrunken oder schwer verletzt flussabwärts ans Ufer gespült worden.
Endlich! Mila spürte festen Boden unter ihren Stiefeln und das Wasser reichte ihr nur bis über die Knie. Mit schwindender Kraft tastete sie den Boden mit ihren Füßen nach großen Steinen oder Löchern ab. Dann winkte sie Josh heran.
Schwankend und dampfend stampfte der Toyota durch die reißenden schlammigen Fluten und erklomm die rettende Sandbank. Erschöpft ließ Mila sich auf den Sand fallen, legte sich auf den Rücken und starrte schwer atmend in den Himmel. Regentropfen prasselten ihr ins Gesicht. Um sie herum rauschte der tosende Fluss. Das Tak-tak-tak des Motors verstummte. Josh hatte ihn abgeschaltet.
„Komm endlich rein“, hörte sie ihn rufen.
Sie rappelte sich auf und folgte ihm in den Wohnmobilaufbau. Und während sie sich ungeniert die nasse Kleidung auszog und sich in eine Decke wickelte, die Josh ihr hinhielt, ohne sie dabei anzusehen, erinnerte sie sich an ein vergessenes Gefühl, welches sie in ihrer kurzen Zeit mit ihrer Mutter verspürt hatte. Ein Zuhause zu haben. Einen Ort, der einem Schutz und Unterschlupf bot. Und dort wartete ein Mensch, der einem freundlich gesinnt war und einem nicht nach dem Leben trachtete oder etwas von einem wollte, was man selbst auf keinen Fall wollte.
Josh saß am Fenster und beobachtete den Fluss. Noch stand der Pick-up auf trockenem Boden. Aber die Sandbank ragte nicht mehr als einen halben Meter aus dem Wasser heraus. Wenn es weiter so stark regnete, würde der Strom die Sandbank überspülen und der Pick-up im aufgeweichten Sand versinken. Unmöglich, ihn dann wieder daraus zu befreien.
Sorgenfalten bildeten sich auf Joshs Stirn, während er in die braunen Fluten starrte.
Mila setzte sich zu ihm ans Fenster und zog ihre Nase hoch. Ihre nassen Haare klebten an ihrem Gesicht. Sie zitterte leicht.
„Sobald der Regen nachlässt, machen wir ein Feuer“, versuchte er, ihr Hoffnung zu geben.
„Wovon denn? Ist doch alles nass.“
Josh widersprach ihr nicht.
„Dann leg dich oben im Alkoven ins Bett und wickele dich ein. Sonst wirst du krank.“
Mila gehorchte. Bibbernd kletterte sie unter das Dach und verschwand unter den Decken. Nur ihr blonder Haarschopf schaute hervor.
Josh beobachtete weiter den Fluss. Der Pegel stieg. Das war deutlich zu sehen. Die Sandbank ragte nur noch zwanzig Zentimeter aus dem Wasser. An der höchsten Stelle stand der Pickup. Das Ufer war nicht weit entfernt und doch unerreichbar.
Mila lag im Bett und der Regen trommelte auf das Dach und sie in den Schlaf.
Eine neue Hoffnung
Ein zarter Duft von Minze stieg ihr in die Nase. Ob sie davon oder aufgrund der Stille aufgewacht war, die sie umgab, wusste sie nicht. Auf jeden Fall war ihr nicht mehr kalt, und es hatte offenbar aufgehört zu regnen. Nur das Rauschen des Flusses drang gedämpft an ihr Ohr. Sie richtete sich auf. Sie war allein im Wohnmobil. Auf dem Tisch stand ein dampfender Becher Tee. Woher hatte Josh heißes Wasser?
Mila kletterte aus dem Alkoven, zog eine Decke hinter sich her, wickelte sich darin ein und setzte sich an den Tisch. Dankbar griff sie nach dem Becher und pustete hinein. Herrlich duftete dieses kostbare Getränk. Josh war wirklich ausgezeichnet ausgerüstet.