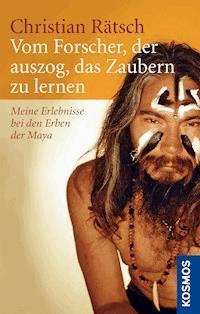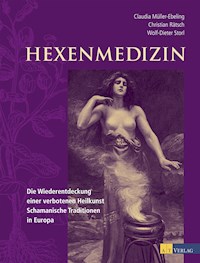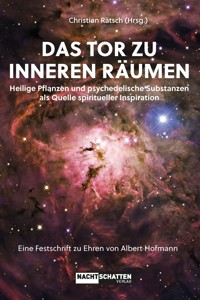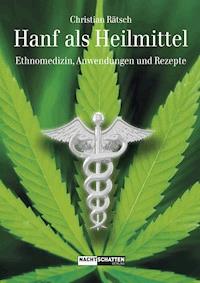
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nachtschatten Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit mindestens 6000 Jahren wird Hanf als Faserlieferant, als Nahrung und Genussmittel kulturell genutzt, aber auch seine vielseitigen medizinischen Qualitäten wurden früh entdeckt. Er hatte seinen festen Platz in der pharaonischen, der assyrischen, der antiken, der islamischen und der mittelalterlichen Medizin. In der chinesischen und tibetischen Medizin werden seine euphorisierenden, antidepressiven Eigenschaften geschätzt, im Ayurveda wird er als Allheilmittel und Aphrodisiakum gepriesen. Doch auch unsere germanisch-keltischen Ahnen haben die Pflanze medizinisch genutzt. Hildegard von Bingen gebrauchte sie genauso wie Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie. In der modernen medizinischen und pharmakologischen Forschung werden nun die früheren und die ethnobotanischen Anwendungen der Hanfpflanze getestet und grösstenteils bestätigt. Dieses Buch zeichnet die Geschichte und die Bedeutung des Hanfs in den verschiedenen medizinischen Systemen und Lehren nach und gibt eine Fülle von praktischen Anwendungen und Rezepten. Mit einem Vorwort von Dr. med. Franjo Grotenhermen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanf als Heilmittel
Christian Rätsch
HANF ALS HEILMITTEL
Ethnomedizin, Anwendungen und Rezepte
Impressum
Verlegt durch:
NACHTSCHATTEN VERLAG AGKronengasse 11CH - 4500 SolothurnTel: 0041 32 621 89 49Fax: 0041 32 621 89 [email protected]
© 2016 Nachtschatten Verlag© 2016 Christian Rätsch
Dieses Buch wurde zuerst 1992 unter dem Titel Hanf als Heilmittel – Eine ethnomedizinische Bestandsaufnahme als Grüner Zweig 154 in der Jointventure-Zusammenarbeit der Medien-Xperimente (Löhrbach) und des Nachtschatten Verlages veröffentlicht. Die vorliegende Ausgabe basiert auf einer gründlich revidierten und erweiterten Ausgabe des AT-Verlages von 1998 und wurde um zwei neue Vorwörter und eine aktualisierte Bibliografie ergänzt.
Umschlaggestaltung und Ergänzungen im Inhalt: Sven Sannwald, CH - LüterkofenSatz der Ausgabe von 1998: AZ Grafische Betriebe AG, CH - Aarau© aller Fotos: Christian Rätsch
ISBN 978-3-03788-390-7eISBN 978-3-03788-511-6
Wichtiger Hinweis:Weder Verlag noch Autor übernehmen jedwede Verantwortung für den unsachgemässen Gebrauch von Heilmitteln, die im vorliegenden Buch beschrieben sind.
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronischer digitaler Medien und auszugsweiser Nachdruck sind nur unter Genehmigung des Verlages erlaubt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Dr. med. Franjo Grotenhermen
Aktualisiertes Vorwort zur Neuauflage 2016
Einleitung
Bum Shankar!Am Anfang waren die Schamanen
MaHanf in der chinesischen Kräuterkunst
KamaninHanf in der japanischen Medizin
VijayaHanf in der ayurvedischen Medizin
BhangaHanf in der indischen und nepalesischen Volksmedizin
Myan rtsi sprasHanf in der tibetischen Medizin
KanchaHanf in der südostasiatischen Medizin
PenkaDas Hanfritual der Skythen
NaschaHanf in der russischen Volksmedizin
Azallû-QannapuHanf im alten Orient
ŠmšmtHanf bei den Pharaonen
Kannabion – CannabisHanf in der antiken Medizin
HaschischHanf in den islamisch-arabischen Medizinlehren
HanafDas Kraut der germanischen Liebesgöttin
De Hanff-CannabusHanf in der Hildegard-Medizin
HempeHanf bei den Vätern der Botanik
DestillateHanf in der Alchemie
HausmittelHanf in der Volksmedizin
DaggaHanf in Schwarzafrika
KifHanf in Nordafrika
GanjaHanf und Rastafaria
KinnickinikHanf bei den Indianern
MarijuanaHanf im Curanderismo
MaconhaHanf in der brasilianischen Volksmedizin
DilutionenHanf in der Homöopathie
DopeHanf in der modernen Selbstmedikation
THC und AnalogeHanf in der Schulmedizin
Perspektiven für eine gehanfte Weltgesundheit
Glossar
Verzeichnis der Krankheiten und medizinischen Systeme
Hanf-Substituenten
Die ACM
Allgemeine Hanfbibliographie
Hanf-Zeitschriften
Ergänzende Bibliographie zur 1. Buch-Auflage (1998) Zusammengestellt von Markus Berger
Stichwortverzeichnis
Zum Autor
»Nicht zu vergessen:
Je höher wir uns erheben,um so kleiner erscheinen wir denen,welche nicht fliegen können.«
FRIEDRICH NIETZSCHEMorgenröte (V, 574)
Wake up to find out that you arethe eyes of the world!
»Wacht auf und begreift, dass ihrdie Augen der Welt seid!«
ROBERT HUNTER/GRATEFUL DEADEyes of the World
Vorwort
von Dr. med. Franjo Grotenhermen
»Wir haben Grund zu der Annahme, dass Hanf die Milch der Götter an der Wiege der Zivilisation war – Nahrung, Medizin und prophetische Pflanze; eine Pflanze, die sowohl Fasern für Stoffe und Papier lieferte wie auch den Zauberstab für schamanistische Heilungen und Harz zum Verschließen der Wunden; die Kummer dauerhaft vertreibt, Asthmakrämpfe lindert und als Beruhigungsmittel dient.«
William Emboden
(Aus dem Vorwort der 1. Auflage)
Wir leben in einer Zeit des Aufbruchs. Immer mehr Menschen, Gesellschaften und Länder sagen Ja zu Cannabis als Medizin. Da beginnt etwas Neues. Wir spüren das weltweit und sehr stark auch in den deutschsprachigen Ländern. Es gibt eine Bereitschaft zum Wandel, ein Interesse am Thema, einen Wissensdurst, der sich in Kongressen, Veranstaltungen, einem vermehrten Zugriff auf Internetseiten und einer Nachfrage nach guten Texten und fundierter Literatur zum Thema äußert.
Dr. Christian Rätsch lässt uns mit diesem Buch an den Schätzen, die er in der Geschichte der Kulturen zur heilsamen Verwendung des Hanfes zutage gefördert hat, teilhaben. Er zeigt, dass es auch in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen, Wandlungen und Neuanfänge gegeben hat. Wenn wir heute nur 200 Jahre zurückblicken, so sehen wir einen zarten Beginn der medizinischen Nutzung des indischen Hanfes in der westlichen Medizin Europas und Nordamerikas, die etwa 50 Jahre lang aufblühte, um dann weitere 50 Jahre später ihren vorläufigen Niedergang zu finden. Wenn wir nur 50 Jahre zurückblicken, dann sehen wir einen erneuten Anfang mit der Identifizierung und Synthese des wichtigsten psychotropen Inhaltsstoffs der Cannabispflanze, dem Delta-9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC genannt. Was zunächst mit dem naturwissenschaftlichen und medizinischen Interesse an der Wirkung einer Pflanze und ihrer Bestandteile auf Mensch und Tier begann, mündete schließlich vor 30 Jahren in die Entdeckung der Funktionsweise eines körpereigenen Cannabinoidsystems mit seinen Endocannabinoiden und Bindungsstellen für Cannabinoide auf und in den Zellen nahezu aller Organe und Gewebe des menschlichen Organismus. Wir beginnen, die umfassende Bedeutung dieses ungewöhnlichen Neurotransmitter-systems für unsere Gesundheit und eine Vielzahl von Erkrankungen zu verstehen. Es wird deutlich, warum Cannabinoide so einzigartig in ihrer Vielfalt der Wirkungen sind.
Christian Rätsch erlaubt uns den Blick in eine Jahrhunderte und Jahrtausende alte Verwendung der Hanfpflanze auf allen Kontinenten. Dabei waren die Menschen häufig gleichermaßen von den psychischen und physischen Wirkungen fasziniert und wussten diese für Heilungszwecke für Körper und Geist zu nutzen.
Es gibt kein dem THC vergleichbares Molekül, das ein so breites Wirkungs-spektrum aufweist und bei so vielen unterschiedlichen Erkrankungen von Nutzen sein kann, von Schmerzen unterschiedlicher Ursachen bis zu chronisch-entzündlichen Erkrankungen, von psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen bis zu Appetitlosigkeit und Übelkeit unterschiedlicher Genese, von neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie und Muskelspasmen bei multipler Sklerose bis zu Hauterkrankungen, Asthma und Glaukom, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Seit einigen Jahren tritt ein weiteres Cannabinoid in den Fokus des Interesses, das Cannabidiol (CBD), mit seinen angstlösenden, antipsychotischen, antiepileptischen, krebshemmenden, entzündungshemmenden und weiteren, in der Erforschung befindlichen Eigenschaften.
Wieso verschwand diese Pflanze mit solch erstaunlichen Wirkungen vor 100 Jahren aus dem medizinischen Repertoire? Dies beruht vermutlich im Wesentlichen auf der Tatsache, dass zu dieser Zeit die chemische Struktur der aktiven Inhaltsstoffe der Cannabispflanze nicht identifiziert werden konnten, sodass es nicht möglich war, standardisierte Zubereitungen herzustellen.
Es ist nicht schwer, sich die völlig anders verlaufende medizinische Geschichte von Cannabis und Cannabinoiden vorzustellen, wenn die chemische Struktur von THC nicht erst 1964, sondern 50 oder 100 Jahre früher ermittelt worden wäre. Der Rückgang in der Verwendung medizinischer Cannabiszubereitungen wäre sicherlich ausgeblieben, wenn ihre Standardisierung früher gelungen wäre, so wie dies für andere therapeutisch nutzbare Inhaltsstoffe von Pflanzen der Fall ist, die im 19. Jahrhundert charakterisiert werden konnten und seit dieser Zeit zur pharmakologischen Ausrüstung gehören, wie beispielsweise Morphium und andere Opiate sowie Salizylsäure und ihr synthetischer Abkömmling Acetylsalizylsäure (besser bekannt als ASS oder Aspirin).
In den vergangenen Jahrzehnten behandelten die Gesundheitsbehörden in den meisten Ländern Cannabis und einzelne Cannabinoide zunächst wie neu entdeckte Medikamente, ohne ihre lange Geschichte der therapeutischen Verwendung zu berücksichtigen. Daher müssen Cannabiszubereitungen, die von pharmazeutischen Unternehmen entwickelt werden, strenge und teure Zulassungsverfahren durchlaufen, so wie dies für völlig neue Moleküle aus den Labors der Hersteller verlangt wird. Gegenwärtig sind Gesellschaften und Staaten daher mit einer Situation konfrontiert, die als ein „Cannabisdilemma“ bezeichnet werden kann.
Auf der einen Seite profitieren Patienten, die an vielen unterschiedlichen Erkrankungen leiden, nach ihren eigenen Erfahrungen und denen ihrer behandelnden Ärzte häufig in beeindruckender Weise von Cannabis-basierten Medikamenten. Andererseits gibt es nur für wenige dieser Indikationen einen zuverlässigen Wirksamkeitsnachweis auf der Basis kontrollierter klinischer Studien.
Heute suchen Ärzte und Gesetzgeber in verschiedenen Ländern nach einem sinnvollen Umgang mit diesem Dilemma. Es gibt ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass schwer kranken Menschen eine wirksame Therapie mit Cannabisprodukten nicht vorenthalten werden darf, auch wenn diese nicht arzneimittelrechtlich zugelassen sind, oder wenn für entsprechende Einsatzgebiete keine für eine Zulassung ausreichenden Daten vorliegen.
Es besteht die Hoffnung, dass sich in unserer modernen westlichen Kultur, die in den vergangenen Jahrzehnten unserem Planeten einen nicht immer heilsamen, einen oft barbarischen Stempel aufgedrückt hat, eine Humanität durchsetzt, die in früheren und anderen Kulturen Kranken ganz selbstverständlich den Zugang zum Hanf und anderen Heilpflanzen ermöglicht und ermöglicht hat.
Rüthen, im März 2016
Franjo Grotenhermen
Aktualisiertes Vorwort zur Neuauflage 2016
»Es ist eine verwünschte Sache mit dem ›Gedankenfassen‹, … man glaubt, man bringt sie mit dem Gehirn hervor, aber in Wirklichkeit machen sie mit dem Gehirn, was sie wollen und sind selbständiger als irgendein Lebewesen.«
GUSTAV MEYRINK
Das grüne Gesicht (1916)
Ich kann es kaum glauben, dass ich noch im April des Jahres 2016 so eine skandalöse Notiz im Hamburger Abendblatt lese:
»Joints gegen Arthroseschmerz
Der Hamburger Ralf C. hatte 3,4 Kilo Marihuana zu Hause aus eigenem Hanf. Nur mit Joints habe er die Arthroseschmerzen ertragen. Deswegen ist er seit Jahren arbeitsunfähig. Das Gericht verurteilte ihn trotzdem zu zehn Monaten Haft auf Bewährung.«
In was für einer Welt leben wir eigentlich? - Der Staat kriminalisiert Patienten, die sich eines ihnen bekömmlichen und zuträglichen Heilmittels bedienen. Es heißt, wir leben in einer Demokratie, und die Würde des Menschen sei unantastbar. Wo aber bleibt die Würde, wenn es um Heilmittel geht? Jeder, der Hanf als Heilmittel verwendet, tut dies, um seine Würde zu behalten. Denn zur Würde des Menschen gehört in erster Linie der freie Zugang zu wirksamen Medikamenten. Es ist völlig absurd, dass Richter entscheiden dürfen, welches Heilmittel für wen legal ist.
Als ich 1992 die erste Fassung dieses Buches publizierte, war ich felsenfest davon überzeugt, dass schon wenige Jahre später Hanfpräparate frei verkäuflich wären. Dass der Hanf längst jeden legalen Status zurückerhalten hätte. Natürlich hatte ich auch gehofft, dass mein ethnomedizinisches Buch über Hanf als Heilmittel gute Argumente für die dringende Legalisierung liefern würde. Fehl gedacht! Darum bin ich froh, dass es jetzt in neuer Auflage wieder erhältlich ist und ihm eine Stimme in den Debatten, zu denen Franjo Grotenhermen soviel beiträgt, zukommt. Denn Hanf als Heilmittel zeigt die interkulturelle ethnomedizinische Bedeutung dieser vielseitigen Heilpflanze auf. In jedem Winkel der Welt, in den der Hanf sich verbreitet hatte, wurde er von Menschen seit langem erfolgreich in der Volksmedizin, im Schamanismus, im Ayurveda usw. angewendet. Viele Indianer, auf deren Kontinent der Hanf erst mit dem »weißen Mann« erschien, sagten mir: »Das einzig Gute, was uns die Weißen brachten, war der Hanf.«
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Freund und Verleger Roger Liggenstorfer bedanken, dass er auf eine Neuauflage meines vergriffenen Buches gedrungen und sie verwirklicht hat. - Bom Shankar!
Christian Rätsch
im April 2016
Einleitung
»Der wahre Wissenschaftler hört auf die Intelligenz der Natur und sieht die Natur der Sache.«
ANTHONY G. E. BLAKE
Intelligenz Jetzt!
(1990)
Die Grundvoraussetzung für eine wissenschaftliche Betrachtung ist die Überwindung von Vorurteilen und ideologisch gebundenen Paradigmen. Der Wissenschaftler muss immer ein offenes Auge bewahren, Neuem gegenüber aufgeschlossen sein und den Mut haben, alte Überzeugungen abzustreifen. Glaubt man, der Hanf sei ein furchtbares »Rauschgift«, das den Genießer »süchtig« und asozial macht, wird man kaum zu einem vertieften Verständnis der Rolle dieser ungewöhnlichen Pflanze gelangen.
Wenn man mit offenen Augen durch die Welt reist, kann man einfach nicht den Blick vor der überwältigenden Fülle medizinischer Anwendungen der Hanfprodukte verschließen. Wenn man die Medizingeschichte aufmerksam studiert, muss man zwangsläufig erkennen, dass es kaum eine andere Heilpflanze gibt, die eine solche Verbreitung und konstante Anwendung in den unterschiedlichsten medizinischen Systemen und Lehren hat.
Der Tatbestand: Seit über sechstausend Jahren wird der Hanf überall dort, wo er in der Gefolgschaft des Menschen hingelangte, als Heilmittel benutzt. Dieser Tatbestand wird hier dargestellt, ganz im Sinne einer ethnomedizinischen Bestandsaufnahme. Dieses Buch ist keine politische Kampfschrift, sondern eine kulturvergleichende Betrachtung. Die ethnomedizinischen Fakten sprechen für sich selbst.
Der Büffel unter den Pflanzen
Der Hanf hat unter den Pflanzen eine ähnliche kulturelle Bedeutung wie der Büffel bei den nordamerikanischen Indianern. Die Indianerkulturen der großen Plains und Prärien begründeten ihre Kultur alleine auf dem Büffel (Bison bison). Der Büffel oder amerikanische Bison lieferte den Indianern alles, was sie zum Leben brauchten. Alle Teile des Büffels wurden kulturell genutzt. Fleisch, Fett und Blut dienten der Ernährung, aus Knochen und Sehnen wurden Werkzeuge, Schmuck und Werkmaterialien geschaffen, die Häute und Felle wurden zu Kleidung verarbeitet, Hörner und Schädel wurden als Ritualobjekte verehrt oder als schamanische Tanzmasken getragen, aus den Eingeweiden wurden nützliche Küchengeräte (Blasen zum Wasserholen usw.) gearbeitet, die Hoden wurden als Aphrodisiaka zubereitet (Rocky Mountain Oysters), aus den Hufen und Zähnen wurden Musikinstrumente hergestellt. Jeder Teil des Büffels hatte eine besondere Verwertung. Diese vielseitige Totalverwertung eines Tieres ist einzigartig in der Kulturgeschichte der Menschheit. Der Büffel war zugleich Nahrung, Rohstofflieferant und spirituelles Zentrum der indianischen Religion (DARY 1990, MCHUGH 1979).
Botanische Darstellung der zweihäusigen Hanfpflanze (Cannabis sativa). Links die blühende männliche Pflanze, rechts die weibliche Pflanze in Blüte.(Illustration, 19.Jh.)
Ähnlich wie der Büffel ist der Hanf eine Pflanze mit vielseitiger Verwertung. Die Samen dienen als Nahrung für Mensch und Tier (Vogelhanf) und liefern vielfach verwendbares Öl, die weiblichen Blüten bilden das begehrte berauschende Harz und werden als Medizin und Aphrodisiakum genutzt. Aus den Blättern werden Pasten und Getränke gewonnen, die Stengel liefern dauerhafte stabile Fasern zur Herstellung von Seilen, Netzen, Papier, Kleidung, die Wurzeln sind medizinisch brauchbar. Aus den Blättern werden Pasten und Getränke zubereitet. Aus den Stengeln werden schamanische Ritualgegenstände (Zauberstäbe) geschnitten, Hanffasern dienen als Amulette, rituell hergestellte Hanfstricke werden als magische Schutzmittel genutzt.
Zudem ist der Hanf eine genügsame Pflanze, die den Boden nicht auslaugt, sondern auch für andere Pflanzen begünstigt (HERER 1990*1). Die multiple Nutzung des Hanfs als Nahrung, Rohstofflieferant, Medizin, Genussmittel und spirituelles Rauschmittel ist für viele frühe Kulturen belegt. Der Hanf wurde in dieser Weise z.B. von den alten Chinesen, den alten Indern und Germanen benutzt (BENNETT et al. 1995*). Überall, wo der Hanf wächst, wird er trotz Verbot bis heute vielseitig genutzt (BEHR 1995*, HAAG 1995*). In manchen Gegenden überwiegt der Gebrauch als Rauschmittel, in anderen die Nutzung der Fasern. Einen medizinischen Gebrauch der Pflanze trifft man praktisch weltweit an. In den letzten Jahren wird der Hanf zunehmend als ökologisch günstige Nutzpflanze angebaut (CONRAD 1993*, HERER und BRÖCKERS 1993*, HESCH et al. 1996*, NOVA-INSTITUT 1995, ROBINSON 1996*, SAGUNSKI et al. 1996*, WASKOW 1995*).
Botanik und Taxonomie
Die botanische und taxonomische Geschichte der Hanfpflanze ist ähnlich verwirrend wie die rechtliche Lage. Wurden von den arabischen Ärzten, den »Vätern der Botanik« und den Begründern der modernen binominalen Taxonomie verschiedene Hanfarten erkannt, so hat sich in der modernen Botanik bis in jüngste Zeit hinein die Auffassung gehalten, es gebe lediglich eine Art des Hanfes (Cannabis sativa L.), wohl aber lokale Variationen (SMALL 1978). Oft wird zwischen dem Faserhanf oder Nutzhanf und dem Indischen Hanf unterschieden. Meist heißt es, dass nur der Indische Hanf berauschend wirke. Daraus wurden auch juristische Konsequenzen abgeleitet. Der Anbau des wirkstofflosen, dh. THC-freien oder THC-armen Faserhanfes wurde erlaubt, der des »rauschgifthaltigen« indischen Hanfs verboten und strafrechtlich verfolgt (EMBODEN 1974b*, 1981a* und 1996*).
Im Laufe der botanischen Geschichte wurden folgende Namen für Arten oder Variäteten der Hanfpflanze publiziert:
Cannabis sativa LINNÉ 1737
Cannabis lupulus SCOPOLI 1772
Cannabis indica LAMARCK 1783
Cannabis foetens GILIBERT 1792
Cannabis erratica SIEVERS ex PALLAS 1796
Cannabis macrosperma STOKES 1812
Cannabis generalis KRAUSE 1905
Cannabis americana HOUGHTON et HAMILTON 1908
Cannabis gigantea CREVOST 1917
Cannabis ruderalis JANISCHEWSKY 1924
Cannabis pedemontana CAMP 1936
Cannabis × intersita SOJAK 1960
Nach den neueren Untersuchungen und Feldforschungen der führenden botanischen Autoritäten Richard E. Schultes und William Emboden sind nur drei Taxa valide (SCHULTES et al. 1975: 34*, EMBODEN 1974a*, 1981a*; vgl. STEARN 1975); somit hat der Hanf drei Arten:
Die Zweihäusigkeit der Hanfpflanze wurde früh erkannt, jedoch falsch interpretiert. Die weibliche Pflanze wurde meist fälschlicherweise als »männlich« gedeutet, die männliche Pflanze dementsprechend als »weiblich« missinterpretiert, wie in diesem frühneuzeitlichen Kräuterbuch aus England.(Faksimile aus GERARD, 1633)
»Ein Narr sieht nicht denselben Baum, den ein Weiser sieht.«
WILLIAM BLAKE
Die Hochzeit von Himmel und Hölle (ca. 1791)
1. Cannabis sativa LINNÉ 1737 – Nutzhanf
Synonyme:
Cannabis americana HOUGHTON
Cannabis chinensis DELILE
Cannabis culta MANSFIELD
Cannabis erratica SIEVERS
Cannabis generalis KRAUS
Cannabis gigantea CREVOST
Cannabis intersita SOJAK
Cannabis lupulus SCOPOLI
Cannabis macrosperma STOKES
Cannabis pedemontana CAMP
Cannabis sativa monoica HOLUBY
Cannabis sativa spp. culta SEREB. ex SEREB. et SIZOV
Die Pflanzen wachsen sehr hoch (bis 4 m), haben einen dicken, faserhaltigen Stengel, sind wenig verzweigt und haben ein lockeres Laubwerk. Der Gehalt an psychoaktiven Wirkstoffen ist eher gering, manchmal kaum vorhanden.
Nach CLARKE (1997: 201f.*) lässt sich diese Art in folgende Unterarten und Varietäten aufteilen (wobei es sicherlich keine gute Idee ist, einmal eine spp. indica, ein andernmal eine var. indica gegenüberzustellen):
Cannabis sativa var. sativa (der gewöhnliche angebaute Nutzhanf)
Cannabis sativa var. spontanea (hat kleinere Samen, kommt wild vor)
Cannabis sativa spp. indica (sehr reich an Cannabinoiden)
Cannabis sativa var. indica (sehr kleine Früchte, kleiner als 3,8 mm)
Cannabis sativa var. kafiristanica (kurze Früchte)
Daneben wird noch eine Einteilung in vier Phenotypen (Chemotypen) vorgenommen (vgl. CLARKE 1997: 203*), die sich jedoch meiner Meinung nach nicht aufrechterhalten lässt, da es innerhalb einer Population bereits zu starken Schwankungen im Cannabinoidgehalt kommen kann (HEMPHILL et al. 1978, LATTA und EATON 1975). Für Afrika sind zwei Chemotypen beschrieben worden (BOUCHER et al. 1977).
2. Cannabis indica LAMARCK 1783 – Indischer Hanf
Synonyme:
Cannabis foetens GILIBERT
Cannabis macrosperma STOKES
Cannabis orientalis LAMARCK
Cannabis sativa α-kif DC.
Cannabis sativa var. indica LAM.
Cannabis sativa ssp. indica (LAM.) E. SMALL et CRONQ.
Die Pflanzen sind klein (bis 1,2 m) und sehr buschig, haben einen faserarmen Stengel, sind stark verzweigt und haben ein dichtes Laubwerk. Der Gehalt an psychoaktiven Wirkstoffen ist sehr hoch (vgl. EDES 1893*).
Der wilde oder verwilderte Indische Hanf wird manchmal als Cannabis indica LAM. var. spontanea VAVILOV bezeichnet (SCHMIDT 1992: 641*).
3. Cannabis ruderalis JANISCHEWSKY 1924 – Ruderalhanf
Der Wasserhanf (Eupatorium cannabinum L.), auch Weißes Hanfkraut, Wasserdost oder Kunigundenkraut genannt, wurde früher als wilder Verwandter des echten Hanfes angesehen. Diese Pflanze hat allerdings keine cannabisähnlichen Wirkungen.(Holzschnitt aus TABERNAEMONTANUS)
Synonyme:
Cannabis intersita SOJAK
Cannabis sativa L. ssp. spontanea SEREBR. ex SEREBR. et SIZOV
Cannabis sativa L. var. ruderalis (JAN.)
Cannabis sativa L. var. spontanea MANSFIELD
Cannabis spontanea MANSFIELD
Die Pflanzen sind sehr klein (60 cm), haben einen dünnen, leicht faserigen Stengel, sind fast gar nicht verzweigt und haben nur ein lockeres Laubwerk mit verhältnismäßig großen Blättern. Der Wirkstoffgehalt ist weder gering noch hoch (vgl. BEUTLER und DER MARDEROSIAN 1978).
SCHULTES et al. (1975: 34*) erkennen auch die Kreuzung Cannabis × intersita SOJAK 1960 zwischen Cannabis sativa und Cannabis ruderalis an.
Alle Hanfarten sind zweihäusig, d.h., sie bilden männliche und weibliche Pflanzen aus. Die männlichen Pflanzen sind in der Regel kleiner und weniger verzweigt als die weiblichen. Es kommt aber auch zu Zwitterbildung. Kulturell sind die weiblichen Pflanzen weitaus wichtiger. Sie bilden stärkere Fasern und mehr psychoaktive Wirkstoffe sowie die nährstoffreichen Samen aus.
Alle Hanfarten oder -variäteten sind sehr variabel und lassen sich kreuzen (vgl. ANDERSON 1980, MEIJER 1994, SMALL et al. 1975, VAN DER WERF 1994). Durch Zuchtauswahl läßt sich der Wirkstoffgehalt generell stark erhöhen (STARKS 1981*, WOLKE 1995*).2
Ursprünglich platzierte man den Hanf in die Familie Urticaceae (Nesselartige). Der Hanf gehört aber nach neueren botanischen Erkenntnissen in die Familie der Cannabaceae (Hanfartige) [= Cannabinaceae, auch: Cannabiaceae, Cannabidaceae], eine Unterabteilung der Moraceae (Maulbeergewächse). Der nächste Verwandte des Hanfs ist der Hopfen Humulus lupulus L., der ebenfalls in die Familie Cannabaceae gehört. Weitere Verwandte sind bisher nicht beschrieben worden (SCHULTES et al. 1975*).
Der Hanf stammt vermutlich aus Zentralasien. Von dort hat er sich durch menschliches Zutun weltweit verbreitet. Möglicherweise haben sich die drei Arten durch Zucht und menschliche Selektion entwickelt (ABEL 1980*, MERLIN 1972*). In der Geschichte der Hanfpflanze unterscheiden SCHULTES et al. (1975*) drei Phasen: Die Wildform, die Kulturform und die verwilderte Form. In den Gebieten, wo unkultivierte Hanfpflanzen auftreten, z.B. in Afghanistan, Nepal, Nordchina und am Kaspischen Meer, lässt sich nicht entscheiden, ob es sich um echte Wildformen oder verwilderte Nachkommen ehemals kultivierter Pflanzen handelt. Heutzutage werden in vielen Labors und Gärtnereien der Welt Hanfpflanzen gezüchtet, die entweder wirkstofffrei sind (so in Japan) oder extrem harzhaltig und dafür samenlos (so in Holland und Kalifornien). Die samenlosen, THC-reichen Züchtungen werden meist Sinsemilla genannt und gelten als »Königin des Cannabis« (MOUNTAIN GIRL 1995*).
Aufgrund der chaotischen taxonomischen Geschichte der Hanfpflanze können im vorliegenden Buch bei der Darstellung des Hanfs in den verschiedenen Medizinsystemen oft keine genauen Speziesangaben gemacht werden. Wenn es eindeutige Belege für die botanische Spezifizierung gibt, so werden diese angeführt. Andernfalls bleibt es zukünftiger Forschung überlassen, die tatsächlich genutzten Spezies zu bestimmen.
In der frühen Neuzeit wurden verschiedene Pflanzen als »Wilder Hanf« bezeichnet. Diese Pflanzen sind weder botanisch noch pharmakologisch mit dem echten Hanf (Cannabis) vergleichbar.(Holzschnitt aus GERARD, 1633)
Chemie und Pharmakologie
Die Chemie von Cannabis ist sehr komplex, aber recht gut aufgeklärt worden (LEHMANN 1995). Die Hanfpflanze bildet in unterschiedlichem Maße mit unterschiedlicher Wirkstoffkonzentration ein Harz aus, das besonders an den weiblichen Blütenständen ausgeschieden wird, aber auch in allen anderen Pflanzenteilen, außer den Samen und Wurzeln, unterschiedlich verteilt vorkommt. Die chemische Zusammensetzung des Harzes ist inzwischen sehr gut bekannt.
Das reine Harz (Haschisch) enthält vier Hauptkomponenten, die Cannabinoide Δ1-Tetrahydrocannabinol (THC) mit drei Varianten, von denen zwei erst bei der Lagerung des Harzes als Artefakt entstehen, das Cannabidiol (CBD) und das Cannabinol (CBN).3 Diese Stoffe sind für die psychoaktive Wirkung des Hanfes verantwortlich (MURPHY und BARTKE 1992).4 Es sind noch die Strukturen weiterer ca. 60 Cannabinoide mit schwacher oder keiner psychoaktiven Wirkung aufgeklärt worden (BRENNEISEN 1986, CLARKE 1981*, HOLLISTER 1986*, MECHOULAM 1970*, SCHMIDT 1992*). Zudem kommen im Harz noch eine Reihe von ätherischen Ölen (Caryophyllen, Humulen, Farnesen, Selinen, Phellandren, Limonen), verschiedene Zucker, Flavonoide, Alkaloide (Cholin, Trigonellin, Piperidin, Betain, Prolin, Neurin, Hordenin, Cannabisativin) sowie Chlorophyll vor, die für die psychoaktive Wirkung der Droge bedeutungslos sind (BINDER 1981*, BRENNEISEN 1996, HAI 1981: 13*).
Die Struktur, pharmakologische Bedeutung und die Struktur-Wirkungs-Beziehungen des THC wurden von Raphael Mechoulam und dessen Team aufgedeckt. Sie fanden ebenso den Syntheseweg des THC (MECHOULAM 1973*; vgl. COMPTON et al. 1993).
Der THC-Gehalt ist in verschiedenen Hanfpflanzen, -sorten und -züchtungen extrem variabel. Er kann bei einigen Pflanzen gleich Null sein, bei anderen bis zu 25% des Harzes ausmachen (HEMPHILL et al. 1978, LATTA und EATON 1975, STARKS 1981*). Zudem können die verschiedenen Darreichungsformen und Zubereitungen die Wirkstoffkonzentration erheblich beeinflussen (SEGELMAN et al. 1975*). Die Cannabinoide bauen sich nur langsam bei der Lagerung ab. Selbst bei langer Lagerung oxydiert das THC nur sehr langsam zu dem viel weniger aktiven CBN, wie Untersuchungen an alten Materialien gezeigt haben (HARVEY 1990).
Die psychoaktiv wirksame THC-Dosis liegt bei 4 bis 8 mg. »Auf die psychotrope Dosis bezogen, ist die Toxizität von THC sehr niedrig. Die akute Lethaldosis bei oraler Verabreichung liegt bei der Ratte bei 600 mg/kg, ist also etwa 6000fach höher als die am Menschen wirksame Dosis« (LAATSCH 1989: 42*). Allerdings ist kein einziger Todesfall des Menschen durch Hanfüberdosierung bekannt geworden (SCHMIDT 1992: 650f.*). Laut juristischen Gutachten und richterlichem Beschluss gibt es »keine lethale Dosis für Haschisch« (NESKOVIC zit. in RIPPCHEN 1992: 16*). Hanfprodukte gelten nach dem neuesten wissenschaftlichen Forschungsstand als die harmlosesten bekannten Rauschmittel (ebd.).
Das THC bewirkt in der Dosis von 4 bis 8 mg (entspricht etwa einem Joint mit 0,5 g Haschisch oder 1 g Marijuana) einen »etwa drei Stunden dauernden Rauschzustand, der durch ein Gefühl von Losgelöstheit charakterisiert ist, das eine meditative Versenkung oder eine Hingabe an sensorische Stimuli erlaubt. Der Zustand ist im Allgemeinen frei von optischen und akustischen Halluzinationen, die beim Vier- bis Fünffachen dieser Dosis auftreten können. Subjektiv gesteigert wird die Gefühlsintensität beim Hören von Musik, beim Betrachten von Bildern, bei Essen und Trinken und bei sexueller Aktivität.« (BINDER 1981: 120*)
Das THC wird im Blut in das aktive Metabolit 11-Hydroxy-Δ9-THC umgewandelt. Dieser Stoff wird nach ca. 30 Minuten vom Fettgeweben aufgenommen und danach wieder ins Blut gegeben, metabolisiert und ausgeschieden. Nach kurzer Zeit (nur wenige Tage!) ist die Substanz völlig ausgeschieden. Bei chronischem Gebrauch lagert sich das 11-Hydroxy-THC im Fettgewebe und in der Leber an und kann über längere Zeit nachgewiesen werden (Urintest! Vgl. RIPPCHEN 1996*).
Das THC hat eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem endogenen Neurotransmitter Anandamid (von Sanskrit ananda, »Glückseligkeit«).5 THC und Anandamid besetzen dieselben Rezeptoren im Nervensystem (DEVANE et al. 1988, PERTWEE 1995).6 Anandamid ist anscheinend der Botenstoff wohliger und euphorischer Gefühle (DEVANE et al. 1992, DEVANE und AXELROD 1994, GROTENHERMEN 1996*, KRUSZKA und GROSS 1994, MESTEL 1993*). Normalerweise binden sich die körpereigenen Neurotransmitter, die Anandamide, an diese Rezeptoren. Wenn der Körper nicht genug Anandamide produziert, kann es zu Nervenkrankheiten kommen. Solche Krankheiten (wie Multiple Sklerose) können vermutlich bei Anandamidmangel erfolgreich mit THC therapiert werden (MECHOULAM et al. 1994).
Als wichtigste medizinische Wirkung gilt die »eigenständige analgetische Wirksamkeit von THC« (GESCHWINDE 1990: 33*). Zudem bewirkt THC eine Senkung des Augeninnendruckes und ist deshalb bei der Behandlung des Glaukom von herausragender Bedeutung (ROFFMAN 1982*).
Das synthetische THC ist besser unter dem Namen Marinol bekannt. 20 bis 45 mg Marinol ergeben nur ein ca. 1- bis 1½-stündiges high. Viele US-amerikanische Patienten, die Marinol einnehmen, beklagen sich, dass das Medikament im Vergleich zum gerauchten oder gegessenen Marijuana wirkungslos sei oder anders, irgendwie unangenehm wirke (mündliche Mitteilung Jack Herer).
Die wichtigsten Hanfwirkstoffe
Das Harz des Hanfes enthält neben ätherischem Öl und anderen Stoffen vor allem Cannabinoide, von denen bereits über 60 strukturell und pharmakologisch bekannt sind (GROTENHERMEN und KARUS 1998: 13ff.*).
Der Hauptwirkstoff ist das Delta-9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC, entspricht dem Δ1-THC, kurz THC genannt). Das THC hat euphorisierende, stimulierende, muskelentspannende, antiepileptische, brechreizmindernde, appetitsteigernde, bronchienerweiternde, blutdrucksenkende, stimmungsaufhellende und schmerzhemmende Wirkungen.
Das Cannabidiol (CBD) hat keine psychoaktive Wirkung, ist dafür sedierend und schmerzhemmend.
Cannabinol (CBN) ist leicht psychoaktiv, aber vor allem augeninnendrucksenkend und antiepileptisch wirksam.
Cannabigerol (CBG) ist nicht psychoaktiv, dafür beruhigend, antibiotisch und augeninnendrucksenkend.
Cannabichromen (CBC) wirkt beruhigend und fördert die schmerzhemmende Wirkung des THC.
In den Hanfsamen kommen neben dem lignan-reichen Öl Proteine und das Enzym Edestinase vor (ST. ANGELO und ORY 1970). Auch wurde in unreifen Früchten das Wachstumshormon Zeatin gefunden (RYBICKA und ENGELBRECHT 1974). Die Samen enthalten ebenfalls die Alkaloide Cannabamine A-D, Piperidin, Trigonellin und L-(+)-Isoleucin-Beatin (BERCHT et al. 1973) sowie das seltene Vitamin K und Mineralstoffe. Kürzlich wurde neben den gamma-Linolsäuren auch die «omega-3»-Stearinsäure nachgewiesen (CALLAWAY, TENNILÄ und PATE 1997).
Das Hanfsamenöl, das durch Kaltpressung der Samen gewonnen wird, ist sehr reich an ungesättigten Fettsäuren (»Vitamin F«). Im Hanfsamenöl kann auch THC vorkommen, was sich sogar im Urin des Konsumenten nachweisen lässt (CALLAWAY, WEEKS et al. 1997).
»Das aus den Hanfsamen gewonnene Hanföl – nicht zu verwechseln mit Haschischöl – besitzt einen ungewöhnlich hohen Gehalt an ein- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (ca. 90%), die von großer Bedeutung für die menschliche Ernährung sind. Hier sind besonders die essenziellen Fettsäuren Linolsäure (50 bis 70%) und Alpha-Linolensäure (15 bis 25%), eine Omega-3-Fettsäure, hervorzuheben. 10 bis 20 Gramm Hanföl genügen, um den Tagesbedarf eines Menschen an diesen beiden Fettsäuren zu decken.«
FRANJO GROTENHERMEN und MICHAEL KARUS
Cannabis als Heilmittel
(1998: 21*)
In den Pollen konnten Δ9-THC sowie THCA, eine alkaloidartige Substanz, Flavone und phenolische Stoffe nachgewiesen werden (PARIS et al. 1975).
Die Blätter von Cannabis sativa enthalten Cholin, Trigonellin, Muscarin, ein nichtidentifiziertes Betain, die Cannabamine A-D und erstaunlicherweise ein Alkaloid, das in vielen Kakteen vorhandene β-Phenethylamin Hordenin (EL-FERALY und TURNER 1975). Daneben kommen in den Blättern thailändischer und afrikanischer Populationen wasserlösliche Glykoproteine, Serin-O-galactosid und Hydroxyproline vor (HILLESTAD und WOLD 1977, HILLESTAD et al. 1997).
In der Wurzel von Cannabis sativa wurden neben Friedelin, Epifriedelinol, N-(p-Hydroxy-β-phenethyl)-p-hydroxy-trans-cinnamamid, Cholin und Neurin die Steroide Stigmast-5-en-3β-ol-7-on (= 7-keto-β-Sitosterol), Campest-5-en-3β-ol-7-on und Stigmast-5,22-dien-3β-ol-7-on entdeckt (SLATKIN et al. 1975).
Das charakteristisch duftende ätherische Öl, das sozusagen das Bukett der Hanfdrogen ausmacht, enthält u.a. Eugenol, Guaiacol, Sesquiterpene, Caryophyllen, Humulen, Farnesen, Selinen, Phellandren, Limonen.
Das in der Pflanze, vor allem im Haschisch vorhandene ätherische Öl enthält auch Caryophyllenoxid, ein Sesquiterpen. Auf diesen Duftstoff werden die Polizeihunde im Dienste der Drogenverfolgung dressiert (MARTIN et al. 1961, NIGAM et al. 1965). Caryophyllenoxid kommt auch in den ätherischen Ölen anderer Pflanzen vor, z.B. im Beifuß (Artemisia vulgaris L.) oder der Gewürznelke (Syzygium aromaticum [L.] MERR. et PERRY).7 Das ätherische Hanföl ist meist frei von THC oder enthält lediglich Spuren.
Der Hopfen (Humulus lupulus) ist botanisch der nächste Verwandte des Hanfes. Beide Gattungen sind die einzigen Vertreter der Familie Cannabaceae. Der Hopfen hat allerdings eher eine dem Hanf gegenteilige Wirkung: Hopfen beruhigt, dämpft, macht schläfrig und wirkt anaphrodisisch. Andererseits ist es beim Hopfen wie beim Hanf: nur die weibliche Blüte ist brauchbar.(Holzschnitt aus BRUNFELS, Kräuterbuch, 1532)
THC konnte bisher nur in den drei Arten oder Variäteten des Hanfes nachgewiesen werden. Im Hopfen (Humulus lupulus L., Humulus spp.) hat man bisher kein THC oder andere Cannabinoide entdeckt (WOHLFART 1993). Angeblich soll Hopfen dann THC ausbilden, wenn er auf Cannabis gepfropft wird (CROMBIE und CROMBIE 1975). Es kam auch die Hypothese auf, dass beim Räuchern mit Olibanum, dem echten Weihrauch (Harz von Boswellia sacra FLÜCKIGER, syn. Boswellia carteri BIRDW.), durch pyrochemische Reaktionen THC entstünde (MARTINETZ et al. 1989: 138). Leider konnte diese Hypothese, die oft als Tatbestand zitiert wird, bisher nicht bestätigt werden (KESSLER 1991). Dennoch ist der Olibanum-Rauch psychoaktiv und berauschend wirksam (RÄTSCH 1996* und 1998: 93*).
Es sind bisher kaum Naturstoffe bekannt geworden, die THCartige oder ähnliche Effekte haben. Pharmakologisch hat Thujon, das chemisch nahe mit Kampfer und Pinen verwandt ist, eine sehr ähnliche Wirkung wie THC (CASTILLO et al. 1975). Thujon ist ein Bestandteil der ätherischen Öle vieler Pflanzen. In hohen Konzentrationen kommt es im Wermut (Artemisia absinthium L.), im Rainfarn (Tanacetum vulgare L.) und in den Lebensbäumen (Thuja occidentalis L., Thuja orientalis L., Thuja plicata D. DON) vor. Thujon ist auch in den ätherischen Ölen der Schafgarbe (Achillea millefolium L.), der Gartensalbei (Salvia officinalis L.), der Muskatellersalbei (Salvia sclarea L.), des Sadebaumes (Juniperus sabina L.), der Atlaszeder (Cedrus atlantica [ENDL.] MANETTI) und des Beifußes (Artemisia vulgaris L.) vorhanden (ALBERT-PULEO 1978). Es wundert wenig, dass viele Thujonhaltige Pflanzen als Marijuana-Ersatz genutzt werden. Thujon ist auch der Hauptwirkstoff im Absinthschnaps (»Grüne Fee«), einer legendären Künstlerdroge des 19. Jahrhunderts (CONRAD 1988).
Es herrschen in der offiziellen, staatlich akzeptierten und geförderten Psychiatrie die seltsamsten Vorstellungen und Vorurteile über die Langzeitwirkungen von häufigem oder chronischem Cannabisgebrauch, z.B. die Hypothese von der »Einstiegsdroge« und das sogenannte amotivationale Syndrom (TÄSCHNER 1981*, CUTRUFELLO 1980*). Diese »psychiatrischen Symptome« sind reine Erfindung und entbehren jeder Empirie (HESS 1996*, vgl. BAUMANN 1989*). Über die Langzeitwirkung von chronischem Hanfgenuss hat eine politisch unabhängige, sozialwissenschaftliche Studie ein interessantes Bild ergeben: »Mit zunehmender Hanferfahrung wächst die Chance, dass man unter Hanfeinfluss kreativ und produktiv denkt und arbeitet« (ARBEITSGRUPPE HANF und FUSS 1994: 103*). Viele Studien zum Langzeitkonsum beweisen, dass Cannabis-Produkte die harmlosesten psychoaktiven Genussmittel sind, die der Mensch bisher entdeckt hat (vgl. BLÄTTER 1992*, GRINSPOON 1971*, HESS 1996*, MICHKA und VERLOMME 1993*, SCHNEIDER 1984* und 1995*, TART 1971*).
In der letzten Zeit wird der Einfluss von Cannabis bzw. THC auf das Fahrverhalten im Straßenverkehr diskutiert. Der Gesetzgeber hält skurrilerweise die Wirkung des Hanfes für gefährlicher als die von Alkohol – obwohl mehrere Studien zeigen, dass bekiffte Fahrer wesentlich langsamer und umsichtiger fahren als nüchterne oder betrunkene Autofahrer (BÖLLINGER 1997: 169–184*, KARRER 1995, ROBBE 1994 und 1996).
»Die wohl älteste Droge der Menschheit ist mit Sicherheit ihre umstrittenste und vielleicht gerade deshalb. In Ländern, wo Hanf über Jahrhunderte seine Tradition hat und in das tägliche Leben integriert ist, wird über die Droge kaum geredet, und sie hat auch noch kein Problem geboren.«
HANS-GEORG BEHR
Von Hanf ist die Rede
(1995: 14*)
Es wird nach wie vor diskutiert, ob Haschisch, Marijuana oder THC süchtig machen (»Haschischsucht«) oder zur Abhängigkeit führen können (CUTRUFELLO 1980*, STRINGARIS 1939, TOSSMANN 1987*, WOGGON 1974*). Meist wird die Position eingenommen, dass es zu einer psychischen Abhängigkeit8 kommen kann (vgl. BÖLLINGER 1997*, GROTENHERMEN und HUPPERTZ 1997: 99f.*, GROTENHERMEN und KARUS 1998: 39f.*). Es wird hin und wieder sogar von »Entzugserscheinungen« gesprochen. In den USA scheint dieses Problem größer als in anderen Ländern zu sein; dort gibt es analog zu den anonymen Alkoholikern die Marijuana Anonymus (KINGSTON 1998).
Literaturlage und Forschungsstand
Die vorhandenen historischen Quellentexte, die aus verschiedenen Zeiten und Kulturen stammen, sind in der medizingeschichtlichen Literatur recht gut aufgearbeitet und jedem zugänglich. Die Literatur, die aus ethnomedizinischer oder ethnobotanischer Forschung resultiert, ist in ihrem Wert und Gehalt recht unterschiedlich. Mit nur wenigen Ausnahmen gibt es keine spezielle ethnomedizinische Literatur, die Hanf als Heilmittel zum Gegenstand hat. Meist findet man ihn nur am Rande erwähnt oder aus persönlichen Vorbehalten der jeweiligen Autoren gänzlich vernachlässigt. Viele Ethnologen haben Angst, den Gebrauch illegaler Drogen bei anderen Völkern zu untersuchen. Sie könnten ja in den Verdacht geraten, heimliche Sympathisanten oder gar stille Kiffer zu sein. Die wenigsten Ethnologen verfügen über Primärdaten zum Hanfgebrauch. Oft haben sie auch Angst, einheimische Drogen an sich selbst auszuprobieren, und reproduzieren nur Kolportiertes (»Man sagt… Mir wurde berichtet… Ich habe gehört…«). Aus diesen Gründen ist die Qualität der ethnomedizinischen Literatur sehr schwankend. Aber ich habe mich bemüht, aus der bestehenden Literatur einen brauchbaren Extrakt zu produzieren. Zudem habe ich immer versucht, die mir gelieferten Daten durch Selbstexperimente zu überprüfen, um den einheimischen Standpunkt besser verstehen oder nachvollziehen zu können. Viele Daten aus eigener Forschung in vielen Ländern der Welt (Nord-, Mittel- und Südamerika, Nepal, Indien, Südostasien, Japan) sind in dieses Buch eingeflossen.
Die medizinische Literatur ergibt auch kein einheitliches Bild. Da gibt es Artikel, in denen nur die von Seiten des Staates offiziell zu glaubenden Vorurteile reproduziert werden. Die Literatur, die auf tatsächlich durchgeführten Experimenten an Menschen basiert, ist extrem dünn gesät. Es gibt zwar Tausende von Artikeln in der medizinischen Fachliteratur, doch nur eine Handvoll echtes empirisches Material. Auf diesen grotesken Missstand hat Andrew WEIL in seinem revolutionären Buch The Natural Mind (1972* und 1986*; zu Deutsch: Das erweiterte Bewußtsein) hingewiesen. Weil war nämlich der erste Arzt, der einen wissenschaftlich korrekten Test im Jahre 1968 durchgeführt hat (WEIL et al. 1968*). Bis heute sind nur noch wenige Arbeiten dazugekommen (HESS 1973*, TART 1971*, ZINBERG 1984*). Häufiger sind die Fragebogenaktionen der Medizinsoziologen, Soziologen und Psychologen (GRUPP 1971*, SCHNEIDER 1984*, SHIK et al. 1968*).
»Es macht den Homo sapiens hungrig, geil, schläfrig und glücklich – oder ängstlich. Es dämpft Schmerzen, hemmt Bewegungen, senkt die Körpertemperatur und führt zum Verlust des Zeitgefühls. Es beeinflusst das Gedächtnis und verdreht Denk- und Wahrnehmungsprozesse. Warum?
Über die Frage, wie Menschen durch Marihuana high werden, gab es jahrzehntelang so viele Theorien, wie es Forscher gab, die sich für die 421 Substanzen in den gezackten Marihuanablättern interessieren.«
JACK HERER und MATTHIAS BRÖCKERS
Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf
(1993: 415*)
Sehr umfangreich ist die chemische und pharmakologische Literatur zum Cannabis. Wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht so sehr mit gesellschaftlichen oder politischen Tabus behaftet ist.
Ich habe am Ende eines jeden Kapitels die in ihm zitierte Spezialliteratur angeführt. Im Anhang gibt es noch eine allgemeine Bibliographie zu verschiedenen Aspekten des Hanfs. Darin sind auch Publikationen angegeben, die von erbitterten Gegnern des Hanfgebrauchs stammen (z. B. NAHAS 1979*, TÄSCHNER 1981*). Diese Arbeiten können im Lichte der modernen wissenschaftlichen Forschung nur noch als historische Kuriosa betrachtet werden. Ebenfalls sind mehrere juristische und politische Publikationen angeführt, da diesen beiden Aspekten in diesem Buch kein Platz eingeräumt wurde (z.B. BURIAN und SZARA 1976*, HELLMANN 1975*, HOMANN 1972*, KAPLAN 1971*, LIGGENSTORFER 1991*, RIPPCHEN 1992* und 1994*, SCHERER und VOGT 1989*). Außerdem sind einige »Klassiker« genannt (z.B. BAUDELAIRE 1972*, JÜNGER 1980*, LUDLOW 1981*, MOREAU DE TOURS 1973*).
Literatur
ALBERT-PULEO, Michael
1978 »Mythobotany, Pharmacology, and Chemistry of Thujone-Containing Plants and Derivatives« Economic Botany 32: 65–74.
ANDERSON, Loran C.
1980 »Leaf Variation among Cannabis Species from a Controlled Garden« Botanical Museum Leaflets 28(1): 61–69.
ANONYM
1981 Das Handbuch für den Selbstanbau. Linden: Volksverlag.
BEHRENS, Katja
1996 Leitfaden zum Hanfanbau in Haus, Hof und Garten. Frankfurt/M.: Eichborn.
BERCHT, C.A. Ludwig, Robert J.J. Ch. LOUSBERG, Frans J.E.M. KÜPPERS und Cornelis A. SALEMINK
1973 »L-(+)-Isoleucine Betaine in Cannabis Seeds« Phytochemistry 12: 2457–2459.
BEUTLER, John A. und Ara H. DER MARDEROSIAN
1978 »Chemotaxonomy of Cannabis I. Crossbreeding Between Cannabis sativa and C. ruderalis, with Analysis of Cannabinoid Content« Economic Botany 32(4): 387–394.
BÓSCA, Iván und Michael KARUS
1997 Der Hanfanbau: Botanik, Sorten, Anbau und Ernte. Heidelberg: C.F. Müller (Umwelt Aktuell).
BOUCHER, Françoise, Michel PARIS und Louis COSSON
1977 »Mise en évidence de deux types chimiques chez le Cannabis sativa originaire d’Afrique du sud« Phytochemistry 16: 1445–1448.
BRENNEISEN, Rudolf
1996 »Cannabis sativa – Aktuelle Pharmakologie und Klinik« Jahrbuch des Europäischen Collegiums für Bewußtseinsstudien 1995: 191–198.
BLAKE, Anthony G. E.
1990 Intelligenz Jetzt! Südergellersen: Verlag Bruno Martin.
CALLAWAY, J.C., T. TENNILÄ und D.W. PATE
1997 »Occurence of «omega-3» Stearidonic Acid (cis-6,6,12,15-octadecatetraenoic Acid) in Hemp (Cannabis sativa L.) Seed« Journal of the International Hemp Association 3(2): 61–63.
CALLAWAY, J.C., R.A. WEEKS, L.P RAYMON, H.C. WALLS und W.L. HEARN
1997 »A Positive THC Urinalysis From Hemp (Cannabis) Seed Oil« Journal of Analytical Toxicology 21: 319–320.
CASTILLO, J.D., M. ANDERSON und G.M. RUBBOTON
1975 »Marijuana, Absinthe and the Central Nervous System« Nature 253: 365–366.
COFFMAN, C. B. und W. A. GENTNER
1979 »Greenhouse Propagation of Cannabis sativa L. by Vegetative Cuttings« Economic Botany 33(2): 124–127.
COMPTON, David R., Kenner C. RICE, Brian R. DE COSTA, Raj K. RAZDAN, Lawrence S. MELVIN, M. ROSS JOHNSON und Billy R. MARTIN
1993 »Cannabinoid Structure-Activity Relationships: Correlation of Receptor Binding and in Vivo Activities« The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 265: 218–226.
CONRAD, Barnaby, III
1988 Absinthe: History in a Bottle. San Francisco: Chronicle Books.
CROMBIE, Leslie und W. Mary L. CROMBIE
1975 »Cannabinoid Formation in Cannabis sativa Grafted Inter-Racially, and With Two Humulus Species« Phytochemistry 14: 409–412.
DARY, David A.
1990 The Buffalo Book. Swallow Press/Ohio University Press.
DE JARDIN, Raphael
1997 Hanfanbau mit Hydrokultur. Solothurn: Nachtschatten Verlag.
DEVANE, William A. und Julius AXELROD
1994 »Enzymatic Synthesis of Anandamide, an Endogenous Ligand for the Cannabinoid Receptor, by Brain Membranes« Proceedings of the National Acadamy of Science, USA 91: 6698–6701.
DEVANE, William A., Francis A. DYSARZ III, M. Ross JOHNSON, Lawrence S. MELVIN und Allyn C. HOWLETT
1988 »Determination and Characterization of a Cannabinoid Receptor in Rat Brain« Molecular Pharmacology 34: 605–613.
DEVANE, William A., Lumir HANUS, Aviva BREUER, Roger G. PERTWEE, Lesley A. STEVENSON, Graeme GRIFFIN, Dan GIBSON, Asher MANDELBAUM, Alexander ETINGER und Raphael MECHOULAM
1992 »Isolation and Structure of a Brain Constituent That Binds to the Cannabinoid Receptor« Science 258: 1946–1949.
EL-FERALY, Farouk S. und Carlton E. TURNER
1975 »Alkaloids of Cannabis sativa Leaves« Phytochemistry 14: 2304.
FRANK, Mel und Ed ROSENTHAL
1980 Das Handbuch für die Marihuana-Zucht in Haus und Garten. Linden: Volksverlag.
HARVEY, D. J.
1990 »Stability of Cannabinoids in Dried Samples of Cannabis Dating from Around 1896–1905« Journal of Ethnopharmacology 28: 117–128.
HEMPHILL, John K., Jocelyn C. TURNER und Paul G. MAHLBERG
1978 »Studies on Growth and Cannabinoid Composition of Callus Derived from Different Strains of Cannabis sativa« Lloydia 41(5): 453–462.
HILLESTAD, Agnes und Jens K. WOLD
1977 »Water-Soluble Glycoproteins from Cannabis sativa (South Africa)« Phytochemistry 16: 1947–1951.
HILLESTAD, Agnes, Jens K. WOLD und Thor ENGEN
1977 »Water-Soluble Glycoproteins from Cannabis sativa (Thailand)« Phytochemistry 16: 953–1956.
JANISCHEWSKY
1924 »Cannabis ruderalis« Proceedings Saratov 2(2): 14–15.
KARRER, Barbara
1995 Cannabis im Straßenverkehr. Achen: Verlag Shaker.
KESSLER, Michael
1991 Zur Frage nach psychotropen Stoffen im Rauch von brennendem Gummiharz der Boswellia sacra. Basel: Inaugural-Dissertation.
KINGSTON, Stephen
1998 »Insane in the Brain« Sky Magazine No. 139 (March): 48–52.
KRUSZKA, Kelly K. und Richard W. GROSS
1994 »The ATP- and CoA-independent Synthesis of Arachido-noylethanolamide: A Novel Mechanism Underlying the Synthesis of the Endogenous Ligand of the Cannabinoid Receptor« The Journal of Biological Chemistry 269(20): 14345–14348.
LATTA, R.P. und B.J. EATON
1975 »Seasonal Fluctuations in Cannabinoid Content of Kansas Marijuana« Economic Botany 29: 153–163.
LEHMANN, Thomas
1995 Chemische Profilierung von Cannabis sativa L. Bern: Dissertation (MS).
MCHUGH, Tom
1979 The Time of the Buffalo. Lincoln und London: University of Nebraska Press.
MARQUART, Benno
1919 Der Hanfbau, seine Verbreitung, seine Bedeutung und sein Betrieb. Berlin: Paul Parey.
MARTIN, L., D. SMITH und C.G. FARMILO
1961 »Essential Oil from Fresh Cannabis sativa and Its Use in Identification« Nature 191(4790): 774–776.
MARTINETZ, Dieter, Karlheinz LOHS und Jörg JANZEN
1989 Weihrauch und Myrrhe. Stuttgart: WVG.
MATSUDA, Lisa A., Stephen J. LOLAIT, Michael J. BROWNSTEIN, Alice C. YOUNG und Tom I. BONNER
1990 »Structure of a Cannabinoid Receptor and Functional Expression of the Cloned cDNA« Nature 346: 561–564.
»Das Geheimnis liegt im Gebrauch von Haschisch.«
FITZ HUGH LUDLOW
Der Haschisch Esser
(1981: 15*)
MECHOULAM, Raphael, Zvi VOGEL und Jacob BARG
1994 »CNS Cannabinoid Receptors: Role and Therapeutic Implications for CNS Disorders« CNS Drugs 2(4): 255–260.
MEIJER, Etienne de
1994 Diversity in Cannabis. Thesis Wageningen (Distributed by the International Hemp Association [IHA], Postbus 75007, 1070 AA Amsterdam, the Netherlands).
MURPHY, Laura und Andrzej BARTKE (Hg.)
1992 Marijuana/Cannabinoids: Neurobiology and Neurophysiology. Boca Raton usw.: CRC Press.
NIGAM, M.C., K.L. HANDA, I.C. NIGAM und L. LEVI
1965 »Essential Oils and Their Constituents XXIX. The Essential Oil of Marihuana: Composition of Genuine Indian Cannabis sativa L.« Canadian Journal of Chemistry 43: 3372–3376.
NOVA-INSTITUT (Hg.)
1995 Biorohstoff Hanf: Reader zum Symposium. Köln: Nova-Institut.
PARIS, M., F. BOUCHER und L. COSSON
1975 »The Constituents of Cannabis sativa Pollen« Economic Botany 29: 245–253.
PERTWEE, Roger (Hg.)
1995 Cannabinoid Receptors. New York: Harcourct Brace Jovanovich.
ROBBE, H.W.J.
1994 Influence of Marijuana on Driving. Maastricht: Institute for Human Psychopharmacology, University of Limburg.
1996 »Influence of Marijuana on Driving« Jahrbuch des Europäischen Collegiums für Bewußtseinsstudien 1995: 179–189, Berlin: VWB.
RYBICKA, Hanna und Lisabeth ENGELBRECHT
1974 »Zeatin in Cannabis Fruit« Phytochemistry 13: 282–283.
SLATKIN, David J., Joseph E. KNAPP und Paul L. SCHIFF, Jr.
1975 »Steroids of Cannabis sativa Root« Phytochemistry 14: 580–581.
SMALL, Ernest
1975 »The Case of the Curious ›Cannabis‹« Economic Botany 29: 254.
1978 »The Species Problem in Cannabis« Science and Semantics (2 Bde.). Toronto: Corpus.
SMALL, Ernest, H.D. BECKSTEAD und Allan CHAN
1975 »The Evolution of Cannabinoid Phenotypes in Cannabis« Economic Botany 29: 219–232.
SMITH, R. Martin und Kenneth D. KEMPFERT
1977 »Δ1–3,4-cis-Tetrahydrocannabinol in Cannabis sativa« Phytochemistry 16: 1088–1089.
ST. ANGELO, Allen J., Robert L. ORY und Hans J. HANSEN
1970 »Properties of a Purified Proteinase from Hempseed« Phytochemistry 9: 1933–1938.
STEARN, William T.
1974 »Typification of Cannabis sativa L.« Botanical Museum Leaflets 23(9): 325–336.
1975 »Typification of Cannabis sativa L.« in: V. RUBIN (Hg.), Cannabis and Culture, S. 13–20, The Hague: Mouton.
STEVENS, Murphy
1980 Marihuana-Anbau in der Wohnung. Linden: Volksverlag.
STORM, Daniel
1994 Marijuana Hydroponics: High-Tech Water Culture. Berkeley: Ronin.
STRINGARIS, M. G.
1939 Die Haschischsucht. Berlin: Springer.
TAURA, Futoshi, Satoshi MORIMOTO und Yukihiro SHOYAMA
1995 »Cannabinerolic Acid, a Cannabinoid from Cannabis sativa« Phytochemistry 39(2): 457–458.
VAN DER WERF, Hayo
1994 Crop Physiology of Fibre Hemp (Cannabis sativa L.). Proefschrift Wageningen (ISBN 90-9007171-7).
WOHLFART, Rainer
1993 »Humulus« in: Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis (5. Aufl.) Bd.5: 447–458, Berlin: Springer.
ZEEUW, Rokus A. de und Jaap WIJSBEEK
1972 »Cannabinoids with a Propyl Side Chain in Cannabis: Occurence and Chromatographic Behavior« Science 175: 778–779.
1 Die mit* gekennzeichneten Literaturangaben finden sich in der Allgemeinen Hanfbibliographie am Ende des Buches.
2 Es gibt eine reiche Literatur zu den Anbaumethoden von allen Hanfarten, -sorten und Kreuzungen: ANONYM 1981, BEHRENS 1996, BÒCSA und KARUS 1997, CLARKE 1997*, COFFMAN und GENTNER 1979, FRANK und ROSENTHAL 1980, HAI 1981*, MARQUART 1919, MOUNTAIN GIRL 1995*, ROSENTHAL 1990*, SAGUNSKI et al. 1996*, STARKS 1981*, STEVENS 1980, WASKOW 1995*. Für die Indoor-Zucht gibt es besondere Verfahren der Hydrokultur (DE JARDIN 1997, STORM 1994). Der illegale Anbau ist sehr amüsant in einem Roman von Coraghessan Boyle beschrieben (1990*).
3 THC bzw. Metabolite wurden in ägyptischen Mumien aufgefunden (BALABANOVA et al. 1992*).
4 Nur trans-THC ist psychoaktiv, nicht aber das Isomer cis-THC (SMITH und KEMPFERT 1977).
5 Anandamid (= Arachidonylethanolamid) bindet sich an den THC-Rezeptor im Hirn und ist das natürliche im Körper vorkommende THC-Analog, obwohl es von seiner inneren Struktur ganz anders aufgebaut ist. Kürzlich wurde Anandamid in der Schokolade bzw. der Kakaobohne (Theobroma cacao) sowie im Rotwein nachgewiesen (GROTENHERMEN 1996*).
6 Wissenschaftler am Medical College von Virginia konnten Rezeptoren im Nervensystem nachweisen (SAD-Meldung im HAMBURGER ABENDBLATT, Nr. 192, S. 5, 1991); vgl. COMPTON et al. 1993, DEVANE et al. 1988, MATSUDA et al. 1990, MECHOULAM et al. 1994.
7 D.h., man kann durch die Reaktion der Polizeispürhunde auf diesen Duftstoff in mitgeführten Gewürzen als Haschischkonsument verdächtigt werden.
8 So heißt es in Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis: »Cannabiskonsum führt zu psychischer Abhängigkeit. Die Tendenz zu physischer Abhängigkeit ist nur schwach oder gar nicht vorhanden, denn nach Absetzen treten nur milde oder keine Entzugssymptome auf. Die Abhängigkeitscharakteristika werden von der WHO als ein eigener Abhängigkeitstyp, als sog. Cannabistyp geführt. (SCHMIDT 1992: 651*).
Bum Shankar!
Am Anfang waren die Schamanen
»Der Schamane verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft und erschafft daraus die Gegenwart.«
AMÉLIE SCHENK
Die berühmte Höhlenmalerei des »Zauberers« mit Hirschgeweih von Les Trois Frères in den französischen Pyrenäen deuten Archäologen als künstlerisches Produkt einer psychedelischen Trance. Dass steinzeitliche Schamanen tatsächlich Hirschmasken getragen haben, wurde durch prähistorische Funde bei Hohen Viecheln, Kreis Wismar, bestätigt. Die heute im Museum Schwerin ausgestellte Hirschschädelmaske stammt genauso wie der älteste Hanffund aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. und weist auf einen neolithischen »Hirsch-Hanf-Schamanen«-Komplex hin. Der Alchemist Agrippa von Nettesheim (1486–1535) schreibt: »Der Hirsch heilt die Verrückten und Wahnsinnigen.« (Die magischen Werke II, 37)